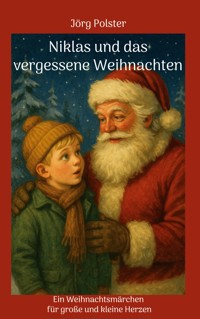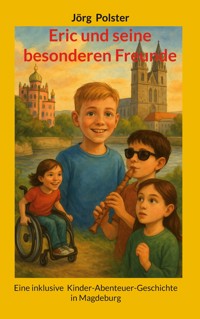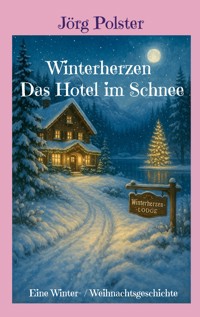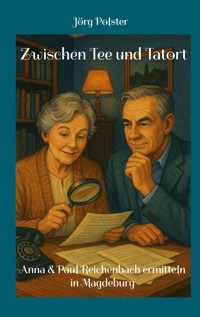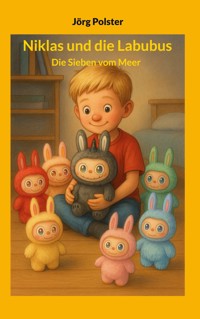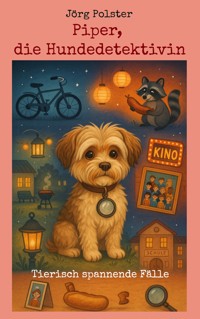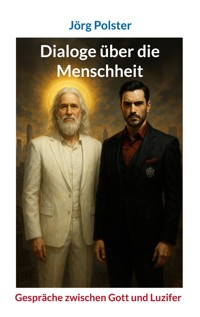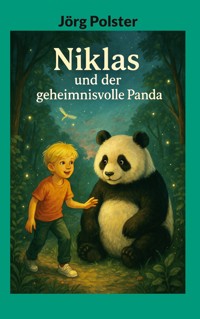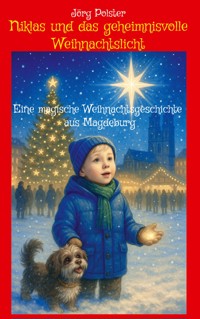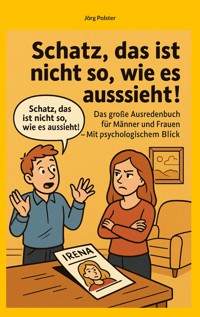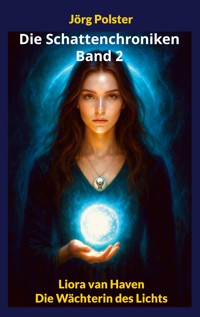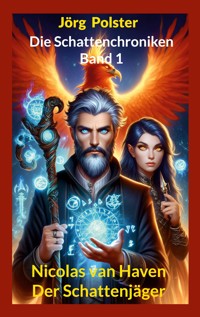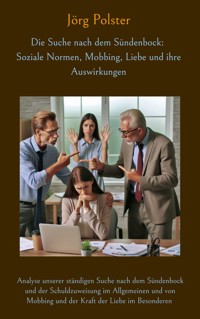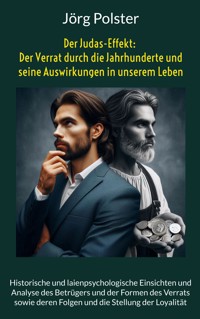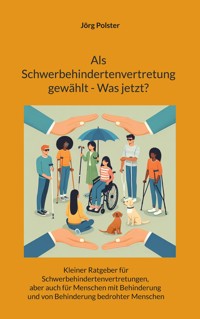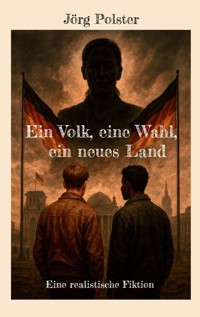
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Land, das fällt. Dieser Roman erzählt die Geschichte eines Landes, das fällt - und wieder aufsteht. Deutschland, wenige Jahre nach dem demokratischen Umbruch: Eine rechtsorientierte Regierung übernimmt die Macht, die Verfassung zerbricht, die Gesellschaft schweigt. Doch im Schatten wachsen Widerstand, Mut - und eine leise, aber unaufhaltsame Erinnerung. Mohamed, Georg und Leila gehören zu jenen, die sich nicht beugen. Ihre Geschichte ist ein bewegendes Zeugnis über Menschlichkeit im Angesicht der Diktatur. Er beginnt zwei Jahre nach der Machtübernahme der rechtsorientierten NAF in Deutschland. Ein Roman über das Ende der Demokratie - und den langen Weg zurück. Ein Roman, der erschüttert, erinnert und Hoffnung gibt. Ein Buch, das mögliche Szenen aufzeigt und fragt: Was bleibt, wenn alles fällt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Autors:
Prolog:
Der Morgen danach
Kapitel 1: Schatten über Leipzig
Kapitel 2: Der erste Riss
Kapitel 3: Die stille Prüfung
Kapitel 4: Dimitrios – Kein anderer Name
Kapitel 5: Jule & Mina – Lichtstreifen
Kapitel 6: Die Verordnung 88/30 – „Zur Bewahrung der nationalkulturellen Wirtschaft“
Kapitel 7: Das leere Regal
Kapitel 8: Hannahs Archiv
Kapitel 9: Die kalte Ordnung
Kapitel 10: Die Lesung
Kapitel 11: Mina Keller
Kapitel 12: Das Archiv
Kapitel 13: Der Verrat
Kapitel 14: Die Stimme der Mutter
Kapitel 15: Das Gesicht der Kanzlerin
Kapitel 16: Schattenkind
Kapitel 17: Die Risse werden hörbar
Kapitel 18: Radio Julius – Die Frequenz der Erinnerung
Kapitel 19: Die Fahndung beginnt
Kapitel 20: Stimmen unter der Erde
Kapitel 21: Das Gedächtnis der Welt
Kapitel 22: Das Gesicht der Wahrheit
Kapitel 23: Die Nacht der Stimmen
Kapitel 24: Schatten über der Freiheit
Kapitel 25: Das Netz der Freiheit
Kapitel 26: Risse im Stahl
Kapitel 27: Die Worte, die zu Waffen wurden
Kapitel 28: Der Punkt ohne Rückkehr
Kapitel 29: Schatten über Berlin
Kapitel 30: Der geteilte Spiegel
Kapitel 31: Erinnerung aus Beton
Kapitel 32: Das Gesetz der Angst
Kapitel 33: Der Rat im Schatten
Kapitel 34: Morgenstille
Kapitel 35: Die Grenze in uns
Kapitel 36: Der Tag, an dem Berlin brannte
Kapitel 37: Die Stadt im Feuer
Kapitel 38: Die Rückkehr
Kapitel 39: Der Tag, an dem die Wahrheit schrie
Kapitel 40: Und dann kam das Licht
Kapitel 41: Die Stille nach dem Schrei
Kapitel 42: Der Preis der Erinnerung
Kapitel 43: Der Tag, an dem sie sich erinnerten
Kapitel 44: Die zweite Wahrheit
Kapitel 45: Erinnerung aus Farben
Kapitel 46: Was wir schreiben, wenn keiner mehr schreit
Kapitel 47: Die Stimme des Volkes
Kapitel 48: Wenn das Erinnern leise wird
Kapitel 49: Die Wahrheit, die verschwindet
Kapitel 50: Was bleibt
Kapitel 51: Das Leben danach – Deutschland im Jahr 2035 und darüber hinaus
Kapitel 52: Epilog: Wenn niemand mehr fragt
Kapitel 53: Nachträge
Vorwort des Autors:
Die aktuelle politische Lage hat mich dazu angeregt, dieses Buch zu schreiben. Ich habe es, der Realitätsnähe wegen, in der Art einer Tagebuch-Chronik geschrieben. In diesem Buch gibt es viele Helden, auch wenn sie sich selbst so nie bezeichnen würden. Insbesondere Georg und Mohammed, die durch die fiktive aktuelle politische Lage nach der Wahl in diese für sie neue Situation hineingerieten.
Insbesondere möchte ich darum dieses Buch als meine persönliche Mahnung herausgeben, um die jetzige, vergangene und zukünftige Generation daran zu erinnern, dass die Demokratie und das Leben, dass wir führen, kein Geschenk ist. Jeder muss seinen Teil dazu tun, dass die im Buch beschriebene Situation möglichst nicht eintritt.
Ich selbst wüsste nicht, ob ich den Mut aufbringen würde, so eine Rolle wie Mohammed und Georg und alle anderen „Helden“ einzunehmen.
Aber das Beste wäre es, wenn wir dies für uns nie herausfinden müssten.
Jörg Polster, Juni 2025
Alle handelnden Personen und Namen sind frei erfunden.
Prolog:
Der Morgen danach
„Unser Ziel ist es, Ordnung zu schaffen. Deutschland ist das Land der Deutschen.“ – Adelheit W. Liebeschals, Kanzlerrede, 2029
Der Himmel über Berlin war bleiern. Kein Regen, keine Sonne, nur dieser stille Druck, der die Stadt seit der Wahl nicht mehr verlassen hatte. Zwei Jahre war es her, dass die rechtsorientierte Partei „Nationaler Aufruf der Freiheitshelden (NAF)“ bei den Bundestagswahlen die absolute Mehrheit gewonnen hatte. Zwei Jahre, seit die neue Kanzlerin Liebeschals in einer Rede auf dem Reichstagsbalkon erklärte, dass „eine neue Zeit“ angebrochen sei.
Es war kein Putsch gewesen. Kein Gewaltakt. Nur ein Kreuz. Millionenfach bei NAF. Und nun: ein anderes Land.
Der „Masterplan Remigration“ war Gesetz geworden. Die sogenannte Kulturwende lief auf Hochtouren: öffentlich-rechtliche Medien umstrukturiert, NGOs verboten, das Bundesverfassungsgericht entmachtet. Eine „Identitätsoffensive“ hatte Schulen, Universitäten und Theater erreicht. Wer nicht ins Raster passte, fiel heraus
So nüchtern klang das Ende einer Gesellschaft.
Und niemand widersprach, als das neue Sozialministerium der NAF-Regierung folgende Direktiven herausgab:
Menschen mit Behinderungen sollten künftig „so wohnortnah wie möglich und so kosteneffizient wie nötig“ betreut werden. Die „Förderung individueller Lebensentwürfe“ wurde gestrichen. Stattdessen hieß es: „Inklusion ist kein Selbstzweck. Wer nicht beitragen kann, soll nicht erwarten, getragen zu werden.“
Die Werkstättenverordnung wurde überarbeitet. Menschen mit geistiger Behinderung wurden in sogenannte „Tätigkeitsreservate“ eingewiesen. Das Wort Teilhabe verschwand aus allen Gesetzestexten.
Arbeitslosen ohne deutschen Pass wurde ab dem 3. Monat jede staatliche Hilfe gestrichen – mit Verweis auf „volkswirtschaftlich fremde Belastungen“.
Ein Gesetz zur „Wiedereinführung von produktiver Ordnungspflicht“ verpflichtete Langzeitarbeitslose zur „arbeitsorientierten Eingliederung“. Sie erhielten weniger als den Mindestlohn – aber „Unterkunftsunterstützung im Kollektivraum“. Kritiker sprachen von Zwangsarbeit. Die Regierung nannte es: „Forderung durch Förderung“.
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen entfiel das Anrecht auf freie Therapieplatzwahl. Nur „staatszertifizierte Psychologien mit identitätsstärkender Grundhaltung“ durften weiter tätig sein.
Arbeitslosen wurde ab dem 6. Monat jede weitere staatliche Hilfe gestrichen, wenn sie für den Staat keine Leistung erbringen.
„Wir müssen gesunde Bürger stärken, nicht Schwache stabilisieren“, sagte ein Staatssekretär im Interview mit dem neuen Sender HeimatTV.
Im neuen Schulgesetz wurde das Inklusionsrecht gestrichen. Sonderklassen wurden wiedereingeführt – getrennt nach „pädagogischer Machbarkeit“.
„Nicht jedes Kind passt in jede Klasse“, sagte ein DVR-Abgeordneter. „Und manche Kinder gehören einfach nicht ins Bild unserer Zukunft.“
Der Satz, der alles zusammenfasste, stand nicht im Gesetz. Er fiel bei einem internen Treffen. Ein Redenschreiber sagte: „Eine Gesellschaft ist nicht dazu da, alle zu tragen. Sondern jene, die gehen können, schneller gehen zu lassen.“
Und niemand widersprach.
Kapitel 1: Schatten über Leipzig
In Leipzig, einer Stadt voller Erinnerungen an Revolution und Protest, lebt Georg. Und in einem Land, das ihn ablehnt, lebt Mohamed.
Georg erwachte früh, obwohl er nicht mehr zur Arbeit musste. Sein Lehrerposten war ihm im Frühjahr entzogen worden. Der Bescheid war kalt gewesen: „Dienstunfähigkeit wegen politischer Illoyalität.“ Ein paar Monate zuvor hatte er im Unterricht ein Gedicht von Erich Fried besprochen – „Was es ist“. Danach begannen die Hausdurchsuchungen in seinem Kollegium. Erst bei Frau Radl, die in Geschichte noch über Kolonialismus sprach. Dann bei ihm.
In der Küche brühte er sich Kaffee auf. Mohamed saß schon am Tisch. In seiner Hand hielt er ein Schreiben, das am Vortag im Briefkasten lag. „Ich soll zur Überprüfung. Nächste Woche.“ Georg sah ihn an. „Was heißt das konkret?“ „‘Feststellung der integrationsbezogenen Loyalität’. So nennen sie’s.“ Mohamed versuchte zu lächeln, aber es brannte in seinen Augen. „Es ist ein Verhör. Mit Psychologen, Polizisten, Sprachprüfern. Alles in einem Raum.“
„Was, wenn…?“ „Wenn sie meinen, ich bin nicht deutsch genug?“ Mohamed zuckte mit den Schultern. „Dann bin ich weg.“ Die Stille zwischen ihnen war schwer wie die Zeit, in der sie lebten. Georg erinnerte sich, wie sie sich kennengelernt hatten. 2014. Mohamed war neu in der Stadt, ein junger Bauingenieur, wortgewandt, witzig. Sie hatten sich auf einer antirassistischen Demo getroffen. Damals, als Pegida noch als Randerscheinung galt. Damals, als „Nie wieder“ noch eine Mahnung war – und kein leerer Slogan.
Kapitel 2: Der erste Riss
Leipzig, Dezember 2029. Drei Monate nach der Wahl.
Die Stadt wirkte äußerlich ruhig. Das war das Verstörendste. Es gab keine Barrikaden, keine Sirenen, keine offenen Straßenkämpfe. Nur Stille. Der Riss lief nicht durch die Häuser – er lief durch die Menschen. Durch ihre Blicke, ihre Sätze, ihre unausgesprochenen Gedanken. Georg war sich sicher: Leipzig war nicht mehr dieselbe Stadt.
Er ging den langen Weg von der Albert-Schweitzer-Schule nach Hause zu Fuß. Sein Fahrrad hatte er vor zwei Wochen verkauft – offiziell wegen Geldnot, inoffiziell aus Angst, erkannt zu werden. Die NAF hatte kurz nach der Wahl den öffentlichen Dienst durchleuchten lassen. Lehrer mussten eine Loyalitätsklausel unterschreiben: „Ich bekenne mich zur deutschen Leitkultur, zur gewachsenen Identität unseres Volkes und zur Integrität unserer nationalen Souveränität.“ Georg hatte es verweigert. Am schwarzen Brett hing sein Name seitdem auf rotem Papier: „Vorläufig beurlaubt. Prüfung durch das Landesamt.“
Er bog in die Seitenstraße ein, die zu seinem Plattenbau führte. Die Lichter waren matt, grauer Beton und grauer Himmel verschmolzen zu einer einzigen Farbe. Dann hörte er es. „Du bist doch der mit der Fried-Geschichte, oder?“ Zwei Männer standen an der Bushaltestelle. Dunkle Kleidung. Keine Uniform, aber irgendetwas an ihnen war… identisch. Die Haltung.
Die Haltung war das Erschreckendste. Aufrecht, abwartend, selbstgewiss. „Was meinen Sie?“, fragte Georg, den Blick auf den Boden gerichtet. „Dieses Gedicht. Von dem Juden. In deiner Klasse. Bist du stolz darauf?“ Georg hob den Kopf. „Ich bin stolz darauf, meinen Schülern denken beizubringen.“ „Denk mal lieber nach, ob du hier noch hingehörst.“ Er ging weiter, schnell, ohne sich umzudrehen. Erst als er seine Wohnungstür hinter sich geschlossen hatte, atmete er durch. Zitternd. Wie damals, in seiner Kindheit, als er sich vor einem Gewitter unter dem Bett versteckt hatte. Am Küchentisch saß Mohamed. Er hatte die Nachrichten gesehen – Adelheit Liebeschals, in einem weißen Blazer, sprach von der „neuen Ordnung, in der kein Platz mehr für Selbsthass und Umerziehung“ sei.
„Weißt du“, sagte Mohamed leise, „ich habe mich früher oft gefragt, was unsere Eltern meinten, wenn sie über 1933 sprachen. Jetzt weiß ich es. Es fühlt sich an wie ein langsames Ersticken.“
Georg setzte sich zu ihm. Ihre Hände berührten sich für einen Moment. Nicht romantisch – existenziell. Zwei Menschen, verbunden durch etwas Unsichtbares.
„Wir müssen irgendetwas tun“, flüsterte Georg. „Was denn? Briefe schreiben? Die Post gehört jetzt auch denen.“ „Nein, erzählen, schreiben, aufnehmen - es weitergeben. Irgendjemand muss das alles festhalten.“ Mohamed schwieg.
Dann nickte er. „Dann fangen wir an.“
Kapitel 3: Die stille Prüfung
Berlin, Ministerium für Innere Ordnung, Januar 2031
Mohamed Khalidi, 33 Jahre, geboren in Stuttgart, wird zur Loyalitätsprüfung geladen. Der Brief war sauber formuliert, als handle es sich um eine Steuererklärung:
„Herr Khalidi, im Rahmen der integrationsbezogenen Vertrauensprüfung gemäß §7 des Gesetzes zur nationalen Ordnung und Kulturidentität (G-NOKI) laden wir Sie zu einem persönlichen Evaluationsgespräch. Ziel ist die Feststellung Ihrer Verbundenheit mit der deutschen Leitkultur und Ihrer grundsätzlichen Eignung zur staatsbürgerlichen Zugehörigkeit.“
Mohamed trug sein schlichtes Hemd, das er sonst nur zu Bewerbungsgesprächen anzog. Er wollte kein Risiko eingehen. Die Schlange im Eingangsbereich war lang. Männer, Frauen, Alte, Junge – manche nervös, manche abwesend, manche wütend. Die Kamera an der Decke surrte. Eine Stimme vom Band sagte immer wieder: „Willkommen im Haus der Heimat. Bitte halten Sie Ihre Dokumente bereit.“
Ein junger Beamter führte ihn in einen Raum ohne Fenster. Drei Personen saßen am Tisch: eine Juristin, ein Psychologe, ein Beamter des Bundesamts für Remigration und Kulturpflege (BRK). Hinter ihnen hing ein großformatiges Porträt von Kanzlerin Adelheit W. Liebeschals. Der Blick fest, das Lächeln dünn.
„Herr Khalidi“, begann die Juristin. „Sie sind 1994 in Stuttgart geboren, korrekt?“ „Ja.“ „Ihre Eltern kamen aus Tunesien. Wann war das?“ „1988. Mein Vater war Maschinenbauingenieur.“ „Und Sie? Was machen Sie beruflich?“ „Ich bin promovierter Bauingenieur. Ich arbeite an nachhaltigen Wohnprojekten.“
Der Psychologe beugte sich vor. „Fühlen Sie sich deutsch?“ Mohamed stockte. „Ich bin deutsch.“ „Das war nicht die Frage.“ Einatmen. Ausatmen. „Ja. Ich fühle mich deutsch.“. „Was halten Sie von der Aussage, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist?“ Pause.
„Ich denke, Geschichte und Gegenwart widersprechen dem.“ Der Beamte schrieb etwas auf. Ohne den Kopf zu heben. „Haben Sie den Koran gelesen?“ „Ja. Ich bin religiös, aber säkular denkend.“ „Können Sie uns versichern, dass Sie deutsches Recht über religiöse Gebote stellen?“ „Das habe ich nie in Frage gestellt.“ „Aber können Sie es versichern?“ „Ja.“
Die Juristin nickte. Der Psychologe blieb ruhig. Dann folgte die letzte Frage. „Kennen Sie Zitate der Kanzlerin?“ Mohamed blinzelte. „Einige, ja.“ „Nennen Sie eins.“ Er schluckte. „‚Multikulturalismus ist gescheitert. Wir holen uns unser Land zurück.‘“ „Finden Sie das gut?“ Pause.
„Ich finde es beängstigend.“ Der Beamte schrieb wieder. Dann legte er den Stift zur Seite.
Zwischenszene: Sitzung im Bundeskanzleramt
Berlin, Bundeskanzleramt – Parallel dazu, wenige Tage zuvor
Kanzlerin Liebeschals betrat das Kabinettssitzungszimmer mit gewohntem Schritt: schnell, gerade, lautlos. Die Minister standen auf. Sie war nicht die Art von Kanzlerin, die Lächeln verteilte. Sie sprach wenig, aber mit Nachdruck. „Die Loyalitätsprüfungen verlaufen zögerlich“, sagte sie. „Wir brauchen Tempo. Entweder diese Menschen bekennen sich – oder wir beenden die Debatte um Zugehörigkeit.“ Der Innenminister nickte. „Wir schieben derzeit monatlich 12.000 Personen ab – offiziell freiwillig. Inoffiziell: wir drängen sie hinaus.“ Liebeschals faltete die Hände. „Wir nennen das ´Heimkehrhilfe. ´“ „Ja, Frau Kanzlerin.“
Auf dem Tisch lagen Mappen mit Statistiken: Rückführungen, Lehrerentlassungen, Indexpresseeinträge. Sie griff sich eine. Auf der Vorderseite: „Evaluation kultureller Identität 2030“.
Darin fett gedruckt: „Die Nation ist kein Ort der Vielfalt, sondern der Form.“ „Unser Ziel bleibt klar“, sagte sie. „Ein deutsches Deutschland. Nicht feindlich, nur konsequent.“
Eine besondere Aufmerksamkeit legte sich auf ein Dossier mit dem Titel „Erlassprotokoll aus dem Innenministerium – Dezember 2030“ ein kühles wissendes Lächeln umspielte ihre Lippen und sie las:
Vertraulich. Nur für dienstlichen Gebrauch.
Betreff: Umsetzungspaket „Kulturelle Identität und Staatsstabilität“
Verteiler: Ministerien für Inneres, Justiz, Kultur, Medien, Bildung
1. Presse und Medienfreiheit
Erlass M-IV/47: „Nationale Verantwortung in der Berichterstattung“
Alle journalistischen Inhalte mit Reichweite über 50.000 Leser und Leserinnen unterliegen ab sofort der staatlichen Inhaltsprüfungspflicht.
Die Begriffe „Meinungspluralismus“ und „systemische Kritik“ werden im Pressegesetz gestrichen. Ersetzt durch „staatskonforme Medienstabilität“.
Ein „Medien-Wahrheitsausschuss“ aus parteinahen Fachleuten prüft öffentlich-rechtliche und private Inhalte auf „zersetzerische Wirkung“.
Journalisten und Journalistinnen mit Migrationshintergrund oder „offenkundiger ideologischer Nähe zur globalistischen Linke“ erhalten keine Akkreditierend mehr bei staatlichen Veranstaltungen.
Zitat Minister: „Pressefreiheit endet dort, wo das Vertrauen ins Volk untergraben wird.“
2. Migration und Asylrecht
Maßnahmenpaket GRENZSCHILD 1.0
Das Grundrecht auf Asyl wird durch „Schutz auf Zeit“ ersetzt.
Familiennachzug ist nur noch bei „deutsch kulturell kompatibler Herkunft“ erlaubt.
Menschen aus nicht-europäischen Herkunftsländern verlieren nach sechs Monaten ohne Beschäftigung ihren Aufenthaltstitel – auch mit Kindern.
Die Bundespolizei erhält erweitertes Durchsuchungsrecht in Wohnungen von „kulturfremden Elementen“ zwecks „Integritätskontrolle“.
„Wer kommt, muss gehen können. Wer bleibt, muss sich anpassen. Bedingungslos.“
3. LGBTQI+-Personen
Erlass G-N-12: „Ordnung der natürlichen Geschlechterverhältnisse“
Alle staatlich geförderten Bildungsangebote zu „Geschlechtsidentität, Queerness und Transitionsfragen“ werden mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Die Eintragung des Geschlechts im Pass darf nur nach biologisch-medizinischer Prüfung angepasst werden.
Öffentlich sichtbare queere Symbole (z. B. Regenbogenflaggen) in staatlichen Gebäuden werden als „ideologische Verzerrung“ eingestuft und untersagt.
Gleichgeschlechtliche Paare werden aus dem Adoptionsrecht ausgeschlossen – rückwirkend.
Zitat Ausschussprotokoll: „Wir schützen nicht Lebensentwürfe – wir schützen das Volk.“
4. Kulturförderung
Neuordnung der Kulturförderung gemäß „Heimatschutzkulturgesetz“
Künstler und Künstlerinnen erhalten nur dann öffentliche Förderung, wenn ihr Werk „zur Stärkung des nationalen Erbes“ beiträgt.
Werke mit „linksliberaler, migrantischer oder dekadenter Ausdrucksform“ werden aus der Förderung ausgeschlossen.
Eine Liste „deutschtümlicher Kulturträger“ wird erstellt – bevorzugt durch Landesmittel subventioniert.
„Deutsche Kultur ist nicht verhandelbar. Sie ist, was sie war – und wieder werden soll.“
5. Justiz und Gerichte
Strukturgesetz zur „Stabilen Rechtsprechung“
Sonderkammern für „Staatsgefährdung“ entscheiden bei politischen Delikten – Urteile sind öffentlich, aber nicht anfechtbar.
Richter und Richterinnen mit migrations- oder LGBTQI+-politischer Aktivität im Lebenslauf können dienstlich versetzt oder entlassen werden.
Der Begriff „Rechtsstaatlichkeit“ wird im Justizportal ersetzt durch „nationale Rechtssicherung“.
Letzter Vermerk: „Abweichungen im Verwaltungsvollzug gelten als ideologische Missachtung der Regierungsverantwortung.“
Zurück zu Mohamed
Nach zwei Stunden wurde Mohamed entlassen. Niemand sagte etwas zu ihm. Kein Urteil, kein Dank. Nur ein letztes Protokoll, das er unterschrieb. Als er draußen war, atmete er tief ein. Dann fuhr er nach Leipzig zurück. Still, leer, müde. Georg wartete in der Küche. „Und?“ Mohamed schüttelte den Kopf. „Sie haben nichts gesagt. Aber ich weiß es. Ich habe nicht bestanden.
Kapitel 4: Dimitrios – Kein anderer Name
Geburt in Marl (1995)
Dimitrios wurde in einem kleinen Krankenhaus in Marl geboren, als der erste Schnee des Jahres fiel. Seine Eltern, Eleni und Andreas, waren 1975 als Gastarbeiter aus Thessaloniki gekommen, geblieben – und dann unsichtbar geworden. Er sprach zuerst Griechisch – aus der Küche. Und dann Deutsch – auf dem Hof.
In der Schule sagte man: „Er ist höflich, aber laut.“ In der Kirche sagten sie: „Er ist deutsch geworden.“
Er selbst dachte nie darüber nach, ob er Grieche oder Deutscher sei. Er war einfach Dimitrios. Bis man ihn fragte: „Wie lange bleibst du noch?“
Jugend im Ruhrgebiet (2009–2014)
Dimitrios war der erste seiner Familie, der das Gymnasium besuchte. Er liebte Geschichte. Besonders die Kapitel über Widerstand. Sein Lieblingssatz: „Ich hätte nein gesagt.“ Später verstand er, wie naiv das war.
Er wurde Fußballtrainer für C-Jugendliche. Studierte Soziale Arbeit in Essen. Arbeitete in einem Jugendzentrum für benachteiligte Jugendliche – viele davon mit Fluchterfahrung. Er war beliebt. Engagiert. Unauffällig sichtbar. Bis zur Wahl 2029. Dann wurde „Herkunft“ wieder ein Wort mit Zähnen.
Der Moment, an dem es kippte (Februar 2029)
Es begann mit dem neuen Formular. Einfach nur eine Statistik: „Erhebung von Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst.“ Dimitrios kreuzte „deutsch-griechisch“ an. Sein Kollege sagte leise: „Wäre besser gewesen, du hättest gar nichts angekreuzt.“
Wenige Wochen später wurde er „versetzt zur Entlastung der Integritätsstruktur“. Die neue Leitung sagte: „Du bist ja eigentlich in Ordnung. Aber wir haben Vorgaben.“
Begegnung mit Leila (März 2029)
Er traf Leila auf einem Seminar für freie Träger. Thema: „Demokratiearbeit unter Druck“ Leila sprach klar. Dimitrios fragte nach. „Was machen wir, wenn wir verlieren?“ „Dann erzählen wir. Damit sie nicht gewinnen.“
Sie tranken Kaffee. Tauschten Nummern. Später schrieb sie ihm: „Du bist nicht allein. Auch wenn sie es wollen.“
Eintrag im Register (Mai 2029)
Ein neuer Erlass regelte, wer „deutschkulturell zuverlässig“ sei. Dimitrios stand auf einer Liste als „Kontrollperson mit erweiterten biografischen Parametern“. Er wurde aus dem Jugendzentrum entfernt. Man warf ihm vor, „Unverhältnismäßige Nähe zu nicht-integrierten Jugendlichen“ zu haben.
Als er sich wehrte, wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Wegen „Systemkritik in einem gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess.“
Er lachte. Dann nicht mehr.
Versteck bei Georg (Sommer 2029)
Dimitrios tauchte unter. Georg versteckte ihn in einem Schrebergarten am Stadtrand. Die Hütte roch nach feuchtem Holz, aber sie war sicher. Mohamed brachte Lebensmittel. Leila schickte Bücher. Georg sagte: „Du hast alles richtiggemacht.“ Dimitrios: „Dann ist es schlimmer, als ich dachte.“
Verhaftung (Herbst 2029)
Bei einer nächtlichen Razzia wurde Dimitrios festgenommen. Anklage: „staatszersetzende Sozialpädagogik“ und „Gefährdung kultureller Integrität“.
Im Protokoll stand: „Subtile Einflussnahme durch Begriffsverwendung wie Vielfalt, Respekt, Gleichwertigkeit.“
Er kam in ein Arbeitsinternierungslager bei Cottbus. Kein Urteil. Keine Besuchserlaubnis. Nur ein Nummernschild: 613–Δ
Kapitel 5: Jule & Mina – Lichtstreifen
Kennenlernen – Die Bibliothek (Frühjahr 2030)
Jule ordnete Bücher in einer bereits vergessenen Universitätsbibliothek in Leipzig. Nach der Machtergreifung war ihr Studiengang „Kultur & Gender“ gestrichen worden – aus dem Vorlesungsverzeichnis, aus den Köpfen, aus den Lebensläufen.