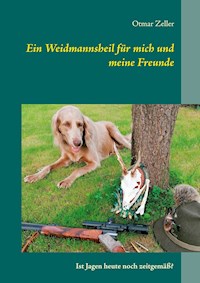
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Inspiriert zu dieser Arbeit hat mich vor allem die Frage, ob die Jagd tatsächlich noch eine Berechtigung und damit eine Zukunft im heutigen modernen Industrie- und Konsumzeitalter hat. Der Wald ist voller Konfliktpotential. Bei der Jagdausübung begegnen wir Jäger immer wieder der nicht jagenden Bevölkerung darunter Mountainbiker, Jogger, Spaziergänger, Reiter, Geo-Cacher usw. Und jeder beansprucht den Wald für sich und seine Passion. Leben wir generell in einer äußerst egozentrischen und konsumorientierten Gesellschaft, so wird auch die Trias Natur-Wild-Wald mit dem Wunsch nach möglichst viel Konsum von Freizeit und Erholung betrachtet. Rücksicht auf Wildtiere findet dabei nur selten Platz, nicht weil dies nicht gewollt wäre, nein, weil viele es gar nicht besser wissen. So glaubten Spaziergänger, deren Hunde im Winter einige Rehe in unserem Au-Revier aufgescheucht hatten, dass diese durch die unfreiwillige Bewegungsmotivation nur die notwendige Wärme in der kalten Winterlandschaft entwickelt hätten. Keine Frage den meisten Mitgliedern unserer urbanisierten Wohlstandsgesellschaft fehlt es an ausreichendem Wissen um wildökologische Zusammenhänge. Dasselbe gilt übrigens auch für so manche (zumeist ältere) veränderungsresistente Grünröcke. Ich selbst begegne ständig jagdfremden Personen auf dem Weg in mein Jagdrevier, denn ich bewege mich zumeist auf Schusters Rappen und der Reviereingang liegt nur etwa zehn Minuten von meinem Wohnhaus entfernt. Dabei freue ich mich stets, auf Menschen zu treffen, um für die Jagd PR-Arbeit zu machen. Die unterschiedlichsten Begegnungen, sehr positive, aber auch so manche negativen Erfahrungen und Erlebnisse haben mich dazu veranlasst, tiefer vorzudringen in den komplexen holistischen Kontext von Jagd und Natur. Und so reflektierte ich aus diesem Spannungsfeld heraus über die moderne Jagd, suchte nach Definitionen und Grundprinzipien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otmar Zeller absolvierte das neusprachliche Gymnasium im Benediktiner Stift in Melk an der Donau (Bundesland Niederösterreich). Das Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften (Psychologie) an der FernUniversität Hagen schloss er als Magister Artium in Hagen, Nordrhein Westfalen ab.
Den Schwerpunkt seiner populärphilosophischen Auseinandersetzungen bilden interkulturelle Studien zur europäischen und chinesischen Philosophie sowie zur Naturphilosophie.
Gegenwärtig beschäftigt er sich mit einem Buch zur interkulturellen Komparatistik des chinesischen und europäischen Denkens hinsichtlich der Frage nach dem Ursprung des Bösen.
Als passionierter Jäger, Jagdaufseher, Reiter und Erholung suchender Freizeitsportler kennt er die unterschiedlichen Konfliktpotentiale der verschiedenen Interessengruppen rund um Wald, Natur und Freizeit sehr gut und vor allem direkt aus der Praxis.
Inhalt
Zum Geleit
Ein Weidmannsheil für mich …
Begriff und Aufgaben der Jagd
Wildtiermanagement
Jagd und Wildökologie
Jagd und Biodiversität
Jagd, Mythos und Geschichte
Wildbret als hochwertiges Nahrungsmittel
Wildbret im urbanen Umfeld
Wildbret und Ernährungsphysiologie
Wildbret, Ballistik und Radioaktivität
Der Jäger als Vermittler zwischen Mensch, Tier und Natur
Jäger und Freizeitstress
Jäger und Waldpädagogen
Jäger und Waldläufer
Der Archetypus der Jägerin
Resümee und Ausblick
Die Jagd ist Menschenrecht
Die Jagd ist Wirtschaftsfaktor
Die Jagd ist Naturschutz
Glossar
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Anmerkungen
Mein Dank gilt …
...Forstrat h.c. Dipl.-Ing. Richard Wurz (für die ergiebigen Gespräche, mit reichhaltigen Geschichten aus 72 Jahren Jagderfahrung; Jagdprüfung 1938 mit 14 Jahren)
…Forstwart Fritz Wolf von der Forstverwaltung des Stiftes Melk und zertifizierter Waldpädagoge (für die vielen wertvollen Informationen besonders zur Waldpädagogik, Tipps, Erzählungen und die tollen Fotos, ohne die das Buch nie zu dem geworden wäre, was es ist)
…Bezirksjägermeister Ofö Ing. Bernhard Egger (für die notwendigen rechtlichen Korrekturen und Anmerkungen)
…Bezirksförster Ing. Georg Pawelka (für die zahlreichen Informationen zum Wildschadens-Monitoring)
…Amtstierarzt Dr. med. vet. Helmut Herndl (für die fachlichen Hinweise und Durchsicht der veterinärmedizinischen Anmerkungen)
…Hubert Pajek, Akademischer Jagdwirt (für die aufschlussreichen Daten zu den Auswirkungen von Verkehrsunfällen mit Wildtieren auf die österreichische Versicherungswirtschaft und die vielen erfahrungsreichen Jagd-Erlebnisse im Ausland)
…Univ.-Prof. em. Dipl.-Ing. Dr. Friedrich und Dr. Susanne Reimoser vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien (für die vielen für dieses Buch so unentbehrlichen Informationen)
…Dr. Elizaveta Tselykhova, Moskau - www.huntingculture.ru (für die ausführlichen Hintergrundinformationen zur Situation der Jagd in Russland)
…K. Anirudh Singh aus Kota, Bundesstaat Rajasthan, Indien (für die ausführlichen Hintergrundinformationen zur Situation der Jagd in Indien)
…Doria Lee aus Shenzhen, China von Wuyuan Technical Co., Ltd. (für die Hintergrundinformationen zur Situation der Jagd in China)
…Hobby-Keltologin McClaudia (für ihre Ausführungen zur keltischen und germanischen Mythologie)
…meiner Weimaraner-Hündin Ella (für die tiefere Einsicht in ein Hundeleben)
…vor allem aber meiner wundervollen Frau Margarete, die – ebenfalls Jägerin – wohl am meisten zu diesem Buch beigetragen hat, ohne es direkt aktiv mitgestaltet zu haben. Ihr möchte ich es widmen.
Zum Geleit
Ein Freund fragte mich eines Tages, welche Kraft mich vorantreibe, dieses Buch zu schreiben. Zuerst wusste ich keine Antwort darauf. Doch dann wurde es mir klar. Ich verspüre einfach diese Kraft in mir, die Passion zur Jagd. Passion kommt ja vom Lateinischen passio, passionis also Leidenschaft, Leiden aus der Hinwendung. Ich liebe die Natur, den Wald, lausche der Musik des Waldes und ich gehe gerne auf die Jagd. Schon als kleiner Junge erklomm ich jeden Hochsitz in meiner Umgebung, las die alten Jagdzeitschriften eines befreundeten Jägers in unserer Gemeinde und begleitete ihn auch mal bei der Pirsch. Dies war für mich wie eine Reise in ein mystisches Fantasiereich. Niemand in meinem direkten Familienverband teilt diese Leidenschaft. Nur mein Großvater mütterlicherseits sammelte Präparate und besaß ein altes Gewehr, ein Werndl-Holub’sches Hinterladungsgewehr aus den Steyr Werken von Josef Werndl von 1867. Natürlich hatte er keine Munition dazu. Er, von Beruf Dachdecker, fand es auf dem Dachboden eines alten Bauernhofes und bekam es vom Besitzer geschenkt. Wahrscheinlich wollte er auch Jäger sein, konnte es sich aber niemals leisten. Als einfacher Arbeiter wäre dies wohl in jener Zeit völlig unmöglich gewesen, ohne Grundbesitz, ohne landwirtschaftlichen Hintergrund.
Meine Intention mit diesem Buch ist es, ein klein wenig von meiner Passion weiterzugeben, darzulegen, warum die Jagd auch heute noch wichtig ist. Dabei erhebe ich mit meinen Feststellungen, Fragen und Antworten keinen Absolutheitsanspruch. Im Gegenteil: mir ist völlig klar, dass diese meine Beschreibungen nur die eigenen Gedanken zu diesem Thema, meine eigene Sicht der Dinge wiedergeben können. Dennoch glaube ich, nein weiß ich, dass sich darin auch viele andere, die sich ebenso für die Natur, für Fauna und Flora interessieren, wiederfinden können. So denke ich, dass dieses Buch nicht nur Jägerinnen und Jäger ansprechen wird.
Aus diesem Grund habe ich im Anhang ein kleines Glossar mit von mir ausgewählten und teilweise in diesem Buch verwendeten Begriffen der Jägersprache aufgelistet. Bei meiner subjektiven Auswahl des Glossars habe ich keine Rücksicht genommen auf jagdliche Genauigkeiten und Differenzierungen. Wichtig war mir einfach eine möglichst verständliche Zusammenfassung für nicht jagende Personen zu schaffen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Diesen Teil mit den einzelnen Bedeutungen der Jägersprache habe ich großteils dem hervorragenden Werk von Hermann Prossinagg entnommen.1 Bei meinen Hinweisen auf jagdgesetzliche Bestimmungen habe ich mich stets auf die Gesetzgebung für das Bundesland Niederösterreich bezogen. Denn einerseits lebe und jage ich in Niederösterreich und andererseits ist das Jagdgesetz in Österreich Landessache während das Forstgesetz in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Dies tut aber dem überregionalen Aussagewert des Landesjagdgesetzes für die praktische Jagdausübung keinen Abbruch. Ich bitte deshalb um Verständnis für meine Reduktion, welche ich ganz im Sinne der glocal-Formel „Think global and act local!“ verstanden wissen möchte.
Bei einem Buch, das neben dem Hauptthema auch viele Nebenthemen anspricht (ich betone absichtlich nur anspricht), bedarf es der direkten oder indirekten Mithilfe vieler unterschiedlicher Fachspezialisten. Dank deren Unterstützung konnte ich das Buch in dieser Form verwirklichen.
Von meinen zahlreichen Treffen mit Kindern profitiere ich wohl am meisten, weil diese unablässig und hartnäckig Fragen stellen, die mich immer wieder aufs Neue fordern und an die Grenzen meines Wissens führen. So gelange ich stets zur Sokratischen Erkenntnis „Ich weiß, dass ich nichts weiß“.
Ein Weidmannsheil für mich …
… und meine Freunde. Das ist der Refrain eines Volksliedes, das von längst vergangenen Tagen erzählt, wo die Jagd noch einen wichtigen Stellenwert in der menschlichen Gesellschaft hatte.
Es grauet schon der kühle Morgen
Franz Ritter von Kobell (um 1860)
1. Auf, auf! Es grauet schon der kühle Morgen,
auf, auf! Ihr Jäger, seid bereit!
Vergeßt des Hauses mannigfache Sorgen,
im Freien wohnt die Fröhlichkeit!
Halli, hallo! Wenn's Hifthorn durch die Büsche schallt,
frisch auf zur Jagd, zur Jagd im dunkelgrünen Wald!
Dann Weidmanns Heil für mich und meine Freunde,
und daß die Büchse sicher knallt.
2. Es trabt der Fuchs durchs Dickicht in dem Bogen,
die Hasen springen flüchtig an,
und stattlich kommt der Rehbock hergezogen,
halli, hallo! die Jagd fängt an.
Halli, hallo! Wenn's Hifthorn durch die Büsche schallt,
frisch auf zur Jagd, zur Jagd im dunkelgrünen Wald!
Dann Weidmanns Heil für mich und meine Freunde,
und daß die Büchse sicher knallt.
3. Und wenn im Wald die Hunde lustig jagen,
so ist's die schönste Melodie,
ja selbst in meinen allerletzten Tagen,
niemals, niemals vergeß' ich sie.
Halli, hallo! Wenn's Hifthorn durch die Büsche schallt,
frisch auf zur Jagd, zur Jagd im dunkelgrünen Wald!
Dann Weidmanns Heil für mich und meine Freunde,
und daß die Büchse sicher knallt.
4. Es leben alle, die das Waidwerk treiben,
das immer frischen Mut gewährt;
und könnt' es Herbst im ganzen Jahre bleiben,
das wäre, was mein Herz begehrt.
Halli, hallo! Wenn's Hifthorn durch die Büsche schallt,
frisch auf zur Jagd, zur Jagd im dunkelgrünen Wald!
Dann Weidmanns Heil für mich und meine Freunde,
und daß die Büchse sicher knallt.
5. Und bin als Waidmann ich einst eingegangen,
legt mich im Wald in den tiefsten Bau;
dort werd' ich rasten ohne Furcht und Bangen,
bis ich den letzten Tag erschau'.
Halli, Hallo! Mein Auferstehungstag ist da!
Frisch auf zur Jagd, zur Jagd im dunkelgrünen Wald!
Drum Waidmanns-Heil für mich und meine Freunde;
es fängt die Jagd von neuem an!2
Auch dieses sehr bekannte und beliebte Volkslied von Gottfried Benjamin Hancke (1724) zeugt von der Freude am Weidwerk:
Auf, auf zum fröhlichen Jagen,
Auf in die grüne Heid!
Es fängt schon an zu tagen,
Es ist die höchste Zeit!
Auf bei den frohen Stunden,
mein Herz muntre dich!
Die Nacht ist schon verschwunden,
und Phöbus zeiget sich …3
Das Lied vom Jäger aus Kurpfalz ist ebenfalls ein bekanntes deutsches Volkslied, das von einer Form der Jagd erzählt, wo sie noch ein naturverbundenes unverfängliches Vergnügen ist. Vermutlich liegt sein Ursprung zu Anfang des 18. Jahrhunderts, der Blütezeit deutscher Jagdlust.
Alle diese Liederweisen malen ein romantisches Bild von der Jagd. Wir können den Duft des Waldes förmlich riechen, die Füchse, Hasen und Rehe zwischen Nebel verhangenen Tannen erblicken, die Freude der Menschen an der Jagd spüren. Wo ist diese Freude hingekommen?
Ist die Jagd heute tot? Wohl kaum, denn wie sollte etwas sterben, das immer schon Bestandteil des Menschen war, das zu seinem Leben gehört wie Land- und Forstwirtschaft. Viel eher hat sich die Art des Jagens geändert. Der Mensch und seine Kulturlandschaft haben sich sogar wesentlich verändert. Die Menschen sind heute weiter von der Natur entfernt denn je und wünschen sich doch nichts mehr, als ihr nahe zu sein. Die Konsumgüterindustrie weiß diese Sehnsucht geschickt für ihre Geschäfte zu nutzen. Freizeitstress und Massenaufläufe in scheinbar unberührter Natur inmitten menschlicher Kulturlandschaft. Outdoor-Aktivitäten und Lagerfeuer-Romantik sind echte Renner in der modernen Wohlstandsgesellschaft.
Auf der anderen Seite wird Zeit zur Mangelware, Zeit für sich selbst, die Familie, Freunde und für die Umwelt, sprich für den uns umgebenden Naturraum. Dabei ist es paradox. Denn objektiv gesehen verfügen wir über mehr Zeit denn je, subjektiv gesehen glauben wir aber weniger Zeit zur Verfügung zu haben. Wir wollen aufgrund unserer zu verplanenden Freiräume in der Freizeit alles gleichzeitig machen. Einkaufen, Freunde treffen, Kinder versorgen, Arztbesuche, dieses und jenes, Sport betreiben und die Natur genießen. Und damit dies alles möglichst schnell geht, bedient man sich modernster technischer Hilfsmittel. Wer seinen Hund mit dem Auto Gassi führt, glaubt schon „draussen“ in der Natur gewesen zu sein. „Wir können ja das Fenster offen lassen für ein bisschen Landluft.“ Und das Gewissen scheint beruhigt. Auch mancher Jäger glaubt, dass Jagen heute nur mehr mit dem Geländewagen möglich ist. Die so genannte „Gummipirsch“ soll die mangelnde Zeit für ausgedehnte Pirschgänge kompensieren. Schnell mit wenig Aufwand den jagdlichen Auftrag erfüllen passt eben in unsere Zeit.
Wie jede Zunft, so verfügt auch die Jägerschaft über eine eigene Sprache, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Dies ist nichts Besonderes, denn viele Bereiche des Menschen haben ihre eigenen Sprachbegriffe. Am deutlichsten wird dies wohl in der Medizin. Jeder Arzt auf der ganzen Welt - egal welche Sprache er spricht weiß, dass z.B. ein Erythema migrans eine entzündliche Wanderrötung der Haut ist, die zumeist durch einen Zeckenbiss hervorgerufen wurde und von der Bissstelle zentrifugal fortschreitet (möglicher Hinweis auf Infektion mit Borreliose).
Um sich von anderen Gruppierungen abzugrenzen und für eine schnelle, möglichst eindeutige Kommunikation innerhalb zu sorgen, verfügt jede Gruppe über ihre eigenen Begriffe. Ob die Reiter, die Segler, die Fußballer, …
Bei der Jagd kommt noch hinzu, dass sich aufgrund ihrer langen historischen Tradition teilweise sehr alte Begriffe erhalten haben. Diese für den Jäger charakteristische Art zu reden ist, ihrem Ursprung nach, zwischen einer Fachsprache und einer Standessprache anzusiedeln und weicht sehr oft gravierend von der Umgangssprache ab. Das geht nicht etwa auf das Bedürfnis zurück, das Besprochene zu verschleiern, sondern ist als eine besondere sprachgeschichtliche Entwicklung anzusehen, die bis ins 7. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann.4
Ihren Ursprung dürfte die Waidsprache aber vermutlich im jagdlichen Aberglauben haben. Der Gebrauch der eigentlichen Alltagssprache sollte nämlich während der Jagd vermieden werden, um Wald und Wild nicht vorzuwarnen. Die geschickten sprachlichen Metaphern sollten die eigentlichen Beuteabsichten vor den Waldgeistern verbergen, so der uralte Aberglaube.5
Natürlich spielte aber auch das Bedürfnis nach elitärer Abgrenzung eine Rolle.
Die Jägersprache setzt sich gezielt von der Sprache der Nichtjäger ab. Sie will den elitären Charakter der Jagd bewahren, die über Jahrhunderte ein Privileg des Adels war. Interessanterweise hatten die Aristrokraten es im frühen Mittelalter nicht nötig, der Jagd ein eigenes Vokabular zu verpassen. Erst als die Jagden größer und aufwendiger wurden und immer mehr nicht adelige Helfer beanspruchten, entwickelten diese eine Art ständische Sprache, die sie selbst über die einfache Bevölkerung erhob.6
Letztendlich schlägt die Jägersprache heute mit ihren bildhaften, kraftvollen, lebendigen und teils auch lautmalerischen Ausdrucksformen nicht nur eine Brücke zwischen den Generationen sondern überwindet auch soziale Gegensätze.
Die Frage, ob die Jagd tot sein kann, kam mir in den Sinn, als ich wieder einmal durch den kühlen Wald an einem sonnigen Sommertag streifte. Anlass für meine Gedankenausflüge war und ist die kritische Auseinandersetzung mit der Jagd als solcher und ihrer Berechtigung in unseren Tagen, in einer Gesellschaft, die einerseits von der Natur weiter weg ist denn je und andererseits für sich beansprucht, besonders naturnah zu sein. Ein Paradoxon, das sich nur auflöst, wenn die Ganzheitlichkeit der Thematik berücksichtigt wird.
Während ich so gemächlich durch den herrlich duftenden, schattigen Wald schritt und den meisterhaft komponierten Partituren bunter Vogelorchester lauschte, fiel mir eine Episode meines Religionsunterrichts im Gymnasium ein. Mein damaliger Religionslehrer, ein Pater des Ordo Sancti Benedicti (Benediktinerorden), erzählte einmal von dem Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900). Dabei schrieb er an die Tafel die Worte „Nietzsche: Gott ist tot. Gott: Nietzsche ist tot.“ Wir mussten schmunzeln und das fesselte uns natürlich sofort, unsere Aufmerksamkeit und gespannte Erwartung auf den weiteren Unterricht war ihm sicher. Er war wirklich ein hervorragender Lehrer, wohl einer der besten, die ich je hatte. Mit seiner toleranten Auffassung schilderte er aus dem Leben des zerrissenen Philosophen. Er zeigte Verständnis für die Haltung Nietzsches (die natürlich ihren Hintergrund hat) und wies daraufhin, dass aus seinen Gedichten auch die verzweifelte Suche nach einem Gott deutlich hervorgehen würde. Nietzsche war ein leidender Mensch und gerade deswegen Gott so nah. Denn seine heftige Kritik zeigte doch, wie sehr er sich mit dem Thema auseinandersetzte, also war es ihm besonders wichtig. Gott war also tot, weil ihn die Menschen tot gemacht hatten. Jetzt in unserer modernen Konsumgesellschaft, wo findige Marketing-Strategen selbst vor Kindern nicht Halt machen und ihnen fragwürdige Werte in überdrehten und gestylten Werbebotschaften vermitteln, ist Gott wohl wieder „tot“.
Und die Jagd? Sie stirbt jedes Mal, um wieder von Neuem, einem Phönix gleich, aufzuerstehen. Damit meine ich nichts Anderes als, dass sie – weil sie dem Menschen immanent ist – auch stets ein Spiegel seiner Zeit ist, sich mit der jeweiligen kulturellen Stufe der menschlichen Entwicklung sozialisiert. Waren Menschen früher zu ihren Mit-Menschen grausam, so behandelten sie Tiere mit derselben Missachtung vor dem Leben und der Schöpfung. Mit der menschlichen kulturellen Entwicklung ändern sich – dem Himmel sei Dank – auch das Brauchtum, die Tradition sowie die jeweiligen gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von Moralität. Aber nicht jede Neuerung muss unbedingt nur gut und nicht alle alten Sitten und Bräuche müssen unbedingt schlecht und überholt sein. Und vice versa ist auch nicht jede Tradition unbedingt erhaltenswert.
In der Natur befindet sich alles im Fluss, was wohl am besten durch die Gestalt eines Kreises symbolisiert werden kann. Vieles in der Natur verläuft kreisend, Leben und Tod, auch Sonne und Mond haben kreisförmige Gestalt. Und selbst der menschliche Körper funktioniert in Form von Kreisläufen.
Panta rhei (πάντα δεί) - alles fließt, soll der antike hellenische Philosoph Heraklit (um 544–483 v.Chr.) gesagt haben. Alles ist im Fluss, nichts bleibt unbewegt, das ganze Universum ist permanente Transformation, wobei alles auf Gegensätzlichkeit basiert. Und so heißt es bei Heraklit weiters: Wir steigen in denselben Fluß, und doch nicht in denselben; wir sind es, und wir sind es nicht.7 Bei einem Fluss, der einmal Hochwasser und einmal besonders wenig Wasser führen kann, lässt sich die permanente Veränderung wohl besonders deutlich beobachten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ihre runde Form legt Zeugnis ab vom ständigen Weg durch das Flussbett. Heraklit liegt damit der chinesischen Philosophie des Daoismus sehr nahe. Denn darin spielt die Gegensätzlichkeit eine wesentliche Rolle wie wir von Lao-zi (6. Jh.v.Chr.), dem großen Vertreter des Daoismus, vernehmen können.
Im schwer verständlichen Werk Daodejing ist über den Weg (daô) Folgendes zu lesen:
Da ist ein Wesen, aus Trübem gemacht, entstanden vor Himmel und Erde. So trüb, so leer, steht es allein ohne Veränderung, geht es im Kreise ohne Gefährdung. Man kann es nennen die Mutter der Welt. Wir wissen seinen Namen nicht und so bezeichnen wir es mit „Weg“.8
So geht stets eins ins andere über, wobei die Gegensätze zu einem fließenden Übergang, zu einer Einheit werden.
Der stete Wandel macht natürlich auch vor der Jagd nicht halt. Nun stellt sich die Frage, ob der Jagd nicht bald ein Requiem geblasen wird? Ein neues Jagdhorn-Signal, nicht Sau tot oder Fuchs tot, sondern „Jagd tot“. Requiescat in pace! (Ruhe in Frieden)! Um sich dieser Frage stellen zu können, muss zunächst geklärt werden, was denn Jagd überhaupt ist und was nicht. Was umfasst der Begriff Jagd eigentlich?
Jagdsignal „Sau tot“ Nach jagdlichem Brauchtum im deutschsprachigen Raum wird jedem erlegten Tier bzw. bestimmten Wildtier-Gruppen (z.B. Flugwild) ein eigenes überliefertes Jagdsignal geblasen. Dabei werden die Tiere sorgfältig mit der rechten Körperseite auf den zuvor mit Tannen- bzw. Fichtenzweigen oder Eichenlaub bereiteten Boden gebettet. Feuerkörbe oder offene Feuerstellen werden entzündet. Es wird Strecke gelegt, wie die Jägerschaft dies nennt. Alles folgt neben festgelegten Regeln einem uralten Ritual. Mit Respekt und Pietät wird den Tieren ihr jeweiliges Musikstück geblasen. Es ist verpönt, respektlos über die Strecke zu steigen. Statt dessen sollte diese bedächtig aussen umgangen werden. Der letzte Bissen, der Zweig eines Nadelbaumes oder einer Eiche bzw. Buche, im Äser oder Fang (das Maul der Wildtiere), zeugt von der Dankbarkeit der Jäger gegenüber seiner erlegten Beute und Versöhnung mit ihm auf einer höheren Ebene.
Begriff und Aufgaben der Jagd
Die Jagd lässt sich in ihrer Ganzheitlichkeit und komplexen Korrelation mit der menschlichen Existenz nur schwer in eine systematische Begrifflichkeit fassen. Denn war sie ursprünglich zum Überleben notwendig, so scheint sie heute bloß eine kultivierte „Erholung vom Menschsein“ zu sein wie der spanische Philosoph José Ortega y Gasset9 in seinen »Meditationen über die Jagd« ausführt.
Die Jagd ist weder rein zweckorientiert noch nur eine reine Zivilisationserscheinung wie Prof. Peter Kampits, Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften und Vorstand des Instituts für Philosophie an der Universität Wien, anmerkt:
Jagd – und darauf hat ORTEGA Y GASSET mehrfach verwiesen – lässt sich weder unter die Bedingungen eines Erfolgs für den Jäger noch unter die des Erfolgs für das entkommende Tier subsummieren. Beides gehört entscheidend zu einem Grundbegriff der Jagd, deren Ziel ja nicht das Töten und Erlegen, sondern die Betätigung, das Jagen selbst, darstellt.10
Was bedeutet nun die Jagd tatsächlich, was sind ihre Charakteristika? Im deutschen Sprachgebrauch – obwohl in den Medien und in der Alltagssprache allgegenwärtig (z.B. als „Schnitzeljagd“ oder „Schnäppchenjagd“) – wird der Begriff „Jagd“ kaum differenziert betrachtet. Zwar verfügt die deutsche Sprache – anders als z.B. im Englischen11 - über keine eigenen Bezeichnungen für die unterschiedlichen Intentionen des Menschen in Bezug auf Tierverfolgungen –fänge und -tötungen, jedoch gilt es – gerade in Zeiten vermehrter Kritik an der Jagdausübung – eine klare Definition des eigentlichen Weidwerks vorzunehmen. Denn nicht alles, wo Jagd draufsteht, ist auch Jagd drinnen. Nachsuche-Hundeführer, Tierfotograf und Jagdautor Seeben Arjes bringt dies auf den Punkt:
Was versteht man im dritten Jahrtausend noch
unter Jagd?
Welche Reviere sind Lebensräume, welche
sind gewerbliche oder private Schießbuden?
Was ist Jagd? Was ist Kommerz?
Abschusshändler und Seelenverkäufer haben
sich des Begriffes Jagd bemächtigt. Sie haben ihn
mitgenommen in ein zwielichtiges Milieu.
Das Wort Jagd muss neu definiert werden!
Und wenn wir geklärt haben, was Jagd ist, werden
wir auch wieder wissen, wer ein Jäger ist.
Und mit dem wird sich eine Debatte über des
Jägers Ehrenschild vermutlich erübrigen.12
Des Jägers Ehrenschild ist nach Julius Adolf Oskar von Riesenthal (1830-1898) die aufrechte Obsorge um das Wild. Auf dem Etikett der Jägermeister-Flaschen ist die erste Strophe seines dreistrophigen Gedichts Waidmannsheil (1880) abgedruckt, fälschlich einem „Otto von Riesenthal“ zugeschrieben.
Das ist des Jägers Ehrenschild,
daß er beschützt und hegt sein Wild,
waidmännisch jagt, wie sich’s gehört,
den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.
Das Kriegsgeschoß der Haß regiert,
Die Lieb’ zum Wild den Stutzen führt:
Drum denk’ bei Deinem täglich Brot
Ob auch Dein Wild nicht leidet Noth?
Behüt’s vor Mensch und Thier zumal!
Verkürze ihm die Todesqual!
Sei außen rauh, doch innen mild,
Dann bleibet blank Dein Ehrenschild!13
Es kann nicht Gegenstand dieser Auseinandersetzung sein, die unterschiedlichen Bezeichnungen der Jagd zu differenzieren. Vielmehr soll der Begriff der Jagd insoweit definiert werden, als eine Differenzierung vom alltäglichen Sprachgebrauch die eigentlichen Aufgaben der Jagd näher verstehen lässt. Ortega y Gasset führt in seinen „Meditationen über die Jagd“ aus, dass der Begriff Jagd nur dann legitim ist, wenn das zu jagende Wild extra aufgespürt werden muss, wenn es nicht zu häufig vorkommt, wenn es eine entsprechende Scheu vor dem Menschen oder Angriffslust gegenüber dem Menschen hat, wenn es stets die Chance hat, zu fliehen, wenn die menschliche bzw. technische Überlegenheit des Jägers nicht zu groß ist und wenn der Jäger unmittelbar handelt, also keine Maschinen die Arbeit des Jägers übernehmen. 14 In anderen Fällen könne höchstens von einem „Freizeitvergnügen“ wie Bergsteigen oder Zielschießen gesprochen werden und nicht von Jagd. Daneben sind noch andere Ansätze der näheren Begriffsbestimmung der Jagd zu verzeichnen, wie z.B. von Cartmill (1995), Prossinagg/Haubenberger (2007) oder Schwenk (1994), denen allesamt in Ihrem Kern gemein ist, dass es sich bei dem bejagten Wild um ungehindert frei lebende Tiere handeln muss, die als natürliche Ressource ökologisch nachhaltig genutzt werden können. Zusammenfassend möchte ich daher die Jagd mit meinen Worten folgenderweise definieren:
Die Jagd ist eine natürliche Betätigung des Menschen, weil sie Teil seiner natürlichen Existenz ist. Jagen bedeutet, in der freien Wildbahn ungehindert wild lebende Tiere zu beobachten, ihnen nachzustellen und sie zu locken, um sie zu studieren, lebendig zu fangen oder zu töten.
Ziel der Jagd ist die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressource „Wild“ in Form eines aktiven Wildtiermanagements. Das Fleisch des Wildes wird auf naturnahe Art und Weise als hochwertiges Nahrungsmittel gewonnen.
Es können aber auch ohne unbedingte fleischliche Verwertung wertvolle Stoffe weiterverarbeitet werden wie z.B. Felle, Leder, Horn, Geweih, Knochen, Fett u.a. für medizinische Zwecke, Schmuck, Werkzeug etc.
Dort, wo weder das eine noch das andere Verwendung findet, dient die Jagd dem Ausgleich zwischen Beutegreifern und Beute, Kulturfolgern und Kulturflüchtern und letztendlich zwischen Mensch und Tier.
Wie bereits hingewiesen kann die Jagd nicht rein zweckorientiert betrachtet werden, vielmehr ist sie in einen umfassenden Gesamtzusammenhang mit der Natur eingebettet. Aufgrund dieser Komplexität der Zusammenhänge von Wild und Natur müssen Jäger auch ein umfangreiches wildbiologisches und wildökologisches Verständnis aufweisen, um nicht nur im Einklang mit der Natur nachhaltig und maßvoll sondern auch in engster Kooperation mit Land-, Forst-, Fischerei-, Tourismus-, Freizeitwirtschaft und Naturschutz das Weidwerk auszuüben.
Der Kodex der Jagd folgt der Achtung vor der Natur und ihren Geschöpfen. In unserer österreichischen jagdlichen Tradition ist dies die Weidgerechtigkeit, in anderen Jagdkulturen ist es eine andere Form des Respekts vor Wild und Natur. Denn der Jagd liegt stets conditio sine qua non das Bestreben nach Harmonie mit Wild und Natur zugrunde. Ansonsten schafft sie sich selbst ab.
Nun, wo wir wissen, was Jagd ist, stellt sich die Frage, was keine Jagd ist. Es gibt beispielsweise „Jagdgesellschaften“, die vor Beginn von Gesellschaftsjagden Wildtiere aus (Zucht)Gattern oder aus Volieren in die freie Wildbahn entlassen, um im Jahr der Aussetzung einen höheren und vor allem sicheren Jagderfolg zu gewährleisten. So werden Fasane (sogenannte „Kistlfasane“), Stockenten oder Wildschweine (in manchen europäischen Ländern auch das Rothuhn) manchmal auch kurz vor der Jagd aus ihren Käfigen ausgesetzt, um ein leichtes Ziel zu bieten. Dass in diesen Fällen nicht von Jagd gesprochen werden kann, liegt auf der Hand. Ebenso wenig ist der Begriff Jagd bei Treibjagden auf Schalenwild15 in überbesetzten Wildgehegen legitim.16 Das ausschließlich der Belustigung dienende Abschießen von in Gattern eingesperrtem oder von zu diesem Zweck ausgesetztem Wild kann daher nur als „Abschießbelustigung“ und niemals als „Jagd“ bezeichnet werden. Überdies haben jene Fasane und Rothühner, welche auf diese Art und Weise ausgebracht wurden und die Jagden überlebt haben, nur eine geringe Chance, in freier Wildbahn zu überleben.17
Aus jagdethischer Sicht ist jede Veräußerung von Wildtieren, die aus Züchtung oder Haltung für „jagdsportliche“ Zwecke stammen sowie die Freilassung solcher Tiere für die Abhaltung von Jagden, in jeder Weise abzulehnen. Eine andere Sache ist dies hinsichtlich der tierschutz- und artgerechten Auswilderung von Wildtieren autochthoner (ansässiger, ursprünglicher) Arten zum Aufbau selbst reproduzierender Wildtierpopulationen wie z.B. Steinwild oder Raufußhühner.
Die überalterten Bezeichnungen „Gatterrevier“ und „Jagdgatter“ wiederum scheinen den Begriff „Jagd“ für sich in Anspruch zu nehmen. Prof. Friedrich Reimoser vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien kommt bei seinen Ausführungen zur Nachhaltigkeitsbeurteilung der Jagd auf „Gatterwild“ zu dem Schluss, dass:
Abschüsse von Wildtieren in Gattern als Gatterabschüsse bezeichnet werden müssen, wodurch Gatter bei der jagdlichen Nachhaltigkeitsbeurteilung automatisch ausscheiden,
keine Veräußerung (Weitergabe, Verkauf) von Wildtieren aus Gattern oder Volieren (Vogelkäfige) zum Zweck des Abschusses stattfinden darf, und
kein Freilassen von Wildtieren aus Gattern oder Volieren zum Abschuss stattfinden darf, und
keine nicht-autochthonen (gebiets- oder faunenfremde) Wildarten in die freie Wildbahn eingebracht werden dürfen.
18
Als umfriedete Eigenjagdgebiete – der Begriff Jagdgatter wird nicht mehr verwendet - sind Areale zu bezeichnen, die von künstlichen Barrieren wie Zäune, Mauern o.ä. umgeben sind und so das Aus- und Einwechseln und damit den genetischen Austausch von Wild mit benachbarten Tieren der gleichen Art ganzjährig verhindern.
Was ist mit nachhaltiger Jagd gemeint?
Jagd ist dann nachhaltig, wenn sie in der Gegenwart so ausgeübt wird, dass sie auch von den zukünftigen Generationen gleichermaßen ausgeübt werden kann.19
Das bedeutet einfach gesagt: So wie ich zu meiner Lebenszeit Jagd erleben kann, sollen auch künftige Generationen daran teilhaben können, mit denselben Voraussetzungen, denselben Möglichkeiten und denselben Chancen.
Für die Nachhaltigkeitsbeurteilung der Jagd sind nach Prof. Reimoser unter anderem besonders zwei Prinzipien hilfreich:
Bejagt werden in der freien Wildbahn selbst reproduzierende Wildtiere.
Durch die nachhaltige Jagdausübung wird die natürliche genetische Vielfalt der Wildarten erhalten und gefördert.
20
Dass dies der Einfachheit halber sehr kurz gefasst ist, liegt auf der Hand. Denn eine vollständige und umfassende Prüfung der Nachhaltigkeit muss ebenso umfassend erfolgen und Kriterien aus Ökologie, Ökonomie sowie soziokulturelle Aspekte gleichermaßen berücksichtigen. Dabei arbeiten, wie Reimoser et al. im Praxisbuch zur Nachhaltigkeitsbeurteilung ausführen, Fachexperten von mit der Jagd mittelbar oder unmittelbar befassten Interessengruppen (Jagdwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Jagdwissenschaft, Wildbiologie und Naturschutz) intensiv zusammen.21
Nachhaltiges Jagen beruht auf drei Säulen: Ökologie, Ökonomie und Soziokultur.
Ökologisch nachhaltig bedeutet, Wildlebensräume zu erhalten und zu verbessern sowie für eine gesunde genetische Artenvielfalt zu sorgen.
Ökonomisch nachhaltig bedeutet, eine jagdwirtschaftliche Rentabilität sicher zu stellen, um einen volkswirtschaftlich relevanten Nutzen im Zusammenhang mit der Jagdausübung zu gewährleisten.
Soziokulturell nachhaltig bedeutet, die Gesamtheit der unterschiedlichen Nutzungsinteressen von durch die Jagdausübung direkt oder indirekt betroffenen Interessengruppen in einen konsensualen Kontext zu bringen unter Berücksichtigung jagdethischer und jagdkultureller Aspekte.
Wird nur eine dieser drei Säulen im Rahmen der Jagdausübung nicht berücksichtigt, so kann die Jagd nicht nachhaltig sein. Insofern kann niemals ein „Zurück zur Natur“ das Ziel einer nachhaltigen Naturnutzung im Rahmen der Jagdausübung sein. Zurück heißt Rückschritt. Vielmehr muss es wohl heißen „Vorwärts zur Natur“.
Zur Nachhaltigkeit habe ich einen sehr treffenden Spruch des indischen Literatur-Nobelpreisträgers Rabindranath Thakur22 (1861-1941) entdeckt, den ich an dieser Stelle abschließend zitieren möchte.
Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.23
Dass die Jäger nicht alles wissen können und wissen müssen, versteht sich von selbst. Wenn der bereits pensionierte Berufsjäger und jagdliche Fachautor Bruno Hespeler mit Ornithologen unterwegs ist, so schildert er, muss er stets erkennen, wie wenig wir Jäger doch über die nicht bejagten Wildarten wissen. Es ist aber auch keineswegs notwendig alles selbst zu wissen, so lange wir unsere Fähigkeiten nicht überschätzen und keine Berührungsängste gegenüber jenen haben, die uns auf diesem oder jenem Teilgebiet überlegen sind.24
Warum also brauchen wir die Jagd heutzutage noch? Ich bin der Meinung, dass wir sie gerade heute mehr denn je benötigen. Die Gründe für diesen Schluss möchte ich im Folgenden darlegen.
Die Jagd, welche diesen Begriff im Sinne des zuvor Genannten verdient, hat im Wesentlichen nach meiner Ansicht drei Aufgaben zu erfüllen: Wildtiermanagement, Schaffung hochwertiger Nahrungsmittel, Vermittlung zwischen Mensch und Natur.
Wildtiermanagement
Die Jagd dient der Wiederherstellung bzw. Wahrung des ökologischen Gleichgewichts in der vom Menschen gestörten Natur.
Der ehemalige deutsche Berufsjäger in der Bayerischen Staatsforstverwaltung und sehr kritische Jagdbuch-Autor Bruno Hespeler findet dazu sehr treffende Worte:
Natur lebt von der Bewegung, vom ständigen Auf und Ab. Natur lässt Pflanzen wachsen und fördert damit Pflanzenfresser. Sie nutzt Feuer, um Freiflächen zu schaffen, und sie streut Samen, um Freiflächen zu verbuschen. Natur lässt Schalenwildbestände anwachsen und ruft damit gleichzeitig Wölfe, um diese anwachsen zu lassen. Geht das Schalenwild zurück, weil es von den Wölfen gefressen wird oder weil seine Nahrung knapp wird oder weil ihm Umweltereignisse zusetzen, bekommen die Wölfe ein existentielles Problem.25
Die Jagd sorgt für einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Menschen und der Wildtiere. Dabei stehen Flinte und Büchse nicht immer im Mittelpunkt der Jagd. Ein Schuss dauert nicht lange, wohl nicht einmal eine Sekunde. Aber nehmen wir der Einfachheit halber einmal an, er erschallt eine Sekunde lang. Wie oft schießt nun ein Berufsjäger, der im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit öfter von seiner Flinte und Büchse Gebrauch machen muss als ein „Freizeitjäger“? Ein befreundeter Berufsjäger erzählte mir, dass er – wenn er wirklich mal viel schießen muss – maximal 180 Schüsse pro Jahr abgibt, wovon natürlich nur etwa 90 Prozent treffen werden, die anderen 10 Prozent gehen wohl ins Leere. Das sind nach Adam Riese 180 Sekunden und ergeben somit 3 Minuten. Korrekt? 3 Minuten in 365 Tagen, das sind 0,00000571 Prozent des gesamten Jahres. Selbst wenn noch die Urlaubs- und Feiertage und die durchschnittlichen Krankenstands-, Pflegetage u.ä. abgezogen werden, so spricht das rein quantitative Verhältnis Bände. In der Folge stellt sich die Frage, was unser Berufsjäger nun qualitativ den Rest des Jahres macht. Das Töten von Wildtieren scheint seinen Job nicht ausreichend zu beschreiben. Die Stellenbeschreibung muss also anders, weitreichender und umfassender lauten. Ah ja, wir sagten, die Jagd müsse für einen Ausgleich sorgen. Warum nun aber muss die Jagd für diesen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Menschen und der Wildtiere sorgen? Kann das nicht die Natur selbst machen? Braucht sie wirklich den Menschen dazu?
Jagd und Wildökologie
Bevor wir die oben gestellten Fragen beantworten können, müssen wir zunächst einige Begriffe erläutern:
Biozönose (Lebensgemeinschaft von Tieren, Pflanzen und Menschen, griechisch:
Der Biotop ist der Lebensraum (die Lebensstätte), in dem eine für ihn charakteristische Kombination von Pflanzen- und Tierarten (Biozönose) vorkommt. Biotop und Biozönose gehören zusammen wie der Schlüssel zum Schloss und bilden gemeinsam eine Einheit: das Ökosystem.26
Es gibt viele Ökosysteme wie z.B. Wasser-, Land- oder Klein-Ökosysteme. Darin stehen alle Lebewesen direkt oder indirekt miteinander in Verbindung, sind wechselseitig von einander abhängig. Greift der Mensch in dieses komplexe Geflecht ein, löst er damit eine bestimmte Reaktion aus, actio est reactio. Das ökologische Gleichgewicht muss deshalb wieder vom Menschen hergestellt werden. Welche Rolle spielt dabei das Humanum? Der Mensch als fixes Bindeglied im Ökosystem kann gar nicht anders als eingreifen, denn sein Wille zu Überleben wie auch seine bloße Existenz als intelligentes Wesen mit einem eigenen Bewusstsein stellen bereits einen Eingriff in die Natur dar. In der Folge ist der verantwortungsvolle, nachhaltige Umgang des Menschen mit der Natur eine notwendige Voraussetzung für ein langfristiges Überleben seiner eigenen Spezies auf dem Planeten Erde.
Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Ziehen wir an einem imaginären Faden, lösen wir - actio est reactio - an anderer Stelle eine bestimmte Reaktion aus (Bild: Jagdprüfungsbehelf, Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag Wien, www.jagd.at).
Denn alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Der deutsche Quantenphysiker und Träger des alternativen- wie des Friedensnobelpreises Hans-Peter Dürr spricht von einer „komplexen Welt“, wo der Mensch Teil des vernetzten Biosystems ist und sein individuelles Handeln Auswirkungen auf die Gesamtsituation hat. Heute sei die Welt – so Dürr – derart komplex, dass viel vom früheren ganzheitlichen Wissen verloren gegangen ist. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Menschen ihre Lernfähigkeit beibehalten und die Welt nicht in Stücken sehen, wie sie es in der Schule gelernt haben.27
Dabei gehe es nach Dürr viel mehr um Weisheit, natürliche Intuition, denn um rationales Wissen allein. Sowohl unser Wirtschaftssystem als auch unsere Landwirtschaft gehen derzeit völlig falsche Wege, da sie die Ganzheitlichkeit der Natur nicht berücksichtigen und nur auf den Mythos vom steten Wachstum setzen.
Nichts in der Natur wächst ständig mit einer kontinuierlichen, jährlichen Steigerung, immer höher, immer schneller, immer stärker, nein. Vereinfacht gesagt, fällt mir jetzt nur ein Tumor ein, der zwar meist wachsen, sich entwickeln wird, dessen Wachstum aber spätestens mit dem Tod des von ihm befallenen Organismus begrenzt ist.
Für den russischen Wissenschafter Prof. Ilya Prigogine, der 1977 den Nobelpreis für Chemie bekommen hat, müssen die Naturwissenschaften neue Wege gehen, indem sie in die Alltagswelt der Gesellschaft integriert und damit durchlässiger werden.
Seeleute und Bauern beispielsweise – so Prigogine - empfinden noch Respekt gegenüber der Welt, in der sie leben. Denn sie wissen um das natürliche Zeitmaß, wo das Wachstum der Lebewesen seinem eigenen Rhythmus folgt und nicht von den wirtschaftlichen Vorgaben des Menschen bestimmt werden kann.28
Die materielle Befriedigung und das rein rationale Verharren auf sachlichen Ebenen erfüllen die tiefe Sehnsucht des Menschen nach seiner natürlichen, spirituellen Existenz nicht. Der Mensch will mehr und braucht mehr. Der ehemalige Abt des Benediktinerstiftes Melk, Burkhard Ellegast, findet sehr treffende Worte dazu. Bei den Waldzell-Meetings29 im Stift Melk konnte er dies stets beobachten.
Ich traf dort Gläubige, Ungläubige, Materialisten und Forscher, die von ihrer Wissenschaft besessen sind. Und bei allen spürte ich immer wieder eine ganz starke Sehnsucht nach Spiritualität.30
Nun zurück zur Jagd. Eine ökosystemgerechte Jagd – und nur eine solche verdient wohl den Begriff Jagd – muss der komplexen Vernetzung Rechnung tragen. Sie verfolgt das Ziel der (Wieder)Herstellung bzw. Bewahrung des vom Menschen durch Auf- und Ausbau seines Kulturraumes gestörten ursprünglichen ökologischen Gleichgewichts.
Die natürlichen Regelmechanismen zwischen Wildtier und Lebensraum werden durch den Menschen so stark gestört, dass wir die entstandenen Probleme ohne ein ausreichendes Wissen über wildökologische Zusammenhänge nicht mehr bewältigen können. Nur wenn diese Kenntnisse vorhanden sind, ist es möglich, eine ökosystemgerechte Jagd mit umweltbewusster Wildhege und Wildstandsregulation durchzuführen. 31
Da die Kulturlandschaft die Naturlandschaft abgelöst hat, kann die Selbstregulation nicht mehr so funktionieren, dass alle Tier- und Pflanzenarten in einer notwendigen Populationsgröße überleben. Der Mensch bringt das natürliche Gleichgewicht durcheinander, indem er durch Wirtschaft, Erholung und Sport in die Natur eingreift. Dadurch werden zahlreiche Tierarten bedroht, während andere überhandnehmen und erhebliche ökonomische und ökologische Schäden verursachen. Ein Gleichgewicht würde sich nur auf Kosten verschiedenster sensibler Arten einstellen. Deshalb ist die Jagd notwendig. Der Jäger schützt jedoch eine viel größere Zahl von Tierarten, als er bejagt. 32
Die Jägerschaft in Österreich hat nach den geltenden Landesjagdgesetzen in erster Linie zwei wesentliche Aufgaben zu erfüllen:
Der Jagdausübungsberechtigte hat das Wild zu hegen und die Entwicklung oder Erhaltung eines artenreichen, gesunden und qualitativ hochstehenden Wildbestandes anzustreben.
Er hat bei Erfüllen dieses Hegeauftrages und bei der Jagd die Interessen der Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen und jede Gefährdung des Waldes und seiner Wirkungen zu vermeiden.
Er hat die Jagd weidgerecht auszuüben und für einen geordneten Jagdbetrieb zu sorgen.33
Die Jägerinnen und Jäger müssen bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages, der Erhaltung und Sicherung eines gesunden und artenreichen Wildbestandes auch im Besonderen die Interessen der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigen. Sie haben demnach das Gleichgewicht zu wahren zwischen dem optimalen Wildbestand und der Tragfähigkeit des Lebensraumes der Wildtiere. Daneben muss auch die dem jeweiligen Ökosystem entsprechende Artenvielfalt gesichert und gefördert werden.
Deshalb ist es besonders wichtig, den Wildbestand – je nach Bestandesgröße - möglichst konstant zu halten, damit er gesund und artenreich bleibt und die Schadensquote ein tolerierbares Niveau nicht überschreitet.
Es gilt also zu prüfen, welche Bestandesdichte ein Biotop ertragen kann. Grundsätzlich werden zwei Formen der Biotop-Tragfähigkeit unterschieden:
1) Die ökologisch-biologische (biotische) Tragfähigkeit
Sie resultiert aus der maximalen Anzahl an Wildtieren einer Art, die überhaupt in einem bestimmten Gebiet aufgrund der dort vorkommenden biologischen Qualität und Ressourcen leben können.
2) Die schadensabhängige (wirtschaftliche) Tragfähigkeit
Diese wiederum hängt von der maximalen Anzahl an Wildtieren ab, die bei verkraftbaren und damit ertragbaren Wildschäden vorkommen können und dürfen.
Die Bezeichnung Wildbestand bezieht sich auf die Summe der Einzeltiere einer Art, die sich zu einer bestimmten Zeit oder auch im Durchschnitt eines Jahres innerhalb bestimmter vom Menschen festgelegter Besitzgrenzen wie jagdliche Reviergrenzen befinden. Hingegen greift der Begriff Wildpopulation weiter. Denn dieser umfasst eine ganze Fortpflanzungs-Gemeinschaft einer Art, die sich an eine bestimmte Umweltsituation angepasst hat (z.B. Rotwild in Augebieten). Zwischen Rotwild im Auenland und Rotwild im Gebirge wird genetisch kein Austausch mehr stattfinden können, da Straßen, Autobahnen und andere Infrastruktur-Maßnahmen die natürlichen Wechsel zerschnitten haben.
Stark vereinfachte Schematisierung einer Bestandespyramide für das Rehwild: Zur jagdlichen Bewirtschaftung und Beurteilung von Bestandesdichten werden zur genauen Evaluierung verschiedenste Diagramme sowie auch sogenannte Bestandespyramiden schematisiert. Bei diesen Bestandespyramiden bilden die Jungtiere die breite Basis während die adulten, also ausgewachsenen Tiere, nach oben hin – je älter sie werden – eine immer kleinere Gruppe bilden. Die Bejagung muss diesem Umstand Rechnung tragen und sowohl in der Jugendklasse als auch bei den Alttieren eingreifen, um die altersmäßige Mittelschicht als gesunde und vitale Population zu sichern, wobei auf ein gleichmäßiges Geschlechter-Verhältnis zu achten ist.
Die Bejagung muss – wie wir wissen - im Sinne einer funktionierenden Bestandespyramide einen gesunden Wildbestand erhalten und sichern. Dazu gehört auch ein homogenes Geschlechterverhältnis. Werden beispielsweise zu wenig ältere Geißen erlegt oder diese gänzlich geschont, kommen junge Geißen kaum zum Zug, da sie von den älteren verdrängt werden. Wie eine dänische Studie zeigte, wurde dadurch ein großer Teil des weiblichen Zuwachses ständig aus dem Gebiet gedrängt, wodurch der Bestand allmählich überalterte. Und obwohl die Fruchtbarkeit nicht abnahm, hatten die Kitze von alten Geißen offensichtlich geringere Überlebenschancen.34
Aufgrund der zielgerichteten Bejagung im Sinne „Wahl vor Zahl“ müssen die Jägerinnen und Jäger auch im Stande sein, die richtigen Stücke selektiv anzusprechen, d.h. das Wildtier auf sein Alter anzuschätzen, sein Geschlecht und seinen möglichen Status im sozialen Gefüge zu bestimmen, um eine möglichst gesunde Bestandesstruktur zu erhalten. Dass dies nicht immer leicht sein wird und manchmal sogar unmöglich, steht ausser Frage.
Die komplexen Zusammenhänge der jagdlichen Kontrolle der Bestandesdichten von Wildpopulationen erinnern mich an einen Vorfall im Frühjahr.
Ich beobachtete wie ein mir bekannter Landwirt einen in seinem Besitz befindlichen kleinen Waldstreifen nahe seines Ackers zurückschnitt. Ich fragte ihn nach dem Grund, wo doch dieser Streifen ein wichtiges Habitat für Niederwild und Vögel der verschiedensten Arten darstellt.
Er antwortete mir, dass dies eine völlig normale Sache sei, da er von Zeit zu Zeit derlei regulierende Schnitte vornehmen müsse. Denn einerseits behindern ihn die in seine Felder hereinhängenden Äste bei der Feldarbeit und andererseits könnten morsche Äste oder ganze Bäume auf die daneben vorbeiführende Straße fallen. Überdies müsse ausgelichtet werden, damit andere Pflanzen mehr Licht bekommen. Mehr Lichteinfall begünstigt die nachkommende (Boden)Vegetation und schafft Lebensraum für viele Kleinlebewesen und Wildarten. Der Waldkreislauf schließt sich. Das beim Baumschnitt anfallende Geäst verwendet er für seine Hackschnitzel-Heizung. Welch ein wunderbarer Kreislauf, dachte ich bei mir. Ich verstand und war zufrieden.
Auf den ersten Blick scheint hierbei die Forstverwaltung des Stiftes Melk ein wenig zu übereifrig gewesen zu sein. Jedoch war auch diese „Baumkur“ notwendig. Einerseits bedrohten abgestorbene Äste und hohle Bäume Verkehrsteilnehmer auf der darunter liegenden Straße und andererseits hinderte der enge Wuchs eine ausreichende Versorgung mit Sonnenlicht. Das war im Frühjahr. Später im Hochsommer war wieder alles begrünt und voll mit jungem Leben.
Dabei wird mit Hilfe von licht absorbierenden Farbstoffen, meistens Chlorophyllen (verantwortlich für die grüne Farbe der Blätter), Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt. Durch die Photosynthese werden aus energiearmen anorganischen Stoffen - hauptsächlich Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasser (H2





























