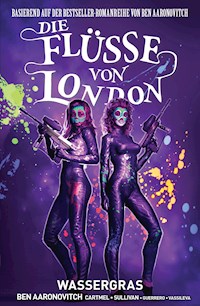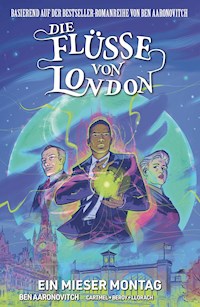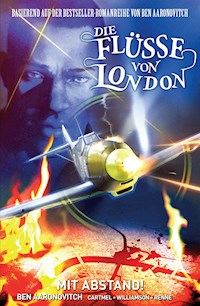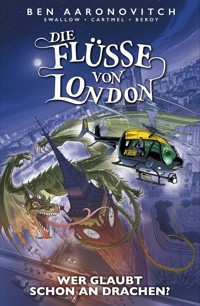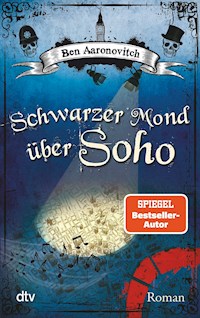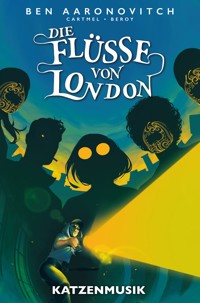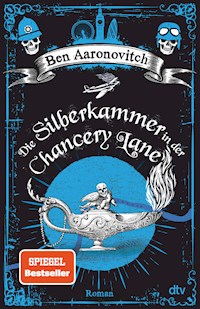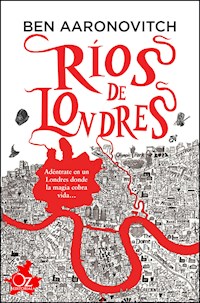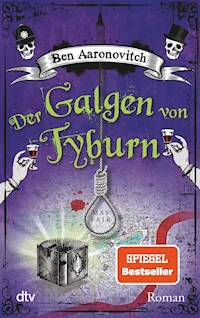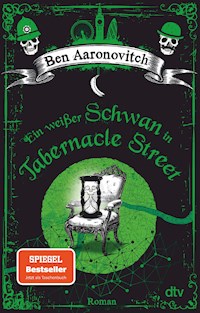
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Keine Panik Peter Grant, unser Londoner Lieblings-Bobby und Zauberlehrling, steht vor völlig neuen privaten Herausforderungen. Welche ihn zu gleichen Teilen mit Panik und Begeisterung erfüllen. Beruflich bekommt er es mit der Serious Cybernetics Corporation zu tun, dem neuesten Projekt des Internet-Genies Terrence Skinner. Und prompt holt die Magie ihn wieder ein. Denn in den Tiefen der SCC ist ein Geheimnis verborgen, eine geheime magische Technologie, die zurückreicht bis weit ins 19. Jahrhundert, das Zeitalter von Ada Lovelace und Charles Babbage. Und die brandgefährlich ist für die Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Peter Grant, unser Lieblings-Bobby und Zauberlehrling, steht vor völlig neuen Herausforderungen. Sein letzter Fall hat ihm ernsthafte Schwierigkeiten mit den hohen Tieren in der Metropolitan Police eingebracht. Und sein Privatleben führt ihn auf bisher gänzlich unbekanntes Terrain ... Da sind gute Nerven gefragt. Umso mehr, als er es auch noch mit der Serious Cybernetics Corporation zu tun bekommt, dem neuesten Londoner Projekt des Silicon-Valley-Stars Terrence Skinner. Peters Abstecher in das unbekannte Universum der technischen Genies und der Künstlichen Intelligenz bleibt nicht folgenlos. Denn in den Tiefen der SCC ist ein Geheimnis verborgen, eine magische Technologie, die zurückreicht bis in das Zeitalter von Ada Lovelace und Charles Babbage. Und die brandgefährlich ist. Wie es aussieht, wird Peter wohl sein gesamtes Geek-Wissen zusammenkratzen und (mit Hilfe von ein paar alten Freunden und ein bisschen Magie) irgendwie die Welt retten müssen.
Ben Aaronovitch
Ein weißer Schwan in Tabernacle Street
Roman
Deutsch von Christine Blum
Dieses Buch ist den unzähligen Großraumbüroinsassen gewidmet, die Tag für Tag in ihren engen Waben unter der Knute gefühlloser Vorgesetzter ohne Dank dafür schuften, dass all die dringend notwendigen Dinge unseres Lebens im Großen und Ganzen so funktionieren, wie sie sollen, oder zumindest nicht im unpassenden Moment spontan explodieren.
Teil einsDer Jacquard
Oft fühle ich mich an gewisse Feen & Kobolde in Büchern erinnert, die soeben noch in jener Gestalt erscheinen & im nächsten Augenblicke vollkommen anders geartet sind; auch die mathematischen Feen & Kobolde sind mitunter außerordentlich trügerisch, lästig & enervierend, ganz wie ihre Gegenstücke in der Welt der Fiktion.
Brief von Ada Lovelace an den Mathematiker Augustus De Morgan, 27. November 1840
1Januar: Manche Schwäne sind weiß
Mein letztes und entscheidendes Vorstellungsgespräch bei der Serious Cybernetics Corporation führte der Sicherheitschef des Unternehmens, Tyrel Johnson, persönlich mit mir. Er war Mitte fünfzig und so ein Schrank von Mann, der dank gesunder Lebensweise und viel Sport nicht fett geworden war, sondern eine kompakte Spannkraft wie Teakholz hatte. Ziemlich hellhäutig, kurzes graues Haar, maßgeschneiderter marineblauer Nadelstreifenanzug mit zitronengelbem Baumwollhemd, keine Krawatte.
Da die Kleidung der restlichen Belegschaft eher in Richtung Gammellook ging, war ein Anzug ein ziemliches Statement. Ich war froh, dass auch ich meinen angezogen hatte.
In Anbetracht der pastellfarbenen Wände, des staksigen Edelstahlmobiliars und des Deko-Schriftzugs in MS Comic Sans Ask me about my poetry quer über eine Wand tippte ich darauf, dass Mr. Johnson sein Büro nicht selbst eingerichtet hatte. Ich saß auf dem niedrigen bananengelben Sofa, er lehnte mit verschränkten Armen an seinem Schreibtisch. Ohne irgendwelche Unterlagen in der Hand, fiel mir auf.
»Peter Grant.« Seine Aussprache war westindisch, vermutlich Trinidad, wobei ich das nie so genau identifizieren kann. »Achtundzwanzig Jahre alt, geboren in London, Schulabschluss nicht schlecht, trotzdem kein Studium. Danach Jobs bei Tesco und kleineren Einzelhändlern sowie bei Spinnaker Office Services – was war das?«
»Eine Büro-Reinigungsfirma.«
»Ah, dann können Sie also mit einem Schrubber umgehen?« Er grinste.
»Leider nur zu gut.« Mannhaft widerstand ich dem Drang, jeden Satz mit einem »Sir« zu beenden. Tyrel Johnson war in dem Jahr aus der Polizei ausgetreten, in dem ich geboren wurde, aber manche Dinge wird man sein Leben lang nicht los.
Irgendwann würde ich mich auch selbst damit auseinandersetzen müssen, dachte ich plötzlich.
»Dann zwei Jahre Polizeiausbildung und Eintritt in die Metropolitan Police. Wo Sie es ganze sechs Jahre ausgehalten haben.« Er nickte, als leuchtete ihm das voll und ganz ein – ich wünschte, mir auch.
»Nach der Probezeit kamen Sie in die Abteilung Spezielle, Organisierte und Wirtschaftskriminalität. Was genau haben Sie dort gemacht?«
Alle waren sich einig gewesen, dass es absolut kontraproduktiv wäre, wenn ich die Einheit Spezielle Analysen alias Folly alias »Oh Gott, bitte nicht die« erwähnen würde. Dass es in der Met eine Spezialeinheit gab, die sich mit abstrusem Scheiß befasste, war in der Polizei vielen bekannt; dass es darin Beamte mit Magieausbildung gab, war nicht unbedingt ein Geheimnis, aber definitiv nichts, worüber man gern sprach. Insbesondere nicht bei einem Bewerbungsgespräch.
»Operation Rummelplatz«, sagte ich.
»Nie gehört.«
»Es ging um nigerianische Fälscherbanden.«
»Haben Sie verdeckt ermittelt?«
»Nein. Zeugenbefragungen, Vernehmungen, Spurenverfolgung. Der Kleinkram, Sie wissen schon.«
»Kommen wir doch mal zur Kernfrage«, sagte Johnson. »Warum sind Sie gegangen?«
Als Expolizist hatte Johnson natürlich noch Kontakte in der Met – garantiert hatte er sich nach mir erkundigt, sobald meine Bewerbung in die engere Auswahl genommen wurde. Andererseits, die Tatsache, dass wir dieses Gespräch überhaupt führten, wies darauf hin, dass er nicht alles wusste.
»Jemand, den ich verhaftet hatte, starb in meinem Gewahrsam«, sagte ich. »Ich wurde suspendiert.«
Er beugte sich ein wenig vor. »Hand aufs Herz, Junge. Waren Sie dafür verantwortlich?«
Ich sah ihm in die Augen. »Ich hätte es kommen sehen müssen. Ich habe nicht schnell genug reagiert, um es zu verhindern.« Es ist so viel leichter zu lügen, wenn man die Wahrheit sagt.
Er nickte. »Einen Sündenbock braucht’s immer. Und Sie wollten nicht einfach die Zähne zusammenbeißen und es durchstehen?«
»Man legte mir nahe zu gehen. Es war klar, dass es einen treffen musste, und die wollten so wenig Aufsehen wie möglich.« Wer »die« waren, sagte ich nicht, aber das schien Johnson nicht zu stören. Er nickte verständnisvoll.
»Wie stehen Sie zu Computern?«, fragte er – was bewies, dass auch der Verhörtrick des plötzlichen Themenwechsels etwas war, was einem nach dem Austritt aus unserer Truppe erhalten blieb.
Unsere Truppe. Als könnte man sich, sobald man erst mal dabei ist, nicht vorstellen, je wieder etwas anderes zu machen.
Sei einfach du selbst, hatte Beverley gesagt, als ich mich heute Morgen fertig gemacht hatte.
»Ich hab mal vierundzwanzig Stunden lang nonstop Red Death Redemption durchgespielt«, sagte ich.
Johnson kniff die Augen zusammen, aber in seinen Mundwinkeln stand ein Hauch Belustigung. Dann schwand sie. »Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Junge. Alles in allem wären Sie eigentlich ein bisschen überqualifiziert für diesen Job. Aber ich habe ein Problem.«
»Sir?« Ich versuchte den Anschein milden Interesses zu wahren.
»In der Belegschaft gibt’s jemanden, der irgendwas im Schilde führt«, sagte er, und ich entspannte mich. »Ich kann regelrecht spüren, wie da jemand durch die Gegend schnüffelt wie eine Ratte. Ich selbst habe nicht die Zeit, mich damit zu befassen, also brauche ich einen Rattenfänger. Jemanden, bei dem ich mir sicher sein kann, dass er die Sache ordentlich erledigt.«
»Ich war eine Weile am Revier Oxford Street. Da hab ich das Rattenfangen gründlich gelernt.«
»Ja«, sagte er langsam. »Sie sind ganz gut geeignet. Wann können Sie anfangen?«
»Sofort.«
»Schön wär’s. Zuerst müssen wir Sie durch die Personalabteilung kriegen. Montag ist völlig ausreichend. Seien Sie pünktlich.«
Er stieß sich von der Schreibtischkante ab, und ich sprang auf die Füße. Er reichte mir die Hand – es war, als würde man einem Baum die Hand schütteln.
»Aber eins muss klar sein«, sagte er, ohne meine Hand loszulassen. »Egal, was irgendwer hier glaubt – der Oberhobbit inklusive –, Sie arbeiten für mich und sonst niemanden. Verstanden?«
»Ja, Sir«, sagte ich.
»Gut.« Und er begleitete mich hinaus.
Johnson hatte betont den Ausdruck »Personalabteilung« verwendet und nicht die offizielle unternehmensinterne Bezeichnung »Magratheanische Agentur zum sinnvollen Einsatz vom Affen abstammender Lebensformen«, genau wie er die Abteilung, zu der ich soeben gestoßen war, »Sicherheitsabteilung« genannt hatte statt »Vogonisches Vollzugskommando«.
Weder das noch die Tatsache, dass die Angestellten offiziell als »Mäuse« bezeichnet wurden, hielt die Magratheanische Agentur zum sinnvollen Einsatz vom Affen abstammender Lebensformen übrigens davon ab, mir sowohl in Papier- wie elektronischer Form einen zwölfseitigen Arbeitsvertrag samt Geheimhaltungsvereinbarung zu schicken, die schlimmer war als das Gesetz zur Wahrung von Staatsgeheimnissen.
Meine Mum warnte mich, dass die Firma bei Reinigungskräften keinen guten Ruf hatte. »Sind zähe Hunde, und es kommt nicht viel rum«, sagte sie mir.
»Es kommt nicht viel rum« bedeutete, die Bezahlung war weit unter Mindestlohn.
Meine Mum wollte außerdem wissen, ob ich mit Beverley einen Geburtsvorbereitungskurs machte und dafür sorgte, dass sie auch ordentlich aß. Ordentlich essen hieß bei Mum, dass Bev täglich möglichst ihr eigenes Gewicht in Reis zu sich nehmen sollte, also log ich und sagte ja. Ich selbst fragte Bev, ob sie eigentlich Heißhungerattacken auf irgendwelches ausgefallene Zeug hätte. Sie meinte, bisher nicht. »Ich kann aber so tun als ob«, sagte sie kurz nach Weihnachten. »Wenn’s dir hilft.«
Beverley Brook wohnte südlich des Wimbledon Common in beiden Hälften eines Doppelhauses in einer Straße, die passenderweise Beverley Avenue hieß. Zwischen den beiden Hälften waren Wanddurchbrüche gemacht und einige Räume umfunktioniert worden, aber wenn man im Hauptbadezimmer herumlief, war an der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit noch immer der Geist der Küche der rechten Haushälfte zu spüren. Seit ich dauerhaft eingezogen war, hatte sich noch einiges mehr verändert, hauptsächlich was die Schaffung von Stauraum anging, in dem Beverley eigentlich ihre Klamotten unterbringen sollte. Noch war das Ergebnis verbesserungswürdig.
Unser Schlafzimmer lag im Erdgeschoss, weil Beverley die Göttin des Beverley Brook war, der hinter dem Grundstück entlangführte, und es ihr wichtig war, so schnell wie möglich bei ihrem Gewässer sein zu können, wann immer es nötig war.
Sie war jetzt im fünften Monat – ein Anlass, aus dem sie sich von einer ihrer Schwestern einen etwas weiteren Neoprenanzug ausborgte, in den das Bäuchlein besser hineinpasste. Außerdem hatte sie mit ihrer Dissertation angefangen, »Positive ökologische Aspekte der Gewässerrenaturierung«, an der sie gewöhnlich auf einem der hochlehnigen Stühle in der Küche schrieb.
An jenem Abend saß ich am anderen Ende des Küchentischs und ging den Arbeitsvertrag durch, dessen Hauptanliegen es zu sein schien, ausführlich die vielfältigen Möglichkeiten zu beschreiben, wie die Serious Cybernetics Corporation mich fristlos und ohne Entschädigung feuern konnte. Es war harte Arbeit, von der ich ständig durch Beverleys schöne Augen abgelenkt wurde, die zwischen dem Laptopbildschirm und ihren Notizen hin- und herhuschten, und ihren schlanken braunen Fingern, die mit einem Textmarker über den Lehrbüchern schwebten.
Sie sah auf. »Was ist denn?«
»Nichts«, sagte ich.
»Okay.«
Ich beobachtete, wie sie sich vorbeugte, um etwas in einem der Bücher nachzusehen, wobei ihre Locken ihr über die Schultern fielen und die glatte Kurve ihres Nackens sichtbar wurde.
»Hör auf, mich anzustarren«, sagte sie, ohne aufzuschauen. »Und mach mit deinem Vertrag weiter.«
Ich seufzte und entschlüsselte mühsam den Absatz, der besagte, dass ich nicht nur ein Jahr lang auf Probe eingestellt war, sondern die Geschäftsleitung sich überdies vorbehielt, diese Probezeit auf unbestimmte Zeit zu verlängern, sofern ich nicht einer Reihe vage definierter Leistungskriterien gerecht wurde. Es klang alles sehr deprimierend und hart an der Grenze des Legalen, aber ich hatte ja keine große Wahl.
Seit über acht Jahren hatte ich keinen anderen Job als den bei »der Truppe« mehr gehabt. Davor hatte ich zuletzt beim Kwiksave in Stockwell Regale aufgefüllt, was mit dem Konkurs des Unternehmens ein Ende gehabt hatte. Das Beste, was ich übers Regaleauffüllen sagen kann, ist, dass es nicht Gebäudereinigen ist.
Ich unterschrieb den Vertrag an den bezeichneten Stellen und steckte ihn in den beigefügten Umschlag.
So wie die Parksituation um den Old-Street-Kreisverkehr herum beschaffen war, würde ich ganz bestimmt nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. Stattdessen nahm ich an der Holland Avenue den 57-er und stieg an der Station South Wimbledon in die Northern Line um, wo ich mich in eine imaginäre Lücke zwischen zwei dicken weißen Männern quetschte. Morgens auf der Northern Line zu pendeln ist in der Regel eine harsche Erfahrung, doch an jenem Morgen herrschte eine ganz merkwürdige Atmosphäre, und ich schwöre, ich spürte das Kribbeln eines Vestigium. Nichts Besorgniserregendes im professionellen Sinn, nur ein Hauch Glitzer und Sternenstaub. Ein paar Achselhöhlen weiter hörte ich eine Frau mittleren Alters sagen: »God-awful small affair«, und dann brach sie in Tränen aus. Während der Zug anfuhr, glaubte ich eine Männerstimme etwas von einem »girl with mousy hair« sagen zu hören, aber der Lärm der U-Bahn übertönte es. Bei Colliers Wood hatte zwar niemand angefangen zu singen, aber aus einer Unterhaltung in meiner Nähe hatte ich aufgeschnappt, dass David Bowie tot war.
Und falls ich immer noch nicht mitbekommen hätte, dass der Mann, der vom Himmel fiel, endgültig den Abgang gemacht hatte, wäre mir spätestens dann etwas aufgefallen, als ich bei der SCC ankam, wo hinter der Glasscheibe des Haupteingangs ein frisch aufgehängtes Plakat prangte und die Praktikantin an alle eintreffenden Mäuse schwarze Armbinden austeilte.
Das Plakat zeigte Bowie in seiner Ziggy-Stardust-Phase mit einem übers Gesicht gemalten roten Blitz, es hing gleich unter dem freundlichen Ratschlag KEINEPANIK, der in Großbuchstaben im Fenster stand.
Nirgends wurde angedeutet, dass das Tragen der Armbinde Pflicht war, doch ich bemerkte, dass keine einzige Maus, nicht einmal solche mit Death-Metal-Sweatshirts, sich weigerte, eine zu nehmen.
Die Lobby der Serious Cybernetics Corporation hatte eine ausweisaktivierte Sicherheitsschleuse. Anders als in den meisten Unternehmen, die ich kannte, waren die Trennwände mannshoch und bestanden aus kugelsicherem Plexiglas; ein Sicherheitsniveau, wie ich es bisher nur in New Scotland Yard und dem Empress State Building erlebt hatte. Jede Maus hatte einen knallbunten Firmenausweis mit einem RFID-Chip, mittels dessen man die Schleuse passieren konnte. Ganze drei Paragraphen meines Arbeitsvertrags widmeten sich detailliert den Strafen, die mich ereilen würden, sollte ich meinen Ausweis je verlieren oder jemand anderem zur Benutzung überlassen. Da ich noch gar keinen besaß, wandte ich mich dem langen himmelblauen Rezeptionstisch zu, wo eine junge, unglaublich dünne weiße Frau mit osteuropäischem Akzent mich anlächelte und mir meinen brandneuen Ausweis samt einem Band zum Umhängen aushändigte.
Sowie ein Handtuch.
Ein flauschiges orangefarbenes Frotteehandtuch.
»Was ist denn das?«, fragte ich.
»Dein Newbie-Handtuch«, sagte sie. »Das wickelst du dir an deinem ersten Tag um den Kopf.«
»Das ist ein Witz, oder?«
»Nein, das zeigt den anderen, dass du neu bist. Und dass sie nett zu dir sein müssen.«
Ich schnupperte vorsichtig an dem Handtuch. Es roch sauber und nach Weichspüler.
»Kann ich es danach behalten?«
»Natürlich.«
Ich schlang mir das Tuch um den Kopf und machte es wie einen Turban fest. »Wie sehe ich aus?«
Die Rezeptionistin nickte. »Sehr hübsch.«
Ich fragte, wie lange ich es anbehalten sollte, und sie sagte, den ganzen ersten Tag.
»Na ja, immerhin wird’s den Peilsender ein bisschen dämpfen«, sagte ich, aber das brachte mir nur einen ratlosen Blick ein.
Hinter der Schleuse befand sich ein kurzer Flur, links waren zwei Aufzüge und rechts die Haupttreppe. Der Flur führte in ein offenes, vier Stockwerke hohes Atrium. Das war, wie Johnson mir gesagt hatte, der »Käfig«, wo die Mäuse Pause machen, sich unterhalten und relaxen konnten. Man konnte die Anführungszeichen um das Wort »relaxen« förmlich in seinem Ton hören.
Aus Sicht von uns Vogonen war es auch der Ort, wo alle Mitarbeiter einschließlich mir während der Arbeitszeit ihre privaten elektronischen Geräte in einem Schließfach deponieren mussten. Die Schließfächer waren vom üblichen Typ, aus Metall mit elektronischen Schlössern, die an die RFID-Chips in unseren Karten gekoppelt waren. Jede Tür war in einer anderen Farbe des Regenbogens gestrichen, und darauf stand eine Nummer in Schwarz oder Weiß, je nachdem, was besser passte. Die Fächer waren nicht fest zugeteilt, sondern man musste das erstbeste nehmen, das gerade frei war. Da das Fach dann mit der Zugangskarte gekoppelt wurde, entriegelte es sich automatisch, wenn man das Gebäude verließ. Es war nicht erlaubt, Dinge länger als über einen Arbeitstag einzuschließen.
Also, wäre ich persönlich für eine Firma voll technophiler Nerds mit sozialen Defiziten verantwortlich gewesen, ich hätte fest zugeteilte Fächer und mechanische Schlösser verwendet. Als ich das Johnson sagte, meinte er, genau das habe er in seiner zweiten Arbeitswoche hier vorgeschlagen, aber die Geschäftsleitung habe abgelehnt.
Zum Gebrauch während der Arbeit konnte sich jeder Mitarbeiter ein Klapphandy ausleihen, ein ganz einfaches Ding, das über das firmeninterne Netz lief. Sie hießen offiziell Babelphones. Gespräche von und nach außen gingen über die Telefonzentrale der Firma und wurden registriert. Die meisten Mäuse gaben sich mit den Dingern erst gar nicht ab, weil sie ohnehin fast die ganze Zeit ins Intranet der Firma eingeloggt waren, wo man sie viel besser erreichen konnte.
Ansonsten war der Käfig in Pastellblau, -orange und -pink gestrichen und ausgestattet mit Sitzgruppen, formlosen Sofas, Sitzsäcken und einer Tischtennisplatte. An den Wänden waren Snackautomaten aufgereiht, und in einer Ecke stand wirklich und wahrhaftig ein menschengroßes Hamsterrad, von dem ein leuchtend blaues Kabel zu einem riesigen Plasmafernseher führte. Abgesehen von ein paar Typen, die offensichtlich bis in die Nacht hinein gearbeitet und dann auf den Sofas genächtigt hatten, zollten die Mäuse den Annehmlichkeiten des Käfigs keine Beachtung, sondern eilten ihren Aufgaben mit derselben grimmigen Entschlossenheit entgegen wie der Strom der morgendlichen Pendler auf der Waterloo Bridge.
Die Serious Cybernetics Corporation betonte gern ihre Nonkonformität, daher herrschte eine große Bandbreite an Kleidungsstilen, wobei sich einige Gruppen identifizieren ließen. Zum Beispiel: schwarze Skinny-Jeans plus Death-Metal-Sweatshirt, mal mit, mal ohne Jeansweste darüber. Oder: Cargohose, knöchelhohe Turnschuhe, Karohemd und Hosenträger, oft kombiniert mit Emo-Frisuren, von denen ich gedacht hätte, sie seien aus der Mode gekommen, als ich sechs war. Vor allem – aber nicht ausschließlich – bei Frauen waren grellbunte Leggings und noch grellere gestreifte Pullis beliebt. Nach meiner ersten Schätzung waren zwei Drittel der Belegschaft männlich und 95 Prozent weiß. Immerhin, ein paar beruhigend dunkle Gesichter fielen mir ins Auge. Ein kleiner dürrer Schwarzer mit Retro-Afro und einem Grateful-Dead-T-Shirt fing meinen Blick auf und nickte mir zu. Ich nickte zurück.
Gut, dass ich ein Handtuch um den Kopf hatte, sonst wäre ich echt aufgefallen.
Die Serious Cybernetics Corporation war über zwei getrennte Gebäude verteilt. Die Lobby, der Käfig und der größte Teil der Verwaltung waren in einem Spekulations-Bürobauprojekt an der Ecke Tabernacle Street/Epworth Street untergebracht, das im Jahre 2009 pleitegegangen war. Als der gefeierte Tech-Unternehmer Terrence Skinner damals überraschend vom Silicon Valley ans Silicon Roundabout wechselte, hatte er es als Schnäppchen erwerben können – okay, ein Schnäppchen nach Oligarchenmaßstäben. Doch da der Platz nicht ausgereicht hatte, hatte er ein fünfstöckiges ehemaliges Lagerhaus aus Backstein etwas weiter die Tabernacle Street hinauf dazugekauft und die beiden Gebäude durch geschlossene Fußgängerbrücken im ersten und vierten Stock verbinden lassen.
Das alles wusste ich, weil ich mir die Zeit genommen hatte, die Originalbaupläne aufzutreiben. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal gern gut vorbereitet.
Wegen dieser räumlichen Aufteilung wuselten jetzt die meisten Mäuse eine breite Stahltreppe zur Galerie im ersten Stock hinauf und strömten von dort aus zu ihren Großraumbüro-Arbeitsplätzen und Konferenzräumen.
Auf dem dritten Stockwerk hatte der Käfig Balkone, von denen aus man eine gute Sicht auf die Mäusehorden hatte, die davonstrebten, um … welchen Tätigkeiten auch immer nachzugehen. Ich hatte keine Ahnung, was sie eigentlich machten. Während ich so dastand, bemerkte ich oben Tyrel Johnson, der lässig am Geländer lehnte und auf uns herabblickte. Als er sah, dass ich ihn bemerkt hatte, winkte er mir.
Ich nahm den Lift.
Als ich zu ihm trat, deutete ich auf das Handtuch um meinen Kopf. Johnson lächelte. »Das muss hier jeder am ersten Tag tragen.« Und er stellte mich meinem Vogonenkollegen Leo Hoyt vor, einem weißen Typen mit nachgedunkeltem blondem Haar und kornblumenblauen Augen in einem überzeugenden dunkelblauen Anzug von Marks & Spencer, der fast – aber nur fast – wie ein Maßanzug wirkte.
Wir schüttelten uns die Hand; sein Griff war fest, sein Lächeln aufrichtig herzlich. Das weckte sofort mein Misstrauen.
»Gibt’s eine Morgenbesprechung?«, fragte ich.
Leo lachte. »Wir sind hier nicht bei der Polizei. Wir haben keine Besprechung, sondern ein Konklave des inneren Zirkels zur Information-Dispersal.«
»Tatsächlich?«
»Oh ja.« Leo grinste.
»Machen wir dann jetzt so eins?«, fragte ich.
»Hier ist irgendwas im Gange«, sagte Johnson.
»Woher wissen Sie das?«
»Weil in den Aufzeichnungen der Sicherheitskameras unerklärliche Aussetzer sind. Immer nur ab und zu ein paar Sekunden. Leo hat sie gefunden.«
Leo machte ein angemessen selbstzufriedenes Gesicht.
»Vielleicht ein Softwarefehler?«, fragte ich ihn.
Er schüttelte den Kopf. »Sieht aus wie absichtlich herbeigeführt.« Er zögerte und gab dann zu: »Ich kann aber kein Muster erkennen.«
»Ich möchte, dass Sie die Mitarbeiterseite übernehmen«, sagte Johnson.
»Befragungen, meinen Sie?«
»Nein. Wandern Sie die ersten Tage überall herum und stecken Sie die Nase in alles, was Sie nichts angeht. Lernen Sie ein paar Mäuse kennen und bekommen Sie ein Gefühl für die Firma. Die sollen sich an Ihren Anblick gewöhnen, dann sind Sie nach vielleicht einer Woche so gut wie unsichtbar.«
Vor allem, wenn ich das Handtuch ablegen durfte.
Ehe ich ging, um mich wieder unter die Mäuse zu mischen, fragte ich Johnson, ob er an seinem ersten Tag auch ein Handtuch getragen hatte.
»Was glauben Sie wohl?«, fragte er.
Ich beschloss, das als rhetorische Frage zu werten.
Mein erstes Ziel waren die Notausgänge. Ich merkte mir ihre Lage und wie man sie erreichte, so dass ich im Notfall wissen würde, wie ich die Leute hier rausbekam. Eine erstaunliche Tatsache, die man als Polizist sehr schnell lernt, ist, dass ein hoher Prozentsatz der Mitbürger ungefähr den Überlebensinstinkt einer Motte in einer Kerzenfabrik besitzt. Sie rennen in die falsche Richtung oder bewegen sich überhaupt nicht von der Stelle, manche laufen geradewegs auf die Gefahr zu, andere zücken sofort ihr Handy und fangen an zu filmen.
Beim Besichtigen der Ausgänge nahm ich mir einen Moment Zeit, um mir die Alarmsysteme daran anzusehen und zu überprüfen, ob sie manipulierbar waren, sei es von innen oder außen.
Ein Bereich, den ich leider nicht überprüfen konnte, waren die Büros auf den beiden obersten Etagen von Beteigeuze, dem nördlich gelegenen ehemaligen Lagerhaus. Soweit ich sehen konnte, gab es zu ihnen nur einen Zugang – den geschlossenen Fußgängerüberweg im vierten Stock, der quer über die Platina Street ging. Im ersten Stock führten zwei solcher Übergänge zu den unteren Büroetagen, aber der obere war anders. Insbesondere war er in unheilvollem Reinweiß gestrichen, hatte getönte Fenster und endete an einer schlichten blauen Tür mit Sicherheitsschloss, an der nicht nur die richtige Zugangskarte, sondern auch das Eintippen eines Codes verlangt wurde.
»Da wird an ’nem Geheimprojekt gearbeitet«, sagte Victor, als wir gemeinsam zu Mittag aßen.
»Echt jetzt, Sherlock?«, entgegnete Everest, den Mund voll Pizza.
Victor und Everest hatte ich auf einem meiner Entdeckungsspaziergänge kennengelernt. Everest war in einem der Multifunktions-Arbeitsbereiche auf mich zugekommen und wollte wissen, ob ich meinen Job bekommen hätte, weil ich schwarz war.
»Natürlich«, sagte ich, nur um zu sehen, wie er reagierte. »Ich brauchte nicht mal ’n Bewerbungsgespräch.«
Er war ein stämmiger weißer Mann mit schweren Hüften, das Gesicht zierten die traditionelle runde Brille und der Ziegenbart, gekrönt von einem Schopf krausen braunen Hobbithaars. Er trug ein lila T-Shirt mit dem OCP-Logo aus RoboCop, ausgeleierte Khaki-Shorts, schwarze Socken und Sandalen. Seine Mitarbeiterkarte war lila und gelb und wies ihn als Harvey Window aus.
»Hab ich’s dir doch gesagt«, sagte er zu seiner Begleiterin, einer kleinen rundlichen weißen Frau mit kleinen blauen Augen und braunem Undercut. Sie ignorierte ihn und streckte mir die Hand hin. »Ich bin Victor, freut mich, dich kennenzulernen.« Den Namen betonte sie auf eine Weise, die andeutete: Das ist ein Hinweis, mal schauen, ob du ihn kapierst. Ich nahm seine Hand und sagte, ich freute mich auch.
»Das ist Everest«, sagte Victor.
Everest hielt mir eine feuchte Hand hin und zog sie sofort zurück, kaum dass ich sie berührt hatte. »Um eins gleich klarzustellen«, sagte er. »Wir sind das Humankapital dieser Firma, und du bist dazu da, für unsere Sicherheit zu sorgen. Nicht zu deinem eigenen Nutzen, sondern zu unserem.«
»Ich lebe, um zu dienen«, sagte ich.
Er schien das wörtlich zu nehmen. »Gut«, sagte er, drehte sich um und marschierte davon.
»Everest?«, fragte ich. »Nicht Gates oder Bill oder Money?«
Victor zuckte mit den Schultern. »Jemand hat ihn mal Update genannt, da mussten wir fast die Polizei rufen.« Er kicherte.
»Ach, wirklich?«
»Wirklich«, sagte er. »Er wollte einen Asset Coordinator beißen. Wenn Tyson ihn nicht gepackt hätte, wär’s wohl zu Blutvergießen gekommen.«
»Tyson?«
»Dein Boss«, sagte sie. »Tyrel.«
»Victor!«, rief Everest ihm quer durch den Raum zu. »Denk daran, wir müssen jetzt in dieses Dingsda.«
»Keine Sorge«, sagte Victor noch, während er sich aufmachte, Everest zu folgen. »Wir sind die Freaks hier, die anderen sind ganz normal.«
Später wartete ich auf einem der Balkone über dem Käfig, bis Victor und Everest in die Mittagspause gingen, wobei es so etwas Altmodisches wie eine richtige Mittagspause bei der Serious Cybernetics Corporation natürlich gar nicht gab. Sobald feststand, wo sie saßen, schlenderte ich nach unten und kam ganz zufällig an ihrem Tisch vorbei.
Im Käfig standen die verrücktesten Snackautomaten, und alles darin war komplett gratis – damit die Mäuse möglichst gar nicht erst auf den Gedanken kamen, sich aus dem Gebäude hinauszubegeben. Die Dinger waren unglaublich unterschiedlich gestaltet, und manche, wie der Art-déco-Doughnut-Automat, waren entweder antik oder zumindest Reproduktionen von antiken Geräten.
Ich entschied mich für langweilig und konventionell: ein Thunfisch-Mais-Baguette aus einem Automaten, den ein Druck von Delacroix’ Die Freiheit ist so damit beschäftigt, das Volk zu führen, dass sie nicht merkt, wie prekär ihr Dekolleté verrutscht ist zierte. Victor hatte eine Sushi-Box aus einem echten japanischen Sushi-Automaten und Everest eine Peperonipizza aus einer Maschine, die angeblich alles frisch aus Einzelzutaten herstellte.
Er starrte mich an, als ich mich setzte, und starrte weiter, während ich Hallo sagte, und dann noch ungefähr eine Minute lang, nachdem ich angefangen hatte, mich mit Victor zu unterhalten, dann wandte er sich seiner Pizza zu, als existierte ich nicht. Gelegentlich nahm er einige sorgsam bemessene Schlucke aus einer Dose Mountain Dew, und er sagte kein Wort, bis ich Victor nach den oberen Etagen von Beteigeuze fragte.
»Das sind die Bambleweeny-Etagen«, sagte Everest. »Kein Zutritt für unbefugte Mäuse.«
»Und was ist dort?«
»Wozu willst du das wissen?«
»Ist leichter, für die Sicherheit von etwas zu sorgen, wenn man weiß, was es ist«, sagte ich.
Everest überdachte dies mit gerunzelter Stirn. »Wenn Tyson dich nicht eingeweiht hat«, sagte er schließlich, »musst du’s auch nicht wissen.« Was von einem charmanten Glauben an hierarchische Weisheit zeugte.
Victor kicherte hinter vorgehaltener Hand.
Ich warf ihm einen fragenden Blick zu, und er schüttelte leicht den Kopf und verdrehte die Augen, während Everest gewissenhaft seine Pizza zu Ende aß.
»Keiner weiß es«, sagte Victor.
Einer der Aspekte, in denen wir Vogonen uns von den gewöhnlichen Mäusen unterschieden, waren unsere klar definierten Arbeitszeiten. Punkt fünf bestand Johnson darauf, dass ich nach Hause ging. »Müde Leute leisten keine gute Arbeit«, sagte er, was bereits einen der Gründe ahnen ließ, warum er unsere Truppe verlassen hatte.
Ich nahm das Handtuch mit nach Hause und zeigte es Beverley.
»Und das hattest du den ganzen Tag auf?«, fragte sie.
»Ehrlich gesagt hab ich nach einer Weile ganz vergessen, dass ich es aufhatte.«
Irgendwann verleibte Beverley es ihrem improvisierten nächtlichen Babybauch-Stützsystem ein, aber erst, nachdem es gewaschen war. Ich sagte, das sei super, weil ich jetzt immer wüsste, wo mein Handtuch sei, aber darauf erntete ich nur mal wieder einen ratlosen Blick.
Am nächsten Tag erschien ich ohne Handtuch, aber weiterhin im Anzug zur Arbeit. Es gelang mir, mich mit diversen Mäusen auf guten Fuß zu stellen, und Victor lud mich zu einer der offenen Rollenspielrunden ein, die in einem der Besprechungsräume neben dem Käfig stattfanden. »Metamorphosis Alpha«, antwortete er auf meine Frage, was gespielt wurde. Was sich als uraltes Spiel aus den siebziger Jahren mit unsäglicher Spielmechanik herausstellte, aber in der Hinsicht bin ich nicht wählerisch. Außer dass es wirklich lustig war, stellte es eine sehr gute Möglichkeit dar, meine Mitmäuse kennenzulernen – um sie umso optimaler schützen zu können, vor äußeren Bedrohungen oder vor sich selbst.
Leo Hoyt sah uns vom Käfig aus spielen, kam herüber, um mich finster anzusehen, und zog kopfschüttelnd wieder ab.
»Der steht sicher eher auf World of Darkness«, sagte Victor.
Everest gab ein unflätiges Geräusch von sich.
Gerüchteweise nahm gelegentlich sogar Terrence Skinner höchstselbst an solchen spontanen Rollenspielrunden teil, allerdings noch nie an einer, bei der Victor und Everest dabei gewesen waren, sagten sie. Für viele Mäuse war Skinner nicht ein Objekt der Bewunderung, sondern eins der quasireligiösen Verehrung. Er war der unspektakuläre Tech-Milliardär, dessen Firma InCon kaum jemandem bekannt war, der sein Vermögen hinter den Kulissen gemacht hatte und es nicht für Marsmissionen, Kanalisationsbau oder gentechnisch veränderten Reis hinauswarf.
Ich wurde dem Großen Meister nicht explizit vorgestellt – so lief das bei der SCC nicht. Terrence Skinner vertrat das Prinzip des von ihm so bezeichneten »Management im Vorbeigehen«, was darin bestand, dass er, eine Wolke persönlicher Assistenten und nervöser Projektleiter hinter sich herziehend, durch die verschiedenen Großraumlandschaften schlenderte.
Mich versuchte er an meinem dritten Tag unverhofft zu erwischen, als ich mich gerade zum Hotdesking an einem Arbeitsplatz im Haggunenons-Raum niedergelassen hatte. Man hörte ihn schon aus zwanzig Metern Entfernung kommen, aber Johnson hatte mich vorbereitet, also tat ich angemessen überrascht, als er sich hinter meiner Schulter materialisierte.
»Na, was machen Sie denn gerade?«, fragte er.
»Ich prüfe das gestrige Mitarbeiterankunftsprotokoll auf Anomalien.«
Terrence Skinner war hochgewachsen und langgliedrig, hatte weit auseinanderstehende blaue Augen, schütter werdendes blondes Haar und schmale Lippen. Er trug einen teuren schwarzen Leinenblazer über einem ausgewaschenen Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-T-Shirt, das ein Smiley mit heraushängender Zunge und der Hand über den Augen zeigte. Daneben stand in großen, freundlichen Buchstaben: Keine Panik.
»Was denn für Anomalien?« Sein australischer Akzent war so stark, dass er fast schon komisch klang. Alles nur Getue, wie ich wusste – in einem TED-Talk-Vortrag von vor fünf Jahren, den ich mir angeschaut hatte, war der Akzent unter einer Schicht Westküsten-Tech-Sprech kaum noch wahrnehmbar gewesen.
Tatsächlich war ich dabei, zu prüfen, ob es bei den Unterbrechungen in den Aufzeichnungen der Überwachungskameras zeitliche Übereinstimmungen mit dem Einloggen bestimmter Personen am Eingang gab, aber das wollte ich Skinners Entourage nicht wissen lassen – rein vorsichtshalber. »Alle möglichen Unregelmäßigkeiten. Zum Beispiel doppelte Einträge, identische Mitarbeiterkarten und so.«
»Glauben Sie, da will sich jemand einschmuggeln?«
»Möglich ist es, Sir. Kein System ist komplett narrensicher.«
»Vor allem hier nicht, wo es ja so viele erfinderische Narren gibt, was?«, sagte Skinner – übrigens ohne mir anzubieten, ihn Terry oder wenigstens Mr. Skinner zu nennen, wie ich bemerkte.
Ich setzte ein überzeugendes kleines Schmunzeln auf. Es schadet nie, sich den Boss gewogen zu machen. »Ja, Sir.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Algorithmen haben, die nach so was suchen«, sagte er.
»Man weiß nie«, gab ich zurück.
Eine große, athletische Frau in einem strapazierfähigen Anzug, eine aus dem Team von Bodyguards, das Skinner in Schichten rund um die Uhr bewachte, musterte mich kurz, ehe sie sich wieder darauf konzentrierte, die Bürozellen nach tödlichen Bedrohungen abzusuchen.
Nehmen Sie sich doch mal die Snackautomaten vor, gute Frau, dachte ich. Die sind ein massives Diabetes-II-Risiko, vorzeitiges Ableben fast garantiert.
Skinner wandte sich ihr zu und sagte: »Ich fühle mich schon viel sicherer.« Er schenkte mir noch ein leutseliges Nicken und defilierte weiter.
Als ich Johnson die Ergebnisse meiner Anomaliensuche aushändigte, erkundigte ich mich nach den Bodyguards.
»In Kalifornien hat mal jemand versucht, ihn umzubringen«, erklärte Johnson. »Daraufhin hat er einen speziellen Sicherheitsdienst engagiert.«
»Wer wollte ihn umbringen?«
»Eigentlich war es nur versuchter Autoraub, aber er bekam Paranoia und wollte zusätzlichen Schutz. In Kalifornien ist das sowieso groß in Mode. Hab ich gehört.« Er spähte auf den Ausdruck, den ich ihm gemacht hatte. »Was Spannendes dabei?«
Ich sagte, soweit ich erkennen könne, versuche niemand sich einzuschleichen.
Johnson gab ein unbestimmtes »Hm« von sich.
»Und die waren sich sicher, dass es nur Autoraub war?«, vergewisserte ich mich.
Er warf mir einen scharfen Blick zu. »Wer?«
»Die amerikanische Polizei.«
»Was interessiert Sie das?«
»Wenn es nun doch kein Autoraub war, sondern ein echter Mordversuch?«
»Ach, Sie denken, Google will ihm ans Leder?«
»Ihm ist es jedenfalls ernst damit. Sonst hätte er doch die Bodyguards nicht eingestellt.«
»Er hat auch eine persönliche Masseurin, wissen Sie.«
»Aber es könnte sich um ein Sicherheitsrisiko handeln«, sagte ich.
»Sie sind wirklich gerade erst von der Truppe weg, das ist nicht zu übersehen.«
»Könnte aber doch sein, oder?«
Johnson seufzte. »Mr. Skinners persönliche Sicherheit ist nicht unsere Sache. Wir sind für das Gelände und die Mäuse zuständig. Und da schleicht jemand rum. Das spüre ich.«
»Bauchgefühl?«
Er winkte in Richtung Tür. »Gehen Sie mit den Mäusen spielen, Peter. Stöbern Sie die Ratte auf.«
Und nur, um zu beweisen, dass es im privaten Sektor auch nicht anders lief als bei der Polizei, fand ich die Ratte schon am nächsten Tag – vollkommen zufällig.
Ich hatte mir angewöhnt, in unregelmäßigen Abständen auf der Fußgängerbrücke im vierten Stock vorbeizuschauen. Hätte Johnson mich gefragt, warum, ich hätte geantwortet, dass das Verbotene daran die meisten Ratten sicher magisch anziehen würde. Aber ich hoffte sehr, dass er nicht fragen würde, weil das eine extrem schlechte Ausrede war und ich schlicht und einfach für mein Leben gern gewusst hätte, was da oben für ein Geheimnis schlummern mochte.
An diesem Nachmittag war eine Reihe von Teambesprechungen und Konferenzen auf höchster Führungsebene geplant, die uhrzeitmäßig auf den frühen Morgen in Kalifornien abgestimmt waren. Die somit weitgehend unbeaufsichtigten Mäuse ergriffen fleißig die Gelegenheit, sich vorzeitig in den Feierabend zu verdrücken. Wenn ich eine Ratte wäre, dachte ich, wäre genau jetzt der Moment, an dem ich an unerlaubten Orten herumschnüffeln würde. Also machte ich mich auf den Weg in den vierten Stock, um zu sehen, ob sich jemand schnüffelnderweise in der Nähe des Überwegs aufhielt.
Ich erwartete nicht, dass jemand versuchen würde, am helllichten Tag die Sicherheitstür zu knacken, daher war ich leicht überrascht, als ich um die Ecke bog und feststellte, dass genau das der Fall war.
Es war ein magerer Typ Mitte zwanzig mit schwarzem Haar, langen Beinen in hautengen schwarzen Jeans und makellos weißen Knöchelturnschuhen. Das weiße T-Shirt spannte sich über seinen Schultern, wie er da so an der Tür lehnte, die Hand auf die Stelle gepresst, wo das Schloss sitzen musste.
Ich überlegte, ob ich ihn erst mal einbrechen lassen sollte, aber er musste mich gehört haben oder so, denn er fuhr herum und starrte mich an. Und da erkannte ich ihn.
»Ach, hallo, Jacob«, sagte ich. »Was haben Sie denn jetzt wieder vor?«
2Dezember: Relative Verschiebungen der Wahrscheinlichkeit
Am westlichen Rand von Hampstead Heath, oben auf der Anhöhe, wo die Häuser einen Banker-Bonus kosten, stehen in einer Senke ein paar Häuserzeilen. Dort lag früher ein Fiebersumpf, der allerdings irgendwann trockengelegt wurde, weil das Wasser für einen Teich gebraucht wurde. In der Regency-Ära gab irgendein Schlaumeier der Senke den Namen Vale of Health, sei es in einem zynischen Versuch, dort Häuser zu verkaufen, oder als ironischen Witz – das weiß niemand so recht. Egal, der Name hält sich jedenfalls bis heute, und der Ort besteht aus einem kleinen Ensemble recht geschmackvoller, bereits von Heideland umgebener Reihenhäuser aus der Regency- und viktorianischen Zeit. Er hat das, was man »Dorfatmosphäre« nennt, insofern, als die Häuser teuer und daher voller Zugezogener sind und man bis zur nächsten Bushaltestelle einen sehr langen, steilen Hügel hinauflaufen muss. Den östlichen Abschluss dieser Siedlung bildet ein rechteckiges, teils asphaltiertes, teils geschottertes Grundstück, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld, auf dem Schausteller ihr Winterquartier aufschlagen. Sie waren der Grund, warum ich an einem kalten, nebligen Montagmorgen einen Monat zuvor von meiner schönen warmen Beverley weg über den Fluss gerufen worden war.
Wie so viele andere Leute hart am Rande der zivilisierten, Mail-on-Sunday-lesenden Gesellschaft sind die Schausteller noch stark den alten Sitten und Traditionen verbunden. Sie leben am Übergang zur Demi-monde, welche das Magische, das Quasimagische und den einen oder anderen Mitbürger umfasst, der mal in den falschen Pub geraten ist und die Atmosphäre da gut fand.
Würden die Schausteller des Vale of Health nicht, wie es sich gehörte, alljährlich zu Mittsommer die Göttin des Flusses Fleet gewogen stimmen, wäre es gut möglich, dass die ganze Siedlung binnen kurzem wieder zum Fiebersumpf verkäme. Behauptete zumindest Beverleys Schwester Fleet, als wir das letzte Mal zum Abendessen bei ihr waren. Als Göttin des Flusses Fleet musste sie es ja wissen.
Beverley fragte natürlich, was in diesem Gewogenstimmen denn so enthalten war – sie hatte im vorigen Jahr von der Gesellschaft zur Erhaltung von New Malden einen Kia bekommen und interessierte sich sehr dafür, ob es einer ihrer Schwestern gelang, das zu toppen.
»Nur das Übliche«, sagte Fleet. »Alkohol in Strömen.«
Während der letzten dreißig Jahre hatte die Anzahl der Schausteller in diesem Winterquartier stetig abgenommen, aber es waren noch immer genug, um den Platz gut zu füllen, so dass ich gezwungen war, draußen vor dem Tor zu parken. Was mit dem nicht geringen Risiko einherging, dass ein umtriebiger wachsamer Nachbar mich sah und anzeigte – wir waren hier schließlich in Hampstead. Aber der Nebel war auf meiner Seite.
Am Tor wartete bereits Henry »Schlawiner« Collins auf mich.
Die Wohnwagen hinter ihm waren unförmige graue Schatten; nur gelegentlich zeigte ein warm leuchtendes Rechteck ein Fenster an. Der Nebel dämpfte alle Geräusche. Wir hätten auch auf einem Feld weit draußen jenseits der M25 stehen können.
Schlawiner war ein derber alter Knabe zwischen sechzig und siebzig, angetan mit Schiebermütze und dickem Kamelhaarmantel. Er grinste mich an, kam auf mich zu und streckte mir die Hand hin. Sie war rau und schwielig.
»Das Fräulein vom Notruf meinte, es könnte ’ne Woche dauern«, sagte er.
»Für Sie kriechen wir doch jederzeit aus dem Bett, Schlawiner«, sagte ich. »Sogar montags in aller Herrgottsfrühe.«
»Kommen Sie mit.« Er führte mich zwischen den grauen Umrissen hindurch zu einem großen grün-rot-goldenen Wagen, der auf Stützen aufgebockt war. Ich war schon auf genug Jahrmärkten gewesen, um eine Attraktion im reisefertig zusammengepackten Zustand zu erkennen. Da man jede Gelegenheit für kostenlose Werbung beim Schopf packen musste, stand auf der Seite in großen Zirkusbuchstaben BERNOULLI’S BOMBASTISCHEORGEL. In einem verschnörkelten Medaillon darunter waren mehrere goldene, rote und blaue Orgelpfeifen abgebildet.
»Eine Jahrmarktsorgel«, sagte ich.
»Aber keine gewöhnliche«, sagte Schlawiner. »Das ist eine echte Gavioli. Ursprünglich für Prinz Albert gebaut, heißt es zumindest.«
Sie wog bestimmt fünf Tonnen. »Gestohlen wurde sie offenkundig nicht«, sagte ich.
»Dürfte ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf das Schloss da lenken.« Schlawiner zeigte auf ein Schlüsselloch im unteren Drittel der Holzwand. Ich erkannte, dass die Verkleidung waagerecht unterteilt war; das untere Drittel konnte nach unten, der Rest nach oben weggeklappt werden. Wie bei so vielen alten Jahrmarktsattraktionen war auch hier die Verpackung Teil der Gesamtstruktur.
Ich musterte das Schlüsselloch und fragte, was daran auffällig sei.
»Es wurde geknackt, ja?«, sagte Schlawiner.
Ich zog meine Stiftlampe heraus und sah es mir genauer an. Das Schlüsselloch wurde von der Messingverkleidung des Schließzylinders blockiert. Mit Gewalt nach links verschoben, vermutete ich, was auch den Riegel aus seiner Verankerung gezogen hatte. Ich kannte diese Aufbruchtechnik. Das bekam man nicht mit Dietrichen oder einem Bohrer hin.
Ich nahm den rechten Handschuh ab und legte die Fingerspitzen an das Schloss. Es war kalt, aber gerade noch erträglich. Ich atmete langsam aus und machte meinen Geist möglichst frei.
Vestigia sind die Spuren, die das Übernatürliche hinterlässt. Es gibt sie häufiger, als man vielleicht denkt, aber man muss gelernt haben, sie zu erkennen. Dann ist es nur noch Übungssache.
Ich spürte einen kurzen, scharfen Schmerz wie einen elektrischen Schlag und ein Prickeln wie von Brausepulver. Dieses Schloss war definitiv magisch aufgebrochen worden, aber mit keinem Zauber, den ich kannte.
»Was ist hinter der Klappe?«
»Ich dachte schon, Sie würden nie fragen«, sagte Schlawiner.
Er löste je einen massiven Riegel vorn und hinten am Wagen, dann musste ich ihm helfen, die schwere, mehrere Zentimeter dicke Verkleidung herunterzuklappen. Auf diese Weise wurde sie zu einer dekorativen Platte, die die Wagenunterseite samt den aufgebockten Achsen verdeckte. Bemalt war sie im traditionellen pompösen Jahrmarktsstil mit viel Gold und knalligem Blau, Grün und Rot. Man sah jetzt den unteren Teil der Orgel, die Basen der Pfeifen wie schweigend aufgerissene Mäuler. In einer waagerechten Reihe von Nischen saßen kleine Trommeln und in der Mitte unter den Pfeifen etwas, was aussah wie ein mechanisches Glockenspiel.
»Wurde noch mehr beschädigt?«, fragte ich.
Etwa fünfzehn Zentimeter über Bodenhöhe des Wagens befand sich eine Reihe von Schlüssellöchern in immer gleichem Abstand. Als ich sie mir näher ansah, erkannte ich, dass sie zu flachen Schubladen gehörten wie in einem riesigen Schreibtisch, deren Umrisse und Griffe geschickt in den goldenen Ornamenten versteckt waren. Nacheinander berührte ich sie – bei jeder durchfuhr mich der gleiche winzige Schlag wie beim Hauptschloss.
Schlawiner beugte sich vor und zog vorsichtig die linke Schublade auf. Sie war in Fächer unterteilt; in jedem lag ein Stapel schwerer Karten von etwa zwanzig mal zwanzig Zentimetern, zusammengehalten von beigem Stoffband, das oben zu einer großen Schleife gebunden war wie bei einem Comic-Weihnachtsgeschenk. Schlawiner zeigte auf ein leeres Fach ganz hinten in der Schublade. »Das wurde geklaut.«
»Und was war ›das‹?«
Er nahm einen der Stapel aus einem Fach und zog die Schleife auf. Auf der obersten Karte standen mit Filzstift die Worte BOHEMIANRHAPSODY. Schlawiner hob sie an, um zu zeigen, dass sie mit der darunterliegenden Karte verbunden war und diese wieder mit der nächsten, so dass der ganze Stapel sich auffalten ließ wie eine Ziehharmonika. In jeder Karte waren unterschiedlich angeordnete Löcher und Schlitze. Das Material wirkte schwer, gediegen und alt.
»Sieht aus wie Lochkarten, was?«, sagte er.
»Was sind Lochkarten?«, fragte ich.
Also, das Ganze fing mit einem französischen Weber namens Joseph Marie Jacquard an, der eine Methode erfand, um mittels großer Karten mit Löchern darin das Webmuster auf einem Webstuhl automatisch zu ändern. Die Karten wurden so miteinander verbunden, dass eine Sequenz entstand, und voilà, konnte jeder sich im Handumdrehen ein schickes Hemd weben lassen. C’est très bon.
Wir hatten uns auf einen Tee und etwas geschichtliche Unterweisung in Schlawiners warmen Wohnwagen zurückgezogen.
»So ein Webstuhl ist ein kompliziertes Ding«, sagte er. »Wenn man also einen Webstuhl mechanisch steuern konnte, warum nicht auch ein Klavier oder eine Orgel?«
Der Wohnwagen war ein fast neuer Sprite Quattro, dessen vorderer Teil zum Büro umgebaut worden war: Man hatte einfach ein Sofa herausgenommen und ein Regal aus Stapelboxen eingebaut, das die Fenster links verdeckte. Als Gast bekam ich das verbliebene Sofa, Schlawiner selbst lehnte sich an die Spüle. Der Nebel war noch immer so dicht, dass ich mich vor meinem Spiegelbild im Frontfenster hätte rasieren können.
Da Unterhaltungsunternehmer schon immer davon geträumt hatten, ohne diese teure und kapriziöse Spezies namens Künstler auszukommen, dauerte es nicht lange, bis ein gewitzter Orgelbauer die Technik auf die Musik anzuwenden begann. Im Jahr 1892 ließ sich Anselme Gavioli, Spross der berühmten Gavioli-Familie, das System patentieren. Zu diesem Zeitpunkt existierten aber schon einige Instrumente, die den Mechanismus anwandten – Bernoulli’s Bombastische Orgel war eines davon. Der Kartenstapel wurde als Notenbuch bezeichnet. Die Karten klappten sich nacheinander auf und wurden über eine Abspielvorrichtung gezogen, wo die Löcher und Schlitze ausgelesen und entsprechende Antriebsventile für die einzelnen Pfeifen, Trommeln und Glocken geöffnet wurden.
Die mechanische Jukebox der Dampfmaschinenära.
»Und eine Lochkarte?«, fragte ich.
Schlawiner wedelte vorwurfsvoll mit einem Butterkeks vor meiner Nase herum. »Nicht zu glauben, dass Sie nicht wissen, was eine Lochkarte ist. Ich dachte, das gehört zur Geek-Kultur.«
»Hängt wohl vom jeweiligen Geek ab«, gab ich zurück.
»In meinem früheren Leben«, sagte er, »als ich noch studierte, hab ich damit Computer programmiert.«
Denn so machte man das damals, als ein Computer einen ganzen Raum füllte und die Mondlandefähre mit einer Hardware lief, die weniger drauf hatte als der Heizungsregler meiner Mum. Schlawiner schrieb seine Programme von Hand und konvertierte sie dann mittels einer Maschine in unzählige Löcher auf Dutzenden von Karten, die sodann durch ein optisches Lesegerät liefen. Und siehe, das Programm wurde ausgeführt, und man bekam die gewünschten Ergebnisse – oft schon beim zehnten oder elften Versuch.
»Wenn man sehr exakt arbeitete«, sagte Schlawiner.
Ich fand, wir schweiften ein wenig ab, und fragte, was das eigentlich mit dem Diebstahl zu tun hatte.
»Ich konnt’s nur nicht glauben, dass Sie das nicht wissen«, sagte er. »Aber es hat schon ein bisschen damit zu tun. Das Notenbuch, das gestohlen wurde, hieß Die Zahlenzauberin.«
Nun regte sich doch etwas in meinem Gedächtnis. »Ada Lovelace?«
»Na, dann ist bei Ihnen ja noch nicht Hopfen und Malz verloren.«
Ada Lovelace, die Tochter von Lord Byron, Mathematikerin und, wie man sagte, die erste Computerprogrammiererin der Welt.
»Ein Lied über sie?«, fragte ich. »Von wem?«
»Wir wissen nicht, ob es ein Lied ist oder nicht«, sagte Schlawiner, »ganz zu schweigen davon, wer es geschrieben hat. Wenn Sie mich fragen, war es Charles Babbage.«
Der seinerseits berühmt dafür war, den ersten Computer entworfen, wenn auch nie gebaut zu haben. Eine gigantische Konstruktion aus Zahnrädern, Walzen und Ketten, mit der das Informationszeitalter hundert Jahre früher angefangen hätte – vorausgesetzt, man hätte sie zum Laufen gebracht.
»Wieso wissen Sie nicht, ob es ein Lied ist?«, fragte ich. »Haben Sie es nie eingelegt?«
»Ging nicht. Es hat zu viele Tonstufen.«
Denn jede mechanische Orgel hatte eine festgelegte Anzahl von Tonstufen. »Die alte Benny da draußen hat 84«, sagte Schlawiner. »Andere haben 101 oder 112 oder sogar mehr. Und dann gibt’s noch die Systeme ohne Tonstufen, aber das führt jetzt zu weit. Entscheidend ist, dass man ein Notenbuch mit 84 Tonstufen nicht auf einer 112-Tonstufen-Orgel abspielen kann und umgekehrt.«
»Und wie viele Tonstufen hat das gestohlene Notenbuch?«
»137. Was Sie sicher sofort als Primzahl erkannt haben.«
Hatte ich nicht, aber mir war klar, dass meine Glaubwürdigkeit als Geek für heute schon genug strapaziert worden war. »Und wo gibt’s so eine 137-Tonstufen-Orgel?«, fragte ich.
»Nirgendwo. Das ist das große Rätsel.«
Einbruchdiebstahl ist juristisch definiert als Eindringen in fremdes Eigentum und Entwenden von Gütern aus demselben. Die Aufklärung eines solchen Vergehens ist ein mühsames Geschäft. Bei Gewaltverbrechen ist oft schlechte Impulskontrolle im Spiel und dass man es dem anderen mal so richtig gezeigt hat, weil der’s nicht anders wollte, und sehr oft geschieht es im Sichtbereich von Überwachungskameras oder vor Zeugen. Einbruch dagegen ist im Allgemeinen ein Verbrechen, das vorausgeplant und mit größtmöglicher Heimlichkeit ausgeführt wird, und noch ungünstiger: es wird von Fremden begangen. Bei Mord sind die Täter meist Freunde, Lebenspartner oder Ehegatten. Einbrüche werden von Leuten verübt, die ihre Opfer auch auf dem besten Polizeifoto nicht erkennen würden.
Die beste Maßnahme, die die Met je entwickelt hatte, um gestohlene Güter wiederzubekommen, war, einen Hehlerring vorzutäuschen und jeden zu verhaften, der so blöd war, seine unrechtmäßig erworbenen Wertsachen dort verticken zu wollen. Irgendwie glaubte ich aber nicht, dass das in diesem Fall funktionieren würde.
Fest stand jedoch: Der Einbruch war präzise und gezielt erfolgt. Und wahrscheinlich stand ein Auftraggeber dahinter.
Ich beorderte auf eigene Rechnung einen Kriminaltechniker her, um den Tatort auf Fingerabdrücke zu prüfen. Nicht dass ich erwartete, dass mein Täter verwertbare Spuren hinterlassen hatte. Meine Ahnung bestätigte sich.
»Trug Handschuhe«, sagte der Spurensicherer. »Den Abdrücken nach zu schließen wahrscheinlich aus Ziegenleder.«
Doch auch diese Abdrücke waren aufschlussreich. Nach ihrer Häufung zu schließen knackte der (oder die) EinbrecherIn der Reihe nach jede Schublade, bis er/sie das Gesuchte fand. Es gab keine Anzeichen, dass etwas anderes berührt worden wäre – insbesondere nicht die anderen Notenbücher.
Offensichtlich hatte der Täter also den Namen des gesuchten Notenbuchs gekannt und gewusst, wo ungefähr dieses lagerte. Nur nicht die genaue Schublade.
Sobald der Spurensicherer sich getrollt hatte, fragte ich Schlawiner, ob sich in letzter Zeit jemand nach der Zahlenzauberin oder generell nach den Notenbüchern erkundigt hätte.
»Da war jemand, der die Orgel kaufen wollte, mit allem Drum und Dran, auch den Notenbüchern. Wollte sie angeblich in einem Freizeitpark in Amerika aufstellen.«
»Wann war das?«
Wir saßen wieder in Schlawiners Wagen, diesmal bei Kaffee und Zeugenaussage. Ich hatte mein Notizbuch gezückt, das Schlawiner mit dem tief verwurzelten Misstrauen des fahrenden Mannes beäugte.
»Letzten Monat.« Auf Nachfrage konnte er mir sogar das genaue Datum samt Uhrzeit nennen.
»Hat er gesagt, wie der Freizeitpark hieß?«
»Ach, er redete ziemlich schnell, und ich hab nur halb hingehört. Er hatte was Glattes, Verschlagenes an sich, also sagte ich, als er den Preis wissen wollte, zwei Millionen in bar. Im Voraus. Pfund Sterling, nicht Dollar.«
»Was ist sie denn in Wirklichkeit wert?« Keine zwei Millionen, da war ich mir sicher.
»Im Prinzip ist sie von unschätzbarem Wert«, sagte Schlawiner. »Aber ich fürchte, mehr als fünfzigtausend würde ich nicht für sie kriegen. Nicht heutzutage. Trotzdem hat er tatsächlich darüber nachgedacht. Er hat mich runterhandeln wollen, aber ich fand ihn einfach zu unsympathisch.«
»Warum?«
»Irgendwas war zwielichtig an dem, ich könnt nicht den Finger drauflegen.«
»Vielleicht übernatürlich?«
»Vielleicht.«
Was ich als »Fae?« in mein Notizbuch eintrug. »Hat er gesagt, in wessen Auftrag er da war?«
»Sekunde.« Schlawiner zog eine braune Lederbörse hervor, die so voll war, dass sie kaum zuging. Er leerte einige Fächer und ging die Stapel durch: Visiten- und Kreditkarten, Werbekärtchen, Krankenversicherungs- und Verbundfahrkarte. Und ein Gutschein für ein Sonderangebot von Audible, der vor einem Jahr abgelaufen war.
»Mist«, sagte er. »Den wollte ich noch einlösen.«
Nach einigem Sortieren fand er die gesuchte Visitenkarte, schlichte schwarze Buchstaben auf festem weißem Karton. Mitchel West, Ankäufe, Guffland Entertainment stand da, gefolgt von Telefonnummer, Website, Mail- und Twitteradresse. Ich notierte mir die Daten und ließ die Karte in einen Beweisumschlag aus Papier fallen – kann ja sein, dass man mal Glück hat.
Von Schlawiner bekam ich eine Personenbeschreibung, die auf mittelgroß, weiß, eher jung, braunes, vielleicht hellbraunes Haar hinauslief. Gekleidet in einen lässigen dunkelblauen Blazer und darüber einen langen Khakimantel, vielleicht von Burberry, aber selbst wenn nicht, hatte er auf Schlawiner nobel gewirkt.
»Nur irgendwie unecht nobel«, fügte er hinzu. »Er meinte, wo ich so viel dafür haben wollte, sollte ich ihm die Ware wenigstens zeigen. Hab ich gemacht. Einschließlich der Musikschubladen.«
Hatte sich Mitchel West besonders für die Notenbücher interessiert?
»Könnte ich so nicht sagen. Aber ich hab auch nicht sonderlich darauf geachtet.«
Aufgefallen war ihm hingegen der silberne Audi A6, in dem Mitchel West gekommen war. »Der roch noch ganz neu. Habe ich gemerkt, als er die Tür aufmachte.«
Auffällig genug, um sich das Kennzeichen zu merken, hatte er den Wagen aber doch nicht gefunden. Niemand merkt sich jemals das Kennzeichen.
Ich ging das Straftaten-Meldeformular zu Ende durch, teilte Schlawiner eine Kennnummer zu und versprach, mich bei ihm zu melden, wenn es Fortschritte gab.
Wäre dies ein gewöhnlicher Diebstahl gewesen, dann hätte der Fall hier wohl geendet. Von meiner Suspendierung mal abgesehen, war ich zwar bereits seit Jahren aus dem gewöhnlichen Polizeibetrieb draußen, trotzdem war mir durchaus aufgefallen, dass die Personallage dort zusehends angespannter geworden war. Aber die magische Komponente bedeutete, dass ich die Sache weiterverfolgen musste.
Ich fuhr das steile Sträßchen zur East Heath Road hinauf und sah mich nach Überwachungskameras um. Nichts. Verfechter des Liberalismus und Kriminelle klagen über den Überwachungsstaat, wenn sie eine Kamera sehen – Polizisten klagen, wenn sie keine sehen. Ich hatte gehofft, dass der brandneue Audi auf einer Aufnahme auftauchte, so dass ich das Kennzeichen rückverfolgen konnte, aber die nächste zuverlässige Kamera stand am South End Green, und bis dahin gab es viel zu viele alternative Routen, wie er das Gebiet verlassen haben konnte. Hätte es sich um ein Schwerverbrechen gehandelt, wären trotzdem Leute auf die Aufnahmen angesetzt worden, egal, wie aussichtslos es war. Aber es war nur Einbruchdiebstahl – eine Straftat von der Stange, die gefälligst zu einem Dumpingpreis aufzuklären war.
Nach fünf Minuten am Handy war geklärt, dass Guffland Entertainment ein reines Fantasieunternehmen war, und auf Facebook und Twitter gab es zwar ein paar Mitchel Wests, aber keiner passte auch nur annähernd. Ich warf noch einmal einen Blick auf die Visitenkarte und fragte mich gerade, ob es sich lohnen würde, mein eigenes Fingerabdruckset herauszuholen und sie probehalber einzustäuben, da bemerkte ich, dass auch auf die Rückseite etwas gedruckt war. Da stand in winzigen Buchstaben: PrettyPrint. Wie mein erster Boss zu sagen pflegte, der größte Trost im Dasein eines Polizisten ist, dass die meisten Ganoven nicht weiter denken, als man sie werfen kann.
Nach weiteren fünf Minuten Googeln hatte ich die Bestätigung, dass PrettyPrint eine Copyshop-Kette war, hübsch klein und übersichtlich – gerade mal fünf Filialen in ganz London, die nächste in der Old Street.
Ich rief meinen jetzigen Boss an, Detective Chief Inspector Thomas Nightingale, sagte ihm, was ich vorhatte, und fragte, ob die Gaviolis mal irgendwo in unseren Akten aufgetaucht seien.
»Nicht dass ich wüsste«, sagte er. Im Hintergrund hörte ich Gehämmer und Geschrei. Die Umbauarbeiten am Folly hatten offensichtlich begonnen. »Ich werde es an Harold weitergeben und fragen, was er darüber weiß.«
Professor Harold Postmartin, D. Phil, FRS, war unser Historiker und Archivar. Selbst wenn er nichts fand, wäre er sicherlich daran interessiert, sich näher mit den Gaviolis zu befassen – obskure historische Zusammenhänge waren seine große Leidenschaft.
Ich legte auf, notierte meine Maßnahmen in meinem Protokollbuch und machte mich auf den Weg.
Da ich wenig Lust hatte, die Dauerbaustelle bei Kings Cross in all ihren malerischen Details kennenzulernen, fuhr ich zunächst nach Osten und dann die New North Road entlang. In der Nähe des Old Street Roundabout fand ich keinen Parkplatz, also bog ich nach Shoreditch ab und hatte hinter dem Charles Square Estate Glück. Dann ging ich zu Fuß zur Old Street zurück.
PrettyPrint war zwischen einem Modeschmuckladen und einer Kebabbude in eine von Stadtentwicklungsmaßnahmen überraschend unberührte einstöckige Ladenzeile gequetscht. Es befolgte die universelle Regel, nach der Copyshops blau-weiß gestrichen sein sollen; meine Theorie ist, dass die Farbgebung dazu dienen soll, die unförmigen grauen Kopierer und Druckmaschinen ideal ins Gesamtbild zu integrieren. Der junge Asiate in dem blauen Firmen-T-Shirt wirkte etwa fünf Sekunden lang erfreut, mich zu sehen, dann zog ich meinen Dienstausweis hervor, und er verwies mich an die Chefin. Sie war eine geradezu schmerzhaft magere Schwarze Anfang dreißig, die mich erst einmal missbilligend musterte. Nicht missbilligend im Hinblick auf etwas Spezifisches, sondern einfach routinemäßig skeptisch. Aus unerfindlichen Gründen ziehe ich solche Blicke schon mein Leben lang auf mich, also habe ich gelernt, sie zu ignorieren.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie.
Ich erklärte die Sache mit den falschen Visitenkarten und dass sie mit einem Einbruchsdelikt zusammenhingen.
»Und?«, fragte sie.
Und ob sie bitte nachschauen könne, wer der Kunde gewesen sei, damit ich den Einbrecher schnappen konnte?
Sie legte den Kopf schief. »Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Wegen Datenschutz und so.«
Ich hielt dagegen, dass sie sich, da ihre Ware zur Förderung eines Verbrechens gedient hatte, nach dem Gesetz über Helfershelfer und Begünstigung von 1861 im Prinzip der Beihilfe schuldig machte.
»Das ist wohl ein Witz«, sagte sie. »1861, und das wissen Sie auswendig?«
»Gehört zum Job«, sagte ich – tatsächlich hatte ich es gerade eben in meinem Blackstone’s Handbuch der Gesetze nachgeschlagen, als ich mir noch rasch einen Kaffee holte. Gute Vorbereitung zahlt sich oft aus.
»Aber wir drucken das Zeug nur. Uns ist egal, wozu es benutzt wird.«
»Nun, jetzt wissen Sie, wozu es benutzt wurde«, sagte ich. »Sollte der Täter es also noch einmal zu einer Straftat verwenden, haben Sie ihm wissentlich Beihilfe geleistet.«
»Reden Sie immer so?«, wollte sie wissen.
»Wie?«
»Na, dass der Helfershelfer im Prinzip wissentlich … und so.«
»Können Sie mir wenigstens sagen, ob die Karte hier gedruckt wurde?«
Sie zögerte noch einen Moment, aber an dem Zug um ihren Mund war zu erkennen, dass sie nachgeben würde. Sie nahm die Karte, die noch immer im Beweisbeutel steckte, und stöckelte zu einem Computer hinten im Laden. Nachdem sie ein bisschen auf der Tastatur herumgetippt hatte, berichtete sie, ja, sie hätten definitiv eine Ladung Visitenkarten mit dieser Aufschrift gedruckt.
Ich sah mich um – und siehe da, an der Decke hing eine Kamera mit Blick auf den Kassentresen.
»Wissen Sie noch, wann der Kunde sie abgeholt hat?«
Sie konnte mir tatsächlich Datum und Uhrzeit nennen. Als ich um das Kameramaterial für diesen Zeitpunkt bat, wirkte sie gar nicht mehr überrascht oder widerstrebend – jetzt schien ihr das Ganze Spaß zu machen. Sobald ihnen klar ist, dass man nicht vorhat, sie oder ihre Lieben unter Arrest zu stellen, helfen die Mitbürger der Polizei eigentlich gern. Vor allem Mitbürger mit langweiligen, schlecht bezahlten Jobs, etwa im Einzelhandel. Das Kameramaterial war digital gespeichert (Sie würden sich wundern, wie viele Läden noch auf VHS aufzeichnen), und die Chefin kopierte mir die beiden Stunden um den fraglichen Zeitpunkt herum auf meinen USB-Stick.
»Ich nehme nicht an, dass mit Karte gezahlt wurde, oder?«, fragte ich.
»Doch, ja«, sagte sie. »Bringt Ihnen das was?«
Einer Bank persönliche Kundendaten abzuringen kostet Zeit und Papierkram – den zum Glück diesmal nicht ich selbst erledigen musste. Also war ich erst am Freitagmorgen so weit, dass ich kühn über die North Circular hinweg nach Palmers Green vorstoßen konnte; um genau zu sein, in die bescheidene Wohnung eines gewissen Jacob Astor – wahrscheinlich nicht sein richtiger Name. Sie lag im ersten Stock eines edwardianischen Reihenhäuschens in einer Seitenstraße von Aldermans Hill. Als ich losfuhr, war es kalt und grau gewesen, die Sonne ließ sich nur gelegentlich kurz blicken, bevor sie wieder hinter einer Wolke verschwand, um heimlich eine zu rauchen. Oder sonst was zu machen. Frost herrschte nicht, aber ich überlegte trotzdem, ob ich nicht allmählich meine warme Unterwäsche hervorkramen sollte.
Die Tür war noch ein Arts-and-Crafts-Original mit einem Bleiglasfenster in Grün, Gelb und Blau über einer schlichten Messing-Briefklappe. Am Türrahmen gab es zwei elektrische Klingeln. Unter beiden klebten Reste von Malerkrepp, auf denen wohl einst Namen gestanden hatten, aber Zeit und Witterung hatten die Schrift verwischt. In der Annahme, dass die obere Klingel für die obere Wohnung zuständig war, drückte ich kräftig und lange darauf. Drinnen vernahm ich gedämpft eine Glocke, konnte aber nicht feststellen, ob oben oder unten.
In wissenschaftlichem Forscherdrang drückte ich auch auf die untere Klingel. Diesmal läutete es laut und durchdringend und definitiv im Erdgeschoss. Ich läutete noch zweimal, dann war durch das Buntglas zu sehen, wie sich drinnen eine Tür öffnete und eine vage menschlich anmutende Gestalt zum Vorschein kam. »Komme schon!«, rief eine Frauenstimme, und darauf folgte sehr deutlich das tiefe Luftholen eines Kleinkinds, das vorhat, im nächsten Moment loszuheulen wie eine Sirene.
Die Haustür öffnete sich, und vor mir stand eine stämmige Frau Ende zwanzig mit dunklem südasiatischem Teint. Sie trug ein blaues T-Shirt mit der weißen Aufschrift ASKMEABOUTWASABI