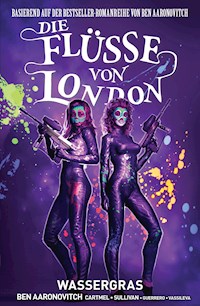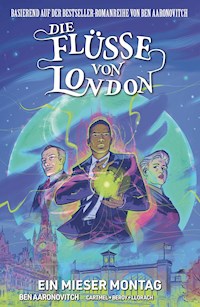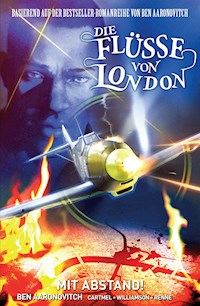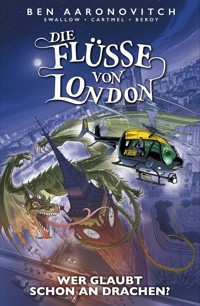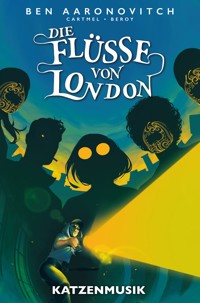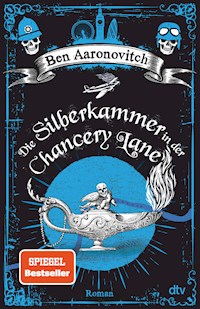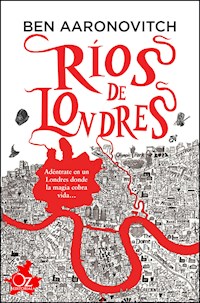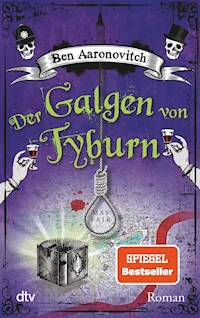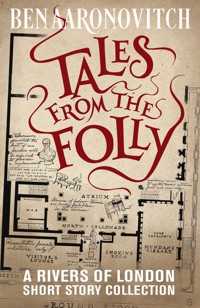Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Die Melodie des Todes Constable Peter Grant ist ein ganz normaler Londoner Bobby. Die Abteilung, in der er arbeitet, ist allerdings alles andere als normal: ihr Spezialgebiet ist – die Magie. Peters Vorgesetzter, Detective Inspector Thomas Nightingale, ist der letzte Magier Englands und Peter seit kurzem bei ihm in der Ausbildung. Was im Moment vor allem das Auswendiglernen von Lateinvokabeln bedeutet, die uralten Zaubersprüche wollen schließlich korrekt aufgesagt werden. Doch als Peter eines Nachts zu der Leiche eines Jazzmusikers gerufen wird, verliert das Lateinstudium auf einmal seine Dringlichkeit. Peter findet heraus, dass in den Jazzclubs in Soho, im Herzen Londons, plötzlich verdächtig viele Musiker eines unerwarteten Todes sterben. Hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Constable Peter Grant ist ein Londoner Bobby, wie er im Buche steht. Die Abteilung, in der er zum Einsatz kommt, ist allerdings ziemlich ungewöhnlich: Ihr Spezialgebiet ist – die Magie. Detective Inspector Thomas Nightingale, Peters Vorgesetzter, ist der letzte Magier Englands, und Peter seit kurzem bei ihm in der Ausbildung. Was im Moment bedeutet, dass er einen Großteil seiner Zeit dem Auswendiglernen von Lateinvokabeln widmen muss, die uralten Zaubersprüche wollen schließlich nicht nur aufgesagt, sondern auch verstanden werden. Doch als er eines Nachts zu der Leiche eines Jazzmusikers gerufen wird, verliert das Lateinstudium auf einmal seine Dringlichkeit. Mit seinem Gespür für Übersinnliches kann Peter eine Melodie hören, die im Zusammenhang mit dem Tod des Musikers stehen muss: Body and Soul … Zusätzlich verbreitet eine geheimnisvolle Blutsaugerin Angst und Schrecken in der Londoner Männerwelt. Es gibt also einiges zu tun für unseren Zauberlehrling!
Ben Aaronovitch
Roman
Deutsch von Christine Blum
Für Karifa, denn jeder Vater
möchte in den Augen seines Sohnes ein Held sein.
Für diese Musik sind Menschen gestorben.
Noch ernster geht es nicht.
Dizzy Gillespie
Es ist eine traurige Tatsache des modernen Lebens, dass man, wenn man lange genug fährt, früher oder später London hinter sich lassen muss. Wenn man die A12 nach Nordosten nimmt, landet man irgendwann in Colchester, der ersten römischen Hauptstadt Britanniens und ersten Stadt, die von dieser rothaarigen Kelten-Tusse aus Norfolk namens Boudicca niedergebrannt wurde. Das wusste ich, weil ich im Zuge meiner Lateinstudien die Annalen des Tacitus gelesen hatte. Der bringt überraschend viel Verständnis für die aufständischen Briten auf und übt vernichtende Kritik an den völlig unvorbereiteten römischen Generälen, die mehr an ihre Bequemlichkeit denn an das Nützliche dachten. Die klassisch gebildeten kinnlosen Schnösel, die in der britischen Armee das Sagen haben, scheinen daraus ihre Lehren gezogen zu haben – heute sitzen in Colchester die härtesten Hunde im ganzen Militär, die Fallschirmjäger. Ich hatte mich als Polizeianwärter oft genug am Samstagabend mit besoffenen Soldaten auf dem Leicester Square herumgeschlagen, um jetzt schön auf der Umgehungsstraße zu bleiben und die Stadt weiträumig zu meiden.
Hinter Colchester bog ich nach Süden ab und fand mit Hilfe der GPS-Funktion meines Handys erfolgreich auf die B1029, die das keilförmige Trockengebiet zwischen dem River Colne und dem Flag Creek der Länge nach durchschneidet. An ihrem Ende liegt Brightlingsea, das sich laut Lesley an der Küste breitmacht wie ein Haufen Müll, der von der Flut an den Strand geschwemmt wurde. Also, ich fand es gar nicht so schlimm. In London hatte es geregnet, aber seit Colchester hatte sich der Himmel aufgeklart, und die gepflegten viktorianischen Reihenhäuser, die sich bis hinunter ans Wasser zogen, strahlten in der Sonne.
Der Familiensitz der Mays war nicht schwer zu finden: ein pseudo-edwardianisches Klinker-Landhaus aus den Siebzigern, mit Hilfe von Kieselrauputz und alten Kutschenlaternen zu einem Idyll ungezügelter Spießigkeit herausgeputzt. Die Haustür wurde von einer von blauen Blüten überquellenden Blumenampel und einem Keramik-Hausnummernschild in Form einer Segelyacht flankiert. Ich hielt kurz inne und ließ den Blick über den Garten schweifen. Nicht weit von der verschnörkelten Vogeltränke hatten sich ein paar Gartenzwerge lässig in Pose gestellt. Ich holte tief Luft und klingelte.
Sofort erhob sich drinnen vielstimmiges weibliches Geschrei. Durch das Buntglasfensterchen in der Tür sah ich am Ende des Flurs ein paar verschwommene Gestalten hin und her eilen. Jemand kreischte: »Es ist dein Freund!«, worauf ein Psst und eine halblaute Ermahnung von jemand anderem folgten. Dann kam ein weißer Schatten näher, bis er das Fenster völlig ausfüllte. Ich trat einen Schritt zurück. Die Tür öffnete sich. Es war Henry May, Lesleys Vater.
Er war ziemlich groß, und das jahrelange Lastwagenfahren und Güterverladen hatten ihm breite Schultern und muskelbepackte Arme eingebracht. Die vielen Raststättenfrühstücke und die Abende am Stammtisch hatten um den Bauch herum einen nicht minder breiten Rettungsring hinterlassen. Er hatte ein kantiges Gesicht und die Stoppelfrisur eines Mannes, der kurzen Prozess mit seiner schwindenden Haarpracht gemacht hat. Seine Augen waren blau und hellwach. Die Augen hatte Lesley eindeutig von ihm geerbt.
Dank seiner sechs Töchter hatte er es im elterlichen Strengblicken zu höchster Vollendung gebracht, und ich musste den Impuls unterdrücken, zu fragen, ob Lesley zum Spielen rauskommen dürfe.
»Hallo, Peter«, sagte er.
»Mr.May«, sagte ich.
Er machte keine Anstalten, den Türrahmen freizugeben oder mich hereinzubitten. »Lesley kommt sofort.«
»Geht’s ihr gut?«, fragte ich. Es war eine dumme Frage, und ihr Dad vermied es, uns beide dadurch in Verlegenheit zu bringen, dass er versuchte, sie zu beantworten. Jetzt hörte ich jemanden die Treppe herunterkommen und machte mich auf alles gefasst.
Dr.Walid hatte erklärt, dass Nasenbein, Oberkiefer, Unterkiefer und Kinn erheblichen Schaden genommen hatten. Die darunter liegenden Muskeln und Sehnen waren zwar größtenteils erhalten geblieben, aber es war den Chirurgen in der Uniklinik nicht gelungen, viel von der Haut darüber zu retten. Man hatte ihr vorläufig eine prothetische Konstruktion eingesetzt, damit sie atmen und schlucken konnte, und es bestand die Chance einer teilweisen Gesichtstransplantation – falls sich eine passende Spenderin fand. Da das, was von Lesleys Kiefer noch übrig war, gegenwärtig von einem feinen Gewebe aus hypoallergenem Metall zusammengehalten wurde, kam Sprechen nicht in Frage. Dr.Walid hatte gesagt, sobald die Knochen wieder ausreichend zusammengewachsen seien, könne man versuchen, die zum Sprechen nötige Beweglichkeit wiederherzustellen. In meinen Ohren hörte sich das alles ziemlich vage an. Egal was Sie sehen, hatte er außerdem gesagt, schauen Sie es sich gründlich genug an, um sich daran zu gewöhnen – damit klarzukommen –, und dann tun Sie so, als wäre nichts geschehen.
»Da ist sie«, sagte Lesleys Dad und drehte sich zur Seite, und eine schlanke Gestalt quetschte sich an ihm vorbei. Sie trug ein blau-weiß gestreiftes Kapuzenshirt, dessen hochgezogene, fest zugeschnürte Kapuze Stirn und Kinn verdeckte. Um ihre untere Gesichtshälfte war ein farblich passender blau-weiß gemusterter Schal geschlungen, und ihre Augen waren hinter einer riesigen altmodischen Sonnenbrille verborgen, von der ich den Verdacht hatte, dass sie aus der Kiste mit aussortierten Klamotten ihrer Mum stammte. Auftragsgemäß schaute ich gründlich, aber es gab nichts zu sehen.
»Du hättest mich vorwarnen können, dass wir einen Raubüberfall vorhaben«, sagte ich. »Dann hätte ich meine Sturmhaube mitgebracht.«
Sie schenkte mir einen ungnädigen Blick – das erkannte ich an der Neigung ihres Kopfes und der Art, wie sie die Schultern hielt. In meiner Brust stockte es kurz, und ich holte tief Atem.
»Lust auf einen Spaziergang?«
Sie nickte ihrem Dad zu, ergriff meinen Arm und zog mich vom Haus weg.
Im Weggehen spürte ich die Augen ihres Vaters in meinem Rücken.
Abgesehen von den Yachtwerften und ein paar Touristen ist es in Brightlingsea selbst im Sommer ziemlich ruhig. Jetzt, zwei Wochen nach Ende der Sommerferien, war außer gelegentlich einem vorbeifahrenden Auto und dem Geschrei der Möwen kaum ein Geräusch zu hören. Ich schwieg, bis wir die Hauptstraße überquert hatten. Hier zog Lesley ihr Notizbuch Marke Polizei aus der Tasche, schlug die letzte Seite auf und zeigte sie mir.
Und, was treibst du so?, war mit schwarzem Kuli quer über die Seite geschrieben.
»Das willst du gar nicht wissen«, sagte ich.
Sie machte eine Geste, die besagte: Doch, will ich.
Also erzählte ich ihr von dem Typen, dem sein bestes Stück von einer Frau mit Zähnen in der Vagina abgebissen worden war (das schien sie zu amüsieren), und von den Gerüchten, dass das Verhalten von Detective Chief Inspector Seawoll bei der Covent-Garden-Randale von der Kommission für polizeiliches Fehlverhalten untersucht wurde (das amüsierte sie eindeutig nicht). Ich erzählte ihr nicht, dass Terrence Pottsley, der einzige weitere Überlebende des Zaubers, der ihr das Gesicht zerstört hatte, sich umgebracht hatte, sobald seine Familie mal kurz nicht hinsah.
Wir gingen nicht den kürzesten Weg zum Strand. Stattdessen führte Lesley mich hinten herum, durch die Oyster Tank Road und über einen grasbewachsenen Parkplatz, wo Reihen von Bootsanhängern mit Segeljollen darauf standen. Eine frische Brise vom Meer strich durchs Takelwerk und ließ die Metallteile bimmelnd wie Kuhglocken aneinanderschlagen. Hand in Hand schlängelten wir uns zwischen den Booten hindurch und erreichten schließlich die windgepeitschte betonierte Uferpromenade. Auf der Seeseite führten Zementstufen zum Strand hinunter, der von morschen Wellenbrechern in schmale Streifen geteilt wurde; auf der Landseite zog sich eine Reihe bunt gestrichener Strandhütten entlang. Die meisten waren fest verrammelt, aber eine Familie hatte es sich anscheinend in den Kopf gesetzt, den Sommer so lange auszureizen wie nur möglich. Die Eltern saßen im Schutz ihres Vordachs und tranken Tee, die Kinder kickten sich am Strand einen Fußball zu.
Zwischen der Strandhüttensiedlung und dem Freibad gab es ein Stück Wiese mit einem Unterstand. Hier ließen wir uns schließlich nieder. Der Unterstand stammte aus den dreißiger Jahren, als man das britische Klima noch realistisch gesehen hatte – er war aus Backsteinen gemauert und so stabil, dass er auch als Panzersperre hätte herhalten können. Auf der Bank an der Rückwand war man gut vor dem Wind geschützt. Die Innenwände zierte ein Wandbild von einem Strand mit blauem Himmel, weißen Wolken und roten Segeln. Irgendein Schwachkopf hatte »BMX« quer über den Himmel gesprüht, und auf einer Seitenwand, genau in Armhöhe einer gelangweilt auf der Bank hockenden Jugendlichen, prangten drei gekritzelte Namen: BROOKE T., EMILY B. und LESLEY M. Man brauchte kein Polizist zu sein, um zu erkennen, dass hier die Dorfjugend von Brightlingsea in dem schwierigen Alter zwischen Strafmündigkeit und legalem Alkoholkonsum abhing.
Lesley zog ein iPad-Imitat aus ihrer Handtasche, fuhr es hoch und tippte im Tastaturmodus etwas ein. Und das Ding fing an zu reden. Irgendwer in ihrer Familie musste sich mit Computern auskennen und hatte eine Sprachsoftware installiert. Es war die Standardausführung mit amerikanischem Akzent, die Lesley klingen ließ wie einen autistischen Surfer aus Kalifornien, aber wenigstens konnten wir uns fast normal unterhalten.
Sie hielt sich nicht lange mit Smalltalk auf.
»Kann Magie was machen bei mir?«
Vor der Frage hatte ich mich gefürchtet. »Ich dachte, Dr.Walid hätte mit dir darüber geredet.«
»Sag du«, sagte sie.
»Was?«
Lesley beugte sich über das iPad und tippte zielstrebig auf dem Bildschirm herum.
»Ich will es von dir hören«, sagte das iPad.
»Warum?«
»Weil ich dir vertraue.«
Ich atmete tief durch. Vor dem Unterstand zischte ein Seniorenpärchen auf Elektromobilen vorbei.
»Soweit ich das überblicke, funktioniert Magie in genau dem gleichen Rahmen physikalischer Gesetze wie alles andere.«
»Was Magie anrichtet«, sagte das iPad, »kann Magie reparieren.«
»Wenn du dir die Hand mit Feuer oder Strom verbrennst – hast du eine Verbrennung. Du heilst sie mit Salbe und Verbänden und solchem Zeug. Nicht mit noch mehr Strom oder Feuer. Und …«
Und dir wurde das Gesicht brutal von einem bösen Geist verformt – dein Kiefer wurde total zerquetscht – und das Ganze wurde nur noch durch Magie zusammengehalten, und als die aufgebraucht war, fiel dein Gesicht auseinander. Dein wunderschönes Gesicht. Ich war dabei, ich musste es mit ansehen. Und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte.
»… du kannst es nicht einfach wegwünschen«, sagte ich.
»Und du weißt alles?«, fragte das iPad.
»Nein. Und ich denke, Nightingale auch nicht.«
Sie saß lange stumm und reglos da. Ich hätte gern den Arm um sie gelegt, wusste aber nicht, wie sie reagieren würde. Gerade hatte ich mich dazu durchgerungen, da nickte sie entschlossen und nahm wieder das iPad zur Hand.
»Zeig mir«, sagte das iPad.
»Lesley …«
»Zeig mir.« Sie drückte mehrmals auf den Wiederholungsknopf. »Zeig mir, zeig mir, zeig mir …«
»Warte.« Ich wollte nach dem iPad greifen, aber sie zog es aus meiner Reichweite.
Ich erklärte: »Ich muss den Akku rausnehmen. Sonst zerstört die Magie die Hardware.«
Sie drehte das iPad um, ließ es aufschnappen und nahm den Akku heraus. Ich hatte nach fünf verschlissenen Handys für mein neues Samsung einen altmodischen Sicherungsmechanismus gebastelt, weswegen das Gehäuse von Gummibändern zusammengehalten wurde. Lesley warf einen Blick darauf und schüttelte sich mit einem Schnauben, das wahrscheinlich ein Lachen war.
Ich stellte mir im Kopf die nötige Forma vor, öffnete die Hand und erschuf ein Werlicht. Kein starkes, aber doch so hell, dass es sich in Lesleys dunklen Brillengläsern spiegelte. Sie hörte auf zu lachen. Ich schloss die Hand, und das Licht ging aus.
Einen Moment lang starrte Lesley meine Hand an, dann machte sie meine Geste nach, einmal, zweimal, langsam und methodisch. Als nichts passierte, sah sie mich an, und ich wusste, dass sie unter Brille und Schal die Stirn runzelte.
»So leicht ist es nicht«, sagte ich. »Ich hab anderthalb Monate lang jeden Morgen vier Stunden geübt, bis ich es konnte, und das ist nur der allererste Anfang. Hab ich dir schon von all dem Latein und Griechisch erzählt …?«
Es herrschte eine kurze Stille, dann piekste sie mich mit dem Finger in den Arm. Ich seufzte und ließ noch ein Werlicht erscheinen. Inzwischen konnte ich das praktisch im Schlaf. Wieder imitierte sie die Geste. Nichts geschah – das mit dem langen Üben war auch kein Witz gewesen.
Das Senioren-Racing-Team kam wieder die Promenade entlanggebraust. Ich ließ das Licht erlöschen, aber Lesley machte die Geste weiter. Mit jedem Mal wurde die Bewegung ungeduldiger. Ich beherrschte mich eine Weile, dann nahm ich ihre Hand in meine, damit sie aufhörte.
Nicht lange danach schlenderten wir zu ihrem Haus zurück. Auf der Schwelle tätschelte sie mir den Arm, ging ins Haus und machte mir die Tür vor der Nase zu. Durch das Buntglasfenster sah ich, wie ihr verschwommener Schatten sich rasch durch den Flur entfernte. Dann war sie verschwunden.
Ich wollte gerade gehen, da öffnete sich die Tür noch einmal, und ihr Vater kam heraus.
»Peter.« Männer wie Henry May werden nicht leicht verlegen, daher können sie es dann umso schlechter verbergen. »Ich dachte, vielleicht trinken Sie eine Tasse Tee mit mir – an der Hauptstraße gibt es ein Café.«
»Danke«, sagte ich. »Aber ich muss zurück nach London.«
»Oh.« Er kam einen Schritt näher und machte eine unbestimmte Geste in Richtung Haus. »Sie will nicht, dass Sie sie ohne die Maskierung sehen. Drinnen nimmt sie das alles ab, und wenn Sie mit reinkämen … Sie will nicht, dass Sie sie so sehen. Das verstehen Sie, oder?«
Ich nickte.
»Sie will nicht, dass Sie sehen, wie schlimm es ist.«
»Und wie schlimm ist es?«
»Ich würde sagen, schlimmer geht’s nicht«, sagte Henry.
»Tut mir leid.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass sie es nicht böse gemeint hat oder so. Dass Sie sich nicht weggeschickt fühlen.«
Aber ich wurde weggeschickt. Deshalb sagte ich auf Wiedersehen, stieg in den Jaguar und machte mich auf den Rückweg nach London.
Es war mir gerade gelungen, die A12 wiederzufinden, da rief Dr.Walid an und sagte, er habe da eine Leiche, die ich mir anschauen solle. Ich trat aufs Gas. Das bedeutete Arbeit, und genau das war es, was ich jetzt brauchte.
Alle Krankenhäuser, in denen ich je war, hatten den gleichen Geruch – diese Mischung aus Desinfektionsmittel, Erbrochenem und Sterblichkeit. Das University College Hospital war brandneu, keine zehn Jahre alt, aber schon setzte der Geruch sich auch hier fest – paradoxerweise nur nicht im Keller, wo die Toten aufbewahrt wurden. Hier unten war die Farbe an den Wänden noch frisch, und das blassblaue Linoleum quietschte unter den Sohlen.
Den Eingang zur Leichenhalle erreichte man über einen langen Korridor, der mit Bildern des Middlesex Hospital aus der guten alten Zeit gespickt war, als der Gipfel des medizinischen Fortschritts darin bestand, dass die Herren Doctores sich zwischen zwei Behandlungen die Hände wuschen. Es handelte sich um eine elektronisch gesicherte Brandschutz-Doppeltür mit einem Schild: ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN – STOP! – NUR FÜR PERSONAL. Ein zweites Schild wies mich an, den Knopf an der Sprechanlage zu drücken. Ich gehorchte. Die Anlage gab ein Quaken von sich. Für den Fall des Falles, dass das eine Frage sein sollte, erklärte ich, ich sei Constable Peter Grant und wolle zu Dr.Walid. Es quakte wieder, ich wartete, dann öffnete sich die Tür, und vor mir stand Dr.Abdul Haqq Walid, Gastroenterologe und Kryptopathologe von Weltrang und bekennender Schotte.
»Peter«, sagte er. »Wie geht’s Lesley?«
»Geht so, glaube ich«, gab ich zurück.
In der Pathologie sah es ähnlich aus wie im übrigen Krankenhaus, nur hörte man weniger Patientenbeschwerden über den staatlichen Gesundheitsdienst. Dr.Walid geleitete mich an dem Security-Typen am Empfang vorbei und stellte mir die Leiche des Tages vor.
»Wer ist das?«, fragte ich.
»Cyrus Wilkinson. Er ist vorgestern in einem Pub am Cambridge Circus kollabiert, wurde in die Notaufnahme gebracht, dort für tot erklärt und zur Routineautopsie hier heruntergeschickt.«
Der arme Cyrus sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, abgesehen von dem Y-förmigen Schnitt vom Brustkorb bis zu den Lenden natürlich. Zum Glück war Dr.Walid schon damit fertig, in seinen Organen zu wühlen, und hatte ihn zugenäht, bevor ich kam. Cyrus Wilkinson war ein Weißer etwa Mitte vierzig, noch ziemlich gut in Schuss – leichter Bauchansatz, aber Arme und Beine hatten deutliche Muskeln. Ich hätte darauf getippt, dass er regelmäßig joggte.
»Und er ist hier, weil …?«
»Nun, es gibt Anzeichen für Gastritis, Pankreatitis und Leberzirrhose.«
Letzteres konnte ich einordnen. »Hat er getrunken?«
»Unter anderem«, sagte Dr.Walid. »Er war extrem anämisch, was zwar mit seinen Leberproblemen zusammenhängen könnte, aber ich würde eher auf einen B12-Mangel tippen.«
Ich warf noch einen Blick auf die Leiche. »Sieht aber einigermaßen trainiert aus.«
»Er war wohl noch recht sportlich. Nur in letzter Zeit hat er sich anscheinend gehenlassen.«
»Drogen?«
»Ich habe alle Schnelltests gemacht. Nichts«, erklärte er. »Bis ich die Ergebnisse der Haarproben habe, wird es noch ein paar Tage dauern.«
»Was war die Todesursache?«
»Herzversagen. Ich habe Hinweise auf eine dilatative Kardiomyopathie gefunden – das bedeutet, das Herz vergrößert sich und kann nicht mehr richtig arbeiten –, aber was ihm gestern Nacht den Rest gegeben hat, war meiner Meinung nach ein akuter Myokardinfarkt.«
Auch diesen Begriff kannte ich aus dem Was-macht-man-wenn-ein-Verdächtiger-beim-Verhör-umkippt-Kurs an der Polizeischule in Hendon. Man kann es auch einfach Herzanfall nennen.
»Natürliche Ursache?«
»Oberflächlich betrachtet, ja. Aber eigentlich war er nicht krank genug, um einfach so tot umzufallen. Wobei ich zugeben muss, dass erstaunlich viele Leute einfach so tot umfallen.«
»Und woher wissen Sie dann, dass er was für uns ist?«
Dr.Walid tätschelte dem Toten die Schulter und zwinkerte mir zu. »Dazu müssen Sie schon näher herangehen.«
Ich finde es nicht gerade berauschend, Leichen nahe zu kommen, nicht einmal so harmlosen wie Cyrus Wilkinson, daher bat ich Dr.Walid um Mundschutz und Schutzbrille. Nachdem jedes Risiko einer versehentlichen Berührung des Leichnams beseitigt war, beugte ich mich vorsichtig hinunter, bis mein Gesicht dicht über dem seinen war.
Vestigium nennt man den Abdruck, den Magie auf Gegenständen hinterlässt. Es ist mit einem Sinneseindruck vergleichbar, ungefähr wie die Erinnerung an einen längst vergangenen Geruch oder ein Geräusch. Auch Sie spüren es wahrscheinlich hundertmal am Tag, aber man kann es leicht mit Erinnerungen oder Tagträumen verwechseln oder sogar Gerüchen, die man gerade riecht, und Geräuschen, die man hört. Manche Materialien, zum Beispiel Steine, saugen alles auf, was um sie herum passiert, selbst wenn es kaum magisch ist – daher haben alte Häuser ihren Charakter. Andere Materialien, zum Beispiel der menschliche Körper, bewahren Vestigia furchtbar schlecht – um auf einer Leiche einen Eindruck zu hinterlassen, braucht es schon das magische Äquivalent einer Handgranate.
Kein Wunder also, dass ich etwas überrascht war, als ich Cyrus Wilkinsons Körper ein Saxofonsolo spielen hörte. Die Melodie wehte aus einer Zeit an mich heran, als die Radios noch aus Bakelit und mundgeblasenem Glas bestanden, und wurde begleitet von einem Geruch nach zersägtem Holz und Zementstaub. Ich verharrte so lange, bis ich sicher war, das Stück erkannt zu haben, dann trat ich zurück.
»Wie haben Sie das festgestellt?«
»Ich überprüfe alle plötzlichen Todesfälle auf Magie«, gab Dr.Walid zurück. »Nur für alle Fälle. Ich fand, es klang wie Jazz.«
»Kennen Sie das Stück?«
»Natürlich nicht. Ich halte es ausschließlich mit Prog-Rock und den Romantikern des 19. Jahrhunderts. Sie?«
»Das ist Body and Soul«, sagte ich. »Ein Stück aus den Dreißigern.«
»Wer hat es gespielt?«
»So ziemlich jeder. Es ist einer der großen Jazzklassiker.«
»An Jazz kann man nicht sterben«, sagte Dr.Walid. »Oder?«
Ich dachte an Fats Navarro, Billie Holiday und Charlie Parker, der nach seinem Tod von einem Gerichtsmediziner doppelt so alt geschätzt wurde, wie er war.
»Wissen Sie«, sagte ich, »ich glaube, Sie werden feststellen, dass man’s kann.«
Bei meinem Vater hatte der Jazz sich auch alle Mühe gegeben.
Um ein solches Vestigium auf einer Leiche zu hinterlassen, brauchte es schon eine ordentliche Dosis Magie. Das bedeutete, entweder hatte jemand Cyrus Wilkinson etwas Magisches angetan, oder er selbst hatte Magie angewendet. Nightingale zufolge waren im Domizil von Magie Praktizierenden, selbst bei Dilettanten, immer Spuren ihrer Tätigkeit zu finden. Also fuhr ich über die Themse zu der Adresse auf Mr.Wilkinsons Führerschein, um nachzuprüfen, ob es dort Spuren von Magie, einem Verbrechen oder Jazz gab.
Es war ein zweistöckiges edwardianisches Reihenhaus auf der besseren Seite der Tooting Bec Road. Die Gegend war fest in VW-Golf-Hand mit ein paar Audis und einem BMW dazwischen, um das Gesamtbild ein bisschen aufzupeppen. Ich parkte im Parkverbot und ging die Straße hoch. Dabei fiel mir ein neonoranger Honda Civic auf – nicht weil er diesen armseligen 1,4-Liter-VTEC-Motor hatte, sondern weil darin eine Frau saß und das Haus beobachtete. Ich merkte mir das Kennzeichen, öffnete das gusseiserne Gartentor, ging durch den kleinen Vorgarten und klingelte. Einen Augenblick lang roch ich wieder zersplittertes Holz und Zementstaub, aber dann öffnete sich die Tür, und ich verlor jegliches Interesse an anderen Dingen.
Unter ihrem ausgeleierten himmelblauen Shetland-Strickpulli hatte sie absolut unzeitgemäße Kurven, üppig und sexy. Dazu ein hübsches blasses Gesicht und eine Unmenge braunes Haar, das ihr weit über den Rücken gefallen wäre, hätte sie es nicht am Hinterkopf unordentlich hochgesteckt. Ihre Augen waren schokoladenbraun, ihr Mund groß und voll mit nach unten gezogenen Mundwinkeln. Sie fragte, wer ich sei. Ich wies mich aus.
»Und was kann ich für Sie tun, Constable?« Sie hatte eine ungemein gestochene Aussprache, fast schon am Rande der Parodie. Es war, als würde eine Spitfire über uns hinwegzischen.
»Ist dies das Haus von Cyrus Wilkinson?«
»Ich fürchte, das war es, Constable«, sagte sie.
Ich fragte sehr höflich nach ihrem Namen.
»Simone Fitzwilliam.« Sie hielt mir die Hand hin. Automatisch nahm ich sie; ihre Handfläche war weich und warm, und der Duft von Geißblatt wehte mich an. Ich fragte, ob ich hereinkommen dürfe, und sie trat beiseite und ließ mich eintreten.
Das Haus war einst für die aufstrebende untere Mittelschicht gebaut worden, mit einem schmalen, aber gut proportionierten Eingangsflur. Die schwarz-weißen Bodenfliesen waren noch original, und an der Wand stand ein antiker, etwas zerschrammter Eichenschrank. Simone führte mich ins Wohnzimmer. Ihre Beine in den schwarzen Leggings waren kräftig, aber wohlgeformt. Das Haus hatte die üblichen Gentrifizierungsmaßnahmen durchlaufen – Wanddurchbruch vom Vorder- zum Esszimmer, die ursprünglichen Eichendielen abgeschliffen, versiegelt und unter Teppichläufern begraben. Die Einrichtung sah nach Edelkaufhaus aus, gehobene Preisklasse, bequem und fantasielos. Der Plasmafernseher war gigantisch und mit einem Sky-Receiver und einem Blu-ray-Player verbunden; auf dem Regal daneben standen DVDs, keine Bücher. Dort, wo der Kamin gewesen wäre, hätte man ihn nicht irgendwann in den vergangenen hundert Jahren herausgerissen, hing ein Monet-Druck.
»Was für eine Beziehung hatten Sie zu Mr.Wilkinson?«, fragte ich.
»Er war mein Geliebter.«
Die Stereoanlage war eine langweilige hochwertige Hitachi, nur mit CD-Player, ohne Plattenspieler. In den CD-Ständern Wes Montgomery, Dewey Redman, Stan Getz, der Rest ein wahlloser Mix von Hits aus den Neunzigern.
»Mein Beileid«, sagte ich. »Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
»Ist das partout nötig, Constable?«
»Wir untersuchen oft Todesfälle, bei denen die Umstände nicht ganz geklärt sind«, erklärte ich. Tatsächlich untersuchen wir, sprich die Polizei, möglichst überhaupt nichts, außer die Sache stinkt drei Meilen gegen den Wind, oder es gibt eine neue Richtlinie des Innenministeriums, im Hinblick auf das Medieninteresse besonderes Augenmerk auf das gerade aktuelle crime du jour zu richten.
»Sind sie denn nicht geklärt?«, fragte Simone. »Ich dachte, der arme Cyrus hatte einen Herzanfall.« Sie setzte sich auf ein pastellblaues Sofa und bot mir mit einer Geste den dazugehörigen Sessel an. »Das ist doch eine sogenannte natürliche Ursache, oder?« Ihre Augen schimmerten, und sie fuhr sich mit dem Handrücken darüber. »Entschuldigen Sie, Constable.«
Ich bat sie, mich Peter zu nennen, was in diesem Stadium der Untersuchungen wirklich inakzeptabel ist – ich konnte praktisch hören, wie Lesley mir über ganz Essex hinweg die Leviten las. Ich bekam aber trotzdem keine Tasse Tee angeboten. Heute war wohl einfach nicht mein Tag.
Aber sie lächelte. »Danke, Peter. Fragen Sie ruhig.«
»War Cyrus Musiker?«, fragte ich.
»Er hat Altsaxofon gespielt.«
»Jazz?«
Noch ein flüchtiges Lächeln. »Gibt es überhaupt andere Musik?«
»Modal, Bebop oder Mainstream?«, fragte ich, um ein bisschen Eindruck zu schinden.
»West Coast Cool«, gab sie zurück. »Aber gerne auch mal etwas Hard Bop, wenn es gerade passte.«
»Spielen Sie auch?«
»Himmel, nein. Meine grauenvolle Talentlosigkeit könnte ich keinem Publikum zumuten. Man muss seine Grenzen kennen. Aber ich bin eine begeisterte Zuhörerin. Cyrus wusste das zu schätzen.«
»Haben Sie an dem bewussten Abend auch zugehört?«
»Natürlich. Ich saß in der ersten Reihe, wobei das in einem so winzigen Lokal wie dem Spice of Life nicht schwer ist. Sie spielten gerade Midnight Sun, Cyrus war mit seinem Solo fertig und setzte sich plötzlich auf den Kontrolllautsprecher. Ich dachte noch, dass er ein bisschen erhitzt aussah, da kippte er zur Seite, und uns allen wurde klar, dass etwas nicht stimmte.«
Sie verstummte, wandte den Blick ab und ballte die Hände zu Fäusten. Ich wartete einen Augenblick, dann ging ich ein paar Routinefragen durch, um ihr Gelegenheit zu geben, ihre Fassung wiederzuerlangen – um wie viel Uhr war das gewesen, wer hatte den Rettungswagen gerufen, und war sie die ganze Zeit bei ihm geblieben? Die Antworten hielt ich in meinem Notizbuch fest.
»Ich wollte mit in den Rettungswagen, aber ehe ich mich versah, war er schon weg. Jimmy fuhr mich zum Krankenhaus. Als ich ankam, war es schon zu spät.«
»Jimmy?«
»Der Schlagzeuger. Sehr netter Mensch, Schotte, glaube ich.«
»Können Sie mir seinen vollen Namen geben?«
»Ich fürchte nein«, sagte sie. »Ist das nicht schrecklich? Für mich war er immer nur Jimmy am Schlagzeug.«
Ich fragte nach den übrigen Bandmitgliedern, aber sie kannte sie nur als Max am Bass und Danny am Piano.
»Sie müssen mich für eine unmögliche Person halten. Ich muss eigentlich ihre Namen kennen, aber sie fallen mir einfach nicht ein. Vielleicht ist es der Schock wegen Cyrus, weil es alles so plötzlich kam.«
Ich fragte, ob Cyrus in letzter Zeit krank gewesen sei oder ob er chronische gesundheitliche Probleme gehabt habe. Simone verneinte. Auch den Namen seines Hausarztes kannte sie nicht, bot mir aber an, sie könne in Cyrus’ Unterlagen danach suchen, falls nötig. Ich machte mir eine Notiz, ihn von Dr.Walid zu erfragen.
Damit glaubte ich genug Fragen gestellt zu haben, um den eigentlichen Grund meines Besuchs zu vertuschen, und fragte so unverfänglich wie möglich, ob ich mich noch rasch im Haus umsehen dürfe. Normalerweise genügt die bloße Anwesenheit eines Polizisten, um auch im gesetzestreuesten Bürger vage Schuldgefühle und infolgedessen einen ausgesprochenen Widerwillen dagegen zu wecken, irgendwelche Polizeiplattfüße in seinen geheiligten vier Wänden herumtrapsen zu lassen. Daher war ich etwas überrascht, als Simone einfach in Richtung Flur winkte und sagte: »Bitte, nur zu.«
Das Obergeschoss sah ungefähr so aus, wie ich erwartet hatte: nach vorne hinaus das Schlafzimmer, nach hinten das Kinderzimmer, das – aus dem freigeräumten Boden und den an der Wand aufgereihten Notenständern zu schließen – als Probenraum genutzt wurde. Das üblicherweise vorhandene »halbe Zimmer« war der Erweiterung des Badezimmers zum Opfer gefallen, das jetzt mit Badewanne, Dusche, WC und Bidet prunkte, alles blassblau gefliest mit Lilienrelief. Im Badezimmerschränkchen herrschte die übliche Drei-zu-eins-Aufteilung zugunsten der Dame. Er benutzte Einmalrasierer mit zwei Klingen und Aftershave-Gel, sie enthaarte sich fleißig auf alle möglichen Arten und kaufte bei Superdrug ein. Nichts wies darauf hin, dass einer der beiden sich in den esoterischen Künsten versuchte.
Im Schlafzimmer standen beide Einbauschränke weit offen, und eine Spur halb gefalteter Kleidungsstücke zog sich von dort zu zwei Koffern, die aufgeklappt auf dem Bett lagen. Wie eine Krebserkrankung schreitet auch die Trauer bei jedem Menschen unterschiedlich schnell voran, trotzdem erschien es mir ein bisschen früh, dass sie schon jetzt die Sachen ihres geliebten Cyrus wegpackte. Dann entdeckte ich einen Hüftslip, den kein anständiger Jazzer getragen hätte, und begriff, dass Simone ihre eigenen Sachen packte, was mir nicht weniger verdächtig vorkam. Ich horchte, um sicherzugehen, dass sie nicht gerade die Treppe heraufkam, und unternahm eine flüchtige Durchsuchung ihrer Unterwäsche-Schubladen, leider ohne Ergebnis, außer dem vagen Gefühl, höchst unprofessionell an die Sache heranzugehen.
Das Musikzimmer hatte immerhin mehr Charakter. Hier gab es gerahmte Poster von Miles Davis und Art Pepper und Regale voller Noten. Ich hatte es mir für zuletzt aufgehoben, um erst ein Gefühl für das Sensis illic, wie Nightingale es nannte (ich sage Hintergrund-Vestigium) des Hauses zu bekommen, bevor ich den Ort betrat, der unverkennbar Cyrus Wilkinsons Allerheiligstes war. Kurz durchzuckte mich wieder Body and Soul und, vermischt mit Simones Parfüm, der Geruch nach Staub und zersägtem Holz, aber gedämpft und kaum spürbar. Anders als im restlichen Haus gab es hier Bücherregale, auf denen nicht nur Fotos und lächerlich teure Urlaubssouvenirs standen. Meiner Einschätzung nach musste sich jemand, der außerhalb der offiziellen Kanäle versuchte, sich das Zaubern beizubringen, erst einmal durch Massen von okkultem Mist wühlen, bevor er auf wahre Magie stieß – wenn das überhaupt möglich war. Ich hätte auf den Regalen wenigstens ein paar einschlägige Bücher erwartet, aber bei Cyrus gab es nichts dergleichen, nicht einmal Aleister Crowleys Buch der Lügen, das immer für einen Lacher gut ist, wenn auch zu nichts sonst. Tatsächlich glichen die Regale eher denen meines Dad: viele Jazzerbiografien – Art Pepper, Charlie Parker etc. pp. –, dazwischen zur Auflockerung ein paar frühe Romane von Dick Francis.
»Haben Sie etwas gefunden?«
Simone stand im Türrahmen. Ich war so in die Betrachtung des Zimmers versunken gewesen, dass ich sie nicht hatte kommen hören. Lesley pflegte zu sagen, dass die Fähigkeit, eine von hinten nahende holländische Volkstanzgruppe nicht zu bemerken, in der komplexen, unberechenbaren Welt der modernen Polizeiarbeit kein positiver Überlebensfaktor sei. Ich möchte anmerken, dass ich zu jenem Zeitpunkt gerade damit beschäftigt war, einem ziemlich schwerhörigen Touristen den Weg zu erklären, und überhaupt waren es keine Holländer, sondern Schweden.
»Noch nicht.«
»Ich will Sie nicht zur Eile drängen«, sagte sie. »Ich hatte nur bereits ein Taxi bestellt, ehe Sie kamen, und Sie wissen, wie diese Burschen es hassen, wenn man sie warten lässt.«
»Wohin wollen Sie denn?«, fragte ich.
»Nur zu meinen Schwestern. Bis ich wieder Boden unter den Füßen habe.«
Ich bat sie um die Adresse und schrieb sie auf. Erstaunlicherweise lag sie in Soho, in der Berwick Street. »Ich weiß«, sagte Simone, als sie meinen Gesichtsausdruck sah. »Sie sind ein bisschen unkonventionell.«
»Hatte Cyrus noch anderes Grundeigentum, einen Schuppen, eine Garage, einen Schrebergarten vielleicht?«
»Nicht dass ich wüsste.« Plötzlich lachte sie. »Cyrus und ein Schrebergarten – eine höchst unwahrscheinliche Kombination!«
Ich dankte ihr für ihre Zeit, und sie begleitete mich zur Tür.
»Ich danke Ihnen, Peter«, sagte sie. »Sie waren sehr freundlich.«
Im Fenster neben der Tür, in dem sich die Straße spiegelte, sah ich, dass der Honda Civic immer noch auf der anderen Straßenseite stand und die Fahrerin genau zu uns herüberstarrte. Als ich mich zur Straße wandte, drehte sie hastig den Kopf und tat so, als studiere sie die Aufkleber auf dem Heck des Autos vor ihr. Dann riskierte sie einen Blick zurück, nur um festzustellen, dass ich jetzt quer über die Straße auf sie zuging. Ich sah, wie sie erst von Verlegenheit, dann von Panik erfasst wurde und schwankte, ob sie den Wagen starten oder aussteigen sollte. Als ich ans Fenster klopfte, zuckte sie zusammen. Ich zeigte ihr meinen Dienstausweis. Sie schaute ihn verwirrt an. Das passiert relativ oft, hauptsächlich deshalb, weil die meisten Mitbürger noch nie einen Polizei-Dienstausweis aus der Nähe gesehen und keine Ahnung haben, was zum Teufel das sein soll. Irgendwann kapierte sie es und öffnete das Fenster.
»Würden Sie bitte aus dem Wagen steigen, Madam?«
Sie nickte und stieg aus. Sie war klein, schlank und gut gekleidet; das türkise Kostüm war von der Stange, aber hochwertig. Immobilienmaklerin, dachte ich, vielleicht auch PR oder hochklassiger Einzelhandel, auf jeden Fall etwas mit Kundenkontakt. Wenn sie es mit der Polizei zu tun kriegen, lehnen sich die meisten Leute zur moralischen Unterstützung an ihr Auto, sofern sie es zur Hand haben. Sie nicht, allerdings spielte sie nervös mit dem Ring an ihrer linken Hand und strich sich die Haare hinter die Ohren zurück.
»Ich habe nur im Auto gewartet«, sagte sie. »Ist etwas?«
Ich bat um ihren Führerschein. Sie händigte ihn gehorsam aus. Fragt man irgendwelche beliebigen Bürger nach Namen und Adresse, lügen sie einen nicht nur regelmäßig an, nein, sie sind nicht einmal verpflichtet, damit herauszurücken, außer man erstattet wegen einer Straftat Anzeige, und selbst dann muss man einen Empfangsschein ausfüllen, um zu beweisen, dass man nicht aus purer Niedertracht blonde Immobilienmaklerinnen tyrannisiert. Lässt man die Leute allerdings in dem Glauben, es handle sich um eine Verkehrskontrolle, dann vertrauen sie dir fröhlich ihren Führerschein an, auf dem ihr Name einschließlich peinlicher zweiter Vorname, ihr Geburtsdatum sowie ihre Adresse stehen. Ich schrieb mir alles ab. Sie hieß Melinda Abbott, war 1980 geboren und wohnte in dem Haus, das ich gerade verlassen hatte.
»Ist das Ihre derzeitige Adresse?«, fragte ich, als ich ihr das Dokument zurückgab.
»Mehr oder weniger«, sagte sie. »Sie war es einmal, und zufällig warte ich momentan darauf, dass ich sie zurückbekomme. Warum?«
»Es hat mit einer laufenden Ermittlung zu tun. Kennen Sie vielleicht einen Mann namens Cyrus Wilkinson?«
»Das ist mein Verlobter.« Sie sah mich scharf an. »Ist ihm etwas passiert?«
Es gibt vom Polizeiverband abgesegnete Richtlinien, wie man Angehörigen schlechte Neuigkeiten beibringt, und dazu gehört nicht, mitten auf der Straße damit herauszuplatzen. Ich fragte, ob wir uns nicht kurz ins Auto setzen wollten, aber davon wollte sie nichts wissen.
»Sagen Sie es mir besser gleich.«
»Ich fürchte, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie.«
Jeder, der jemals The Bill oder Casualty gesehen hat, weiß, was das bedeutet. Melinda stolperte einen Schritt zurück, fand ihr Gleichgewicht aber sofort wieder. Fast hätte sie die Fassung verloren, dann konnte ich förmlich sehen, wie alle Emotion hinter die Maske ihres Gesichts zurückgesogen wurde.
»Wann?«
»Vorgestern Nacht«, informierte ich sie. »Herzinfarkt.«
Sie sah mich verständnislos an. »Herzinfarkt?«
»Ich fürchte ja.«
Sie nickte. »Warum sind Sie dann hier?«
Es blieb mir erspart, sie anzulügen, weil in diesem Moment ein Taxi vor dem Haus vorfuhr und hupte. Melinda drehte sich um, blickte starr auf die Eingangstür und wurde mit dem Anblick von Simone belohnt, die mit ihren zwei Koffern herauskam. Der Taxifahrer legte ein für seine Zunft untypisches Maß an Ritterlichkeit an den Tag: Er eilte zu Simone, nahm ihr die Koffer ab und lud sie in den Kofferraum, während sie die Haustür abschloss – ein normales und ein Sicherheitsschloss, bemerkte ich.
»Du Schlampe«, rief Melinda.
Simone ging zum Taxi, ohne sie zu beachten, was genau die Wirkung auf Melinda hatte, die zu erwarten war. »Ja, dich meine ich«, schrie sie. »Er ist tot, du Miststück, und du hast es nicht mal für nötig gehalten, mich anzurufen. Das ist mein Haus, du fette Kuh.«
Da sah Simone auf. Zuerst schien es, als hätte sie Melinda überhaupt nicht erkannt, aber dann nickte sie geistesabwesend und warf die Hausschlüssel ungefähr in unsere Richtung. Sie landeten vor Melindas Füßen.
Manche Ausraster kann man von weitem kommen sehen, deshalb lag meine Hand um Melindas Oberarm, bevor sie über die Straße rennen und Simone zu Kleinholz verarbeiten konnte. Schließlich muss ich bitte schön die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Für ein so dürres kleines Ding entwickelte Melinda erstaunliche Kräfte, und am Ende musste ich auch die zweite Hand hinzunehmen, während sie über meine Schulter hinweg Zeter und Mordio brüllte.
»Wollen Sie, dass ich Sie festnehme?«, fragte ich. Das ist ein alter Polizeitrick: Wenn man die Leute nur warnt, wird man oft ignoriert, aber sobald man ihnen eine Frage stellt, sind sie gezwungen, darüber nachzudenken. Wenn sie sich dann die Folgen klarmachen, beruhigen sie sich fast immer wieder – es sei denn natürlich, sie sind betrunken, bekifft, zwischen vierzehn und einundzwanzig Jahre alt oder kommen aus Glasgow.
Bei Melinda trat der gewünschte Effekt zum Glück ein, und sie hörte fürs Erste auf zu schreien. Das Taxi verschwand, und als ich sicher war, dass sie nicht vor lauter Frust als Nächstes auf mich losgehen würde – das übliche Berufsrisiko –, hob ich die Schlüssel vom Boden auf und drückte sie ihr in die Hand.
»Möchten Sie jemanden anrufen?«, fragte ich. »Jemand, der herkommt und ein bisschen bei Ihnen bleibt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich setze mich einfach noch eine Weile ins Auto. Danke.«
Sie müssen mir nicht danken. Ich sprach die Floskel nicht aus. Ich tue nur …
Ja, was tat ich eigentlich gerade? Jedenfalls bezweifelte ich, dass ich an diesem Abend noch etwas Nützliches aus ihr herausbekommen würde, also ließ ich es dabei bewenden.
Manchmal braucht man nach einem langen Arbeitstag unbedingt ein Kebab. Ich kaufte mir eins bei einem Kurden in Vauxhall und setzte mich zum Essen ans Albert Embankment – kein Kebab im Jaguar, lautet eine eiserne Regel. Eine Seite des Embankment hatte in den 1960ern unter einem bedauerlichen Anfall von Modernismus schwer gelitten, aber ich wandte den einförmigen Betonfassaden den Rücken zu und sah stattdessen zu, wie die Sonne die Dächer des Millbank Tower und des Westminster Palace in rote Flammen tauchte. Der Abend war noch warm genug für kurze Ärmel, und die Stadt klammerte sich an den Sommer wie ein Möchtegern-Glamourgirl an einen vielversprechenden Mittelstürmer.
Offiziell gehöre ich zur ESC 9, das steht für Einheit 9 für Wirtschaftskriminalität und Spezialermittlungen, auch bekannt als Folly oder die Einheit, über die man in anständiger Gesellschaft nicht spricht. Es hat aber überhaupt keinen Sinn, sich ESC 9 merken zu wollen, weil die Metropolitan Police ungefähr alle vier Jahre umstrukturiert wird, und dann ändern sich alle offiziellen Bezeichnungen. Weshalb die Einheit für Schweren Raub aus dem Ressort Schwerverbrechen und Organisierte Kriminalität bei uns seit ihrer Gründung im Jahre 1920 nur als »Flying Squad« firmiert – oder »Sweeney«, wenn man sich bei der Cockney sprechenden Population empfehlen will. Wer sich wundert: »Sweeney Todd« reimt sich auf? Genau, »Flying Squad«.
Im Gegensatz zu Sweeney ist das Folly leicht zu übersehen: Teilweise deswegen, weil wir Dinge tun, über die niemand gern redet, aber hauptsächlich deswegen, weil wir kein erkennbares Budget haben. Kein Budget bedeutet, dass es keine bürokratischen Abläufe gibt und damit keine Datenspuren. Sehr hilfreich ist auch, dass die Einheit bis Januar dieses Jahres aus genau einer Person bestand: einem gewissen Detective Chief Inspector Thomas Nightingale. Obwohl sich unser personelles Kontingent verdoppelt hat, seit ich mit eingestiegen bin und versuche, die gut zehn Jahre unerledigten Papierkram aufzuarbeiten, spielen wir in der bürokratischen Hierarchie der Metropolitan Police immer noch eine äußerst diskrete Rolle. Und so bewegen wir uns still und unerkannt zwischen den anderen Ordnungshütern und tun unsere unergründliche Pflicht.
Zu unserer Pflicht gehört es unter anderem, unbefugten Zauberern und anderen Magie-Dilettanten auf die Schliche zu kommen. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass Cyrus Wilkinson nichts praktiziert hatte außer hochklassigem Saxofonspiel. Ich bezweifelte auch, dass er sich mit dem traditionellen Jazzercocktail aus Alkohol und Drogen den Rest gegeben hatte, wobei ich da auf die Auswertung der Drogentests warten musste. Warum aber sollte jemand Magie anwenden, um einen Jazzmusiker mitten im Auftritt umzubringen? Okay, ich habe auch so meine Probleme mit dem New Thing und diesen atonalen Avantgardisten, aber ich würde niemanden umlegen, nur weil er so was spielt – zumindest solange ich nicht über längere Zeit in einem Raum mit ihm eingesperrt wäre.
Am anderen Ufer löste sich mit aufheulendem Dieselmotor ein Katamaran vom Millbank Pier. Ich knüllte das Kebabpapier zusammen und warf es in einen Mülleimer. Dann stieg ich wieder in den Jaguar, ließ den Motor an und glitt in die Dämmerung hinein.
Ich würde mich wohl irgendwann in nächster Zukunft im Folly in die Bibliothek setzen und nach historischen Fällen zu dem Thema suchen müssen. Polidori zum Beispiel war immer für grelle Geschichten von Suff und Ausschweifungen gut. Das könnte eventuell damit zusammenhängen, dass er so lange dauerbedröhnt mit Byron und den Shelleys am Genfer See herumgehangen hatte. Wenn jemand über vorzeitige, unnatürliche Tode Bescheid wusste, dann Polidori, der buchstäblich das Werk dazu verfasst hatte, bevor er selbst zum Zyanid gegriffen hatte. Es heißt Eine Untersuchung unnatürlicher Todesfälle in London in den Jahren 1768–1810 und wiegt weit über ein Kilo – ich hoffte bloß, die Lektüre würde mich nicht auch in den Selbstmord treiben.
Als ich den Jaguar in der Remise des Folly abstellte, war es später Abend. Kaum öffnete ich die Hintertür, da fing Toby an zu kläffen, kam über den Marmorboden des Atriums auf mich zugeschlittert und warf sich gegen meine Schienbeine. Von der Küche her glitt Molly heran wie die Siegerin im internationalen Miss-Grusel-Gothic-Lolita-Wettbewerb. Ich ignorierte Toby und fragte, ob Nightingale noch wach sei. Molly legte den Kopf in der Weise schräg, die »nein« bedeutete, und sah mich dann fragend an.
Molly ist die Haushälterin, Köchin und Kammerjägerin des Folly. Sie spricht kein Wort, hat zu viele Zähne und eine Vorliebe für rohes Fleisch, aber ich versuche ihr das nicht übel zu nehmen und sie nie zwischen mich und den Ausgang kommen zu lassen.
»Ich bin todmüde, ich gehe gleich ins Bett«, sagte ich.
Molly warf einen Blick auf Toby, dann auf mich.
»Ich hab den ganzen Tag gearbeitet«, protestierte ich.
Molly neigte den Kopf zu einem Mir egal, aber wenn du den kleinen Stinker nicht Gassi führst, bist du derjenige, der’s aufwischt.
Toby hörte einen Moment lang auf zu bellen und sah erwartungsvoll zu mir auf.
Ich seufzte. »Wo ist die Leine?«
Die Öffentlichkeit hat ein recht verzerrtes Bild davon, wie eine polizeiliche Ermittlung abläuft. Sie malt sich gern aus, wie hinter heruntergelassenen Jalousien fieberhafte Beratungen abgehalten werden und unrasierte, aber auf verwegene Art gutaussehende Ermittler sich zielstrebig und aufopfernd in den Suff und die Ehekatastrophe hineinarbeiten. In Wirklichkeit geht man, falls man nicht auf irgendeine brandeilige Spur gestoßen ist, nach Feierabend nach Hause und widmet sich den wichtigen Dingen des Lebens – wie Essen, Trinken, Schlafen und, wenn man Glück hat, einer Beziehung zu jemandem mit Geschlecht und sexueller Orientierung nach Wunsch. Ich hätte am nächsten Morgen liebend gern zumindest einer dieser Tätigkeiten gefrönt, wäre ich nicht zufällig auch der letzte verdammte Zauberlehrling Englands gewesen. Was bedeutete, ich musste meine Freizeit damit verbringen, die Theorie der Magie zu studieren, tote Sprachen zu büffeln und Bücher zu lesen wie Abhandlungen über das Metaphysische von John »hasst Wörter, die nicht mindestens drei Silben haben« Cartwright.
Und natürlich zaubern zu lernen – weshalb sich das Ganze wenigstens lohnte.
Hier ist ein Zauberspruch: Lux iactus scindere. Sie können das leise oder laut sagen oder in dramatischer Pose während eines Gewitters deklamieren – nichts wird passieren. Das liegt daran, dass die Worte nur die äußere Gestalt der Formae sind, die Sie dabei im Geiste aufbauen: Lux, um Licht zu erschaffen, und Scindere, um es an einer Stelle zu fixieren. Führt man diesen Zauber richtig aus, dann erschafft er ein Licht, das an einem Ort verankert ist.
Verpatzt man ihn, kann er ein Riesenloch in einen Labortisch brennen.
»Wissen Sie«, sagte Nightingale, »ich glaube nicht, dass ich so etwas schon einmal erlebt habe.«
Ich verpasste dem Tisch einen letzten Spritzer aus dem Feuerlöscher und bückte mich, um nachzuschauen, ob der Boden unbeschädigt geblieben war. Ein kleiner Brandfleck war zu sehen, aber zum Glück kein Krater.
»Es haut mir immer wieder ab«, sagte ich.
Nightingale stand aus dem Rollstuhl auf und sah selbst nach. Er bewegte sich vorsichtig und belastete die rechte Seite kaum. Falls er noch einen Verband um die Schulter trug, verbarg er ihn unter einem frisch gebügelten fliederfarbenen Hemd, das ungefähr bei der Abdankung von König Edward in Mode gewesen war. Molly tat ihr Bestes, um ihn herauszufüttern, aber er war immer noch bleich und dünn. Er ertappte mich dabei, wie ich ihn prüfend ansah.
»Ich wäre froh, wenn Sie und Molly aufhören würden, mich derart zu mustern. Ich bin auf dem besten Wege der Genesung. Ich weiß, wovon ich rede, ich wurde ja nicht zum ersten Mal angeschossen.«
»Soll ich’s noch mal probieren?«
»Nein«, sagte er. »Das Problem liegt ganz offensichtlich beim Scindere. Ich dachte mir schon, dass Sie sich das nicht gründlich genug erarbeitet haben. Morgen fangen wir mit der Forma noch einmal von vorn an, und sobald ich mir sicher bin, dass Sie sie richtig beherrschen, versuchen wir es wieder mit diesem Zauber.«
»Halleluja«, sagte ich.
»Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich«, versicherte er in ermutigendem Tonfall. »Sie müssen die Grundlagen unserer Kunst einwandfrei beherrschen, sonst wird alles, was Sie darauf aufbauen, fehlerhaft und darüber hinaus instabil. In der Zauberei gibt es keine bequemen Lösungen, Peter. Wenn es sie gäbe, würde sie jeder praktizieren.«
Oh ja, zum Beispiel in England sucht den Zauberstar, dachte ich, aber so ein Kommentar wäre bei Nightingale fehl am Platz, weil er, was die Zauberkunst anging, keinen Spaß verstand und sich im Fernsehen sowieso nur Rugby anschaute.
Ich setzte die aufmerksame Miene des pflichteifrigen Lehrlings auf, aber Nightingale ließ sich nicht täuschen.
»Erzählen Sie mir von Ihrem toten Musiker.«
Ich informierte ihn über alles, wobei ich betonte, wie stark die Vestigia gewesen waren, die Dr.Walid und ich in der Nähe des Leichnams gespürt hatten.
»Hat er sie genauso stark empfunden wie Sie?«, wollte Nightingale wissen.
Ich hob die Schultern. »Es waren Vestigia, Boss. Stark genug, dass wir beide eine Melodie hören konnten. Das ist doch verdächtig.«
»Verdächtig ja«, meinte er und ließ sich stirnrunzelnd wieder in seinem Rollstuhl nieder. »Aber ist es ein Verbrechen?«
»Im Gesetz heißt es zur Definition eines Mordes nur, dass man einen Menschen unter dem Frieden der Königin unrechtmäßigerweise aus niederen Beweggründen getötet haben muss. Wie, davon steht da nichts.« Das hatte ich vor dem Frühstück in Blackstone’s Enzyklopädie für das Polizeiwesen nachgeschlagen.
»Es dürfte interessant werden, mitzuerleben, wie die Staatsanwaltschaft das den Geschworenen unterbreitet«, sagte er. »Zuerst müsste man beweisen, dass er durch Magie getötet wurde, und dann herausfinden, wer in der Lage ist, so etwas zu tun und es aussehen zu lassen wie einen natürlichen Tod.«
»Könnten Sie’s?«
Nightingale musste kurz nachdenken. »Ich denke schon«, sagte er dann. »Zuvor müsste ich einige Zeit in der Bibliothek verbringen. Es müsste ein sehr mächtiger Zauber sein. Möglich, dass die Musik, die Sie gehört haben, das Signare des Praktizierenden ist – seine unverwechselbare Handschrift, seine Signatur. So wie früher die Telegrafenbeamten einander an der Art und Weise erkennen konnten, wie sie die Tasten bedienten, so hat auch jeder Praktizierende eine persönliche, einzigartige Weise, einen Zauber zu wirken.«
»Hab ich auch eine Signatur?«, fragte ich.
»Oh ja. Wenn Sie zaubern, haben die Dinge in Ihrer Umgebung die verhängnisvolle Tendenz, in Flammen aufzugehen.«
»Im Ernst, Boss.«
»Für ein Signare sind Sie noch nicht weit genug, aber ein anderer Praktizierender würde sicherlich erkennen, dass Sie mein Lehrling sind. Vorausgesetzt natürlich, er wäre mit meiner Arbeit vertraut.«
»Gibt es denn noch andere Praktizierende?«
Nightingale setzte sich in seinem Rollstuhl zurecht. »Es gibt ein paar Überlebende aus dem Verein vor dem Krieg. Aber abgesehen davon sind Sie und ich die letzten klassisch ausgebildeten Zauberer. Das heißt, Sie werden es sein, sofern Sie je genug Konzentration aufbringen, um sich klassisch ausbilden zu lassen.«
»Könnte einer von diesen Überlebenden hinter meinem Fall stecken?«
»Nicht, wenn zu dem Signare Jazz gehört.«
Und folglich wohl auch keiner ihrer Lehrlinge – falls sie Lehrlinge hatten.
»Wenn es keiner von Ihrem Verein war …«
»Unserem Verein«, sagte Nightingale. »Sie haben einen Eid abgelegt. Damit gehören Sie zu uns.«
»Wenn es keiner von unserem Verein war, wer könnte so was noch zustande bringen?«
Nightingale lächelte. »Jemand von Ihren Freunden vom Fluss hätte sicherlich genug Macht.«
Das gab mir zu denken. Es gab zwei Götter der Themse, und beide hatten mehrere eigensinnige Kinder, eines für jeden Zufluss. Sie besaßen unbestreitbar große Macht – ich hatte persönlich miterlebt, wie Beverley Brook ganz Covent Garden geflutet hatte, womit sie rein zufällig mir und einer Familie deutscher Touristen das Leben rettete.
»Aber Vater Themse würde nicht unterhalb der Teddington-Schleuse aktiv werden«, fuhr Nightingale fort. »Und Mama Themse würde unsere Abmachung nicht aufs Spiel setzen. Wenn Tyburn jemanden tot sehen wollte, würde sie ihn auf dem Rechtsweg ruinieren. Fleet würde ihn in den Medien auseinandernehmen. Brent ist zu jung. Und abgesehen davon, dass Soho am falschen Ufer liegt – wenn Effra jemanden mit Musik umbringen wollte, dann sicherlich nicht mit Jazz.«
Nicht, wo sie praktisch die Schutzheilige des britischen Grime ist, dachte ich. »Gibt es noch andere?«, bohrte ich. »Andere Irgendwas?«
»Möglich«, sagte Nightingale. »Aber bevor Sie sich zu sehr auf das Wer versteifen, würde ich empfehlen, dass Sie sich näher mit dem Wie beschäftigen.«
»Irgendein Tipp?«
»Fangen Sie doch damit an, sich den Tatort anzusehen.«
Sehr zum Missfallen der herrschenden Klasse, die in ihren Städten gern Sauberkeit, Ordnung und freies Schussfeld hat, zeigte sich London nie sehr gefügig, was großangelegte Planungsprojekte anging, nicht einmal, nachdem es 1666 bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Nichtsdestoweniger gab es immer wieder Unverzagte, die einen solchen Versuch wagten, und in den 1880ern entwarf der Großstädtische Ausschuss für öffentliche Bauten die Charing Cross Road und die Shaftesbury Avenue, um bessere Verbindungen von Nord nach Süd und von Ost nach West zu schaffen. Dass dabei auch gleich die berüchtigten Newport Market Slums beseitigt wurden und sich somit die Anzahl unästhetisch ärmlicher Individuen, denen man beim Flanieren durch die Stadt begegnete, drastisch reduzierte, war sicherlich nur eine erfreuliche Begleiterscheinung. Wo sich die Road und die Avenue kreuzen, entstand der Cambridge Circus, dessen Westseite heute vom Palace Theatre und dessen spätviktorianischer Lebkuchenpracht beherrscht wird. Daneben steht das im selben Stil erbaute Bauwerk, das einst als Wirtshaus George and Dragon bekannt war und heute Spice of Life heißt. Laut Eigenwerbung Londons erste Adresse für guten Jazz.
Damals, als mein Dad noch auftrat, war das Spice of Life alles andere als eine Jazzkneipe. Laut seiner Aussage bestand die Kundschaft aus Typen mit Rollkragenpullovern und Kinnbärten, die Folk hörten und Gedichte rezitierten. In den Sechzigern spielte Bob Dylan dort ein paarmal, und Mick Jagger auch. Aber damit konnte mein Dad gar nichts anfangen – er sagte immer, Rock’n’Roll sei okay für Leute, die von allein nicht in der Lage seien, einem Rhythmus zu folgen.
Bis zu diesem Mittag hatte ich noch nie einen Fuß ins Spice of Life gesetzt. Vor meiner Zeit als Polizist war es nicht die Art Pub, wo ich was trinken ging, und seither war es nicht die Art Pub, wo ich Leute verhaftete.
Ich hatte meinen Besuch so gelegt, dass ich den Mittagsandrang vermied, was bedeutete, dass die Menge, die sich am Circus auf die Füße trat, hauptsächlich aus Touristen bestand und es im Pub angenehm kühl, dämmrig und leer war. In der Luft hing ein Hauch von Reinigungsmitteln, der versuchte, sich gegen Jahre verschütteten Biers zu behaupten. Ich wollte ein Gefühl für den Ort bekommen, und die natürlichste Methode dafür schien mir, an der Theke ein Bier zu trinken. Weil ich im Dienst war, nahm ich nur ein kleines. Anders als vielen Londoner Pubs war es dem Spice of Life gelungen, sich seine Einrichtung aus poliertem Holz und Messing zu erhalten und trotzdem nicht ins Kitschige abzugleiten. Als ich an der Theke stand und den ersten Schluck nahm, wehte mich eine Ahnung von Pferdeschweiß und Gehämmer auf einem Amboss an, Rufen und Lachen, der ferne Schrei einer Frau und Tabakgeruch – ziemlich typisch für ein Pub mitten in London.
Die Söhne von Mūsa ibn Shākir waren scharfsinnig und kühn, und wären sie keine Muslime gewesen, sie wären heute vermutlich die Schutzheiligen der Nerds und Erfinder. Sie sind berühmt für ihren im neunten Jahrhundert in Bagdad verfassten Bestseller, eine Sammlung von Beschreibungen genialer technischer Erfindungen, die sie originellerweise auch genauso nannten: Kitab al-Hiyal, das Buch der genialen Erfindungen. Darin beschreiben sie den wohl ersten brauchbaren Apparat, mit dem man Druckdifferenzen messen kann. Damit ging es erst richtig los. 1593 nahm sich Galileo Galilei eine Auszeit von seinen Hauptbeschäftigungen Astronomie und Ketzerei und erfand mal rasch ein Thermoskop, also einen Hitzemesser. 1833 erfand Carl Friedrich Gauß ein Gerät zum Bestimmen der Stärke eines Magnetfelds, und 1908 baute Hans Geiger ein Instrument, das ionisierende Strahlung aufspürte. Heutzutage entdecken Astronomen Planeten, die um weit entfernte Sterne kreisen, indem sie messen, wie stark deren Umlaufbahn eiert, und die klugen Köpfe bei CERN lassen haufenweise Partikel aufeinanderprallen in der Hoffnung, dass irgendwann Doctor Who auftaucht und ihnen sagt, sie können aufhören. Die Geschichte der Technik, mit deren Hilfe wir das physische Universum messen, ist die Geschichte der Wissenschaft selbst.
Und was hatten Nightingale und ich, um Vestigia zu messen? Einen feuchten Dreck – und es ist auch nicht so, als ob wir gewusst hätten, was wir überhaupt messen sollten. Kein Wunder, dass die Erben von Isaac Newton die Magie sicher unter ihren gepuderten Perücken verwahrten. Der Not gehorchend hatte ich eine eigene Skala für Vestigia aufgestellt, die auf der Stärke von Tobys Gekläff basierte, wenn er mit Magieresten in Berührung kam. Meine Einheit war das Wuff. Ein Wuff entsprach einem Vestigium in einer Stärke, dass ich es spontan spürte, ohne danach zu suchen.
Ein Eintrag im Internationalen Einheitensystem war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich legte jedenfalls die Standard-Hintergrundmagie eines Pubs in der Londoner Innenstadt als 0,2 Wuff (0,2 wf) oder 200 Milliwuff (200 mwf) fest. Als ich das zu meiner Zufriedenheit geklärt hatte, trank ich mein Bier aus und machte mich auf den Weg in den Keller, wo der Jazz wohnte.
Über eine knarrende Treppe erreichte ich die Backstage Bar, einen annähernd achteckigen Raum mit niedriger Decke und vereinzelten dicken cremefarbenen Säulen, die vermutlich Stützfunktion hatten, denn zur Optimierung des Blickfelds trugen sie definitiv nicht bei. Als ich im Türrahmen stand und versuchte, ein Gefühl für eventuelle magische Unterströmungen zu bekommen, stellte ich fest, dass meine Kindheit dabei war, meine Ermittlungen zu gefährden.
1986 kam Journey to the Urge Within von Courtney Pine heraus, und plötzlich war Jazz wieder in, und mein Vater stieg zum dritten und letzten Mal in seinem Leben beinahe in die luftigen Höhen von Ruhm und Reichtum auf. Bei seinen Gigs war ich nie dabei, aber in den Schulferien nahm er mich oft in Clubs oder Aufnahmestudios mit. Manche Eindrücke bewahrt man selbst aus der Zeit vor dem Einsetzen der bewussten Erinnerung – schales Bier, Tabakrauch, der Klang einer Trompete, wenn sich der Trompeter warm spielt. In diesem Keller hätten sich zweihundert Kilowuff Vestigia verstecken können, ich wäre nicht fähig gewesen, sie von meinen eigenen Erinnerungen zu trennen.
Ich hätte Toby mitbringen sollen, der wäre von größerem Nutzen gewesen als ich. In der Hoffnung, dass es etwas bringen würde, näher ranzugehen, trat ich direkt vor die Bühne.
Mein Dad sagte immer, ein Trompeter richtet seine Waffe auf das Publikum, aber ein Saxofonist liebt es, ein gutes Profil abzugeben, und hat immer eine bevorzugte Seite. Es gehörte zum Credo meines Dad, dass niemand ein Rohrblattinstrument auch nur anfasst, dem es nicht wichtig ist, wie sein Gesicht aussieht, wenn er hineinbläst. Ich stellte mich auf die Bühne und nahm ein paar typische Saxofonistenposen ein. Und da begann ich etwas zu spüren, vorn rechts auf der Bühne, ein kleines Prickeln und die Melodiestimme von Body and Soul, wie aus weiter Ferne, schneidend und bittersüß.
»Erwischt«, sagte ich.
Da das magische Echo eines ganz bestimmten Jazzstücks derzeit meine einzige Spur war, überlegte ich, dass es wahrscheinlich angebracht wäre, herauszufinden, um welche der etlichen hundert Coverversionen von Body and Soul es sich handelte. Was ich brauchte, war ein Jazzexperte, der so besessen von seinem Thema war, dass er darüber seine Gesundheit, seine Ehe und seine eigenen Kinder vernachlässigte.
Mit anderen Worten, meinen Dad.