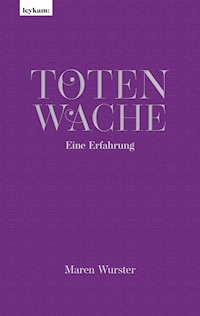Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maren Wurster erzählt die Geschichte einer Frau, die vor ihrer Mutterschaft flieht, und die eines Jungen, der mutterlos aufwächst. „Die außergewöhnlichste Mutter-Sohn-Geschichte, die ich je gelesen habe.“ (Stefanie de Velasco) Eine Frau versteckt sich in einem Ferienhaus, aus ihren Brüsten läuft Milch, sie kauert sich zusammen, versucht die Stimme ihres Babys aus dem Kopf zu bekommen, des kleinen Jungen, der immer schreit und nie schläft. Vor ihm ist sie weggelaufen. Ein Junge lebt im Internat, seine Mutter hat er nie kennengelernt. Wenn er in der Werkstatt mit Holz arbeitet, spürt er eine wütende Energie, die er genießt und nicht versteht und die ihn antreibt, etwas im Holz freizulegen, aber was? In einer so präzisen wie unerschrockenen Sprache erzählt Maren Wurster von der Einsamkeit eines zurückgelassenen Kindes und der Verzweiflung einer Mutter, die eine radikale, gesellschaftlich geächtete Entscheidung trifft, und lässt dabei beide Perspektiven aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zurollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Maren Wurster erzählt die Geschichte einer Frau, die vor ihrer Mutterschaft flieht, und die eines Jungen, der mutterlos aufwächst. »Die außergewöhnlichste Mutter-Sohn-Geschichte, die ich je gelesen habe.« (Stefanie de Velasco)Eine Frau versteckt sich in einem Ferienhaus, aus ihren Brüsten läuft Milch, sie kauert sich zusammen, versucht die Stimme ihres Babys aus dem Kopf zu bekommen, des kleinen Jungen, der immer schreit und nie schläft. Vor ihm ist sie weggelaufen. Ein Junge lebt im Internat, seine Mutter hat er nie kennengelernt. Wenn er in der Werkstatt mit Holz arbeitet, spürt er eine wütende Energie, die er genießt und nicht versteht und die ihn antreibt, etwas im Holz freizulegen, aber was? In einer so präzisen wie unerschrockenen Sprache erzählt Maren Wurster von der Einsamkeit eines zurückgelassenen Kindes und der Verzweiflung einer Mutter, die eine radikale, gesellschaftlich geächtete Entscheidung trifft, und lässt dabei beide Perspektiven aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zurollen.
Maren Wurster
Eine Beiläufige Entscheidung
Roman | Hanser Berlin
Ein kläglicher Laut. Sie zuckte zusammen. In ihren Brüsten zog es, Milch schoss heraus. Warm. Drängend. Es war ein Lamm, das schrie, irgendwo da draußen vor dem Fenster. Lena rannte in den Flur, schlug die Tür hinter sich zu. Wie schwer ihre Brüste waren, bei jeder Bewegung, selbst beim Atmen spürte sie das Gewicht, allein dadurch, dass ihr Brustkorb sich hob und senkte. Das Lamm blökte wieder, noch entfernt zu hören, gedämpft hinter Tür, Raum und Fenster. Die Milch floss weiter, klebte Lenas Oberteil an die Haut. Um die Brustwarzen wurde der grüne Stoff dunkler, in größer werdenden, ovalen Flecken. Lena öffnete das Hemd, fing die Milch in den Händen auf, sie sammelte sich zwischen den Fingern und tropfte auf den Holzboden. Als sie es wieder schloss, waren die feuchten Stellen kühl und unangenehm.
Im Flur gab es einen in die Wand eingelassenen Schrank, ein Kessel war darin, Kupferrohre gingen von ihm ab, in den Fächern darüber lagen Handtücher und Wolldecken. Darin würde sie nichts mehr hören, auch nicht das Lamm. Lena legte eine Decke auf den Schrankboden, polsterte die Rückwand mit einem Handtuch und setzte sich neben den Kessel, die Beine eng an den Körper gezogen. Mit Schwung zog sie die Türen zu sich heran, ließ rechtzeitig los, um ihre Finger nicht einzuklemmen. Beim dritten Versuch schlossen sich die Türen, vorsichtig stellte sie die Füße dagegen. Ein schmaler Lichtstrahl fiel durch den Spalt in den Schrank, knickte am Kessel ab und lief daran entlang nach oben. Der Kessel war weder warm noch kalt. Seine Oberfläche, dessen Material Lena nicht benennen konnte, war uneben und in der Unebenheit ganz gleichförmig. Als hätte jemand es mit einem breiten Daumen besonnen und strukturiert bearbeitet, bevor es sich verhärtete.
Lena wachte auf und wusste nicht, wo sie war, bis sie die raue Decke spürte und gleichzeitig ihr Knie, das wie ihr ganzer Körper zitterte und dadurch gegen den Kessel schlug. Ihr Gesicht glühte. Die Luft war verbraucht und schwer, sauer roch es, vergoren. Die Brüste waren hart. Lena tastete sie ab. Das waren keine vollen Milchbrüste mehr, sie fühlten sich an wie mit Steinen gefüllte Lederbeutel. Würden sie nicht so schmerzen, könnte sie glauben, sie gehörten nicht zu ihr. Als sie vorsichtig das Hemd anhob, das von getrockneter Milch steif war, sah sie im fahlen Licht des Schranks dunkle Stellen auf der Haut, die linke Brust war schlimmer betroffen. Lena lehnte den Kopf an den Kessel, tief in seinem Inneren surrte etwas. Sie musste pinkeln, doch sie wusste nicht, wie sie überhaupt aufstehen sollte. Sie zog das Handtuch hinter dem Rücken weg, hielt es sich in den Schritt und ließ das Wasser laufen, das sich warm im Stoff verteilte.
Lena hatte Robert bei einem Seminar zur Selbsterfahrung in der Natur kennengelernt, zu dem das Modelabel, für das Lena arbeitete, sie geschickt hatte. Eine Woche war sie auf einer Hütte am Fuße des Göritzer Törls. Es gab einen Raum, in dem sie zu siebt schliefen, die Teilnehmer und Georg, der Bergführer. Und einen Raum fürs Kochen und Zusammensitzen mit einem Kachelofen, an den sie abends Socken und Anzüge hingen. Es roch nach Suppe, Kaffee, nasser Kleidung und Holz. Am Morgen ging es um sieben Uhr los. Die Sonne stand knapp über dem Hügelkamm. Manche ließen die Arme kreisen oder rieben sich die Hände. Lena rauchte eine imaginäre Zigarette und fächelte ihren wolkigen Atem von den anderen weg. Robert lachte darüber, ein großer und schöner Mann mit auffallend hellen Augen. Sie übten, wie sie die Harscheisen an den Skiern anbringen mussten, prüften die Lawinenpiepser, die sie an einem Gurt unter der Kleidung trugen, banden die Skier so zusammen, dass sie eine Trage bilden konnten. Gegenseitig mussten sie sich tragen, sowohl auf ebener Fläche als auch einen Abhang hinunter. Mehrere Male ließ Georg sie die Konstruktion zusammenbinden und wieder auseinandernehmen.
»Niemand geht oder fährt alleine. Niemals«, sagte Georg, »bei Nebel kann die Sicht unter zehn Metern liegen. Das geht schnell. So schnell könnt ihr gar nicht schauen. Wie viel sind zehn Meter?«
Sie sollten es abmessen.
Dann gingen sie hintereinander her. Georg hatte den Weg grob skizziert, einen Bogen mit seinem Arm gezeichnet, von einer Schlucht und Schneewehen erzählt, auf einen Gipfel gezeigt, der so weit entfernt lag, dass Lena sich nicht vorstellen konnte, wie sie ihn erreichen sollte. Doch sie fand rasch in den Rhythmus, auf ihre Vorderfrau achtend, eine Juristin mit X-Beinen und kräftigem Stockeinsatz. Lena schob einen Ski vor den anderen, die Waden spannten sich abwechselnd an, sie setzte die Stöcke in den Schnee, neben, manchmal direkt in den Blumenabdruck eines anderen Skistocks. Als sie nach einiger Zeit zurücksah, war die Hütte schon nicht mehr zu sehen. Lenas Gesicht war feucht vom Atem, kalt vom Wind und heiß von innen.
Am dritten Tag fühlte sie sich schon beim Losgehen schlapp. Immer wieder musste sie anhalten, die anderen warteten auf sie, jeder Schritt war anstrengend. Sie sah zwar, dass der Schnee glitzerte, konnte sich dafür aber nicht wie an den anderen Tagen begeistern. Bei einer Teepause fragte Georg, wie es ihr gehe. Lena schüttelte den Kopf.
»Kannst du guten Kaffee machen?«, fragte er.
Sie nickte.
»Dann brau uns einen in der Hütte, so stark, dass wir heute Nacht nicht zu schlafen brauchen.«
Lena sah ihn fragend an. Und Georg wies auf Robert und Pamela. »Ihr schlagt Sahne dazu.« Er zeigte ihnen, wie sie zur Hütte abfahren, wo sie zwischendurch halten und aufeinander warten sollten.
»Bleib einfach direkt hinter mir«, sagte Robert.
Mit wackeligen Beinen fuhr Lena ihm nach. Robert zog lange Bögen mit schmal gestellten Skiern, und das trotz des Tiefschnees. Er machte mehr Pausen als nötig und lächelte sie unter seiner Skibrille jedes Mal an, wenn sie neben ihm zum Stehen kam. Als die Hütte in Sichtweite vor ihnen lag, winkte Pamela den beiden zu und wedelte elegant hinab. Lena fuhr weiterhin hinter Robert her. Als sie ankamen, öffnete sie die Bindung, ließ sich in den Schnee fallen und machte mit müden Armen und Beinen einen Engel. Ein blauer gleißender Himmel über ihr. Robert reichte ihr die Hand und zog sie wieder hoch.
Am vorletzten Abend auf der Hütte stapften Lena und Robert ins Dorf hinab. Sie gingen über Flächen, die im Mondschein weiß leuchteten, überquerten eine geschotterte Straße, ihre Sohlen knirschten. Einmal sank Lena so tief in den Schnee ein, dass er in ihren Stiefel quoll. Sie spürte, wie der Schnee an der Haut schmolz. Der Fuß war beim Gehen nun etwas schwerer. Im Dorf gab es ein Gasthaus, die Stube war qualmig und warm. An einem langen Tisch saßen mehrere Männer, einer hatte den Kopf auf die Tischplatte gelegt, und sein speckiger Hut lag offen vor ihm. Kurz wurde alles still, dann rief einer der Männer Lena und Robert zu sich. Auf der Bank wurde Platz gemacht, sie setzten sich, Lenas Schenkel drückte sich an Roberts. Robert erwiderte die Berührung. Schnaps wurde gebracht. Lenas Wangen wurden heiß, und sie zog unterm Tisch die Stiefel aus. Der Mann neben ihr stellte sich als Bürgermeister vor. Er schüttete aus einer Dose Schnupftabak auf seinen Handrücken und zog ihn in das eine, den Rest in das andere Nasenloch. Dann hielt er den Tabak Lena und Robert hin. Sie machten es ihm beide nach. Ein bitterer Reiz, es kribbelte, und Lena unterdrückte ein Niesen. Robert legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
»Das Kokain der Berge«, sagte er.
Sie waren rasch betrunken und auf eine angenehme Weise aufgedreht. Lena flirtete mit dem Bürgermeister. Wickelte sogar spielerisch eine Strähne um den Finger und zwinkerte Robert zu, was ihn zum Lachen brachte. Zwischendurch versicherten sie einander, wie toll es gewesen war, sich aufzumachen, nicht wie die anderen im Schlafraum zu liegen und die Anstrengung der Tour auszuschwitzen.
»Diese Langweiler«, sagte Robert.
»Wo kommts ihr her?«, fragte ein Mann am Tisch, er hatte ein grobschlächtiges Gesicht mit glasigen Augen und einem sanften Blick.
»Berlin«, sagte Robert.
»Berlin«, sagte Lena.
»Kinder?«
»Wie bitte?«, fragte Lena.
»Zwei«, sagte Robert, »die Große ist sechs, kommt im Sommer in die Schule. Der Kleine ist drei. Liselotte und Konrad.«
»Liselotte? Nie und nimmer«, flüsterte Lena in Roberts Ohr, ihre heiße Wange berührte die von Robert.
»Sie spielen auf dem Spielplatz, auf dem wir schon als Kinder gespielt haben. Wir kennen uns seit dem Sandkasten.« Roberts Wange löste sich von ihrer, sein Blick flirrte zwischen ihren Augen hin und her, obwohl er zu dem Mann sprach.
»Der war früher direkt an der Mauer, der Sandkasten«, sagte Lena.
»Osten oder Westen?«, fragte der Mann.
»Westen«, sagten sie beide.
Der Bürgermeister bestellte weiteren Schnaps. Robert trommelte mit den Händen auf die Tischplatte. Ein Mann stimmte ein, erweiterte Roberts Rhythmus, der sich auf das Spiel einließ, neue Variationen erfand. Lena griff ihm in den Nacken, es war eine spontane Regung, der sie nachgab. Sie fuhr durch seine Stoppeln. Robert kam aus dem Takt und legte den Kopf auf ihre Schulter. Am Kinn spürte Lena seinen warmen Atem.
Sie gingen erst, als der schlafende Mann von zwei anderen geweckt und dann unsanft an den Armen, den Hut schief ins Gesicht gezogen, nach draußen geführt wurde. Stühle wurden auf den Tisch gestellt. Der Bürgermeister beglich die Rechnung, auch ihre, und lud sie zum Gottesdienst am kommenden Sonntag ein.
»Ja«, sagte Lena und küsste ihn auf die Wange und wusste schon nicht mehr, wann genau der Gottesdienst stattfinden sollte.
Hand in Hand rannten Robert und sie, soweit der Schnee und ihre Kräfte es zuließen, zurück. Robert stolperte und zog Lena mit in den Schnee, die laut lachen musste. Sie fanden ihre Spur vom Hinweg und traten in die Stapfen. Stritten sich, welche von wem gewesen waren.
»Nie und nimmer habe ich so riesige Füße«, sagte Lena, »ich bin hier gelaufen und du da drüben.«
»Nee, das ist eindeutig mein Gang, stolz und erhaben«, sagte Robert, »ich will in meinen Abdrücken zurückgehen.«
»Das sind nicht deine.«
»Doch.«
»Nein.«
»Ich hab die Lösung!« Robert drehte Lena den Rücken zu, ging in die Hocke. Sie verstand und sprang auf. Umschlang seinen Hals, drückte ihr Gesicht in seine Haare. Und ließ sich wiegend tragen.
Vor der Hütte fielen sie erneut in den Schnee.
»Musik?« Robert keuchte und lachte.
»Musik!«
»Deine oder meine?«
»Deine. Lass mal hören.«
Irgendwann kroch Lena doch aus dem Schrank heraus. Sie ertrug den eigenen Geruch darin nicht mehr, die feuchtwarme Luft, die Enge. Und sie musste die Milch loswerden. Schlotternd stand sie vor der Badewanne und wartete. Der Boiler erhitzte brummend das Wasser. Als sie in den Spiegel sah, erschrak sie. Vor allem über ihren Blick, der wirr wirkte. Und mager war sie geworden, unter den Jochbeinen fielen die Wangen ein wenig ein. Schön eigentlich, wenn sie sich nicht so schrecklich fühlen würde. Oder eher so überhaupt gar nicht fühlte, nur der Körper eine einzige Entzündung. Auch die Brüste, sie konnten glatt operiert sein, so prall standen sie ab. Lena machte einen Schritt auf dem kalten Boden zum Spiegel hin. So konnte sie ihren Bauch sehen. Er war immer noch faltig, mehr Haut als Muskeln. Ohne Narbe, dabei hatte sie so gebettelt, um den Schnitt durch die Bauchdecke und vor allem die Vollnarkose.
Das heiße Wasser tat gut. Das Gewebe wurde weicher. Milch floss. Auch nachdem sie aus der Wanne gestiegen war. Lena fing sie in einem Glas auf, sah aus wie trübes Wasser. Allmählich, Lena strich die Brüste nun mit der Hand aus, wirkte die Milch sämiger, nahrhafter. Sie schwenkte das Glas hin und her, die Milch hinterließ einen wellenförmigen Rand. Lena setzte es an und trank.
»Hallo. Ich bin’s, deine Sandkastenliebe.«
»Hallo du, süßeste Spielkameradin Westberlins.«
»Weißt du noch, wie ich das Mädchen mit der Schaufel geschlagen habe und ihre Lippe geblutet hat, weil sie mit dir eine Sandburg bauen wollte?«
»Schon damals warst du so eifersüchtig. Sexy. Und weißt du noch, wie wir uns im Kletterturm, oben in dem kleinen Häuschen, versteckt haben? Weil wir partout nicht nach Hause wollten.«
»Schon damals nicht.«
»Deine Mama hatte gerufen. Und wir haben uns gegenseitig die Hände gedrückt, um nicht zu lachen.«
»Und als wir auf der Schaukel geraucht haben? Die geklaute Zigarette deines Vaters?«
»Dir war so übel.«
»Und als ich mich zu dir auf den Schoß gesetzt habe, auf der Schaukel?«
»Was hast du dann gemacht?«
»Geschaukelt.«
»Warst du mit dem Rücken zu mir?«
»Nein, ich hatte meine Beine um dich gelegt. Und mich dabei so an dir gerieben.«
»Meine erste Erektion.«
»Ich konnte sie durch die Hose hindurch fühlen.«
»Ich leg mal kurz den Hörer zur Seite. Zieh dich aus währenddessen.«
»Schon geschehen.«
Ihr Leben bestand aus Arbeit, viel Arbeit, Ausgehen und wenig Schlaf. Sie gefielen sich darin. Robert wurde Berater und betreute sein erstes eigenes Projekt für ein Unternehmen in Süddeutschland, das Anlagen für Biokraftstoff produzierte und in Tansania eine Niederlassung eröffnete. Zu seinen Aufgaben gehörte, die Mitarbeiter zu schulen, kulturell sensibel vorzugehen. Es gab ein eigens entwickeltes Konzept für interkulturelle Kompetenz, das auf Kommunikationen und Handlungen übertragen werden sollte. Nicht nur Wohnen, Essen, Gepflogenheiten spielten eine Rolle, auch Gesten, innere Haltungen. Es ging darum, emotionale und kognitive Muster von Kunden und Mitarbeitern besser antizipieren, vielleicht sogar verinnerlichen zu können. So erklärte Robert es Lena, mit Worten, die ihr wie aus einem Prospekt erschienen. Sie selbst folgte dem Auf und Ab der Mode-Saisonen, was sich wie ein permanenter Ausnahmezustand anfühlte. Kaum war eine Kollektion für die Produktion bereit, war die nächste längst überfällig, immer gepaart mit dem Druck, das Noch-nie-Gesehene zu kreieren. Lena selbst arbeitete an konzeptionellen Fragen. Wie konnte Mode ethisch verantwortlich produziert werden und genau deswegen attraktiv und besonders sein? Nicht nur eine Frage der Stoffe, wie sie hergestellt und verarbeitet wurden, sondern auch — dabei kam ihr Bereich ins Spiel — von Gesichtern, Einstellungen, Settings. Selbst in der Schrifttype sollte etwas zu finden sein, das verantwortungsbewusst, beständig und zugleich überraschend wirkte.
Waren sie beide in Berlin, trafen sie sich abends in einem Restaurant oder einer Bar, tranken viel und sprachen über ihre Arbeit. Dabei sprangen sie von einem zum anderen, so viel hatten sie sich zu erzählen. Etwa wie die Sonne aus dem Meer auftauchte am Strand von Pangani, vom hysterischen Geschrei einer der Designerinnen, das abrupt enden konnte, als wäre ein Stück aus der Zeit herausgeschnitten worden, wenn sie sich wieder konzentriert und mit ruhiger Stimme einer Abnahme widmete, von den nächtlichen Stunden am Schreibtisch, Kollegen und Kolleginnen, »wie heißt die Schlampe?«, fragte Lena, der Sehnsucht nacheinander unterwegs. Lena fasste in Roberts Schritt. Einmal gingen sie nach einer langen Nacht morgens ins Freibad und sprangen in Unterwäsche ins Wasser.
»Philipp, mein Bruder, zieht jeden Morgen seine Bahnen«, sagte Robert, als sie nebeneinander am Beckenrand saßen, »ausgeschlafen und nüchtern, versteht sich.« Lenas Haare auf den Oberschenkeln standen ab, sie betrachteten sie beide. »Er belächelt, was ich mache. Kommt sich groß und wichtig vor, der Herr Doktor. Und schreibt doch nur immer das Gleiche, unter unterschiedlichen Überschriften.« Robert legte die Hand auf die Wasseroberfläche, er hatte schmale lange Finger. »Zu Hause sitzt er mit meinem Vater zusammen, schwenkt seinen Rotwein und spricht vom linguistic gap. Meine Mutter bewegt sich dann immer so leise, um die beiden nicht zu stören. Sie kann Gläser abräumen, ohne ein Geräusch zu machen.«
Lenas Rhythmus bestand nicht aus Tagen, sondern unterschiedlichen Phasen, wach zu sein. Selten schlief sie tief und traumlos, und wenn, dann meist nur kurz. Unbestimmte Zeiten verbrachte sie in fiebrigen Zuständen im Schrank oder auf dem Bett. Manchmal konnte sie sich nicht erinnern, wie und wann sie von dem einen in den anderen Raum gekommen war. Einmal betrachtete sie ausgiebig das Laken, wie es an der Matratze klebte und mit einem großen Fleck an die Lage ihres schwitzenden Körpers erinnerte. Dann wieder hörte sie das Baby weinen, konnte nicht orten, wo genau, irrte durch die Zimmer und rutschte auf einem Teppich aus. Rieb ihr Gesicht heftig und lange in die Schurwolle, erst die eine Wange, die andere, dann Nase und Stirn, bis es brannte. In klareren Momenten kühlte sie die linke Brust mit einem Handtuch, das sie in den Kühlschrank gelegt hatte. Tupfte den Eiter vorsichtig ab. Als sie lange und heiß badete, löste sich ein Pfropfen, und, nachdem zunächst etwas Blut austrat, floss wieder Milch.
Im Wandschrank über der Spüle fand sie neben drei Streuern mit Rosmarin und einem mit Pfeffer Instantkaffee und Honig. Der Kaffee war eingetrocknet und schon längst über das Verfallsdatum hinaus. Lena schabte die Körner mit einem Löffel raus und übergoss sie mit heißem Wasser. Ihre Milch hellte das Getränk auf. Sie gab so viel dazu, bis es beige war. Nach längerem Rühren löste sich auch der Klumpen Honig auf. Wie intensiv der Kaffee roch, wie süß er schmeckte. Sie spürte, wie die Flüssigkeit durch ihre Speiseröhre in den Magen rann. Sie trank in hastigen, kleinen Schlucken. Stellte sich dafür an die Tür und lehnte sich an den Rahmen mit der Tasse in der Hand, eine so oft schon eingenommene Haltung aus einer anderen Welt. Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Hofs, stand ein Schuppen. Vielleicht zur Lagerung von Arbeitsmaterialien oder Holz oder einem Fahrrad. Das Fenster war ungewöhnlich groß, der Raum konnte auch gut als Atelier genutzt werden. In der Scheibe spiegelte sich der Zaun mit dem Tor, ein schmaler Streifen Asphalt, die Büsche auf der anderen Straßenseite.