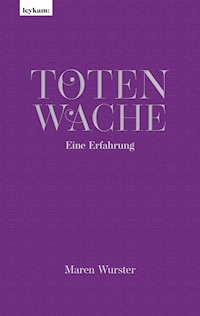Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, das uns alle betrifft: Maren Wursters zutiefst berührende Reflektion über Fürsorge und Übergriffigkeit, Krankheit und Tod – und die Suche nach der eigenen Geschichte. Ein persönliches, in seiner Offenheit radikales, überraschend tröstliches Buch über den Abschied von den Eltern – und der literarische Versuch, die eigene Herkunft zu ergründen. Der Vater liegt auf der Intensivstation, die demenzkranke Mutter wird in einem Pflegeheim betreut. Dazwischen steht die Tochter, selbst Mutter eines kleinen Kindes, und muss sich kümmern, weiß aber nicht, wie. Sie fängt an, sich zu erinnern: an ihre Kindheit, an das Ferienhaus in Spanien, aber auch an die Sucht des Vaters und die Unnahbarkeit der Mutter. Und während sie das Leben der Eltern vom Moment des Sterbens aus erzählt, begreift sie nach und nach, was die beiden eigentlich für Menschen waren, was für ein Mensch sie selbst geworden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ein persönliches, in seiner Offenheit radikales, überraschend tröstliches Buch über den Abschied von den Eltern — und der literarische Versuch, die eigene Herkunft zu ergründen.Der Vater liegt auf der Intensivstation, die demenzkranke Mutter wird in einem Pflegeheim betreut. Dazwischen steht die Tochter, selbst Mutter eines kleinen Kindes, und muss sich kümmern, weiß aber nicht, wie. Sie fängt an, sich zu erinnern: an ihre Kindheit, an das Ferienhaus in Spanien, aber auch an die Sucht des Vaters und die Unnahbarkeit der Mutter. Und während sie das Leben der Eltern vom Moment des Sterbens aus erzählt, begreift sie nach und nach, was die beiden eigentlich für Menschen waren, was für ein Mensch sie selbst geworden ist.
Maren Wurster
Papa stirbt, Mama auch
Hanser Berlin
1
Du hast dieses kleine Loch da. Zwischen dem gewölbten Bauch und der Brust. Da, wo diese Falte ist, der Bauch abfällt und der Brustkorb beginnt. Hast ja nichts an, nur dieses gepunktete Stück Stoff, das im Nacken gebunden wird und am Rücken frei bleibt. Es liegt zerknüllt auf deiner rechten Körperhälfte, das Band schneidet in deinen Hals, verschwindet in einer Falte.
»Ein Leberfleck.« Die Krankenschwester deutet auf das Loch. Sie auf der einen Seite deines Bettes, ich auf der anderen. Du hättest dir wahrscheinlich einen Leberfleck abgerissen. Über dich hinweg sagt sie das. »Hat sich wahrscheinlich einen Leberfleck abgerissen.«
Und jetzt hast du da ein Loch, so groß wie mein kleiner Fingernagel. Und darunter irgendwelche Schichten. Fett, Muskeln, Sehnen. Durch deine Atmung, dadurch, dass sich der Bauch bewegt, dehnt sich das Loch oval auseinander. Ich mag nicht so genau hinsehen. Die Schwester sprüht Desinfektionsmittel auf die Stelle und klebt ein Pflaster darüber. Vorsichtig decke ich dich mit dem Kittel zu. Dein Kopf bewegt sich in meine Richtung, und ich sehe, dass dein Hals durch die Reibung des Bandes wund ist.
Aufgedunsen bist du, schon länger, von der Hormontherapie und dem Kortison. Dein Hals wie ein Wulst, der von deinem Kinn auf die Brust gedrückt wird, obwohl du mit seltsam nach oben geneigtem Kopf schläfst. Dein Mund ist geöffnet.
Ein Schlauch verläuft über deine Ohren und Wangen zu deiner Nase, zwei kleine Ausstülpungen führen in die Löcher. Ein anderer Schlauch dringt unterhalb des Schlüsselbeins in deinen Körper, ich sehe die Erhebung, die der Zugang unter deiner Haut bildet, eine Kanüle steckt in deinem linken Handrücken, ein hellblauer Hahn ist daran befestigt. Ein rot leuchtender Clip klemmt an deinem Finger. Alles führt zu Maschinen hin oder kommt aus ihnen heraus, sie penetrieren dich. Ein Monitor zeichnet in verschiedenfarbigen Flatterlinien deinen Herzschlag, deine Atmung nach. Es piept, es pumpt.
Sanft berühre ich dich an deinem Handrücken, lege meine Finger auf deine trockene Haut, deine Altersflecken, neben den Bluterguss, der blau um den Einstich der Kanüle ausläuft und sich in roten Fransen verliert. Dein Kopf zuckt wieder in meine Richtung, deine Augen bleiben geschlossen. Schmale, lange Finger hast du, überhaupt schöne Hände. Wie meine, ich habe meine Hände von dir. So sagt man doch. Die Hände hat sie vom Vater. Die Schwermut auch. Auch die Sucht. Oder vielmehr die Struktur der Sucht. Wenn ich rauche, dann direkt nach dem Aufstehen auf dem Balkon. Ich stelle das Babyfon auf die Holzfliesen, ein kleines grünes Licht zeigt, dass die Verbindung stabil ist, ich zünde mir die allererste in einer langen Reihe von Zigaretten am Tag an. Es tut mir nicht gut, ich schäme mich, wegen des Atems, des Geruchs, der in den Kleidern und meiner Haut sitzt, besonders aber, wenn das Kind dabei ist und mich sieht. Die kleine Schwester der Sucht heißt Scham. Ich bin ein Einzelkind, ich stelle sie mir trotzdem oder gerade deswegen als Händchen haltende Geschwister vor. Wenn ich trinke, dann wanke ich ins Bett, der unsichere Schritt und die Dumpfheit verknüpfen mich mit dir. Wenn ich Drogen nehme, dann tunke ich den Finger so tief in das Pulver und sitze morgens mit blutig getanztem Zehennagel auf dem Rand der Badewanne. Konfetti sammelt sich rund um den Abfluss.
Am Ende des Bettes ist ein Dokument befestigt, eine ausklappbare Tabelle mit Abkürzungen und Zahlen und Haken und Strichen. Ich betrachte das kryptische und zugleich akribisch geführte Protokoll. Dein Blutdruck ist als eine Gebirgskette verzeichnet: jede Stunde zwei Punkte, die jeweils miteinander verbunden werden. Zwischen sieben und zehn Uhr steigen beide Linien massiv an, jemand hat einen roten Pfeil dazugemalt, dann fallen sie wieder ab. »PWTT: SpO2-Sonde«, lese ich. »Vas. Zug.: pVK, ZVK (Hickman)«. Und: »ZVD1 mmHg, 1,36 cmH2O«. »38,5«, das ist deine Temperatur, »38,7«, »39,0«. Deine Medikation, »Fentanyl 12,5 µg/h, ASS, Pantoprozol, Mirtazapin, Prednisolon, Macrogol«. Dass du 240 ml Urin ausgeführt hast. Bei Erbrechen ein Strich. Drainagen, auch ein Strich.
Draußen vor den Fenstern, sie haben keine Griffe, steht ein unbewegter, gleißender Sommerhimmel. Es ist heiß, ich weiß es, ich bin im Sommerkleid zu dir gekommen, ich schwitze noch nach, obwohl es hier kühl und seltsam gedämpft ist. Als ich ans Fenster trete, sehe ich ein junges Mädchen im Bikini auf der Wiese liegen, im gelblich trockenen Gras hat sie ein weißes Tuch ausgebreitet.
»Is he dying?«, frage ich den Arzt. Ich spreche Englisch, weil ich annehme, dass du mich hörst. Dass du auch gehört hast, was der Arzt mir aufgezählt hat und du bereits weißt. Dass du Metastasen hast, in der Lunge, der linke Flügel komplett befallen, in der Leber, an den Knochen, Hüfte, Becken, Schulter. Wasseransammlungen im Körper. Dass du eine Lungenentzündung hast, das ist neu, deshalb bist du hier, eine Infektion der Harnwege wahrscheinlich auch, eine Sepsis.
»Wir müssen noch den Laborbericht abwarten«, sagt der Arzt.
»Mein Vater hat eine Patientenverfügung«, sage ich. Und: »Ich habe eine General- und Vorsorgevollmacht.« Ich reiche ihm die Kopien. Die Dokumente habt ihr, Mama und du, vor über fünfzehn Jahren erstellen lassen, ich habe auch Vollmachten für all eure Konten, hätte sie leerräumen oder mich zumindest bedienen können, wenn ich gewollt hätte. Das war aber nicht nötig, ihr habt mich gut versorgt, mein Studium ermöglicht, ihr habt mir immer vertraut. Müsst es auch jetzt, da eure Willensbekundungen relevant werden.
»Wir möchten keine lebensverlängernden Maßnahmen«, sage ich.
»Sie sind hier auf der Intensivstation«, sagt der Arzt.
Er ist schön, dieser Arzt. Das sehe ich, auch wenn die Hälfte seines Gesichts von der Maske verdeckt ist. Dunkle Haut, der Kopf rasiert, große braune Augen, die Augenbrauen etwas wild. Jung.
Ich lege meine Hand auf deine Stirn. Ich werde das noch oft machen, dich am Kopf berühren, da, wo deine weißen Haare zu wachsen beginnen. Du fällst aus dem Schlaf heraus und öffnest die Augen, langsam und schwerfällig, dein Blick ist zunächst unbestimmt, kann nichts halten und irrt umher, noch unverbunden mit der Situation, vielleicht auch mit deiner Persönlichkeit. Dann finden deine Augen mich, dein Blick beruhigt sich.
»Papa«, sage ich.
Du öffnest den Mund, den trockenen Mund, deine Zähne sind auf der inneren Seite schwarz, leise und mit schwerer Zunge sagst du: »Und Mama?«
Du fragst nach Mama. So, wie ich sie anspreche: Mama. Nicht Ingrid. Oder Besele, wie du sie liebevoll nennst. »Besele«, sagte ein Amerikaner, den du bei der Marine kennengelernt hast und der dich nach deinem Lieblingsessen gefragt und dann versucht hat, es zu wiederholen: Spätzle. Mit Linsen und Saitenwürstchen.
»Mama geht es gut«, sage ich, klar und laut, dabei weiß ich es nicht.
»Ich fahre gleich zu ihr«, sage ich.
Deine Augen schließen sich wieder und du fällst zurück in den Schlaf mit einem fast unmerklichen Ruck. Ich kenne es vom Kind. Im Moment des Einschlafens sinkt der Körper ein wenig ab, ins Loslassen hinein, und die Traumwelt beginnt. Auch dein Körper erzählt mir nun davon, deine Finger bewegen sich, die Augen rollen nach oben, ich kann die Bewegung unter den Lidern sehen. Dein Mund öffnet sich leicht. Auf dem Monitor beruhigen sich die Ausschläge, das Hoch und Runter, das Piepen verlangsamt sich wieder.
Mama. Deine erste Frage, als ich dich auf der Intensivstation besuche, gilt ihr. Also ist deine Geschichte auch Mamas Geschichte. Dein Sterben ist auch Mamas Sterben. Oder anders: Mit ihrem Sterben hat es angefangen.
Menschen fotografieren
Eine meiner ersten Erinnerungen ist ein Gecko, ein kleiner, dunkel gefleckter Gecko, der an der weiß getünchten Decke hängt. Über mir, im Haus in Dénia, in unserem Haus. Nur einmal zuckt sein Kopf ruckartig von der einen zur anderen Seite, und ich erschrecke. Du bist es, Papa, der mir sagt, das sei ein Gecko. Meine Sprache ist eine Vatersprache, denn du bist es, der mir die Wörter sagt. Gecko. Olivenhain. Buenos días. Die weit gespreizten Zehen des Tiers faszinieren und ängstigen mich zugleich. Du bist es, Papa, der mir auch sagt, dass ich beim Zähneputzen das Wasser nicht schlucken darf. Wir stehen am Waschbecken in unserem Haus in Dénia, ich auf einem Schemel, und du zeigst mir, wie ich ausspucken soll: Wasser rinnt zum Abfluss. Ich mache es dir nach: nur ein kleiner, zäher Fleck. Du bist es, an dessen Hand ich über den Sand gehe, die gekräuselten Wellen kitzeln meine Füße. An deiner Hand mache ich überhaupt die ersten Schritte, schief und stolz, Mama steht hinter der hohen, dunklen Bar in der Küche und bejubelt mich, an deiner Hand gleiche ich das Wanken aus. Werde später so oft dein Wanken ausgleichen. Einmal gehen wir vom Bärensee nach Hause, ein Grillfest am Ersten Mai, ich bin acht oder neun Jahre alt und ich bin Teil einer Kette von Menschen, die sich an den Händen halten und den breiten asphaltierten Weg durch den Wald zum Parkplatz hochgehen. Du stolperst als Letzter an meiner Hand, die andere hält jemand anderes, ich weiß nicht mehr, wer, aber ich möchte nicht, dass dein unsicherer Schritt auffällt. Ich stemme mich gegen dich oder ziehe dich heran, um dein Torkeln nicht zu übertragen, es zu verbergen.
Damit ich auf der Fahrt nach Spanien nicht in der prallen Sonne sitze, befestigt Mama mit Reißzwecken ein blaues Tuch mit weißen Punkten im Gummi der Autotür. Das Licht fällt nun in einzelnen, schmalen Strahlen auf mich, in ihnen bewegt sich Staub. Mama und ich pflücken Orangen, große Orangen, und tragen sie auf unseren Armen. Eine fällt mir runter und platzt auf, Saft und Fruchtfleisch fließen auf den fein gekörnten Weg. Mama wirft die aufgebrochene Orange in die Plantage zurück. Den Katzen, die ums Haus streichen, stellt Mama abends Milch in einer Schale hin. Ich streichele sie. Immer vom Kopf zum Schwanz, Mama zeigt es mir. Vor Killy, dem Hund der Nachbarn, habe ich Angst. Dabei ist er immer hinter dem Zaun, vor dem ich stehe und ihn betrachte. Im Gegensatz zu den Katzen, die nur als Vielzahl, weich oder struppig, mit freien Stellen im Fell, auftauchen, ist meine Erinnerung an ihn sehr deutlich: ein Schäferhund mit heraushängender, bleicher Zunge und abfallendem Hinterteil, was so aussieht, als setze er gleich zum Sprung an.
Im Gesamtbild meiner ersten Erinnerungen ist es heiß in Dénia, und ich bin nackt, manchmal in einem Trägerkleid, es gibt einen kleinen Garten, Stufen vor dem Haus. Mama streicht eine Wand weiß, sie trägt lediglich einen Bikini, das Sonnenlicht wird von der weißen Wand reflektiert. Ist das ein Foto? Ein Foto, das ich erinnere und das mir vielmehr suggeriert, mich an Mama erinnern zu können, im Bikini die Außenwand des Hauses weiß streichend?
Die Erfindung der Fotografie stellt bisherige Gewissheiten in Frage. Walter Benjamin beschreibt, wie die Fotografie sich aus einem Hier und Jetzt, er nennt es Traditionszusammenhang, löst.1 Für mich, für meinen Erinnerungszusammenhang passiert etwas Vergleichbares: Es gab ein Hier und Jetzt, in dem Mama die Wand des Hauses weiß gestrichen hat, an einem heißen Tag um die Mittagszeit, in wolkenloser Hitze, und in dem du, Papa, Teil warst, indem du wahrscheinlich auf den Auslöser der Kamera drücktest. Doch meine Position bleibt unklar, auch wenn es meine Erinnerung und meine Gefühle sind, sie oszilliert zwischen dem Kind, das das Foto seiner Mutter im Bikini kennt, und meiner möglichen Anwesenheit, meinem Hier und Jetzt, das ich nur zu erinnern meine, irritierend identisch mit dem Foto, auch wenn ich es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Die tatsächliche Referenz entweicht mir.
»Look, it’s me with my mother«, sagt Rachael im Film Blade Runner zu Deckard. Das Foto zeigt ein Mädchen, umarmt von einer Frau, im Sonnenlicht, sie sitzen beide auf den Stufen einer Veranda. Rachael führt es an, um zu beweisen, dass sie keine Replikantin ist.
Obwohl ich nicht hinter das Bild komme, zu einem sinnlich bewegten Moment, Mama im Bikini vor der weißen Wand, auf den ich mich mit Sicherheit beziehen kann, fühle ich Traurigkeit, wenn ich meine schöne Mama, schlank und braun gebrannt, die Bikinihose lediglich an der Taille mit zwei Bändern zusammengeschnürt, vor der Wand und in meiner Vorstellung sehe, wie sie sich gerade mit dem Roller zum Farbeimer herabbeugt.
Ich erinnere mich an das erste Foto in meinem Leben, das ich mache. In einem Hotelzimmer auf den Kanarischen Inseln. Nachdem ihr das Haus in Dénia verkauft habt, machen wir eine Zeitlang Cluburlaube auf den diversen Inseln. Und auf einer dieser Inseln, Fuerteventura oder Gran Canaria, in einem Hotelzimmer, darf ich eure Kamera nehmen. Ihr setzt euch auf die Couch, neben den ausladenden Blumenstrauß, so üppig und darin auch sperrig wie derjenige, den Mama später bei ihrer Ankunft im Pflegeheim bekommen wird, den weder sie noch ich in die Hand nehmen werden, der unbeachtet an der Hand der Pflegeheimleiterin herunterhängt. Du legst den Arm um Mama, und ich mache das Foto von euch, indem ich durch ein kleines rechteckiges Fenster schaue und einen Knopf drücke. Mama trägt ein rotweiß gestreiftes Kleid, ihre Arme sind frei und braun gebrannt, sie hat dunkle Locken bis zu den Ohren. Du, Papa, bist hell angezogen, trägst ein weißes Hemd, bist groß. Mama erwidert deine Berührung, indem sie dich auch umarmt. Zwischen euch bleibt ein schmaler Raum frei. Ich erinnere mich daran, wie ich das Foto mache, das verwackelt ist, euer Lachen sieht man trotzdem. Es wird in einem der Umzugskartons sein, die sich auf meinem Schrank stapeln, in einem der fünf Kartons, die die letzten Dokumente enthalten, die es noch von euch gibt.
Die Griechen, schreibt Roland Barthes, bewegen sich rückwärts in das Reich der Toten hinein, vor sich haben sie ihre Vergangenheit. In dieser Haltung durchmisst Barthes das Leben seiner Mutter, die er das letzte halbe Jahr ihres Lebens gepflegt hat, blättert sich durch Aufnahmen von ihr. Anders als für Benjamin ist für Barthes die Fotografie mehr als jede andere abbildende Kunst an ein Hier und Jetzt gebunden. Sie beweist, dass etwas so war, »daß die Sache da gewesen ist«2, und, hier kommt die Trauer ins Spiel, die Trauer über seine tote Mutter, zugleich beweist sie, dass es nicht mehr so ist. Schon im Moment der Aufnahme schwingt der Verlust der Abgebildeten mit, zeigt sich ihr Sterben. Barthes geht noch einen Schritt weiter, denn auch der Betrachter eines Fotos, seine Gefühle, sein Wissen, seine Zeugenschaft werden vergehen. Er findet eine Aufnahme seiner Eltern und wird sich des endgültigen Verlusts bewusst: »Beim Betrachten des einzigen Photos«, schreibt er, »auf dem mein Vater und meine Mutter gemeinsam zu sehen sind, die beiden, von denen ich weiß, daß sie sich liebten, denke ich: die Liebe als etwas Kostbares, das wird für immer verschwinden; denn wenn ich nicht mehr da bin, wird niemand mehr sie bezeugen können: nichts wird bleiben, als die gleichgültige Natur.«3
Mein Foto von euch, meinen Eltern, die ihr euch auch liebt, auf fatale Weise es manchmal getan habt, bezeugt bereits euer Gehen, das ich nun in einer Eindeutigkeit erlebe, die aber schon immer da war. »Jede Fotografie ist eine Art memento mori«4, schreibt auch Susan Sontag. Wenn ich es so betrachte, ist alles Festhalten, ist auch mein Schreiben über das Foto, mein Schreiben über euch, von dem Vergehen geprägt, das ich letztlich erleben werde, ist euer Sterben vorhanden in jedem einzelnen Bild, mein Text eine Archäologie des Verlusts. Sontag beschreibt den brutalen Akt, Menschen zu fotografieren, und ich denke das Schreiben mit. Ich verwandle euch in Objekte, zeige euch, wie ihr euch niemals sehen würdet, erfahre etwas über euch, was ihr nicht erfahren werdet. Ich beschreibe Szenen, die ihr nicht autorisiert habt. Auch wenn ich dich gefragt habe, ob ich über dich schreiben darf, auch wenn du, deine Großzügigkeit und Gelassenheit berühren mich, dazu »ja, freilich« gesagt hast. Und auf meinen Hinweis, dass ich auch über unschöne Momente schreiben würde, über deine Alkoholsucht, nur wiederholt hast: »Ist in Ordnung.«
2
Ich radele vom Krankenhaus direkt zu Mama ins Pflegeheim, es ist nur die Straße hoch. Die Straße, die gestern Abend der Krankenwagen entlanggefahren sein muss, auf der anderen Seite und mit Blaulicht, du mit Schmerzen in der Brust darin, mit Atemnot, beatmet vielleicht. Intubiert?, frage ich mich. Das Sommerkleid flattert um meine Oberschenkel, ich halte es mit der Hand fest.
»Ihre Mutti war ganz ruhig, als der Krankenwagen Ihren Vati gestern mitgenommen hat«, sagt die Pflegebereichsleiterin zu mir, »wir wollten sie nicht in der Wohngemeinschaft lassen und haben sie mit zu uns auf die Station genommen.«
Ich kenne die Station bereits. »Geschützter Wohnbereich für Menschen mit Demenz« steht auf dem Schild an der Tür. Mama ist die ersten Wochen hier gewesen, als ich sie vor zwei Jahren nach Berlin geholt habe, bevor du nachgekommen bist und ihr in eine Wohngemeinschaft innerhalb des Pflegeheims gezogen seid. Die schwere Metalltür mit der milchigen Scheibe lässt sich nur mit einem Code öffnen, ich weiß ihn noch: 47—11. Aber meine Sorge war sowieso nie, dass Mama weglaufen könnte, was Hinlauftendenz genannt wird. Ich mag das Wort, da es die Suche nach dem Bekannten, nach dem Zuhause beschreibt. Doch Mama ist zu ängstlich, sie konzentriert sich auf Menschen. Wie das Kind, das flitzt auch nie vom Spielplatz weg, weiß immer, wo ich bin, und spielt in meiner Nähe.
Mama sitzt auf der roten Couch im Aufenthaltsraum. Sie schaut geradeaus auf die gegenüberliegende Wand. Sie trägt ein ärmelloses Oberteil, ich berühre sie am Arm, der sich leblos anfühlt, wie Teig, wie kalt gehender Hefeteig, und sie sieht mich an. Ich weiß gar nicht, ob sie mich erkennt. Ihr Blick wie eingegraben. Ich setze mich neben sie.
»Alles gut«, sagt Mama und schaut wieder geradeaus.
Sie riecht streng, weil sie sich weigert, geduscht zu werden, vehement weigert, und die Pflegekräfte es zwar immer wieder probieren, ihr dieses Recht auf Verwahrlosung aber auch zugestehen, auch wenn Mamas Verhalten sicherlich nicht auf Verwahrlosung zielt. Das ist ein wenig wie mit der Hinlauftendenz. Der Beweggrund und das Resultat können konträr auseinanderliegen. Und Mama hat Mundgeruch, weil die Zähne in ihrem Mund verfaulen, einige fehlen bereits, geben ihrem Lachen, wenn sie denn lacht, eine irritierende Durchsicht. Ich weigere mich, dass die anderen befallenen Zähne ihr gezogen werden. Das ginge nur unter Vollnarkose, sagt der Zahnarzt, und ich fürchte sie dadurch noch mehr zu verlieren, an das, was Demenz heißt und so viele Gesichter hat. Ich streite mich mit dem Arzt deswegen. Schlage vor, Mamas Hand bei einer örtlichen Betäubung zu halten, bitte darum, es zu versuchen. Er lehnt das ab. Und ich lehne den Eingriff ab, ich habe eine Vollmacht, auf die ich mich beziehe. Deutlich spüre ich sein Unverständnis, er findet mich anmaßend, weil ich seine Kompetenz in Frage stelle, nicht seinem ärztlichen Rat folge. Auch wenn ich erkläre, dass der Neurologe dazu geraten hat, eine Vollnarkose bei einer demenziellen Entwicklung in allen Fällen zu vermeiden.
Nun nehme ich Mamas Hand, und da liegt sie in meiner, ohne Druck, ohne Erwiderung. Nur in ihr drin ist eine Unruhe, die ich über die Hand spüre, ein entferntes Rascheln und Nesteln. Mama fragt nicht nach dir, was mich irritiert. Wenn du nur eine Minute aus dem Zimmer warst, hat sie schon nach dir gesucht. Immer wieder aufs Neue habe ich ihr gesagt, dass du im Badezimmer bist, dass du gleich wiederkommst. Weiter weg warst du meist nie. Und jetzt traue ich mich nicht, dich zu erwähnen. Vielleicht war dein Weggehen aus dem Zimmer noch in einer kurzlebigen Erinnerung verhaftet, und deshalb hat sie nach dir gefragt, wie Mama überhaupt Themen und Gesprächsfetzen aus der unmittelbaren Vergangenheit immer wieder aufgreift, dreht und wendet. Du und ich, wir waren manchmal schon woanders in unserem Gespräch, während Mama plötzlich noch eine Frage zu Vorangegangenem stellen konnte. Jetzt bist du bereits eine Nacht und einen Morgen, einen ganzen Tag weg, und ich weiß nicht, wie ich Mama erklären soll, was vielleicht nicht als greifbare Tatsache, sondern nur als Gefühl vorhanden ist. Soll ich offen ansprechen, dass es schlecht um dich steht? Ich wäre Mama gerne nahe, in der Sorge um dich, ich frage mich, ob es einen gangbaren Weg gibt, er kommt mir zugestellt vor, vielleicht auch von meiner Unsicherheit. Die letzten zwei Jahre habe ich Mama fast immer nur zusammen mit dir erlebt, und, das merke ich jetzt, du warst unser Bezugspunkt, wir sind beide um dich gekreist. Nun weiß ich nicht, wie ich mich auf Mama einstellen soll.
Hinter unseren Rücken kracht etwas, ein Mann stöhnt laut auf. Ich drehe mich um und sehe, wie sich zwei Männer in ihren riesigen Gehhilfen ineinander verhakt haben. Wie Käfige umschließen die weißen, kopfhohen Stangen die beiden von drei Seiten. Der eine Mann versucht, weiterhin vorwärts zu kommen, eine Rolle quietscht dabei, seine Bemühungen werden von ruckartigem Stöhnen begleitet, der andere steht mit offenem Mund da und starrt, seine Hände massieren den Griff. Mama sieht zu mir, wie ich zu den beiden sehe. Ich bemerke ihren Blick, der sich auf mich gelegt hat, als stünde in meinem Gesicht eine Antwort auf eine Frage, die sie eben vergessen hat. Sonja, eine Pflegerin, kommt und hilft den beiden Herren, sie trennt die Gerätschaften voneinander, und sie können weitergehen, hintereinander her. Das Pflegeheim hat einen Innenhof, und die Station ist so gestaltet, dass sich die Zimmer zur außenliegenden Seite befinden und im Flur ein Rundlauf um den Innenhof möglich ist. Hinter den großen Fenstern sieht man die ausladende Kastanie. Unterhalb der Fenster sind Handläufe angebracht, für diejenigen, die auch ohne stabilisierende Gehgeräte ihrem Bewegungsdrang, ihren täglichen, manchmal nicht enden wollenden Spaziergängen nachkommen möchten. Das Holz ist dunkel abgeschliffen und weich von den darüberstreichenden Händen so vieler Menschen.
Über den Gang werden nun metallene Rollwägen geschoben, und ich gehe mit Mama in den Speiseraum. Wir setzen uns neben eine Frau, die ein feines Seidentuch um ihre Schulter gelegt hat. Eine andere, wuchtige Frau am Tisch gegenüber strickt. Eine dritte knabbert an einer Serviette. Sonja gibt ihr einen Kuss auf die Backe und entwendet ihr vorsichtig das Stück Papier, das durchweicht und an einer Ecke bereits aufgelöst ist. Auf dem Tisch stehen Wurst, Käse, Gurken, Tomaten, Brot und Brötchen, fast wie bei uns zuhause früher.
»Fast wie bei uns zuhause früher«, sage ich. Mama sieht mich an.