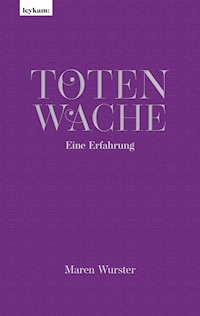
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Gegen das Verdrängen von Tod und Sterben« Drei Tage lang hielt Maren Wurster für ihren Vater Totenwache. Sein Körper lag aufgebahrt in einem Raum, für sie stand ein Bett darin. Ihr 5-jähriger Sohn war über lange Strecken da, auch ihre demenzkranke Mutter nahm Abschied von ihrem Mann. Die Autorin blieb sogar über Nacht – und schlief tief und fest. Aufbauend auf dieser persönlichen Erfahrung erkundet Maren Wurster die Totenwache aus philosophischer, historischer und gesellschaftskritischer Perspektive. Sie betrachtet verschiedene kulturelle Umgangsweisen mit dem Tod ebenso wie aktuelle Themen, etwa die Unmöglichkeit, in Corona-Zeiten Sterbende würdevoll zu begleiten. Es ist ein Plädoyer für Akzeptanz, für das Aushalten, für das Zumuten, für das Fühlen, das nur möglich ist in einer Gesellschaft, in der die Toten einen Platz haben, die Raum lässt für Nichtfunktionieren und Schmerz. Eine Gesellschaft, in der das Sterben nicht verdrängt wird, sondern das sein darf, was es ist: Teil des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Drei Tage lang hält Maren Wurster für ihren Vater Totenwache. Was sie dabei fühlt, sieht und denkt, schreibt sie auf. Intime Beobachtungen sind das, die mit philosophischen Gedanken verknüpft einen so unerschrockenen wie tröstlichen Text entstehen lassen.
„Während Maren Wurster in ihrer Totenwache das Leichentuch um ihren verstorbenen Vater legt, lüftet sie den Schleier um eines der Themen, das heute immer noch viel zu oft im Verborgenen bleibt: das Sterben und der Tod. Ein feiner, kluger, überaus berührender Essay.“ Daniel Schreiber
Über Maren Wurster
Maren Wurster, geboren 1976, studierte Filmwissenschaft und Philosophie in Köln und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 2017 erschien ihr Debütroman „Das Fell“, 2021 das Memoir „Papa stirbt, Mama auch“, 2022 der Roman, „Eine beiläufige Entscheidung“. Sie lebt mit ihrem Sohn in Berlin und im Wendland.
Newsletter des Leykam Verlags
In unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Veranstaltungen, unsere Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:
https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
leykam:seit 1585
Maren Wurster
TOTEN WACHE
EINE ERFAHRUNG
Für B.
Contents
Schau nicht hin
Der verbotene Tod
Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet
Tanz auf den Gräbern
Sterbeort Nummer eins
Der pornografische Tod
Tränen um eine Katze
„Es kann sein, dass man eine gefährliche Krankheit kriegt“
Das absolute Auge der Medizin findet den Tod nicht
Die Geräte sind angeworfen
Das Kind und der Tod
To-do: Bestattung
Ein Turm stürzt ein
„Hallo Papa, jetzt bist du gestorben“
Gespenster und Mumien
Let it be
Drei Tage, ich meine es ernst
Raster der Trauer
Skateboardsprünge ums Totenbett
Endlich unendlich
Anmerkungen
Der Wecker piept, ich wache auf. Ich liege auf dem schmalen, aufgeklappten Reisebett. Mein Blick geht zu meinem Vater, an dessen Bettende ich geschlafen habe. Papa. Mein Papa. Geliebter Papa. Ich schlage die Decke zur Seite, setze mich auf und betrachte ihn. Die Kristalllampen beleuchten sein Gesicht, ein warmes Licht auf seiner weißen Haut, die wie Porzellan wirkt. Markant ist sein Gesicht, so wie es sein ganzes Leben war, nur in den letzten Monaten seines Sterbens ist es weich und feminin geworden. Jetzt zeigen sich seine klaren Konturen wieder, jetzt, da mein Vater tot ist. Die Jochbeine sind deutlich zu sehen, die Augen geschlossen in den Höhlen, seine große Nase, der geöffnete Mund. Die Dreiecksform seines Gesichts, Yvonne hat mich am letzten Tag vor seinem Tod darauf hingewiesen, wie von der Stirn zum Kinn sich der Schädel zeigt, weil die Gesichtsmuskeln erschlaffen. „Er wird gehen“, hat sie gesagt, nun erkenne ich, was sie meinte. Mein Vater ist in ein Leinentuch gehüllt. Um seinen Kopf herum haben Angela, die Bestatterin meines Vaters, und ich es aufgebauscht. Geborgen ruht sein Kopf darin. Blumen liegen auf seinem Bett, Rosen, Nelken, Gänseblümchen, auch auf dem Tuch, darunter zeichnet sich sein großer, ausgemergelter Körper ab. Zu seinen Füßen der gewebte Teppich meines Sohns, türkisfarbene Wolle, bunte und dann rosafarbene, die Enden verknotet und ein wenig zottelig. Wir haben lange daran gewoben und wollten ihn Opa eigentlich zu Weihnachten schenken, jetzt ist er der ein fliegender Teppich für seine Himmelsreise geworden. Mein Sohn hat auch Bilder für seinen Opa gemalt, die er ebenfalls zu den Füßen angeordnet hat, ein Meer mit dicken, brausenden Wellen. Das könnten jetzt die Wellen des Totenflusses sein, über den in der antiken Mythologie der Fährmann Charon die Verstorbenen bringt. Als Bezahlung dafür hätten wir meinem Vater noch eine Münze unter die Zunge legen müssen. Auch ein bunt gestreiftes Ei ist auf einem der Bilder zu sehen, passend eigentlich, wegen Ostern, Auferstehung, denke ich. Die Hände meines Vaters liegen auf seinem Bauch. Angela hatte Schlitze in das Tuch geschnitten und ich habe seine schönen Hände durchgeführt. Ich habe meine Hände von ihm, ganz der Vater, wie in so vielem, die gleiche lange Form. Große, schmale Hände griffen also ineinander, warm meine, kalt seine. Ich habe seine Hände miteinander verbunden. Sie lösten sich. Nur noch der Daumen der linken Hand berührt Zeige- und Mittelfinger der rechten. Ein zarter letzter Kontakt.
Angela hatte mir gesagt, ich solle zwischen Mitternacht und ein Uhr wach sein. Wegen der Geister. Deshalb habe ich mir den Wecker gestellt. Es sei ein besonderer Moment, insbesondere in der zweiten Nacht, denn dann mache sich der Verstorbene auf den Weg. Dass ich präsent bin, helfe ihm dabei und schütze ihn. Und ja. Ich fühle ihn, noch ist mein Vater da. Noch ist er mit dem Körper, also dem toten Körper verbunden, er füllt darüber hinaus auch den Raum aus. Die Ruhe der Totenwache hat mich so feinfühlig werden lassen, das wahrzunehmen.
Ich stehe auf, gehe zu meinem Vater, berühre seine Stirn, so wie ich es die letzten Monate immer getan habe. Tränen tropfen auf das Tuch, hinterlassen Punkte. Ich streiche über seine Wangen. Das hat mich überrascht, seine Kälte. Das habe ich nicht gewusst, dass er so kalt wird. Wie so vieles, so vieles habe ich nicht gewusst.
„Papa, du bist gestorben“, sage ich zu ihm. Es sei wichtig für die Verstorbenen, ihnen das zu sagen. Oftmals wissen sie es noch nicht, hat Angela mir erklärt. Ich sage es auch zu mir, auch ich weiß es noch nicht so recht. Ich setze mich zu ihm.
Mein ganzes Leben war mein Vater da, auch wenn ich wochenlang nicht an ihn gedacht, ihn monatelang nicht gesprochen, ihn einmal ein ganzes Jahr nicht gesehen habe. Ich hatte immer einen Vater. Das ist eine so einfache, fast banale Aussage. Ich verstehe sie erst jetzt. Jetzt, da ich Kind ohne Vater bin.
Ich bin auch eine erwachsene Frau, die in ihrem ganzen Leben noch nie mit dem Tod konfrontiert war. Ich hatte grausige Vorstellungen von den Toten, von einer Totenwache hatte ich nur ein verschwommenes Bild. Niemand in meiner Familie hat je eine Totenwache gehalten und hätte mir davon berichten können. Ich stehe in keinem Kontext, aus dem ich schöpfen und auf den ich mich beziehen kann. Es war Angela, die die Aufbahrung vorschlug. Intuitiv wollte ich sie sofort machen. Ich hatte meinen Vater beim Sterben begleitet, lange, zwei Jahre hieß es, er werde bald gehen. Die Wache war der konsequente Abschluss meiner Annäherung an den Tod. Ich wollte ihn kennenlernen, Gevatter Tod, jetzt, da er mir sowieso ungefragt begegnet war. Ich ahnte bereits, dass in den drei Tagen eine Erfahrung verborgen sein könnte, die ich machen wollte, die mir etwas über das Sichtbare hinaus zeigen würde. Und so ist es auch gekommen.
Ohne die Totenwache hätte ich zwar mit Mitte vierzig den ersten toten Menschen in meinem Leben gesehen, meinen Vater, der Tod als Prozess aber wäre mir ferngeblieben. Verborgen. So aber habe ich meinen Vater gewaschen, ihn eingeölt, in ein Tuch gehüllt. So sitze ich und halte Wache. Ich weine, lache, singe, schweige und schlafe neben seinem Totenbett. Ohne diese Erfahrung würde mir etwas fehlen im Leben. Ich möchte sie nicht missen, sie hat einen anderen Menschen aus mir gemacht.
Schau nicht hin
„Schau nicht hin“, sagte mein Vater zu mir. Ich war mit meinen Eltern auf dem Weg in den Urlaub. Mein Vater saß am Steuer und rauchte. Ihm schien nicht bewusst zu sein, was der Zigarettenqualm für mich als Sechsjährige auf dem Rücksitz bedeutete. Besonders im Winter, wenn die Scheiben geschlossen blieben und warme Luft aus dem Gebläse die Giftstoffe gleichmäßig in den paar Kubikmetern verteilte. Wir gerieten in einen Stau, ein Unfall, nicht weit vor uns, Blaulicht blinkte zu mir auf den Rücksitz. Im Schneckentempo näherten wir uns einer Absperrung, unser Auto reihte sich auf der rechten Fahrbahn ein. Bei den rot-weißen Hütchen, die die anderen beiden Fahrbahnen absperrten, stand ein Polizist und weinte. Er rieb sich mit den Händen über die Augen, schien sich dafür zu schämen, dass er weinte. Aber er konnte nicht anders, er stand da und weinte.
„Schau nicht hin, Mariele. Schau auf die Felder raus.“ Die Hand meines Vaters zeigte zum Beifahrersitz, wo meine Mutter saß. An der Art, wie mein Vater das sagte, merkte ich, dass er es ernst meinte. Es kam selten vor, dass er streng mit mir sprach. Meist konnte ich machen, was ich wollte.
Ich schaute trotzdem hin, zu seiner Seite, der Fahrerseite, hinaus. Vor zwei ineinander verkeilten Autos lag ein Mann ohne Beine und Arme auf dem Asphalt. Heute weiß ich, dass dieses Bild nicht stimmen kann. Da war kein Blut. Keine Ärztin, keine Sanitäterin. Nur ein Mensch als Rumpf am Boden vor kaputten Autos. Ein Mann, sein Gesicht war mir zugewendet, es war schmerzverzerrt. Jetzt, da ich diese Erinnerung beschreibe, frage ich mich, warum ich meinen Vater später nie nach diesem Moment auf der Autobahn gefragt habe. Auch nicht, als wir so viel sprachen, weil wir wussten, dass es unsere letzten Gespräche sein würden. Jedes Gespräch ein letztes. Und dann noch eines. Und dann noch eines. Wochenlang, monatelang. Manchmal hatte ich die Sprachmemo-Funktion an meinem Telefon aktiviert. Weil ich erinnern und festhalten wollte, was mein Vater erzählte. Weil er bald – ich wusste nicht wann, aber auf jeden Fall bald – nicht mehr würde erzählen können. Bereits da war es für ihn mühsam, seine Zunge war vom Morphium betäubt und dadurch etwas schwer, die Aussprache undeutlich und langsam, aber immer noch in dem schönen, tiefen Bass, den mein Vater sein ganzes Erwachsenenleben lang hatte. Ich fragte ihn nach seiner Kindheit, nach seinem Vater, auch nach dem Tod seines Vaters. Nach dem Unfall fragte ich ihn nicht. Ob er sich an diesen Unfall erinnern konnte. An den Toten. War da denn einer? Oder war es keine Erinnerung, sondern nur meine Vorstellung vom Tod?
Zwanzig Jahre nach jenem Moment auf der Autobahn war ich auf der Beerdigung der Oma meines Freundes, der Immi, die mir immer Socken gestrickt hatte. Habe ich kalte Füße, denke ich heute noch an die Unmengen von Socken, die längst durchgelaufen und verlorengegangen sind. Die Immi hatte mich gemocht, ich hatte es in ihrem Blick gesehen, der wie eine Einladung war, ihre Freundin zu werden. Nun lag sie aufgebahrt in einem Raum der Kapelle, und die Familie meines Freundes nahm Abschied von ihr, seine Eltern, seine Schwester und ihr Mann, die Tante, deren Sohn. Ich klammerte mich an meinen Freund und sagte, dass ich nicht in die Nähe dieses Raumes wollte, dass er bitte bei mir bleiben sollte. Ich betrat die Kapelle erst, nachdem er mir versichert hatte, dass der Sarg geschlossen worden war. Ich studierte zu dieser Zeit Philosophie und Filmwissenschaft in Köln, ich hatte eine eigene Wohnung und verdiente als studentische Hilfskraft einen Großteil meines Lebensunterhalts selbst. Und doch führte ich mich auf wie, ja, wie ein Kind, möchte ich fast schreiben, aber ein Kind führt sich nicht so auf, es nimmt den Tod einfach als Ereignis hin, wie ich noch erleben sollte. Ich führte mich also seltsam auf, als geschähe Schreckliches, würfe ich nur einen Blick auf die Immi. Ich wusste damals schon, dass es lächerlich war, mich so zu verhalten. Ich war die Einzige, die den Aufbahrungsraum nicht betrat. Der Tod schien grausige Vorstellungen in mir heraufzubeschwören, die ich abwehren wollte. Dabei kannte ich ihn noch gar nicht, abgesehen von dem Moment auf der Autobahn. Als wir Trauernden uns später in der Kapelle an den Händen hielten, fehlte mir jedoch etwas. Denn ich mochte die Immi, das Unangepasste und Neugierige, worin wir uns über die Generationen hinweg ähnlich waren. Ohne dass ich es in dem Moment so klar benennen konnte, hätte ich ihr gerne noch mal zugezwinkert. Und auf diese Weise Abschied genommen.
Der verbotene Tod
Der Tod ist im 20. Jahrhundert hinter die Kulissen des Lebens geschoben worden, wie der Soziologe Norbert Elias das in „Die Einsamkeit der Sterbenden“ so bildlich fasst. Da der Tod ihm zufolge als „eine der großen biosozialen Gefahren des Menschenlebens“1 betrachtet wird. Mit weitreichenden Konsequenzen. Der heutige Tod ist ein verborgener Tod, ein verdrängter. Das bedeutet vor allem für die Sterbenden, dass sie von der Gesellschaft isoliert werden, ihren Weg einsam gehen müssen.
In meinem Leben sind Menschen gestorben. Erlebt habe ich ihr Sterben, ihren Tod nicht. Ich erinnere mich an den Anruf meiner Oma. Ich hielt den Hörer in der Hand, und sie fragte mit flatternder Stimme, die ich von meiner strengen Oma nicht kannte, nach meiner Mama. Normalerweise sprach sie zuerst ein wenig mit mir. Aber dieser Anruf war nicht normal, das spürte ich mit meinen sechs Jahren sofort. Deshalb blieb ich stehen, als meine Mutter das Telefon an sich nahm, um mitzuhören, obwohl meine Mutter mir mit einer Geste deutete, ins Kinderzimmer zu gehen. Ich hörte also im trotzigen Stehenbleiben, dass Tante Else gestorben sei. Sie hatte mir immer langweilige Schlafanzüge aus Frottee zu Weihnachten geschenkt und auf ihren Schoß das Geschenkpapier glattgestrichen, um es wiederzuverwenden. Ich weiß bis heute nicht, wie sie gestorben ist. Ich erfuhr es nicht. Sie war an Weihnachten, Ostern, an den Geburtstagen bei uns, immer wieder auch zwischendurch. Und doch – es ist eine Leerstelle in meinen Erinnerungen an sie – weiß ich nicht, ob sie vorher krank war, längere Zeit im Sterben lag oder überraschend von uns gegangen war.
„Nichts ist charakteristischer für die gegenwärtige Haltung zum Tode als die Scheu der Erwachsenen, Kinder mit den Fakten des Todes bekannt zu machen“, schrieb Elias, zufällig genau in dem Jahr, in dem meine Tante starb, 1982. „Als Symptom für das Ausmaß und die Gestalt der Verdrängung des Todes auf der individuellen wie auf der sozialen Ebene ist sie besonders bemerkenswert. Aus einem dunklen Gefühl heraus, daß man die Kinder schädigen könne, versteckt man vor ihnen die einfachen Fakten des Lebens, die sie ja doch unweigerlich kennenzulernen und zu begreifen haben. Dabei liegt die Gefahr für die Kinder durchaus nicht darin, daß sie mit der einfachen Tatsache der Endlichkeit jedes Menschenlebens, also auch des Lebens der Eltern und ihres eigenen Lebens, bekannt werden; kindliche Phantasien kreisen sowieso um dieses Problem und überhöhen es häufig genug mit Furcht und Angst, aufgrund der leidenschaftlichen Stärke ihrer Vorstellungskraft.“2 Ich weiß genau, was er meint, schließlich gibt es in meinen Erinnerungen einen toten Mann als Rumpf auf der Autobahn.





























