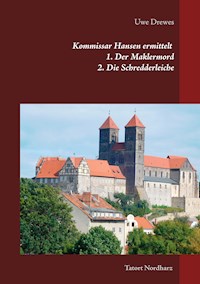Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman wendet sich mit einer literarischen Darstellung aktueller Themen der neueren deutschen Geschichte an historisch und politisch interessierte Leserinnen und Leser. Es ist keine Biographie. Der Autor zeichnet Episoden aus dem Lebensweg junger Menschen in der DDR nach. Er gewährt Einsichten in ihr Denken und Fühlen. Im Mittelpunkt stehen drei Geschwister aus einfachen Verhältnissen. Indem der Roman die Entwicklung "normaler Sozialisten" zum Thema macht, können sich viele ehemalige DDR – Bürger in den Figuren wiedererkennen. Das Buch reicht von 1949 bis in den Anfang des 21. Jahrhunderts. Der Verfasser führt sehr anschaulich vor Augen, wie sich junge Menschen in der DDR entwickelten und wie sich ihr Leben nach der Wende veränderte. Er entdeckt das Besondere im Allgemeinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Bine
Dieser Roman ist eine fiktive Geschichte, inspiriert durch reale Ereignisse. Die Darstellungen von Personen und Ereignissen sind im Wesentlichen als Fiktion zu betrachten und erheben damit keinen Faktizitätsanspruch. Das gilt auch dann, wenn hinter den Romanfiguren Personen als Urbilder erkennbar sind.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I. Freunde
Kapitel II. Herbst 89
Kapitel III. Der Ungewollte
Kapitel IV. IrmgardI
Kapitel V. Abenteuerzeit
Kapitel VI. Die Band
Kapitel VII. Das Meer
Kapitel VIII. Student
Kapitel IX. Irene
Kapitel X. Geschwister
Kapitel XI. Im politischen System
Kapitel XII. Gott und die Welt
Kapitel XIII. Parteibeamte
Kapitel XIV. Das Volk
Kapitel XV. Mauerfall
Kapitel XVI. Rette sich wer kann
Kapitel XVII. Die sozialistische Idee
Kapitel XVIII. Elmshorner Einsichten
Kapitel XIX. Stalinismus
Kapitel XX. Die Ehrenkommission
Kapitel XXI. Ben aus Amerika
Kapitel XXII. Der Steuermann
Kapitel XXIII. Die Erben
Kapitel XXIV. Die Sünde
Kapitel XXV. Neue Freunde
Kapitel XXVI. Verjährt
Kapitel XXVII. Die Abrechnung
Kapitel XXVIII. Das Hamburger Trio
Kapitel XXIX. Fahrt zu den Rittergütern
Kapitel XXX. Misstrauen und Geiz
Kapitel XXXI. Jugendliebe
Kapitel XXXII. Die Stiftung
Kapitel XXXIII. Klassentreffen
I. Freunde
30. Juni 1990. „Udo, hast du was dagegen, wenn ich auf deinem Beet tanze?“ Anton Graf war von Kopf bis Fuß Sirtaki. Noch bevor Dr. Udo Behrens antworten konnte, stolzierte er schon mit ausgebreiteten Armen zum Rhythmus der Gitarre auf dem sandigen Boden der Rostocker Kleingartenanlage. Dagegen hatten die Zwiebeln keine Chance. Es war ein Treffen der verzweifelten Seelen. Morgen sollte die D - Mark offizielles Zahlungsmittel in der DDR werden, was für die lustige Gesellschaft dieser Gartenparty nur bedingt ein Grund zum Feiern war. Nicht, dass sie etwas gegen das Westgeld als begehrtes Zahlungsmittel hatten, aber mit der Einführung einer einheitlichen Währung in Gesamtdeutschland wurden ihre beruflichen und privaten Wege neu justiert. Was nichts Gutes bedeutete.
Trotzdem fanden sie sich zu dieser abendlichen Feier zusammen, weil keiner von ihnen an diesem schicksalsschweren Tag alleine sein wollte.
Dr. Udo Behrens spielte auf der Gitarre die Lieblingsmelodien seiner Freunde. Anton Graf liebte besonders den Sirtaki, weil er sich gerne mit Alexis Sorbas in dem gleichnamigen Film identifizierte, der nach dem totalen Scheitern seines großen Bauprojektes die Arme ausbreitete, um diesen griechischen Volkstanz in den Staub zu stampfen. Genauso fühlte er sich heute. Alles lag in Scherben, und er schritt im wiegenden Schritt über das Zwiebelbeet und rief: „Fangt nur an zu tanzen, die Musik kommt dann von ganz alleine.“
Nachdenkich zog Rudolf Eberhard, ein angesehener Rostocker Bildhauer, an seiner Karo: „Udo spiel doch für mich Hans Beimler Kamerad.“ Udo wusste, weshalb Rudolf dieses Lied jetzt brauchte, war es doch eine Erinnerung an seine Kämpfe in den Internationalen Brigaden Spaniens. Und mit leiser Stimme sang er in die einbrechende Abenddämmerung das Lied von der Kugel aus dem Heimatgewehr, die das Leben des Kommunisten Hans Beimler auslöschte.
Er sah eine tiefe Traurigkeit in Rudolf Eberhards Augen: „Tragen wir heute den Sozialismus in der DDR zu Grabe, waren alle unsere Kämpfe für eine neues Deutschland umsonst?“ Mit dieser Frage holte der alte Spanienkämpfer die alkoholselige Runde zurück in die Realität. Doch mehr als die Frage nach den Perspektiven des Sozialismus in der DDR beschäftigte sie die Sorge um die eigene Zukunft. Sie waren alle in ihrer beruflichen Tätigkeit sehr eng mit der DDR verbunden. Ihnen gemeinsam war die Angst, ob nach dem Niedergang der DDR und der absehbaren Vereinigung der beiden deutschen Statten die neuen Machthaber über sie zu Gericht sitzen würden. Würde man ihnen den Prozess machen, würde man ihnen ihre akademischen Qualifikationen streitig machen oder sogar aberkennen, würden sie ihre Arbeitsplätze behalten oder müssten sie im Extremfall sogar Deutschland verlassen und sich im Ausland, zum Beispiel in Schweden, eine völlig neue Existenz aufbauen. Im Kopf spukte das Wüten der Konterrevolution in Chile. Wo man die Sozialisten im Stadion interniert hatte und dem bekannten Liedermacher Victor Jara im September 1973 zuerst die Hände brach. Damit er nicht mehr Gitarre spielen konnte. Um ihn wenig später hinterrücks zu erschießen.
„Ich denke, die D – Mark wird ihre Wirkung haben.“ Der Historiker Professor Grünau beugte sich in seinem Gartenstuhl nach vorn, um Rudolf Eberhard besser sehen zu können. „Das Volk hat sich gegen die Mangelwirtschaft der DDR entschieden. Wir hatten über vierzig Jahre lang unsere Chance, die sozialistische Gesellschaft zum Sieg über den Kapitalismus zu führen. Jetzt werden wir die Rückkehr zum Kapitalismus nicht aufhalten können.“
Das war für Dr. Udo Behrens ein Stichwort. Zu oft hatten sie in den letzten Tagen und Wochen über die Ursachen für das Scheitern des Sozialismus in der DDR diskutiert. Heute wollte er mit seinen Freunden ein paar lustige Stunden erleben. Er nahm die Gitarre und wandte sich an seine Freunde. „Ich habe für den heutigen Anlass nach dem Vorbild des Oktoberklub – Songs ‚Kommunismus in Bernau‘ ein Lied verfasst. Es heißt:
‚Der Kapitalismus tritt in Kraft‘:
Jetzt endlich haben wir’s geschafft, der Kapitalismus tritt in Kraft.
Am 1. Juli wie beschlossen, da sind wir glücklich und besoffen
Heut feiern wir von früh bis spät, kein Mensch der heute leer ausgeht. Hopsasa
Refrain: Hopsa hopsa rüber und nüber,
jetzt gehen wir zum Kapitalismus über hopsasa`
2. Strophe:
Jetzt könn` wir mikrowellisch garen
und halbbesoffen Auto fahren
Und alle hocken strahlend froh
auf OBIs neuem Wasserklo
Als Hymne gilt der neue Sound,
money make the world go round
Unter dem Gelächter seiner Freunde stimmte er die dritte Strophe an
Jeder kriegt `nen großen Wagen
und darf jetzt seine Meinung sagen
Deutschland hoch und Fitschis raus,
wir Deutschen sind die Herrn im Haus.
Woran wenn nicht am deutschen Wesen
soll denn sonst die Welt genesen.
Dr. Inge Graf, Germanistikdozentin an der Universität, warf mit großer Geste eine Handvoll DDR-Münzen über die Beete. „Lasst uns trinken auf das Wohl unseres heißgeliebten Bundeskanzlers, dem wir dieses schöne neue Geld verdanken“, rief sie theatralisch. Alle waren dankbar für diese Wendung der Diskussion. Sie wollten an diesem Abend keine tiefschürfende Debatte führen, sondern in dieser besonderen Stunde sich gegenseitig Halt geben.
Anton Graf nahm die Vorlage seiner Frau an. „Hast du noch einen Schnaps für mich“, rief er Dr. Udo Behrens zu und steckte sich eine Kabinett unter seinen dicken Schnauzbart. Doch in seinem Kopf schwirrten die Gedanken. Er war als ehemaliger Sekretär der Kreisleitung der SED massiven Verleumdungen ausgesetzt. Die Tageszeitungen hatten behauptet, er hätte in der DDR – Zeit wertvolle Gemälde aus Rostocker Museen in den Westen verschoben. Er konnte sich nicht dagegen wehren. Jeder Versuch, seine Wahrheit in den Medien zu vertreten, hätte nur zu neuen, aggressiveren Attacken gegen ihn geführt. Die Öffentlichkeit wollte von Leuten seines Schlages keine Rechtfertigungen hören, sondern ihn am Boden sehen. So blieben ihm nur der Sirtaki von Alexis Sorbas und die Solidarität seiner Freunde.
Dr. Udo Behrens sah in die vertrauten Gesichter seiner Gäste. Es waren gute Freunde und interessante Persönlichkeiten, die in der bescheidenen Sitzgruppe seines Schrebergartens zusammen saßen. Er war froh und stolz, diese Menschen, gerade jetzt, wo alles in Frage gestellt war, an seiner Seite zu wissen. Seit Monaten überschlugen sich die Ereignisse. Er befand sich im freien Fall und wusste nicht, wo und wie er landen würde. Er hatte keinen Plan, wie sein Leben weitergehen würde und funktionierte einfach so vor sich hin, von heute auf morgen. Weiter konnte er nicht denken. Unwillkürlich musste er an sein Gespräch mit dem Dekan der medizinischen Fakultät denken. Der parteilose Dekan hatte ihm versichert, dass er als Parteisekretär des Bereiches Medizin eine hervorragende Arbeit geleistet und sich hohes Ansehen erworben hatte. Ob das heute noch was wert ist? Wird es bei der Regulierung der Personalfragen an der Universität eine differenzierte Beurteilung geben? Oder wird man alle Leistungsträger der SED über einen Leisten scheren? Immer wieder die gleichen Gedanken, davon brummte ihm schon der Kopf.
Er nahm lieber wieder die Gitarre und sagte zu seinen Gästen: „Kennt ihr eigentlich das Lied des Oktoberklubs ‚Wir über 30‘? Ich finde es passt zu unserer heutigen Runde. Denn es schildert in leicht ironischer Weise, wie sich unsere Generation nach dem Ende des großen Weltkrieges in ihrer sozialistischen Heimat einrichtete.“ Seine Gäste folgten interessiert dem Vortrag und konnten schon bald den Refrain mitsingen:
…“Jeder wird groß, in irgend‘ner Zeit.
Und jeder meint,
seine war ganz was Besonderes …“!
„Von wegen, ganz was Besonderes“, Anton Graf lachte zynisch, „ganz besonders beschissen, müsste es wohl richtiger heißen.“
Der Bildhauer ließ das so nicht gelten: „Da bin ich ganz und gar anderer Meinung. Ich bin froh und dankbar, dass ich dieses Leben in der DDR führen durfte. Für mich war es eine ganz besondere Zeit. Nicht besonders beschissen, sondern besonders wertvoll.“
II. Herbst 89
September 1989. Es war einer dieser endlosen Arbeitstage. Der Herbst malte schon seine bunten Farben auf das Laub der Bäume vor dem Hauptgebäude der Rostocker Universität. Im Konzil Zimmer tagte die Universitätsparteileitung zu ihrer turnusmäßigen Sitzung. Dr. Udo Behrens verfolgte mit geringer Aufmerksamkeit der Ansprache des Parteisekretärs der Universität Dr. Hans Bäcker. Wortfetzen über eine zugespitzte politisch – ideologische Situation drangen in sein Unterbewusstsein. Seine Augen wanderten im Raum herum. Das Konzil Zimmer war für ihn ein zweites Zuhause. Er hatte nicht gezählt, wie oft er in diesem Raum an Verteidigungen von Diplom- und Doktorarbeiten teilgenommen hatte. Er hatte selber hier seine Diplomarbeit, die Dissertation A und die Dissertation B verteidigt. Die großen Holztische, die Polsterstühle mit den hohen Lehnen und die Porträts ehemaliger Rektoren der Rostocker Universität verliehen diesem Raum ein würdevolles Ambiente.
Doch heute standen keine akademischen Verfahren auf der Tagesordnung, es ging um viel mehr. Er spürte wieder dieses flaue Gefühl im Magen, das ihn immer beschlich, wenn er schwere, unangenehme Aufgaben zu erfüllen hatte. Er schaute sich in der Runde der Genossen um. Mit Sympathie betrachtete er den Rektor. Er war mit ihm per Du und schätzte seine freundliche und bescheidene Art. Ein armes Schwein, dachte er. Reibt sich auf und ruiniert dabei seine Gesundheit. Nicht mal 50 und schon den ersten Herzinfarkt. Neben ihm der ehemalige Rektor, auch mit ihm war Dr. Udo Behrens per Du. Seine Blicke wanderten zur Oberin des Bereiches Medizin. Er mochte sie gut leiden, ein Arbeitstier, das für seine Pflichten lebte und kein Privatleben kannte. Sie hatten gemeinsam zahlreiche Gespräche mit jungen Schwestern geführt, um neue Kandidaten für die SED zu gewinnen. Die SED – Kreisleitung hatte ihm diese Aufgabe aufgedrückt. In Vorbereitung des XII. Parteitages sollte er neue SED – Mitglieder gewinnen. Eine aussichtslose Aufgabe. Nicht eine Schwester hatte sich dafür entschieden. Stattdessen nutzten die jungen Frauen die Gespräche, um über ihre Unzufriedenheit mit der Politik der SED zu sprechen. Dr. Udo Behrens lehnte sich in seinem hochlehnigen Stuhl zurück. Er war mit seinen 40 Lebensjahren angekommen im A –Team der Universität. Nicht schlecht für einen Burschen aus einer armen Landarbeiterfamilie. Dachte er für sich.
„In Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED müssen wir eine Offensive in unserer politisch-ideologischen Arbeit unter den Mitarbeitern und Studenten der Universität einleiten“, hörte er den Parteisekretär sagen, „wir dürfen uns von den Westmedien nicht eine Diskussion von außen aufzwingen lassen, sondern müssen unsere Themen offensiv unter die Menschen tragen.“ Er hatte ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Mann. Einerseits beneidete er ihn um seine Eloquenz und sein selbstbewusstes Auftreten. Andererseits nervte ihn dessen selbstherrliche Art. Er duldete in den Leitungssitzungen der hauptamtlichen SED – Funktionäre der Universitätsparteileitung keinen Widerspruch. Dazu passte seine äußere Erscheinung. Immer im Anzug und Krawatte; die geliebte Weste spannte sich über seinen prallen Bauch.
Dr. Hans Bäcker hatte Dr. Udo Behrens es zu verdanken, dass er heute als Parteisekretär des Bereiches Medizin hier saß. Er hatte versucht, sich vor dieser Funktion zu drücken. Leider ohne Erfolgt. Dabei gab es noch ein interessantes Angebot des Direktors für Internationale Beziehungen, sein Amt für einige Jahre zu übernehmen. Dr. Udo Behrens hätte diese Aufgabe sehr interessiert, zumal damit auch Reisen in das sozialistische und nichtsozialistische Ausland verbunden waren. Aber im Bereich Medizin wurde ein neuer Parteisekretär benötigt und damit setze sich der Parteisekretär gegen den Direktor für internationale Beziehungen durch. Für seine Karriere als Hochschullehrer wurde von der Partei ein Praxiseinsatz gefordert. Das sahen die Kaderprogramme so vor. Nach der Habilitation war Dr. Udo Behrens im Juni 1988 zum Hochschuldozenten berufen worden. Da hatte er schon ja gesagt zum Praxiseinsatz in der Medizin. Im November war er dann zum Sekretär der SED Grundorganisation des Bereiches Medizin gewählt worden.
Heute sollte er vor der Universitätsparteileitung über den Umtausch der Parteiausweise sprechen. Wie soll ich mich verhalten, ging es ihm durch den Kopf. Er war kein Mensch, der Konflikte suchte, sondern eher einer, der Harmonie vorzog. Er sah sich in der Runde um. Was wollten diese Genossen von ihm hören? Sollte er dem Stil der offiziellen Parteipropaganda folgen und die Situation verharmlosen? Oder sollte er sagen, was wirklich los war? Er hatte in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit den APO – Sekretären des Bereiches Medizin, mit Klinikdirektoren, FDJ – Sekretären, Mitarbeitern und Studenten geführt. Nervös blickte er auf seine Notizen. Es blieb ihm nicht mehr viel Zeit, sich zu entscheiden. Sollte er Tacheles reden oder nicht. „Udo, kannst du bitte anfangen“, hörte er Dr. Hans Bäcker sagen.
Dr. Udo Behrens begann zu sprechen. Am Anfang standen nüchterne Zahlen. Im Bereich Medizin wurden 631 persönliche Gespräche zum Umtausch der Parteidokumente mit den Genossen geführt, allein er hatte mit 31 Mitgliedern der Grundorganisationsleitung und APO-Sekretären geredet. Unverblümt wurde über die Lage in der DDR gesprochen. Eigentlich keine schlechte Maßnahme. Wann nahm man sich sonst schon die Zeit für ein offenes Gespräch über die Partei und deren aktueller Politik. Es wurde eine Atmosphäre der gemeinsamen Verantwortung der Genossen zur Verbesserung des Sozialismus in der DDR sichtbar. Mit großer Betroffenheit hatten die Genossen auf die massenhafte Abwanderung von Bürgern der DDR reagiert. Ihre Enttäuschung war umso größer, weil die SED – Führung die Lage falsch einschätzte und keine Konsequenzen zur Verbesserung der demokratischen Verhältnisse zog.
Dr. Udo Behrens hatte sich in Fahrt gesprochen. Er konnte jetzt nicht mehr taktieren, sondern sprach klar und deutlich die Probleme an. Die überalterte und starrsinnige SED – Führung ignorierte die Forderungen der Parteibasis nach den dringend notwendigen Reformen in der DDR. Unter den Mitgliedern der Partei herrschte große Unzufriedenheit. Das Vertrauen in die SED – Führung war erschüttert. Dennoch bekannte sich die Mehrheit zu den Werten des sozialistischen Gesellschaftmodells und erklärte sich bereit, an seiner Verbesserung mitzuarbeiten. Allerdings hatten schon 6,3 % der Genossen des Bereiches Medizin ihren Austritt aus dieser Partei erklärt. Das war ein ernstes Alarmsignal, denn Austritte aus der Partei waren nicht üblich und für die weitere Karriere dieser Menschen extrem schädlich.
Dr. Udo Behrens merkte, dass seine Anspannung zunahm. Er löste seine Augen von seinen Notizen und suchte den Blickkontakt zum ehemaligen Rektor. Der nickte ihm fast unmerklich zu, Dr. Udo Behrens nahm das dankbar zur Kenntnis und setzte seine Analyse fort, indem er über die Forschung, Lehre und Betreuung im Bereich Medizin informierte. Er sprach mit spröder Stimme über die unzureichende Ausstattung der Kliniken mit Grundmitteln und Verbrauchsmaterial und über die teilweise desolaten baulichen Zustände der Kliniken und Institute. Wenn hierbei nicht bald grundlegende Verbesserungen durchgeführt wurden, konnte es dazu führen, dass die medizinische Versorgung nicht mehr dem Niveau eines modernen Industrielandes entsprach. Hinzu kam ein zunehmender Mangel an mittlerem medizinischem und ärztlichem Personal. Ergänzt durch extreme Missstände in der apparativ – technischen Ausrüstung konnte die Forschung nicht mit der internationalen Entwicklung Schritt halten und selbst einen einfachen Nachvollzug internationaler Spitzenleistungen nicht mehr realisieren. Das war umso bedauerlicher, weil es unter den Mitgliedern der SED wie unter der Mehrzahl der Ärzte und des medizinischen Personals eine ausgeprägte Leistungsbereitschaft gab.
Im Bereich Medizin war es nie einfach gewesen, Mitglied der SED zu sein. Für viele war diese Mitgliedschaft in der sozialistischen Partei der DDR eine lästige Notwendigkeit, um Karriere zu machen. Die Mitglieder der SED genossen in den Kliniken und Instituten wenig Sympathie. In der aktuellen politischen Krise der DDR mehrten sich die Angriffe gegen die Genossen der SED. Die Mitglieder und Sympathisanten der neuen demokratischen Organisationen, wie dem Neuen Forum, gewannen Oberwasser. Viele waren diesem Druck nicht mehr gewachsen und erklärten ihren Austritt aus der SED. Besonders problematisch war das Anwachsen der Republikflucht. Seit dem 1. Januar 1989 hatten 71 Mitarbeiter und Studenten aus dem Bereich Medizin die DDR illegal verlassen. Darunter befanden sich 23 Ärzte und Naturwissenschaftler. Es war zu einem massiven Vertrauensverlust gekommen. Es existierte ein Widerspruch zwischen der positiven Haltung der Genossen zum Sozialismus und dem substantiell gestörten Verhältnis zur SED – Führung. Die Mitglieder der SED hatten das Vertrauen in die Parteiführung verloren. Ddie SED – Organisation des Bereiches Medizin begann, sich aufzulösen.
Dr. Udo Behrens beendete seinen Vortrag. Im Konzil Zimmer war es still. Durch die undichten Fenster drangen die Geräusche des Rostocker Boulevards, auf dem zu dieser Tagesstunde reges Leben herrschte. Gerne würde er sich jetzt in die Anonymität des bunten Treibens flüchten und im Fünfgiebelhaus einen guten Mokka trinken, wie er es schon oft mit seinen Kollegen in der Mittagspause getan hatte. Da ergriff der ehemalige Rektor das Wort: „Ich möchte mich bei Genossen Behrens für seine gründliche und offene Analyse bedanken. Ich kann seine Einschätzungen nur unterstreichen und wir sollten alle daraus Anregungen für unsere Arbeit ziehen. Ich schlage vor, einen offenen Brief an die Parteiführung zu verfassen, in dem wir unsere tiefe Sorge über den Ernst der politischen Lage in der DDR ausdrücken.“
Eine große Last fiel von Udos Schulter, dankbar sah er dem ehemaligen Rektor, den er sehr verehrte, in die Augen. Sie gingen nach der Sitzung noch gemeinsam zur Straßenbahnhaltestelle am Schröderplatz. Mit Absicht nahmen sie nicht die nächstgelegene Station in der Langen Straße, um Zeit für ein Gespräch und frische Luft für die Lungen zu gewinnen. Langsam schlenderten sie an den beleuchteten Schaufenstern vorbei, ohne einen Blick für die dargebotenen Waren zu haben. Der ehemalige Rektor begann die Unterhaltung: „Mir hat deine Einschätzung gefallen. Ich freue mich, dass du dich innerhalb kurzer Zeit so gut in deine neue Funktion eingearbeitet hast. Ich verfolge deinen Weg an der Universität schon seit einiger Zeit und möchte dir sagen, dass ich dich bald als außerordentlichen Professor sehe. Allerdings weiß ich wenig Privates von dir. Wo kommst du her, was macht deine Frau.“
Dr. Udo Behrens blieb einen Augenblick stehen, um sich eine Antwort zu überlegen. Außerdem war ihm jetzt nach einer Zigarette: „Ich komme aus einfachen Verhältnissen, von einem kleinen Städtchen am Harzrand. Mein Vater war Polizist. Er lebt nicht mehr. Meine Mutter war Hausfrau mit Gelegenheitsjobs. Ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester ist die älteste. Sie leitet einen modernen Kuhstall einer LPG. Mein großer Bruder ist Offizier beim Ministerium für Staatssicherheit. Ich gehöre zu den Arbeiter- und Bauernkindern, die sich in der DDR besonderer Förderung erfreuten. Ich bin dafür sehr dankbar, alle drei Geschwister konnten sich gut entwickeln und was aus ihrem Leben machen. Am schwersten hatte es vielleicht meine Schwester. Sie wurde in einer Zeit des Mangels als Magd zu Bauern geschickt, weil meine Eltern in der Stadt nicht für alle genug zum Essen hatten.“
III. Der Ungewollte
August 1949. Es war unerträglich heiß. Die Sonne schien Löcher in die schlecht isolierten Dächer der alten Fachwerkstadt zu brennen. Helga Behrens litt besonders stark unter der Sonnenglut. Vor wenigen Tagen hatte sie ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Sie fühlte sich schwach und unglücklich. Kein Kind der Liebe, nur ein Esser mehr, wo es ohnehin nicht reichte. Die bescheidene Unterkunft bestand aus zwei kleinen Zimmern und einer winzigen Küche. Eigentlich ein Stall, der sich im Hofgebäude befand. Im Winter eiskalt, im Sommer viel zu warm. Die Toilette war eine Holzhütte im Hof. Von dort hörte sie die laute Stimme ihres Mannes Gerhard. Sie konnte die Wortfetzen nicht verstehen. Was er nur wieder hatte. Sie mochte diesen Mann nicht. Ihr geliebter erster Mann war im großen Krieg vermisst worden. Sie konnte nicht begreifen, dass er nicht mehr lebte und hoffte immer noch auf dessen Heimkehr. Derartige Wunder geschahen immer wieder. Trotzdem hatte sie sich auf Gerhard eingelassen. Für sie alleine war es mit den beiden Kindern zu schwer. Sie hatte noch Glück, bei dem Frauenüberschuss überhaupt einen neuen Partner zu finden. Sie konnte es sich nicht leisten, wählerisch zu sein.
„Warte nur, dich erwische ich noch“, hörte sie Gerhard schimpfen. Dann Stille, seine Schritte auf der knarrenden Holztreppe. Mit triumphierendem Gesicht stand er in der Tür: „Ich habe wieder eine Ratte getötet. Sie war in die Mülltonne gekrochen. Ich habe sie mit kochendem Wasser erledigt.“
Helga spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Wie sie dieses primitive Milieu verabscheute. Wenn sie Zeit zum Träumen hatte, sehnte sie sich nach ihrem Zimmer in der Villa des Friedrichsbrunner Rechtsanwaltes, wo sie ihr Pflichtjahr verbringen durfte. In dieser kultivierten Welt zu leben blieb ihr Traum. Die Realität war aber ganz anders. Ein Schrei ihrer Tochter Irmgard holte sie ins Diesseits zurück. Mit wenigen Schritten eilte sie ins Nebenzimmer, wo der Wäschekorb mit dem Neugeborenen stand. Irmgard wies mit hochrotem Kopf auf das Bettchen: „Igitt, was ist das?“
Ein Blick genügte. Helga kannte die lästigen Bettwanzen nur zu gut. Udos Gesicht war von den kleinen braunen Schmarotzern bedeckt. Ihre Bisse hatten der zarten Haut arg zugesetzt. Das Blut lief über das Gesicht. Mit einem Ruck riss Helga ihr Kind an sich. Weg, nur weg von hier! Und wenn es nur für einige Stunden war. Sie wusch dem Säugling das Gesicht, lief mit ihm die steile Holztreppe hinunter in den Hof und legte ihn in den Kinderwagen. Sie brauchte nur wenige Minute, um den Brühlpark zu erreichen. Große Bäume mit prächtigen Kronen spendeten Schatten. Ihr Weg führte sie vorbei an den Villen der Quedlinburger Oberschicht. Vermögende Bankiers, Fabrikanten und Großgrundbesitzer hatten diese Gebäude an der Wende zum 20. Jahrhundert errichten lassen. Sie kündeten von dem Wohlstand in der alten Stadt, den sie der Saatzucht zu verdanken hatte. In Folge der Enteignungen nach dem Krieg wurden diese Häuser jetzt vermietet. Ganz vorn befand sich die sowjetische Kommandantur. Man sah den Häusern an, dass die Stadtverwaltung als neue Eigentümerin für deren Erhaltung keinerlei Mittel verwendete.
Helga verweilte kurz vor dem Gedenkstein, auf dem die Hochwasserstände der Bode dokumentiert worden waren. Aber dafür besaß sie heute kein Auge, sah sie doch ihren fünfjährigen Sohn nah am Ufer des Flusses stehen. An jener Stelle, wo die Bode einen kleinen Wasserfall bildete. Seit jeher ein Magnet für kleine Entdecker. Vorsichtig schlich sie sich an, um ihn nicht zu erschrecken. Nicht auszudenken, wenn er sich erschrak und das Gleichgewicht verlor. Das Wasser war tief, die Strömung stark. Mit einem kräftigen Griff nahm sie ihn in den Arm: „Werner, mein Junge, was treibst du denn hier. Du hast ja nur einen Schuh an, wo ist der andere?“
Werner sah seine Mutter ernst an, seine Stirn legte sich in Falten: „Ich erforsche die Strömung der Bode. Dazu habe ich den Schuh ins Wasser gesetzt.“ Und als er das entsetzte Gesicht seiner Mutter bemerkte, fügte er hinzu: „Der kommt aber morgen hier wieder vorbei, dann hole ich ihn mir zurück.“
Da musste sie trotz aller Sorgen herzhaft lachen. Sie gab ihrem kleinen Forscher einen lieben Kuss. Er war ihr Liebling, war er doch der ganze Stolz ihres ersten Mannes. „Komm“, sagte sie, „lass uns zur Brühlgaststätte gehen. Heute gönnen wir uns mal was.“
Dieses Restaurant war die beliebteste Ausflugsgaststätte der Quedlinburger. Schon seit Jahrzehnten existierte hier ein Gaststättenbetrieb. Vor dem Krieg war sie oft mit ihrem Mann hier gewesen. Manchmal, so zum Tanzen, hatte er ein Glas Wein spendiert. Auch heute war das Lokal gut besucht. Johlend kam ihr eine Horde Halbwüchsiger entgegen. Sie eskortierten einem betrunkenen Mann, der in einer Schubkarre nach Hause gefahren wurde. Helga kannte das zur Genüge. Auch Gerhard war schon so transportiert worden. Sie besaß keinerlei Verständnis dafür, wenn Männer das Geld in die Kneipe trugen und sich bis zur Besinnungslosigkeit betranken. Sie konnte gerade noch ihren Sohn davon abhalten, sich dem Konvoi anzuschließen. Sie drohte ihm: „Anständige Jungen machen das nicht. Lass dir das eine Lehre sein. Du willst doch wohl nicht auch in der Gosse landen!“
Im Biergarten war alles besetzt. Helga bat ein älteres Ehepaar höflich darum, an deren Tisch Platz nehmen zu dürfen. Die Frau lächelte freundlich und machte eine einladende Handbewegung: „Aber bitte, Fräulein Helga, nehmen sie doch Platz. Oder darf ich schon Frau zu ihnen sagen.“ Und als sie Helgas Überraschtsein bemerkte, fügte sie hinzu: „Sie haben uns wohl nicht erkannt. Wir kommen aus Ditfurt, besitzen dort eine Bauernwirtschaft. Wir kennen sie von Friedrichsbrunn, als wir dort unseren Anwalt konsultierten.“
„Aber das ist doch schon so lange her, da können sie sich noch an mich erinnern?“
„Ja, aber natürlich“, mischte sich der Mann in das Gespräch.
„Sie waren so ein bildhübsches junges Ding, das vergisst man doch nicht. Und sie hatten ein sehr gutes Benehmen. Ich habe gleich zu meiner Frau gesagt, das Mädel wird es zu was bringen. Die gehört in die bessere Gesellschaft.“
Die Frau merkte, wie diese Worte Helga verunsicherten: „Was du immer hast. Du machst das Fräulein Helga noch ganz verlegen. Schließlich hatten wir diesen schlimmen Krieg. Da lief manches anders als wir wollten. Nicht wahr?“
Die Unterhaltung wurde vom Kellner unterbrochen. Ihr schmales Budgets berücksichtigend, bestellte Helga zwei Gläser der beliebten grünen Fassbrause und eine Bockwurst mit Brot, um sich diese mit Werner zu teilen.
„Nein, nein, bringen sie bitte für die Dame zwei Bockwürste“, sagte der Bauer. Und an Helga gewandt: „Wir können uns das leisten. Wir dürfen sie doch einladen? Haben sie etwa noch mehr Kinder?“
Helga lächelte verlegen: „Ja, noch eine Tochter, die ist jetzt 12 Jahre alt. Es ist gar nicht so einfach, in diesen Zeiten drei Kinder satt zu bekommen. Von anderen Wünschen ganz zu schweigen. Mein erster Mann wurde als vermisst gemeldet. Mein zweiter Mann arbeitet als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Da bleibt nicht viel zu Leben…“
Der Bauer atmete hörbar aus: „Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, wir können ihnen helfen. Schicken sie doch ihre Tochter zu uns, wenn sie alt genug ist. Sie kann uns zur Hand gehen. Sie haben einen Esser weniger am Tisch und wir können eine tüchtige Magd gut gebrauchen. Oder was meinst du?“ Er sah fragend seine Frau an.
Helga war unsicher, wie sie antworten sollte. Ihre Tochter wurde demnächst dreizehn. Das bedeutete, sie würde im nächsten Jahr das Haus verlassen. Viel zu früh, eigentlich sollte sie eine gute Ausbildung erhalten. Aber die Zeiten waren hart, vielleicht war das ein Wink des Schicksals. Ditfurt war nicht aus der Welt - mit dem Zug nur ein paar Minuten. Oder bei schönem Wetter über den Lehhof zu Fuß oder mit dem Rad, eine zumutbare Strecke. Konnte sie den beiden Bauern ihr Kind anvertrauen? Sie antwortete ausweichend: „Ich bedanke mich für ihr Angebot. Ich möchte darüber noch mit meinem Mann sprechen. Ich melde mich dann bei ihnen.“
„Na, dann warten sie man nicht zu lange, junge Frau“, sagte die Bäuerin unwirsch, „an Interessenten ist kein Mangel.“
Werner hatte inzwischen die Gelegenheit genutzt und beide Bockwürste gegessen. Helga hatte das sehr wohl bemerkt. Ließ ihn aber gewähren. Sie sagte zu ihm: „Komm, wir müssen nach Hause gehen.“ Nach Hause, sinnierte sie, kann man diese Loch als Zuhause betrachten? Seufzend nahm sie ihren Werner an die Hand und schob lustlos den Kinderwagen mit dem schlafenden Udo vor sich her.
IV. Irmgard
I
Januar 1951. Irmgard konnte sich viele Jahre später noch genau an jenen eiskalten Wintertag erinnern, als sie der Bauer mit dem Pferdewagen vom Bahnhof abholte. Sie musste hinten auf einem Bündel Stroh sitzen und fror jämmerlich in ihrem dünnen Mantel. Auf der langen Bahnhofstraße mit dem holprigen Kopfsteinpflaster wurde sie kräftig durchgeschüttelt. Sie summte leise, damit der Bauer es nicht bemerkte: „Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg.“ Oh, wie sie ihren Vater jetzt vermisste. Er war schon zum Beginn des Krieges eingezogen worden, und sie hatte ihn nur zweimal gesehen, wenn er für kurze Zeit im Heimaturlaub war. Ihr war noch sein vertrauter Geruch gegenwärtig, wenn er sie auf den Arm genommen und ihr lockiges schwarzes Haar gestreichelt hatte. Nie und nimmer hätte er es erlaubt, dass seine süße kleine Tochter aus dem Hause gejagt wird. Wo der liebe Vati wohl jetzt sein mag. Für sie war er noch nicht tot, nur vermisst. Sie hoffte so sehr, eines Tages steht er vor der Tür und holt sie nach Hause. Und weiter summte sie die Melodie des alten Kinderliedes: „Die Mutter ist im Pommerland, und Pommerland ist abgebrannt. Maikäfer flieg.“
Sie hatte davon geträumt, nach der 8. Klasse eine gute Lehrausbildung antreten zu können. Jedoch war das nicht so einfach. Die Wirtschaft lag noch danieder. Gute Ausbildungsplätze waren rar. Aber sie war sehr hübsch und hatte gute Noten. Sekretärin bei einem Rechtsanwalt wollte sie werden. Mutter hatte viel von ihren Erlebnissen während ihres Pflichtjahres bei einem Anwalt erzählt. Später wurde dieser nationalsozialistische Dienst für junge Mädchen und Frauen als Ausbeutung charakterisiert. Doch ihre Mutter sprach nur gut darüber. Aus einfachen Verhältnissen stammend, hatte sie in dieser Zeit gute Umgangsformen gelernt und war von dem Wert einer hohen Bildung überzeugt worden. Seitdem achtete sie sehr darauf, dass sich ihre Kinder in der Schule Mühe gaben und nicht den Harzer Dialekt, sondern ein gutes Hochdeutsch sprachen.
Für Irmgard war das eine neue, unbekannte Welt, in die sie so gerne hätte eintreten wollen. Umso größer fiel ihre Enttäuschung aus, als die Mutter ihr die Anstellung als Gehilfin beim Bauern verschaffte. Die Mutter hatte sie in Quedlinburg in den Zug gesetzt, ein kleiner schäbiger Koffer enthielt ihre wenigen Habseligkeiten. Nun betrat sie zum ersten Mal ihre neue Arbeitsstelle. In ihrem Kopf summte noch immer die kleine Melodie ‚Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg‘.
Jäh holte die mürrische Bauersfrau sie in die Realität zurück. Unlustig hielt sie ihr die Hand zur Begrüßung hin und stellte eine dampfende Suppe auf den Tisch. Im barschen Ton erklärte sie ihr, was ihre Arbeitgeber von ihr erwarteten. Morgens um fünf Uhr aufstehen, die Kühe melken und danach alle anfallenden Arbeiten im Haus, im Stall und auf dem Acker erledigen. Freie Tage waren nicht vorgesehen. Verpflegung und Unterkunft waren umsonst, darüber hinaus gab es ein paar Mark Lohn. Die kleine Mädchenkammer war unter dem Dach und hatte keinen Ofen. Ein altes Bett mit einem Strohsack als Matratze und ein kleiner Schrank – das war alles. Und doch sollte diese kleine Kammer ihr Reich der Phantasie werden. Hierhin konnte sie sich zurückziehen und sich in eine bessere Welt träumen, mit einer guten Arbeit in einer Anwaltskanzlei und ihrem geliebten Vati.
Die Zeit verging und es stellte sich heraus, dass ihr bäuerliches Leben nicht nur Schattenseiten hatte. Die Bauersleute waren zwar kurz angebunden und strahlten keine Herzenswärme aus. Das mag zu großen Teil aus ihrem harten Arbeitsleben erwachsen sein. Es war nicht üblich, Gefühle zu zeigen. Das war schon immer so. Das kannte man nicht anders und gab diese Gefühlskälte von Generation zu Generation weiter. Irmgard konnte als gelehrige Schülerin schnell die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Sie errang sich damit Anerkennung und wusste auch die gute Verpflegung zu schätzen. Es dauerte nicht lange, und ihr war das dörfliche Leben so vertraut, als ob sie nie etwas anderes gemacht hätte.
Ihre kleine Kammer war ihr Refugium, hier konnte sie lesen, wenn es warm genug dafür war. Besser als Zuhause, dachte sie oft, wo sie mit zwei kleineren Brüdern in einem Bett schlafen musste. Außerdem brauchte sie nun keine Angst mehr vor dem zweiten Mann ihrer Mutter zu haben. Wie sehr hatte sie sich geschämt, wenn er sie beim Abseifen in der Küche anstierte. Hier auf dem Dorf passte die Bäuerin schon auf, dass sie bei der Körperreinigung nicht beobachtet oder gestört wurde. Sie stellte dabei keine großen Anforderungen. Sie kannte keine beheizten Badezimmer. Sie war es gewohnt, sich in der Küche mit einer kleinen Emailschüssel zu begnügen und sich mit einem Lappen gründlich abzuseifen. Es war ihr schon Luxus genug, wenn sie dabei allein sein durfte, das Wasser warm und die Küche geheizt waren.
Es brauchte keine lange Zeit, bis sich im Dorf herumgesprochen hatte, dass ein junges hübsches Ding aus der Stadt auf dem Hof der Maltes eine Anstellung gefunden hatte. Der Pastor hatte schon nachgefragt, ob sie nicht am kirchlichen Leben teilhaben wollte. Aber sie war atheistisch erzogen worden und zeigte deshalb kein Interesse an der Religion. Größere Sympathien hegte sie für Egon, den FDJ – Sekretär des Dorfes. Ein junger, hübscher Traktorist. Sie hatte ihn während des Tanztees im Dorfkrug kennengelernt und schwärmte heimlich für seine blauen Augen. Er konnte so packend von den großartigen Zukunftschancen der jungen Generation erzählen und lag damit auch Irmgard ständig in den Ohren.
Gerne ging sie mit Egon in der Abendsonne spazieren. Hinter sich das Dorf und vor sich die Weite der Feldflur. Als ob der Weg sie in ein neues Leben führte, ihr Wunschleben. Egon bedrängte sie nicht in ihrer Unschuld. Sie hielten sich an den Händen und tauschten verliebte Blicke. Irmgard spürte ein starkes Verlangen, Egon in ihre Arme zu nehmen und ihn innig zu küssen. Aber sie wollte damit noch warten, bis sie alt genug dafür war, vielleicht schon im nächsten Jahr, wenn sie sechzehn wurde. So beschränkten sie sich darauf, über ihre Zukunftsträume zu reden. Sie wollte aus ihrem Leben mehr machen, für junge Menschen wie sie standen im Arbeiter – und – Bauern - Staat alle Türen offen. Ihre Stelle als Magd durfte kein Abstellgleis werden. Sie waren sich bald einig, dass sie die Arbeiter – und Bauern - Fakultät in Halle besuchen und danach ein Lehrerstudium aufnehmen sollte. Ein lang gehegter Traum nahm Gestalt an. Er setzte sich fest in ihrem hübschen Lockenkopf. Immer wenn sie in ihrer primitiven Dachkammer lag, öffnete sie ihrem Traum die Tür. Sie ging mit ihm spazieren durch ihr späteres Leben. Sie sah sich in einem bunten Sommerkleid vor einer Schulklasse stehen und in neugierige Kinderaugen blicken. Diese schönen Tagträume liebte sie über Alles. Sie waren die größte Hoffnung in ihrem harten Leben und gaben ihr Halt und Zuversicht.
Mehr Egon zuliebe als einer politischen Überzeugung folgend, wurde Irmgard Mitglied der Freien Deutschen Jugend, der Jugendorganisation der DDR. Als Einheitskleidung diente die blaue Bluse mit der aufgehenden Sonne am Ärmel. Verschämt trug sie dieses Kleidungsstück, obwohl Egon meinte, es würde ihr ausgezeichnet stehen. Im Dorf wurde sie deshalb angepöbelt . ‚Innen rot, außen blau, so kleidet sich die Sau‘ war noch ein harmloser Spruch. Einige schreckten nicht vor Drohungen zurück: „Warte nur, wenn es wieder anders kommt, wir werden an dich denken, du rote Sau.“
Derartige Drohungen konnten Irmgard nicht davon abhalten, sich am Leben des Jugendverbandes zu beteiligen. Sie fühlte sich in ihrer Ortsgruppe zuhause. Hier konnte sie mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten auf Augenhöhe kommunizieren. In den Versammlungen spielten politische Diskussionen eine wichtige Rolle. Krieg und Nationalsozialismus waren für diese Generation nicht nur Geschichte, sie hatten das alles unmittelbar miterlebt und benötigten die Unterstützung politisch Erfahrener, um das Erlebte zu verarbeiten. Gern gesehene Gesprächspartner waren alte Genossen der SPD und KPD, die im antifaschistischen Widerstand aktiv gewesen waren. Irmgard machte dabei aus ihren Sorgen kein Hehl. „Warum geht es heute den einfachen Menschen in der DDR viel schlechter als im Westen. Die Großbauern leben wie die Maden im Speck, wir einfachen Landarbeiter haben kaum genug zum Essen. Das kann doch kein wirklicher Arbeiter – und – Bauern – Staat sein“, fragte sie einen alten Genossen, der eigentlich über seinen Widerstand gegen das Hitlerregime sprechen wollte. Sofort wollte ihr eine Agitatorin der Kreisleitung ins Wort fallen, um sie wegen der ketzerischen Frage zu maßregeln. Aber der alte Genosse ließ das nicht zu: „Lassen wir doch die Jugendfreundin ihre Fragen stellen. Dafür gibt es doch die FDJ.“ Und sich zu Irmgard wendend fuhr er fort: „Ich gebe dir Recht, uns gefällt das auch nicht. Aber wir hatten in der DDR viel schlechtere Starbedingungen als der Westen, Unsere Kriegsschäden waren viel größer, weil die Nazis an der Ostfront die Taktik der verbrannten Erde praktizierten. Sie sprengten was sie konnten, um dem roten Feind möglichst wenig zu überlassen. Außerdem hatten wir kaum eine Grundstoffindustrie, die befand sich im Westen. Diese Disproportionen konnten wir in den vergangenen Jahren erheblich reduzieren. Dabei blieb leider die Versorgung der Menschen etwas auf der Strecke. Wir beginnen aber jetzt mit unserem ersten Fünfjahrplan. Damit wollen wir endlich auch das Leben der Arbeiter und Bauern verbessern. Die Zeit der Versorgungslücken wird bald vorbei sein.“
Ein junger Traktorist fiel ihm ins Wort: „ Du kannst aber nicht alles auf den Krieg und die Disproportionen in unserer Wirtschaft schieben. Ich komme aus der Stadt. Wir mussten zusehen, wie die Sowjetunion im großen Stil die Betriebe ausschlachteten. Überall wurden die zweiten Gleise demontiert. Die besten Betriebe haben die Sowets sich als Sowjetische Aktiengesellschaften einverleibt. Dagegen haben die im Westen durch den Marschallplan sogar noch Unterstützung erhalten.“
Der alte Genosse nahm eine Papirossa aus der Packung und steckte sich die Zigarette an. Er blies den blauen Rauch in die Luft. Eine Pause entstand. Was würde mit dem frechen Frager passieren. Wird man ihn der Staatssicherheit melden? Schließlich hieß doch die aktuelle Losung ‚Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen‘. Und dann macht so einer die Sowjetunion schlecht. Aber der alte Genosse blieb ruhig: „Wir müssen doch zugeben, dass die Kriegsschäden in der Sowjetunion viel größer als in Amerika waren. Für mich ist es eine Frage der Ehre, dass wir dafür Wiedergutmachung leisten. Auch wenn es wehtut. Schau dir meine Papirossa an. Eine einfache und ehrliche Zigarette. Wie sie der sowjetische Soldat im Schützengraben rauchte, bevor ihn die feindliche Kugel traf. Diese, zugegeben etwas stinkende Zigarette ist mir lieber als das parfümierte amerikanische Kraut. Denn ohne den opferreichen Kampf der Roten Armee hätten wir die Nazis nicht besiegen können. Deshalb ist die Freundschaft zur Sowjetunion für mich eine Frage der Dankbarkeit und Verpflichtung. Auch wenn uns die Reparationszahlungen schmerzen, wir sind es unseren Freunden einfach schuldig.“
Irmgard hatte aufmerksam zugehört. Sie freute sich, wie offen der alte Genosse die Fragen der Jugend beantwortete. Bald würde sie studieren und dadurch vieles noch besser verstehen. Darauf freute sie sich sehr.
Doch diese Hoffnung dauerte nicht lange. Es war einer dieser heißen Augusttage, als die Getreideernte eingefahren wurde. Den ganzen Tag von früh an hatte Irmgard, sie war inzwischen sechzehn Jahre alt, auf dem Leiterwagen gestanden und die Getreidegarben hoch aufgestapelt. Sie trug kurze Shorts, eine leichte Bluse und hatte ihre langen lockigen Haare zu einem Dutt hochgesteckt. Sie war sich ihrer Jugend und Schönheit bewusst und sah mit Genugtuung das Funkeln in den Augen der Männer, wenn sie sich zum Packen der Garben nach vorn beugte und die Ansätze ihrer jungen, festen Brust zu sehen waren. Edmund, der Neffe ihrer Bauern, bemühte sich besonders darum, ihre Aufmerksamkeit zu erhalten.
Am Abend dann war sie alleine in ihrer Mädchenkammer. Ihre Bauern waren in den Dorfkrug gegangen, um sich den Staub aus dem Hals zu spülen. Plötzlich stand Edmund mit einer Flasche Wein in der Tür. Sie war nie aufgeklärt worden. Ihre Mutter hatte sie nur immer davor gewarnt, dass die Männer von den Mädchen immer nur das Eine wollen und sie sollte sich vor ihnen in Acht nehmen. Doch plötzlich stand dieser junge kräftige Bauernbursche in ihrer Kammer und bot ihr ein Glas Wein an. Nach dem zweiten Glas wurde die Welt leicht und sie atmete seinen Geruch von frischem Stroh. Als er auf ihr lag und in sie eindrang, konnte ihr niemand helfen.
Neun Monate später kam ihre Tochter zur Welt. Davor hatte sie Edmund geheiratet. Die Hochzeit war im pompösen Stil gefeiert worden. Ein Schwein wurde geschlachtet, um der großen Hochzeitsgesellschaft ausreichend Fleisch vorsetzen zu können. Irmgard hatte diese Wochen und Monate wie im Rausch verbracht. Sie hatte eine tiefe Abneigung gegen ihren zukünftigen Mann. Sie verabscheute sein rotes, aufgedunsenes Gesicht. Sehr bald schon musste sie zu Edmund ziehen und war dort von ihm fast täglich sexuell bedrängt worden.
Ihre Mutter und ihr Stiefvater waren ihr in dieser schlimmen Lage keine Hilfe. Ganz im Gegenteil. Beide liebten es, sie in ihrem neuen Zuhause zu besuchen und sich dabei nach Herzenslust mit Speisen und Getränken versorgen zu lassen. Sie hatte diese Besuche gehasst. Da man kein Telefon hatte, war es nicht üblich, seine Besuche anzukündigen. So hatte Irmgard immer Ärger, wenn ihre Eltern unangemeldet in der Hoftür standen. Edmund wollte sich keine Blöße geben und ließ reichlich Essen und Trinken auftafeln. Besonders liebte er es, seinen Schwiegervater besoffen zu machen, was auch regelmäßig gelang. Weil Irmgards Stiefvater Mitglied der SED war, wurde er von Edmund verachtet. Umso größer war seine Schadenfreude, wenn er sah, wie seine Schwiegermutter mit ihrem torkelnden Mann zum letzten Zug lief. „Das kann er, der Herr Genosse“, pflegte er dann zu sagen, „auf unsere Kosten fressen und saufen. Aber warte nur, bis es anders kommt, dann hängt er am nächsten Laternenpfahl.“
Edmunds Eltern hatten durch die Bodenreform einige Morgen Land bekommen. Als Grundlage für einen bäuerlichen Erwerbsbetrieb reichte es nicht, lediglich für die Versorgung des eigenen Viehs, vor allem der Schweine. Wenn man sich darum gut kümmerte, das Eine oder Andere aus der LPG mitgehen ließ, konnte man im Laufe der Jahre ein beträchtliches Vermögen zusammenraffen. Unbeeindruckt vom wachsenden Wohlstand blieb in Edmund eine tief verwurzelte Unzufriedenheit mit seinem Status als Landarbeiter in der LPG. Er träumte von einem Leben als angesehener Großbauer und sah in der SED – Herrschaft die Ursache dafür, dass er diesen Lebenstraum nicht realisieren konnte. Als in den Dörfern die ersten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gebildet wurden, sah er seine Felle davon schwimmen. Seine Hoffnung, seinen Landbesitz zu mehren und allmählich zum Großbauern aufzusteigen, war im Winde verweht. Er blieb, was er war, ein kleiner Landarbeiter, und er hatte ewig diesen Groll in sich.
Die Heirat mit Irmgard kam Edmund nicht zupass. Zwar war sie ein hübsches junges Ding, aber arm wie eine Klofrau auf dem Bahnhof. Ihm wäre eine wohlhabende Bauerntochter lieber gewesen. Aber das Kind war unterwegs und er wollte und konnte sich gegen diese Heirat nicht wehren.
Die Ehe von Irmgard und Edmund hatte keinen langen Bestand. Ihr Mann erwies sich als herrschsüchtiger und gewalttätiger Egomane. Eines Tages ritt Edmund auf seinem Kaltblüter in die Dorfkneipe und erregte damit erhebliches Aufsehen. Im stark alkoholisierten Zustand beschimpfte er den anwesenden Vorsitzenden der LPG und forderte von ihm die Herausgabe des ihm zustehenden Anteils am genossenschaftlichen Eigentum. Als der auf diese Weise Beschimpfte sich diese Forderungen verbat, sprang Edmund mit unvermuteter Geschicklichkeit vom Pferd und begann auf ihn einzuschlagen. Nur mit größter Mühe gelang es fünf kräftigen Männern, Edmund von diesem Vorhaben abzubringen. Die herbeigerufene Polizei nahm ihn in Gewahrsam bis er seinen Alkoholrausch ausgeschlafen hatte. Damit war für Irmgard der Bogen überspannt worden. Sie reichte die Scheidung ein. Was sie noch nicht wusste, war, dass sie das zweite Kind von Edmund unter dem Herzen trug.
Der Richter hatte viel Verständnis für die Sorgen Irmgards und vollzog die juristische Trennung des Paares. Der als Zeuge aufgerufene Stiefvater trug zu dieser Entscheidung maßgeblich bei, indem er den gewalttätigen Charakter und die antikommunistische Einstellung Edmunds ausgiebig erläuterte. Edmund sollte ihm das nie vergessen. Eine lebenslange Männerfeindschaft war geboren. Nach der Scheidung verließ Irmgard das Dorf und fand in der Stadt eine kleine, schäbige Bleibe. Im Winter ließ sich die schlecht gedämmte Wohnung in einem alten Fachwerkhaus mit der feuchten Braunkohle kaum erwärmen. Das Klo war auf dem Hof und unter den Fußbodendielen pfiffen die Ratten. Viele Stunden hatte sie in dieser trostlosen Umgebung geweint. Mutter und Stiefvater ließen sich nicht sehen. Sie war wieder allein auf sich gestellt. Es war deshalb nicht wirklich eine Überraschung, als Irmgard nach nur einem halben Jahr den drängenden Bitten Edmunds nachgab und wieder zu ihm zog. Die zweite Hochzeit wurde in aller Stille im kleinen Kreis gefeiert. Das zweite Kind war ein Junge. Edmund blieb immer im Zweifel, ob dieser Junge von ihm oder ein Bastard war.
Udo Behrens sollte von diesem Leidensweg seiner geliebten Schwester erst später erfahren. Das bäuerliche Leben war für ihn nicht die Hölle, sondern das Abenteuerland.
V. Abenteuerzeit
August 1961. Es war höchste Zeit, die Getreideernte einzufahren, denn es herrschte ein unbeständiges Wetter. Udo Behrens verbrachte einen Teil der Sommerferien bei seiner Schwester Irmgard in dem kleinen Dorf im Harzer Vorland. Er liebte diese Ferienzeit auf dem Lande. Hier konnte er weite Räume nutzen, um seiner Phantasie freien Lauf zu lassen. Am liebsten war er dabei alleine. Zu den Kindern des Dorfes suchte er keinen Kontakt. Seine Schwester ließ ihm jede Freiheit. Sie kannte ihren kleinen Bruder als Träumer und Individualisten und gönnte ihm seine Freiräume.
Udo konnte stundenlang im Gras liegen und den Wolken nachschauen. Er gab den Wolken Namen, je nachdem welches Gebilde sie in seiner Phantasie darstellten. Da gab es das Kamel, den Löwen, aber auch das Flugzeug oder das Schiff. Lange folgten seine Augen dem Zug der fragilen Figuren am Himmel, und er freute sich, wenn aus seinen Lieblingswolken neue Phantasiegebilde entstanden. Es war deshalb nicht verwunderlich, dass in ihm der Wunsch keimte, Pilot zu werden. Er fand dabei Unterstützung bei einem älteren Jungen, der eine Ausbildung zum Segelflieger machte und später Flugzeugführer auf einer MIG 19 werden wollte. Für Udo war es das Größte, wenn ihn sein älterer Freund mit zum Flugplatz nahm. Begierig nahm er hier alles in sich auf und liebte es, mit offenen Augen und Ohren dem Fachsimpeln der Segelflieger zu folgen. Zu Udos Lieblingsspielen gehörte, mit einem selbstgebauten Bogen und einer ebenfalls selbstgebauten Schleuder, Schlappi genannt, durch die Stoppelfelder zu stromern. Immer auf der Suche nach einem Hasen oder einem Rebhuhn. Wiederholt ließ er seine Pfeile fliegen, blieb aber stets ohne Jagderfolg. Gerne half er seiner Schwester bei der Verrichtung aller bäuerlichen Arbeiten. Mit Geschick konnte er die Futtermischung für die Schweine herstellen. Er zerstampfte in einem Holzbottich die gekochten Kartoffeln, die noch warm dampfend aus dem großen elektrischen Kochtopf kamen, mischte diesen Brei mit einer grob kalkulierten Menge Kleie und warf die Melange den hungrigen Tieren vor. Diese stürzten sich mit lautem Quieken auf das leckere Angebot und hatten es in Windeseile verputzt.
Udo war in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, wie es für den großen Teil der Nachkriegsgeneration typisch war. Seine Eltern konnten mit ihm und seinen Geschwistern keinerlei Urlaubsreisen unternehmen. Es fehlte dafür das Geld. Umso mehr freute er sich, wenn er im Sommer für zwei Wochen von zuhause weg kam und am dörflichen Leben teilhaben konnte. Seine ältere Schwester Irmgard bewohnte mit ihrem Mann, ihren Kindern, sowie mit der Mutter und dem Bruder ihres Mannes einen kleinen Bauernhof. Neben der Arbeit in der LPG bewirtschaftete die Familie noch einige Morgen privaten Ackerlandes. Vor einigen Tagen war der notreife Weizen mit der Sense abgemäht worden. Udo bewunderte seinen Schwager, der einen großen Erfahrungsschatz als Bauer besaß und seine Kenntnisse bereitwillig an Udo weitergab. Udo wusste nicht, wie gewalttätig der Schwager seine Schwester behandelte. Diese bittere Erkenntnis wartete noch auf ihn. Jetzt verfolge er voller Bewunderung, wie sein Schwager und dessen Bruder mit geschicktem Schwung das Getreide von den Halmen sensten. Die Frauen gingen dahinter und banden das Mähgut zu