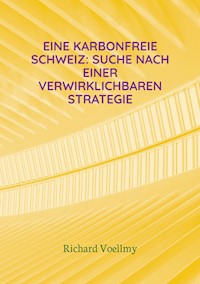
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dem Klimawandel soll durch drastische Reduktionen und die eventuelle Sistierung von Emissionen aus fossilen Kraftstoffen entgegengewirkt werden. Fossile Energien sollen durch erneuerbare Energien (sprich Sonneneinstrahlung und Wind) ersetzt werden. Wie ich am Beispiel der Schweiz unter Verwendung von allgemein zugänglichen Zahlen aufzeige, ist diese Strategie unrealistisch. Deshalb ist es wohl auch nicht von Nachteil, dass diese Strategie nicht wirklich zielstrebig verfolgt wird. Ich plädiere für einen zwischenzeitlichen Weiterausbau der Kernkraft und eine konsequente, parallele Entwicklung der geothermischen Stromproduktion, die zu einem Grundpfeiler der Stromversorgung werden sollte. Die Fortschritte, die in der tiefen Geothermie in den letzten Jahren erzielt wurden, sollten diese alternative Strategie ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abbildung kreiert von Robert E. Ronde für «Global Warming Art». Die Projektion beruht auf einem IS92a «business as usual» Szenario. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Richard Voellmy
Avenue de Sully 67
CH-1814 La Tour-de-Peilz
Inhaltsverzeichnis
In Kürze, Zusammenfassung
Einleitende Gedanken
Der ökologische Fussabdruck - Energiesparen
Die «Elektrifizierung von allem» und deren Strombedarf
Grüne Energien (Sonne, Wind usw.)
Nationale Gesetzgebung
Tiefe geothermische Energie
Energie aus Kernkraft
Wie sollte ein rationaler Ansatz zur Reform des Energiesystems aussehen?
Korollar
Abschliessende Gedanken
Weitere Anmerkungen
Literatur
Begleitwort
Autor
In Kürze
Dem Klimawandel soll durch drastische Reduktionen und die eventuelle Sistierung von Emissionen aus fossilen Kraftstoffen entgegengewirkt werden. Fossile Energien sollen durch erneuerbare Energien (sprich Sonneneinstrahlung und Wind) ersetzt werden. Wie ich am Beispiel der Schweiz unter Verwendung von allgemein zugänglichen Zahlen aufzeige, ist diese Strategie unrealistisch. Deshalb ist es wohl auch nicht von Nachteil, dass diese Strategie nicht wirklich zielstrebig verfolgt wird. Ich plädiere für einen zwischenzeitlichen Weiterausbau der Kernkraft und eine konsequente, parallele Entwicklung der geothermischen Stromproduktion, die zu einem Grundpfeiler der Stromversorgung werden sollte. Die Fortschritte, die in der tiefen Geothermie in den letzten Jahren erzielt wurden, sollten diese alternative Strategie ermöglichen.
Zusammenfassung
Gemäss dem Pariser Übereinkommen von 2016, das von den meisten Ländern der Welt ratifiziert wurde, soll die durchschnittliche Erderwärmung deutlich unter 20C und möglichst unter 1,50C relativ zu vorindustriellen Werten gehalten werden. Es scheint allgemein akzeptiert zu sein, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn Treibhausgasemissionen sukzessive gesenkt werden und ab 2050 keine unkompensierten Emissionen mehr stattfinden. Die Schweiz hat sich zu einer 50%igen Verminderung bis 2030 (relativ zu 1990 Werten) und zu netto-null Emissionen ab 2050 verpflichtet. Bloss, wie soll das gehen? Obwohl darüber geredet wird, gibt es wenige Anzeichen dafür, dass das Gros der Leute ihren ökologischen Fussabdruck freiwillig verkleinern werden, was eine Verringerung des Verbrauchs von fossilen Energien zur Folge hätte. Ganz im Gegenteil. Um die Emissionsminderungsziele vielleicht dennoch (wenn auch wahrscheinlich etwas verspätet) einhalten zu können, sollen alle mit fossilen Energien alimentierten Prozesse (insbesondere die Mobilität und das Heizwesen) elektrifiziert und mit grünem Strom (in der Schweiz hauptsächlich aus der Photovoltaik) betrieben werden. Wenigstens in der Schweiz fehlt eine griffige Gesetzgebung, die diesen Wandel effektiv vorantreiben könnte. Ein Verbot von neuen Kernkraftwerken gibt es allerdings. Die geltende und vorgeschlagene Gesetzgebung wird in diesem Beitrag ausführlich diskutiert. Die Elektrifizierung der hauptsächlichsten Prozesse (Mobilität, Heizung) ist machbar. Hingegen erscheint eine grüne Stromproduktion mittels Photovoltaik, die sowohl die neu elektrifizierten Prozesse alimentieren als auch den Verlust von Strom aus den alternden Kernkraftwerken und mit fossiler Energie betriebenen Kraftwerken wettmachen könnte, als illusorisch. Meine Überschlagsrechnungen ergeben, dass die Stromproduktion in etwa verdoppelt werden müsste (+ 70-75 TWh). Ich habe drei vereinfachte Szenarien gerechnet: (1) alle Photovoltaikanlagen befinden sich im schweizerischen Mittelland und sind so überdimensioniert, dass sie auch den Winterbedarf abdecken können (peak shaving), (2) alle Anlagen befinden sich im Mittelland und überschüssiger Sommerstrom wird mittels (im Übrigen noch unerprobten) «power-to-gas» (P2G) Technologien für das Winterhalbjahr gespeichert and (3) alle Anlagen befinden sich in alpinen Regionen. Um den zusätzlich benötigten Strom zuverlässig produzieren zu können, müssten Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von etwa 1'600 (1), 960 (2) oder 540 km2 (3) installiert werden. Zur Veranschaulichung: die Fläche des Kantons Thurgau beträgt 991 km2. Die Gesamtfläche aller Photovoltaiktauglichen Gebäudedächer und Fassaden beläuft sich auf etwa 202 km2. Welch eine Verschandelung von Natur und Ortsbildern, die ein solcher Ausbau zur Folge hätte. Die Anlagen würden etwa 500 (1) oder 300 (2,3) Milliarden Franken kosten. Es darf angenommen werden, dass sie etwa alle 20 Jahre ersetzt werden müssten. Der Energieaufwand zur Herstellung der Anlagen entspräche etwa 9,2-mal (1), 5,7-mal (2) oder 3,2-mal (3) dem jährlichen Gesamtenergieverbrauch (inklusive fossiler Energie) der Schweiz. Diese Zahlen sind so gigantisch, dass es offensichtlich ist, dass diese Art von Energiewandel undurchführbar ist. Wenn man bedenkt, dass halb Europa auf einen massiven Ausbau der Photovoltaik setzt, ist es voraussehbar, dass die notwendige Anzahl von Photovoltaik Modulen und elektronischem Zubehör gar nicht beschafft werden könnte. Und das ist noch nicht alles: der Tagesverlauf der photovoltaischen Produktion müsste geglättet und Wetterschwankungen ausgeglichen werden durch kurzfristige Speicherung eines Grossteils der produzierten Elektrizität. Genügend Kapazitäten für eine Kurzzeitspeicherung in einem solchen Massstab sind nicht vorhanden. Es müsste z.B. die Pumpspeicherkapazität der Schweiz um ein Mehrfaches vergrössert werden, was mit geschätzten Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe verbunden wäre. Es erscheint als offensichtlich, dass andere karbonfreie Technologien eingesetzt werden müssen, um den zusätzlich benötigten Strom zu erzeugen. In Frage kämen in der Hauptsache Kernkraftwerke und geothermische Kraftwerke. Neue Designs haben Kernkraftwerke sicherer gemacht. Auch sind Kraftwerke der dritten Generation typischerweise Last-folgend, was wichtig ist, da die Saisonalität der hydroelektrischen Produktion und des Strombedarfs von Wärmepumpenheizsystemen zu kompensieren wäre. Solange die bestehenden Kernkraftwerke noch am Netz sind, dürften einige wenige zusätzliche Kernkraftwerke genügen, um einen Grossteil des voraussehbaren zusätzlichen Bedarfs zu decken. Die effektive Bauzeit von Kernkraftwerken der dritten Generation dürfte rund 5 Jahre betragen, und technologische Hürden sollten nicht mehr im Weg stehen. Ich betrachte die Kernkraft als Lückenbüsserin und plädiere dafür, dass wir längerfristig auf eine Lastfolgende geothermische Stromproduktion setzen und deren Realisation umgehend angehen sollten. Erdwärme ist die ultimative, nachhaltige und karbonfreie Energie, die überall und für geologische Zeiten verfügbar ist. Gestein in einigen Kilometern Tiefe ist genügend heiss, um damit Wasser auf eine Temperatur zu erhitzen, auf der es eine Turbine anzutreiben vermag. Die tiefe Geothermie hat beachtliche Fortschritte gemacht, seit induzierte Erdbeben in Basel und St. Gallen ihren Ausbau in der Schweiz abrupt stoppten. Die Perfektionierung des horizontalen Bohrens durch die Erdölindustrie macht es möglich, geschlossene Systeme («advanced geothermal systems oder «AGS») in Betracht zu ziehen: das «Eavor loop» System besteht aus zwei tiefen vertikalen Bohrlöchern, deren untere Enden über Kilometer-lange horizontal verlaufende Bohrlöcher miteinander kommunizieren. Eine Pilotanlage wurde gebaut und die Technologie sorgfältig ausgetestet. Dieses System hat matchentscheidende Vorteile gegenüber den ursprünglichen Systemen (den sogenannten «enhanced geothermal systems» oder «EGS»): 1. Die Ungewissheit beim Bau eines EGS, ob eine genügende Durchflussgeschwindigkeit der Arbeitsflüssigkeit durch das aufgebrochene Gestein erreicht werden kann und ob der Flüssigkeitsverlust im Gestein tragbar sein wird, entfällt. Die Durchflussgeschwindigkeit ist planbar, und Flüssigkeitsverluste sollten nicht auftreten; 2. Seismische Ereignisse sind praktisch ausgeschlossen; 3. Umweltverschmutzung sollte kein Thema mehr sein, da die Arbeitsflüssigkeit ausschliesslich durch versiegelte Bohrlöcher fliesst; 4. Die Arbeitsflüssigkeit muss nicht gepumpt werden (Thermosiphon Effekt), was die Effizienz der Stromproduktion erhöht. Eine Weiterentwicklung minimiert den Fussabdruck des Systems weiter: die vertikalen Bohrlöcher stehen nahe beieinander, und die horizontalen Bohrlöcher sind als Schleifen angelegt. Kommerzielle Projekte sind unterwegs oder geplant. Ein massgeblicher Faktor, der den Bau von geothermischen Kraftwerken teuer macht, sind die Bohrkosten. Kontaktfreie Bohrmethoden versprechen diese Kosten deutlich zu senken. An solchen Methoden wird bereits seit Jahren geforscht. Ein Plasmapuls Verfahren (PLASMABIT), das in Labor- und Feldversuchen alle Versprechungen erfüllt hat, soll demnächst Europas tiefste Bohrungen ausführen. Ich bin der Ansicht, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, konsequent auf die Erschliessung von tiefer geothermischer Energie zu setzen mit dem Ziel, diese Technologie zu einem Grundpfeiler unserer zukünftigen Stromversorgung zu machen. Natürlich müssten wir dazu ein wenig Pioniergeist entwickeln sowie die staatlichen Garantien und Teilfinanzierungen sprechen, ohne die sich Industrieakteure kaum dazu bewegen lassen werden, kommerzielle geothermische Kraftwerke (oder auch neue Kernkraftwerke) zu erstellen.
1. Einleitende Gedanken
11. Januar 2022
Ich sitze an meinem Bürotisch in La Tour-de-Peilz, einer kleinen Stadt am schweizerischen Ufer des Genfersees. Die Omikron Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 breiten sich weltweit rasant aus. Ende letzter Woche informierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über 30'000 neue Infektionen an einem einzigen Tag. Die USA wiesen am selben Tag beinahe 900'000 Neuinfektionen aus. Es scheint, dass die meisten neuerlich infizierten Menschen relativ milde Krankheitsverläufe haben. Ich nehme an, dass dies wenigstens z.T. dem Impfen zuzuschreiben ist. Mein Interesse an der Wirksamkeit von Impfungen ist professionell. Meine Firma beschäftigt sich bereits seit zehn Jahren mit der Entwicklung eines neuartigen Impfverfahrens. Unsere Versuche werden an verschiedenen akademischen Forschungslaboratorien ausgeführt. Zwischen der Planung eines Versuchs und dem Erhalt der Resultate vergehen typischerweise mehrere Monate. Während Versuche am Laufen sind, habe ich Zeit, mich mit anderen Themen zu befassen. Ich denke seit längerem über das Thema Klimawandel nach. Dabei überlasse ich es den professionellen Klimaforschern sich damit herumzuschlagen, wieviel davon menschengemacht ist. Ich gehe von der Hypothese aus, dass der Klimawandel vollumfänglich durch die Verbrennung von Erdölprodukten und Erdgas verursacht wird und beschäftige mich mit der Frage, wie wir es schaffen könnten, auf die Verbrennung dieser Energieträger zu verzichten.
Letzten Sommer haben mein Freund Dr. Olivier Zürcher (Ingenieur und Thermodynamiker) und ich eine Übersichtsstudie publiziert1, in welcher wir uns mit dem Aufwand beschäftigten, welcher betrieben werden müsste, um die Schweiz mittels grüner Technologien CO2-neutral zu machen. Wir zeigten auf, dass die notwendigen Anstrengungen gigantisch wären, sowohl bezüglich des finanziellen Aufwands als auch bezüglich der grauen Energie, die dafür eingesetzt werden müsste. Wir überliessen es den Lesern und Leserinnen, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Echo das wir erhielten liess uns vermuten, dass die Leser und Leserinnen das Unterfangen für undurchführbar hielten. Ich dachte damals, dass unsere Studie eine einmalige Anstrengung bleiben würde. In der Zwischenzeit begann ich mich immer mehr daran zu stören, dass wir keinen vernünftigen Weg vorwärts skizziert hatten. Ich nehme deshalb das Thema hier nochmals auf.
Wie schon in unserer vorausgegangenen Arbeit werde ich hauptsächlich (vorpandemische) schweizerische statistische Daten zur Energieproduktion und zum Energieverbrauch verwenden und mich auch mit der relevanten Schweizer Gesetzgebung befassen. Aus diesem Grund betrifft meine Diskussion hauptsächlich die schweizerischen Verhältnisse. Natürlich sind die besprochenen Probleme nicht Schweiz-spezifisch. Nicht nur die Schweiz, sondern auch ein Grossteil der übrigen Welt strebt danach, auf fossile Energien zu verzichten. In diesem Sinne bezieht sich meine Diskussion auf gemeinsame Probleme und Anliegen, die am Beispiel der Schweiz konkret gemacht werden.
Ich habe kürzlich wieder einmal einen alarmierenden Bericht in der Schweizer Presse gelesen, der sich mit dem extrem hohen ökologischen Fussabdruck der Schweiz befasste. Ich werde mich mit diesem Thema im nächsten Kapitel befassen.
Zuvor möchte ich jedoch einige allgemeine Anmerkungen machen. Grundsätzlich stehen uns zwei komplementäre Strategien zur Verfügung, um den Verbrauch von fossiler Energie zu reduzieren, nämlich Energiesparen und Energieträgersubstitution. Wie wir sehen werden, könnten die grössten Einsparungen gemacht werden, wenn wir auf private Mobilität verzichteten und Wärmepumpensysteme für die Gebäudeheizung und Warmwassererzeugung einsetzen würden. Darüber hinaus gäbe es unzählige weitere Möglichkeiten, den fossilen Energieverbrauch zu senken. Einige der Massnahmen brächten vielleicht nicht viel, deren Gesamtheit hingegen schon. Die folgende, unvollständige und unsystematisch zusammengestellte Liste zeigt auch auf, welche verfehlte Lebensweise wir uns angewöhnt haben. Unsere gegenwärtigen Leitmotive scheinen Bequemlichkeit und scheinbarer Effizienzgewinn zu sein.
In unseren Mehrzimmerwohnungen beheizen wir alle Zimmer. Dies ist offensichtlich unnötig. Wenigstens Schlafzimmer müssten nicht beheizt werden.
Heizkörperflächen (in Häusern ohne Bodenheizung) wurden minimiert, um möglichst viel freie Wand- und Fensterfläche zu erhalten. Eine Energieverschleuderung.
Ältere Gebäude sollten energetisch saniert werden.
Baden sollte durch Duschen ersetzt werden. Beim Duschen müsste das Wasser nicht länger als etwa eine Minute fliessen.
Wieso braucht eine Einzelperson eine Wohnung mit über 100 m
2
Grundfläche? Zusammenrücken spart viel Energie (auch wenn dies epidemiologisch nicht völlig unbedenklich ist).
Macht es Sinn mit Erdgas zu heizen und elektrisch zu kochen?
Ich schätze ein bei Migros erhältliches Duschgel namens «Petit Marseillais». Leider wird es in «kugelsicheren», dickwandigen 250 ml Plastikflaschen verkauft?
Wieso werden Mineralwasser in Lebensmittelgeschäften in offenen Kühlschränken ausgestellt?
Fehlverhalten. Ein Beispiel: bei der Abfallstation vor unserem Gebäude werden oft leere Weinflaschen, grosse Kartonschachteln, Möbel, Velos, usw. deponiert. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde mehrmals täglich einen Lastwagen vorbeischickt um aufzuräumen.
Weshalb braucht jedermann einen motorisierten Laubbläser? Wo ist der gute alter Rechen geblieben?
Als wir eine oder zwei kleine Waschmaschinen für unser Mehrfamilienhaus, in welchem die meisten Wohnungen Studios sind, kaufen wollten, wurde uns gesagt, dass ein Servicevertrag nur für eine industrielle Waschmaschine erhältlich sei. Jetzt waschen manche Mitbewohner zwei Hemden die Woche in der industriellen Maschine.
Neue Geräte und Fahrzeuge werden vermehrt modular gebaut. Selbst beim kleinsten Defekt müssen ganze Module ersetzt werden.
Altkleider und gebrauchte Schuhe werden über Tausende von Kilometern transportiert, um dann grossenteils auf einer Müllhalde zu landen.
Selbst einfache Güter wie Kleider, Spielsachen und Möbel werden in Asien hergestellt und dann über die ganze Welt verteilt. Wussten Sie, dass die «steinreiche» Schweiz sogar Kies importiert?
Benötigt unsere Küche wirklich Avocados, Mangos oder Maniok? Oder Erdbeeren, Blaubeeren oder Mandarinen im Frühling? Solche Lebensmittel kommen oft von weit her, z.T. aus Übersee. Könnten wir allenfalls auf australischen oder kalifornischen Wein verzichten?
Zeitungen werden immer noch gedruckt und täglich verteilt. Wir wurden sogar unlängst an die Urne gerufen, um über eine Subventionierung der Verteilung von Zeitungen abzustimmen. Machen farbige Kataloge auf Hochglanzpapier und voluminöse Zeitungen der Lebensmittelindustrie wirklich Sinn?
Mit jedem neuen Gerät, das wir nicht kaufen, und mit jedem Gerät, das wir nicht vorzeitig ersetzen, sparen wir die Energiemengen ein, die zu deren Herstellung hätten aufgewendet werden müssen.
Ein langer Arbeitsweg verbraucht viel Energie, besonders wenn er mit dem Privatfahrzeug bewältigt wird. Man müsste bestrebt sein, so nahe beim Arbeitsort wie möglich zu wohnen.
Ich habe mich überzeugen lassen, dass das Energiesparen aus gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Gründen wahrscheinlich nur wenig zur angestrebten Verminderung von CO2 Emissionen beitragen wird. Deshalb beschäftigt sich diese Arbeit hauptsächlich (aber nicht ausschliesslich) mit dem Thema der Energieträgersubstitution.
2. Der ökologische Fussabdruck - Energiesparen
26. Januar 2022





























