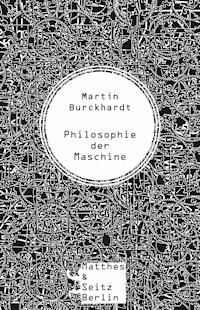5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Von elektrisierten Mönchen zur künstlichen Intelligenz: Die Geistesgeschichte der Maschine
Wir erleben täglich das Wechselbad der Gefühle: Digitalisierungsbegeisterung und Furcht vor der fremden kalten Macht. Doch woher kommt sie, diese Macht? Der Kulturtheoretiker Martin Burckhardt zeigt: alles ist von Menschen erdacht. Schließlich begann das digitale Zeitalter 1746. Wir würden nicht im Internet surfen, hätte Abbé Nollet damals nicht die Sofortwirkung von Elektrizität entdeckt. Hätte Joseph-Marie Jacquard nicht den automatisierten Webstuhl erfunden und Charles Babbage mit seiner Analytischen Maschine nicht den Grundstein für unseren heutigen Computer gelegt. Nicht die Mathematik treibt die Digitalisierung voran, sondern menschliche Wünsche und Sehnsüchte. Dieses Buch ist eine Einladung, den Computer nicht als Gerät zu denken, sondern als Gesellschaftsspiel, das unsere Zukunft prägen wird. Ein Crashkurs in der Geistesgeschichte der Maschine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Wir erleben täglich das Wechselbad der Gefühle: Digitalisierungsbegeisterung und Furcht vor der fremden kalten Macht. Doch woher kommt sie, diese Macht? Der Kulturtheoretiker Martin Burckhardt zeigt: Alles ist von Menschen erdacht. Schließlich begann das digitale Zeitalter 1746. Wir würden nicht im Internet surfen, hätte Abbé Nollet damals nicht die Sofortwirkung von Elektrizität entdeckt. Hätte Joseph-Marie Jacquard nicht den automatisierten Webstuhl erfunden und Charles Babbage mit seiner Analytischen Maschine nicht den Grundstein für unseren heutigen Computer gelegt. Nicht die Mathematik treibt die Digitalisierung voran, sondern menschliche Wünsche und Sehnsüchte. Dieses Buch ist eine Einladung, den Computer nicht als Gerät zu denken, sondern als Gesellschaftsspiel, das unsere Zukunft prägen wird. Ein Crashkurs zur Geistesgeschichte der Maschine.
Zum Autor
Martin Burckhardt lebt in Berlin. Der Kulturtheoretiker hat eine Reihe von kulturgeschichtlichen Büchern geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Bei Knaus erschien sein Roman »Score«, zuletzt veröffentlichte er »Philosophie der Maschine«.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Martin Burckhardt
Eine kurze
Geschichte der
Digitalisierung
Für Johannes (wenn er denn groß genug ist)
INHALT
GEDANKEN VORWEG
1 VOM KURZSCHLUSS DER GESCHICHTE
2 DIE GÖTTLICHE KRAFT
3 LOB DER FAULHEIT
4 DAS MATHEMATISCHE KIND
5 ALLES UND NICHTS
6 EINLADUNG ZUM GEFLÜGELSALAT
7 DAS GEHEIME LEBEN
8 DER HEISSE KRIEGER
9 WAR GAMES
10 VON DEN ZWERGEN DES SILICON VALLEY
11 AMAZING GRACE ODER WIE MAN EINEN COMPUTER ERZIEHT
12 DIE ERFINDUNG DER MAUS
13 ÜBER DEN ÄTHER
14 DAS GENIE DER MASSE
15 DER MANN VOM MARS
16 NOCH FRAGEN?
17 VON DER GEISTESGEGENWART
EPILOG IN THE YEAR 2046 (ODER HABE ICH DAS GETRÄUMT?)
GEDANKEN VORWEG
GEDANKEN VORWEG
Alle reden von »Digitalisierung«. Doch was sich dahinter verbirgt, ist eine große Unbekannte geblieben – der innigen Beziehung zum Trotz, die wir zu unserem Smartphone unterhalten. Fragt man danach, woher der Computer kommt, lautet die Antwort meist: »von der Rechenmaschine«, oder es folgt verlegenes Schweigen. Erstaunlicherweise betrifft diese Ahnungslosigkeit nicht nur diejenigen, die als User keinen Grund sehen, dem Innenleben ihres Lieblingsspielzeugs hinterherzuforschen, sondern vielfach auch Programmierer, deren Beruf darin besteht, der Maschine Dienstbarkeit, wenn nicht gar »Intelligenz« einzuhauchen. Dies führt zu jener sonderbaren Spaltung der Welt, in der ein Teil des Publikums die Maschine als himmlisches Jerusalem bejubelt, ein anderer sie als Abgrund verteufelt. Derlei Glaubensstreitigkeiten haben jedoch wenig mit der Realität zu tun. Hin- und hergerissen zwischen Himmel und Hölle, bewegt man sich in der Cloud, einem geistigen Schwebezustand, in dem nichts mehr gewiss ist.
Hat schon Marx prophezeit, dass alles »Stehende und Ständische verdampft«, kann jede Gegenwartsdiagnose nur nüchtern konstatieren, dass die sogenannte »Realität« in Auflösung begriffen ist: ein Potemkin’sches Dorf, das nicht zufällig immer mehr »Fake News« hervorbringt. Konnte man vor einigen Jahren noch glauben, dass der Welt mit der Digitalisierung eine Art Second Life angeflanscht ist, begreifen wir heute: Wir hängen im Netz, so oder so, hier und jetzt. Und das ist unser Leben.
Jedoch ist dieser Prozess kein Verhängnis, das von einer höheren Instanz ins Werk gesetzt worden wäre. Ganz im Gegenteil: Die Digitalisierung ist ein Menschheitsprojekt. Anders als in der Auseinandersetzung mit der Natur hat man es hier nicht mehr mit behämmerter Materie, der Tücke des Objekts oder anderen Widrigkeiten zu tun. Wenn der Gedanke an eine Grenze stößt, so liegt sie im eigenen Fassungsvermögen begründet, dem Mangel an Imagination oder der schieren Unkenntnis der Regeln und Sprachen, denen die digitale Welt gehorcht.
Wenn ich die »kurze Geschichte der Digitalisierung« erzähle, so ist der Impuls, der mich treibt, der Versuch, die Geschichte eines welt- und gesellschaftsverändernden kulturellen Wandels zu fassen, der in Begriffslosigkeit, Märchenglauben und Halbwissen zu ersticken droht. Dabei besteht der größte Irrglaube in der Annahme, man habe es mit einem Werkzeug zu tun, das man, wie einen Hammer, »im Griff« haben könne. Nein, der Computer ist nichts, was man »im Griff« hat, er ist vielmehr eine gesellschaftsüberwölbende Architektur, eine geistige Kathedrale, die sich über mehrere Jahrhunderte herausgebildet hat.
Lässt man sich auf diese Geschichte ein, die gelegentlich heitere, immer aber höchst menschliche Züge trägt, entsteht ein neues Bild der Moderne: ein Bild, in dem die Digitalisierung nicht mehr als kalter Dämon erscheint. Denn nicht der Himmel ist unsere Grenze, sondern die menschliche Einbildungskraft.
Martin Burckhardt
Herbst 2018
1 VOM KURZSCHLUSS DER GESCHICHTE
1
VOM KURZSCHLUSS DER GESCHICHTE
Jede Vorgeschichte ist dunkel – und so muss man sich nicht wundern, dass man von seinem Kind gefragt wird, ob man eigentlich die Steinzeit miterlebt habe. Aber so weit müssen wir gar nicht zurück. Bloß in das Jahr 1746, das ebenfalls weit vor meiner Zeit liegt. Und doch behaupte ich, dass in diesem ansonsten recht ereignislosen Jahr das Internet in die Welt geraten ist. Bitte? Ja, das klingt verrückt. Vermutlich wird mancher protestieren und sagen: Was für ein Quatsch! Was ist mit Tim Berners-Lee? Aber Geduld! Denn auf der Suche nach den Wurzeln des digitalen Zeitalters werden wir nicht der allgemeinen Heldengeschichte folgen, sondern dem »Geist der Maschine« – genau dorthin, wo unsere wundersame Analog-Digital-Wandlung ihren Ausgang nimmt.
Stellen wir uns ein freies Feld im Norden Frankreichs vor. Sechshundert Mönche, die sich in einem großen Kreis aufstellen und einander mit Eisendraht verkabeln.
Nachdem sich die Mönche in Formation gebracht haben, berührt einer von ihnen, der Abbé Jean-Antoine Nollet, ein Gefäß. Und was passiert?
Nicht bloß einer, nein, alle Mönche beginnen zu zucken!
Was so esoterisch klingt wie Stühlerücken und Totenbeschwörung, ist kein rätselhafter Kult, sondern ein streng wissenschaftlicher Versuch. Man hatte herausgefunden, dass sich Elektrizität speichern lässt – nämlich in der sogenannten Leidener Flasche, einem mit Wasser gefüllten Glasbehälter, der durch Reibung elektrisiert worden war.
Und mit dieser »Batterie« im Gepäck stellte sich die Frage, wie schnell sich die wunderbare Substanz durch einen Menschenkreislauf bewegt. Gibt es da jene Art Phasenversatz wie bei einer La-Ola-Welle?
Ursprünglich hatte man angenommen, dass der Strom, den man sich als feine Flüssigkeit vorstellte, sich wie eine rasend schnelle Flutwelle ausbreiten würde. Deshalb die Versuchsanordnung: das große, weite Feld und die große Zahl der Mönche, die einen Kreis von etwa 600 Metern Durchmesser bildeten. Gleichwohl, das Ergebnis war überraschend. Denn als der Versuchsleiter den kleinen Metallstift berührte, der aus der Flasche hervorragte, begannen die Mönche gleichzeitig zu zucken, ohne dass das Auge eine Verzögerung wahrnehmen konnte. Das musste bedeuten, dass in dem Augenblick, als der Geist die Flasche verließ, die Elektrizität überall war! Wie erstaunlich! Und gleichzeitig verstörend. Wie der liebe Gott, den man sich als eine Allgegenwart vorstellte.
Schon die ersten Beobachtungen, die man mit dieser merkwürdigen Kraft gemacht hatte, waren überaus rätselhaft gewesen. Fast vierzig Jahre zuvor hatte Stephen Gray, ein Textilfärber und Hobbyastronom, bemerkt, dass der Glaszylinder, den er mit Wolle oder Katzenfell abgerieben hatte, plötzlich anziehend wirkte: Im Raum herumliegender Gänseflaum blieb daran hängen. Was tut man wohl, wenn man einen Geist in der Flasche gefangen hat? Man pfropft die Flasche mit einem Korken zu.
Damit freilich war diesem Geist nicht beizukommen. Denn als Gray seinen Korken anderweitig benutzen wollte, stellte er fest, dass sich die rätselhafte Anziehungskraft auf den Korken übertragen hatte – auch er zog nun Gänsefedern an. Gray befestigte Hanfschnüre am Korkenverschluss, um zu prüfen, ob sich der Geist an diesen Schnüren entlang zu anderen Punkten im Raum zu hangeln vermochte. Bei den nachfolgenden Versuchen wurden die Schnüre, die er »Lines of Communication« nannte, immer länger. Und es zeigte sich, dass sich die merkwürdige Kraft zu jedem beliebigen Punkt transportieren ließ. Allerdings gelang dies nicht immer. Holz und Glas beispielsweise waren gänzlich unempfindlich, während Kupferdraht eine besonders hohe Leitfähigkeit besaß. Folglich gelang es Gray im Jahr 1729, mithilfe eines seidenumwickelten Kupferdrahts eine größere Strecke zu überbrücken. Berührte er nun den elektrisierten Glaszylinder, erhoben sich am anderen Ende der Leitung Blattgoldstücke und tanzten wie Schmetterlinge um eine Elfenbeinkugel herum. Natürlich stellte sich die Frage: Wie verhält sich der menschliche Körper zu dieser beweglichen Anziehungskraft? Ist er leitfähig oder nicht?
Um das herauszufinden, hängte Gray einen Knaben in eine Seilkonstruktion, elektrisierte ihn mithilfe einer aufgeladenen Glasröhre und ließ das Kind mit den Fingerspitzen Messingplättchen anziehen.
Da der Junge an einem nicht leitenden Holzgestell hing, war klar, dass der menschliche Körper animierbar war. Folglich musste es so etwas wie eine »animalische Elektrizität« geben. Sehr bald schon verwandelten sich diese Versuche zu einem modischen Zeitvertreib, bei dem die Kavaliere der Wissenschaft vorführten, dass man jungen Frauen Funken aus dem Kopf ziehen konnte, Schriftzüge aufglühen lassen und dergleichen mehr.
Aber was hat all das mit unserer Computerwelt und dem Internet zu tun? Schweifen wir hier nicht ab und kommen von Hölzken auf Stöcksken, vom Hundertsten ins Tausendste? Strenggenommen ist genau diese Abschweifung unser Thema. Denn das Experiment mit den Mönchen ist nur eine radikale Ausweitung der Gray’schen Versuche, mit dem Unterschied, dass hier erstmals die Frage der Geschwindigkeit im Vordergrund steht. Der Versuchsleiter, Abbé Nollet, hatte bereits dem französischen König die Schlagkraft einer Leidener Flasche demonstriert, und zwar indem er eine ganze Kompanie von Soldaten in Zuckungen versetzt hatte. Seine Mönche bekamen nun die Doppelrolle auferlegt, als elektrische Leiter, aber auch als Sensoren zu fungieren, an deren Zuckungen abzulesen sein würde, ob sie von der Geisterkraft erfasst worden waren oder nicht. Dass alle Mönche gleichzeitig zu zucken begannen, ließ nur die Schlussfolgerung zu, dass diese Kraft die Entfernung sozusagen entfernt hatte, trat sie doch zeitgleich an allen Punkten des Kreises in Erscheinung. Aber wie war dies möglich? Was war das für eine Kraft, der es mühelos gelang, den Raum zu überbrücken?
Man kann sich leicht vorstellen, dass diese Frage die Menschen durcheinanderbrachte, umso mehr, als die Wissenschaft die Gesetze der Natur gerade auf den Fall eines Apfels, will sagen: die Gravitation eingeschworen hatte. Tatsächlich sei die Welt, so behaupteten die Philosophen, nichts weiter als eine große Maschine. Folglich war es nur logisch, die Lebewesen als natürliche Automaten aufzufassen, während der Geist präzise und unbestechlich wie ein Uhrwerk funktionierte. Hätte man Kenntnis von der Lage, Position und Geschwindigkeit aller im Universum befindlichen Teile, so könnte man jeden vergangenen, aber auch jeden künftigen Weltzustand verlässlich berechnen. In diese schöne Regelmäßigkeit schlug nun der Blitz der Elektrizität ein wie ein göttliches Wunder – oder anders: Die Entdeckung zog auf wie eine schwere Wolke, die den hellen Himmel der Aufklärung bedrohlich verdunkelte. In jedem Fall ließ diese Wolke allerlei okkulte Fragen wiederauferstehen. Personifiziert im Philosophen Swedenborg, dessen Werk ein merkwürdiges Pandämonium von Engeln und Geistwesen versammelte, strömten mit Macht allerlei Fragen zurück, die zuletzt die Theologen des Mittelalters beschäftigt hatten. Hatte man damals darüber spekuliert, wie schnell sich eigentlich Engel bewegen, war man auf die Lösung verfallen, dass ein Engel, wenn er beispielsweise von Barcelona nach Mailand reist (978 Kilometer Entfernung), sich so schnell bewegt, dass ihn bei einem Regenguss kaum mehr als zwei Regentropfen berühren. Setzen wir dafür eine Dauer von 1 Sekunde an, kommen wir auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von stolzen 3 520 800 km/h (ein Dreihundertstel der Lichtgeschwindigkeit, der Geschwindigkeit, mit der elektrische Teilchen durch ein Vakuum reisen).
Was aber hat das nun mit dem Internet zu schaffen? Indem die Versuchsanordnung des Abbé Nollet die Geschwindigkeit der Elektrizität zu ermitteln sucht, nimmt sie die Frage der Relativitätstheorie des 20. Jahrhunderts vorweg – jene Kopplung von Lichtgeschwindigkeit und Echtzeit, in der die Möglichkeit des Fernhandelns bereits eingepreist ist. War es möglich, mit einem Fingerdruck eine Aktion auszulösen, die viele Kilometer entfernt stattfand? Für die damalige Zeit, die sich mit Pferdekraft und Kutsche voranbewegte, war dies eine ungeheure, vor allem gänzlich fremdartige Vorstellung. Aber wenn wir ehrlich sind: Haben wir nicht selbst Schwierigkeiten damit, uns eine solche Gleichzeitigkeit vorzustellen? Deshalb die Rätselfrage: Wie lange braucht wohl ein elektrisch geladenes Teilchen, um auf einem Chip des Jahres 1961 von A nach B zu reisen? Diese Frage ist nichts als die Umformulierung des Nollet’schen Versuchs – nur dass die Mönche hier »Transistoren« genannt werden und ihr Abstand voneinander auf 0,15 Mikrometer zusammengeschrumpft ist. Die Antwort lautet: Wenn ein Meter definiert ist als die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunde zurücklegt, braucht das Teilchen nur ein Hunderttausendstel dieser 299 Sekunden-Milliardstel – also eine so geringe Zeitspanne, dass wir sie gar nicht zu denken vermögen.
Letztlich macht es keinen Unterschied, ob wir uns die Engel des Mittelalters, die Mönche des Abbé Nollet oder die Transistoren auf einem Computerchip vorstellen. Für uns spielt der Zeitfluss keine Rolle mehr. Genau das ist die Bedeutung dieses merkwürdigen Wortes: »Echtzeit«. Damit nämlich ist gesagt, dass, obwohl es durchaus eine Reisegeschwindigkeit der elektrischen Teilchen gibt, diese von unseren Sinnen nicht erfasst werden kann. Weil der Mensch kaum mehr als 30 Bilder in der Sekunde erfassen kann, behaupten wir eine Gleichzeitigkeit, also »Echtzeit« – obwohl das streng physikalisch nicht richtig ist. Insofern gibt es zwischen den elektrisierten Mönchen des Abbé Nollet und den Transistoren eines Computerchips keinen Unterschied. Man könnte vom Humanprozessor des Abbé Nollet sprechen. Wie bei den Engeln des Mittelalters, die von den Mönchen des 18. Jahrhunderts auf Trab gebracht werden, ist es vor allem eine Beschleunigungs- und wie man sieht: eine Verkleinerungsfrage. Genau darin besteht ja der Geschwindigkeitsfortschritt unserer Tage. Fragte man sich im Mittelalter, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz haben, lautet die Frage moderner Prozessorarchitektur: Wie viele Mönche (Transistoren) kann ich auf einen Chip drucken?
2 DIE GÖTTLICHE KRAFT
2
DIE GÖTTLICHE KRAFT
Man versteht leicht, warum die Menschen des 18. Jahrhunderts die Elektrizität als göttliche Kraft betrachteten. Diese Überzeugung hatte weitreichende Implikationen: Schon der Abbé Nollet verfiel auf den Gedanken, Kranke mit Elektroschocks zu behandeln. Man hatte die Elektrizität als Lebenskraft identifiziert – immerhin war es gelungen, Kleingetier wie Spatzen oder Kaninchen mithilfe von Elektroschocks aus dem Leben und wieder zurück zu befördern. Zu wahrer Meisterschaft im Umgang mit der neuen Energie brachte es ein Magier, der als Sohn eines Försters bei Konstanz geboren war, in Wien zu Reichtum gelangt und dann, nach einigen Skandalen, 1778 nach Paris gegangen war: Franz Anton Mesmer.
Hatte er seine Patienten zu Anfang mit Elektrizität und mineralischen Magneten behandelt, begriff er bald, dass die Wirkung des »Schocks« selbst dann einsetzte, wenn Elektrizität und Magnet nicht bei jeder Person direkt zum Einsatz kamen. Die Erkenntnis dieses scheinbaren Placebo-Effekts führte Mesmer dazu, von einem sogenannten animalischen Magnetismus auszugehen. Er kreierte eine Apparatur aus einem hölzernen, mit Wasser und Eisenspänen gefüllten Zuber, an dem sich, kreisförmig angeordnet, bis zu zwanzig metallene Bügel befanden.
Üblicherweise saßen seine Patienten um diese Apparatur herum und drückten das Körperteil, für das sie sich Heilung erhofften, gegen den Metallbügel. Zudem befand sich neben jedem Bügel ein kleines Seil, mit dem sich der Patient an die Apparatur anschließen konnte, was die Wirkung verstärken sollte. Um einen »elektrischen Kreis« zu bilden, hielten die Patienten einander an den Händen.
Zweifellos war Mesmers Maschine nach dem Vorbild der Leidener Flasche modelliert – auch wenn sie, als medizinisches Instrument, vollkommen nutzlos war. Nichtsdestoweniger waren die Séancen von höchster Suggestivkraft. Während die Patienten auf den Auftritt des Meisters warteten, verloren sie sich in den Klängen einer Glasharmonika, den Spiegelbildern oder den astrologischen Zeichen, die den opulenten, von schweren Vorhängen verdunkelten Raum verzierten. Irgendwann betrat der Wunderheiler Franz Anton Mesmer das Zimmer und versetzte die Patienten mit starrem Blick oder mittels einer Berührung in hysterisches Gelächter, dramatische Zuckungen oder ansteckende Übelkeit. Verlor ein Patient die Fassung, so wurde er von einem Assistenten in einen schallgedämpften Krisenraum geführt. In Mesmers Séancen wurden frei flottierender Spiritismus, Erotizismus und Gruppenpsychologie zu einem hoch infektiösen gesellschaftlichen Ereignis. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere praktizierten allein im Großraum Paris etwa 6000 (unautorisierte) Mesmeristen. War all das schon erstaunlich genug, so zeigte sich als bemerkenswertester Effekt doch der Umstand, dass die Mesmer’schen Kuren zu einem Politikum wurden. Die von ihm gegründete »Gesellschaft für Universelle Harmonie« wandelte sich zum Ort aufrührerischer Reden – was schließlich zur Verbannung Mesmers aus Frankreich führte (die Königin Marie-Antoinette aber nicht daran hinderte, Mesmer darum zu bitten, vor seinem erzwungenen Abschied zumindest zwei Assistenten in seine Lehre einzuarbeiten). Dass man die Blockaden eines kranken Körpers lösen und den freien Fluss der Mesmer’schen fluida befördern könnte, wurde zur Metapher auch der politischen Reinigung: dass eine kranke, verkünstelte und dekadente Gesellschaft nur geheilt werden könne, wenn sie von Mesmer’schen, revolutionären Zuckungen heimgesucht würde.
Während sich Mesmer seines Pariser Ruhms erfreute, gewahrte Luigi Galvani, ein italienischer Forscher, dass sich in seinem Labor merkwürdige Dinge ereigneten. Auf der Suche nach der geheimnisvollen Lebenskraft hatte er allerlei Tiere untersucht (Vögel, Fische, andere Kleintiere). Als er nun eines Tages einen Frosch sezieren wollte und ihn dazu auf einen Tisch legte, auf dem eine Elektrisiermaschine stand, bemerkte er, dass die Schenkel des toten Tieres bei der zufälligen Berührung durch das Seziermesser zu zucken begannen – während ein Assistent einen Funkenschlag aufblitzen sah.
Bei einer systematischen Untersuchung ergab sich, dass nur leitende Materialien wie Metall den Nerv zu reizen vermochten – und dies auch nur dann, wenn sie ihrerseits elektrisiert worden waren. Demgegenüber hatte ein Glaszylinder (selbst wenn er eine elektrisierte Substanz enthielt) keinerlei Wirkung. Weil Galvani über Benjamin Franklins Beweis der Verbindung zwischen Gewitter und Elektrizität gelesen hatte, hängte er seine gehäuteten Froschschenkel während eines Gewitters an der metallenen Balustrade seines Balkons auf. Wann immer ein Froschschenkel das Metall berührte, verfielen die Schenkel in eine sonderbare Tanzbewegung. Als Systematiker unternahm Galvani nun eine ganze Serie von Experimenten (in Freiluft, unter Wasser, in Öl), bei denen die Frösche mit Messingklammern fixiert und der Nerv mit einem Kupferbügel berührt wurden. Diese Experimente führten ihn (freilich ohne dass er dies wusste) zur Erzeugung eines geschlossenen Stromkreises: Dabei spielten die Metalle die Rolle der stromleitenden Substanzen, das Salzwasser im Froschschenkel die Rolle eines Elektrolyten (der die Ladung in eine bestimmte Richtung bewegt) und der zuckende Muskel die Rolle eines Stromanzeigers. Galvani war davon überzeugt, mit seinen Versuchen die Existenz einer sogenannten »thierischen Elektrizität« bewiesen zu haben.
Inspiriert von seinen Erkenntnissen, begann eine Reihe von merkwürdigen Versuchen. Vor allem Galvanis Neffe Giovanni Aldini tat sich dabei hervor. Er vollzog seine Experimente in aller Öffentlichkeit, ganz in der Nähe des Richtplatzes, wo man ihm die Köpfe der Guillotinierten brachte. Aldini steckte Drähte in die Ohren des abgeschnittenen Kopfes – und ließ ihn unter Stromzufuhr heftigst grimassieren. In Anbetracht derartiger Unternehmungen wundert es nicht, dass die britische Schriftstellerin Mary Shelley, als sie am Genfer See weilte, den Traum des Dr. Frankenstein träumte, jenes neuen Prometheus, der ein aus Leichenteilen zusammengesetztes Monster mit einem Blitzschlag zum Leben erweckt.
Während die sensationshungrigen Zeitgenossen noch einem elektrischen Wunderglauben huldigten, machte sich ein anderer Forscher daran, die Leidener Flasche zu einem dauerhaften Energiespeicher umzugestalten. Im Jahr 1800 gelang Alessandro Volta mit seiner Voltasäule die Fertigung einer Batterie – womit erstmals die stete Zufuhr von Energie möglich war. Nachdem er Galvanis Experimente nachgestellt hatte, kam er zu dem Schluss, dass der Frosch in dieser Konstellation nicht die Quelle der wunderbaren Substanz, sondern nur ein Leiter sei – dass man also auf ihn verzichten könne. Also konzentrierte sich Volta auf die verschiedenen Metalle und Flüssigkeiten. In Ermangelung präziser Messinstrumente nutzte er vor allem die eigene Zunge, um die elektrisierende Wirkung der Metalle zu untersuchen.
Berührte das Metall seine Zungenspitze, bildete sich eine sauer schmeckende Flüssigkeit. Kombinierte er zwei unterschiedliche Metalle (wie etwa Zink und Silber), kam es zu einer leichten elektrischen Entladung. Wenn die Metalle durch einen kleinen Draht miteinander verbunden waren, blieb dieser Effekt aus (der noch heute als Volta-Effekt bezeichnet wird).
Mit Leidensfähigkeit und einer feinen Zunge begabt, setzte Volta nun alles daran, die verschiedensten Metallkombinationen daraufhin zu überprüfen, welche die stärksten Entladungen hervorrief. Die Kombination von Zink und Silber erwies sich als besonders ergiebig. Volta ging nun daran, Zink- und Kupferplättchen übereinanderzustapeln – wobei jeweils eine in Salzwasser (später in Säure) getränkte Pappe dazwischengelegt wurde. Dies war eine Entsprechung zur Leidener Flasche, die, nach Nollet, zu einer Batterie zusammengeschaltet worden war. Im Unterschied freilich zur Leidener Flasche, die nur eine einmalige, heftige Stromentladung zuließ, erlaubte die Volta’sche Säule, dass die Elektrizität, anstatt sich blitzartig zu entladen, zu strömen begann.
Damit war der Glaubensstreit zwischen Galvanisten und Voltaisten entschieden. Denn nun war klar, dass nicht der Frosch die Quelle der Elektrizität war, sondern dass die elektrische Spannung aus dem Potenzialgefälle zwischen den verschiedenen Metallen herrührte. Damit beginnt die Geschichte der modernen Wissenschaft, der es, mit der Batterie ausgerüstet, gelingt, die verschiedenen Elemente systematisch zu zergliedern. So konnte Humphry Davy, der die Volta’sche Säule in Wasser legte, beobachten, dass es zu blubbern begann – woraus er schloss, dass das Wasser aus verschiedenen Grundelementen besteht, ja, dass alle vorfindlichen Stoffe aus verschiedenen Grundelementen zusammengesetzt sind. Folgten wir diesem Strang der Geschichte, würden wir eine Ahnengalerie entwerfen, die uns über Michael Faraday, James Clerk Maxwell bis hin zu Albert Einsteins Relativitätstheorie führen würde – und der Einsicht, dass, wo man früher verschiedenste unterschiedliche Stoffe als naturgegeben angenommen hatte, sich ein allgemeiner Energiebegriff durchsetzte.
Wie sich in der Naturbetrachtung alles zu Energie verwandelt, gibt es auf der anderen Seite eine Entwicklung hin zu einem alles vereinheitlichenden Code, zur Idee einer Universalschrift. Wie im Falle der schrittweisen Entdeckung der atomaren Welt kennt auch diese Geschichte allerlei Irrungen und Wirren. Da mit der Volta’schen Säule die Elektrizität zu einer zuverlässigen Energiequelle geworden war, begannen verschiedene Forscher ernsthaft darüber nachzudenken, ob man Grays »Lines of Communication« zu einem funktionsfähigen Kommunikationsmedium ausbauen könnte.
Tatsächlich hatte das Nachdenken über die Telegrafie schon früher begonnen, zu Zeiten der Französischen Revolution, als Claude Chappe einen optischen Telegrafen errichtete, mit dem sich binnen weniger Minuten eine Nachricht durchs ganze Land schicken ließ.
Weil für eine solche Leitung, bei der eine Nachricht von Hügel zu Hügel geschickt wurde, eine ganze Kette von bemannten Bauten unterhalten werden musste, war klar, dass ein elektrischer Telegraf demgegenüber weit überlegen wäre. 1809 wartete Thomas von Soemmerring mit einem Apparat auf, der, gespeist von einer Voltasäule, einen Buchstaben einer gewissen Spannung zuordnete, die dann auf der Empfängerseite mithilfe eines ebensolchen Geräts wieder zum Buchstaben zurückverwandelt werden konnte.
Allerdings war dieser Mechanismus recht aufwendig und erlaubte darüber hinaus nur die Sendung in eine Richtung, sodass der Vorschlag keine Anwendung fand. 1816 entwickelte der englische Erfinder Francis Ronalds einen lauffähigen elektrischen Telegrafen und stellte ihn der Admiralität vor, die ihn jedoch als vollkommen überflüssig abtat. Ihre Haltung änderte sich, als mit der Eisenbahn ein Vehikel in die Welt entlassen wurde, das durch keinen Reiter mehr einzuholen war – man also nach einem Medium suchte, mit dem sich ein abgefahrener Zug würde kontrollieren lassen. Es bestand die Gefahr, dass zwei Züge sich in unwegsamer Umgebung, zum Beispiel im Tunnel, begegneten. Also bedurfte es eines geeigneten Frühwarnsystems. Hier erwies sich die Telegrafie als äußerst hilfreich. Dazu nutzte man anfangs den Nadeltelegrafen von Charles Wheatstone und William Fothergill Cooke, der parallel zur Eisenbahnstrecke zwischen London und West Drayton errichtet wurde.
Zur überzeugendsten Lösung aber fand Samuel Morse – ein mittelmäßig erfolgreicher amerikanischer Porträt- und Kunstmaler, der bei einer Atlantiküberquerung auf der »SS Sully« mit einem Elektrizitätsforscher ins Gespräch kam, der die Passagiere mit selbst gebauten elektrischen Instrumenten unterhielt – und dabei die Idee äußerte, dass man die Elektrizität für die Telegrafie nutzen könne. Morse war von der Idee eines solchen Kommunikationsmediums begeistert und verwandelte kurzerhand seine Staffelei, seinen Leinwandspanner, diverse Blechabfälle und die kostbare Wanduhr aus seinem Atelier in einen Telegrafen, den er am 4. September 1837 erstmals vorführte.
Dabei war die Sprache, der er sich bei seinem Prototypen bediente, noch ziemlich unvollkommen: ein Zahlencode, der Sender und Empfänger nötigte, ein dickes Wörterbuch zu konsultieren. Auf den Vorschlag seines Assistenten Alfred Vail hin gelangte Morse dann zu jener Logik, bei der die Buchstaben in eine binäre Ordnung aus langen und kurzen Impulsen übersetzt wurden.
Mit der Unterstützung des Chemieprofessors Leonard Gale und seines eigenen findigen Assistenten gelang es Morse, ein technisches Problem ersten Ranges zu meistern. Denn je weiter sich das elektrische Signal vom Sender entfernte, desto mehr ging es im Rauschen der Leitung unter. Um dem entgegenzuwirken, verstärkte man einerseits die Sendebatterie und schaltete darüber hinaus alle 16 Kilometer ein Relais dazwischen, einen elektromagnetisch wirkenden Schalter, der das ursprüngliche Signal verstärkte. Auf diese Weise konnte man den ganzen amerikanischen Kontinent überbrücken, ja, war schon 1858 ein erstes transatlantisches Telegrafenkabel verlegt. Damit stand der Telegrafie die ganze Welt offen, kam es zu dem, was Historiker als Globalisierung des 19. Jahrhunderts bezeichnet haben.
3 LOB DER FAULHEIT
3
LOB DER FAULHEIT
Es heißt, dass die Notwendigkeit die Mutter der Erfindung ist. Im Falle des Herrn, der uns jetzt beschäftigen soll, war es ganz eindeutig die Faulheit, die, wie man weiß, das Gegenteil der industria ist, also des Fleißes. Kurioserweise war Joseph Marie Jacquard bei der Verfolgung seines Arbeitsvermeidungsplans überaus hartnäckig – er brauchte mehr als vierzig Jahre, um seine Idee in die Tat umzusetzen.
Der Anfang war nicht gerade verheißungsvoll. 1752 als eines von neun Kindern in der Weberstadt Lyon geboren, wurde der kleine Joseph früh von seinen Eltern genötigt, im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten. Ziemlich lustlos kam er dem nach. Als seine Schwester einen gebildeten Mann heiratete, brachte dieser dem 13-jährigen Analphabeten das Lesen bei, und der kleine Joseph nutzte die Gelegenheit zur Flucht und erlernte das Handwerk des Buchbinders. Nach dem Tod seines Vaters erbte er einen Weinberg, einen Steinbruch und die Weberei – doch an seiner Abneigung der Arbeit gegenüber änderte sich nichts. Als sein Vermögen aufgebraucht war, heiratete er eine vermögende Frau. Aber weil sehr bald auch ihr Vermögen dahin war, sah sich Jacquard gezwungen, Haus, Webstühle, die Juwelen seiner Gattin, schließlich sein eigenes Bett zu verkaufen.
In deutlich fortgeschrittenem Alter kam Jacquard auf die Grundfrage seines Lebens zurück: Wie kann man mit möglichst wenig Aufwand eine maximale Wirkung erzeugen? Wie lässt sich die Arbeit am Webstuhl auf ein Minimum reduzieren? Um das herauszufinden, studierte er erst einmal gründlich, was sich seine Vorgänger so alles hatten einfallen lassen. Vor allem die Lösung des berühmten Automatenmachers Jacques de Vaucanson tat es ihm an.
Hatte dieser rastlose Erfinder bereits eine automatische Ente mit Verdauungsapparat entworfen, war er ebenso auf den Gedanken einer hölzernen Lochkartensteuerung gekommen, die eine gewisse Automatisierung der Abläufe in einer Maschine ermöglichte.
Ein Loch? Das ist alles? Nein, wenn wir verstehen wollen, worin der Geniestreich Jacquards bestand, müssen wir weiter zurückgehen. Denn Programmierwerkzeuge gibt es schon sehr, sehr lange, in Gestalt von Räderwerkmechanismen, die Figurengruppen oder kleine Musikstücke steuern.
In der Spieluhr beispielsweise schlagen kleine Sporne, die auf einer Walze angebracht sind, Metallplättchen an. Auf diese Weise kann die Spieluhr ein ganz bestimmtes Musikstück abspielen.
Was aber, wenn man ein anderes Musikstück hören möchte? Dann braucht man eine neue Spieluhr – was ungefähr so sinnvoll ist, als müsste man sich für jede neue Platte einen neuen Plattenspieler oder einen neuen iPod kaufen. Mit dieser Überlegung nähern wir uns Jacquards Grundidee. Zunächst war da der Gedanke, dass der Webstuhl wie eine solche Spieluhr von einem Mechanismus gesteuert werden könnte. Schlagen bei einer Spieluhr die Sporne auf der Walze kleine Metallplättchen an, müssen bei einem Webstuhl Fäden gehoben werden. Und daraus ergibt sich dann ein charakteristisches Muster.
Um beliebig viele Muster erzeugen zu können, hatte Jacquard nun die Idee, dass man, statt eine »fest verdrahtete« Walze zu benutzen, einen Mechanismus entwickeln konnte, der ein Papier daraufhin abtastete, ob an einer bestimmten Stelle ein Loch war oder nicht. Fand sich ein Loch, wurde der Faden gehoben, ansonsten nicht. Mit diesem Kunstgriff hatte er seinen Webstuhl sozusagen zum Plattenspieler verwandelt – denn nun konnte man beliebige Muster weben, auch solche, an die man zum Zeitpunkt der Maschinenkonstruktion noch gar nicht gedacht hatte. Der Kunstgriff bestand also darin, das Steuerungsprogramm vom Maschinenkörper zu lösen – oder wenn wir das bildlich nehmen: die Walze zu häuten und das materielle Zeichen durch ein Loch zu ersetzen.
Von den ersten Versuchen bis hin zum Prototypen brauchte Jacquard vier Jahre. Als Napoleon, der die französische Industrie auf Vordermann bringen wollte, das Modell sah, war er begeistert. Er kaufte das Patent, schenkte es der Stadt Lyon und versah den Erfinder mit einer Pension. Womit sich endlich der Lebensplan einlöste, den schon das Kind Joseph avisiert hatte: sich zur Ruhe setzen zu können.
Dabei war der Erfolg des Jacquard’schen Arbeitsvermeidungsplans geradezu durchschlagend – denn der Webstuhl besaß etwa die 30-fache Effizienz eines menschlichen Webers und erlaubte zudem die Fertigung von komplexen Mustern – und dies bei sinkenden Preisen.
Weil damit das letzte Hindernis auf dem Weg zur Mechanisierung des Tuchgewerbes beseitigt war, fand sich der Berufsstand des Webers urplötzlich in der Bredouille, lief er doch Gefahr, von billigeren und verlässlicher arbeitenden Maschinen ersetzt zu werden. Schon kurz nach der Einführung der Jacquard’schen Technik rotteten sich die Weber zusammen, zerstörten und verbrannten die neuen Webstühle und griffen den Erfinder tätlich an. Die Erfahrung, die eigene, im Übrigen keineswegs einfache Arbeit durch eine Maschine entwertet zu sehen, war so durchschlagend, dass mit den »Ludditen« eine Arbeiterbewegung entstand, die darauf abzielte, die Früchte des Fortschritts zu zerschlagen.
Was unsere Computergeschichte anbelangt, hätte sich Jacquard selbst nicht träumen lassen, welche Folgen seine Arbeitsvermeidungsstrategie freisetzen würde – so wenig übrigens, wie er einen Zusammenhang seiner Erfindung mit der Leidener Flasche, Galvanis zuckenden Froschschenkeln und dem telegrafischen Fernschreiber gesehen hätte. Damit nähern wir uns, neben dem Maschinenstürmer-Impuls, einem weiteren Leitmotiv: der sonderbaren Tatsache nämlich, dass ein Gedanke, wenn er erst einmal in der Welt ist, eine erstaunliche Eigendynamik entwickelt.
Sind wir diesem Flaschengeist bei der Entfesselung der Elektrizität schon begegnet, so führt der Jacquard’sche Webstuhl zur Trennung von Materie und Schrift, analog und digital. Zwar folgt das Loch, als präzise markierte Abwesenheit, noch nicht der binären Logik, jedoch führt es vor, dass sich das Denken von der Stofflichkeit emanzipieren kann. Der Geist, wenn man so will, ist aus der Flasche und wird sich nicht wieder einfangen lassen. Nun könnte man einwenden, dass die Trennung von Schrift und Materie schon immer dagewesen ist, ja, dass sie den ersten Glaubenssatz unserer Kultur markiert. »Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« Schwebte der Geist Gottes als weltfremde, extraterrestrische Schriftintelligenz über den Wassern, konnten sich seine Bewunderer nur in theoretischen Betrachtungsweisen ergehen. Mit diesen Spielen jedoch hat die Lochkarte nichts gemein. Sie bringt im Gegenteil eine Betrachtungsweise ins Spiel, die Karl Marx zur Maxime des Materialismus geführt hat: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.« Und wie? Indem man dem Stoff seine Muster aufprägt, indem man die Welt neu programmiert. Insofern Jacquard das Prinzip der Lochkartensteuerung so weit fortentwickelte, dass damit beliebig viele verschiedene »Programme« ausgeführt werden konnten, antizipierte er das, was wir mit der Unterscheidung von Hardware und Software beschreiben – und was uns schnurstracks zum nächsten Kapitel führen wird, zum ersten Computer der Geschichte.
4 DAS MATHEMATISCHE KIND
4
DAS MATHEMATISCHE KIND
Jede Geschichte, die halbwegs aufregend ist, dreht sich auf die eine oder andere Art um die Liebe – nur dass man sich für durchaus unterschiedliche Dinge begeistern kann: die Eleganz einer mathematischen Formel, die Regelmäßigkeit eines physikalischen Gesetzes oder den lieben Gott. Lässt sich ein Schuhfetischist beispielsweise von Stiletto-Heels betören, mag das für einen leidenschaftlichen Schachspieler völlig unverständlich sein. Noch viel schwieriger ist es, die Gruppenorgasmen der Mesmeristen, ein aus Leichenteilen zusammengenähtes Monster oder tanzende Engel mit der Frage der Digitalisierung in Verbindung zu bringen. Gewiss, ein Techniker mag uns einreden, dass in der Computerwelt nichts herrsche als die blanke Vernunft, aber schon die zurückliegenden Seiten sollten uns klargemacht haben, dass auf der dunklen, weltabgewandten Seite vor allem die Ungeheuer der Vernunft lauern. Und weil diese Ausschläge ins Irrationale auch im Folgenden nicht aufhören werden, will ich einen kleinen Umweg unternehmen und die Frage beantworten, warum der Computer, neben seiner fraglos nützlichen Seite, immer auch als fetischistische Apparatur in Erscheinung tritt.
Des Rätsels Antwort liegt im Begriff der »Maschine« verborgen, der, wenn wir ihn ins Altgriechische zurückübersetzen, als »List« oder »Betrug an der Natur« zu verstehen ist. Tatsächlich ist die erste Maschine, mit der die alten Griechen aufwarten konnten, der deus ex machina, jener olympische Gott, der mithilfe eines Krans auf die Bühne herabgeseilt wird. Und weil die Zuschauerschar von diesem Wunder in Bann gezogen wird, stört es nicht weiter, dass man es lediglich mit einem Theatergott zu tun hat.
Eines der erstaunlichsten Betrugsmanöver, welche das Abendland an der Natur vollbracht hat, ist die Gestalt der Muttergottes, also der Maria, die es auf unbefleckte Weise fertiggebracht hat, einen Gottessohn zu gebären. Man mag das Dogma der unbefleckten Empfängnis, das der Welt eine Frau ohne Unterleib präsentiert, als Kuriosum belächeln, dennoch hat die Muttergottes-Menschenmaschine ein maschinelles Himmelfahrtsprojekt auf den Weg gebracht, das radikaler ist als alles, was die Welt bis dato zu Gesicht bekommen hatte. Denn überall dort, wo die Menschen der Lieben Frau, Notre Dame, zu huldigen begannen, entstanden Kathedralen – und aus den Kathedralen wiederum gingen Kathedralenschulen, schließlich Universitäten hervor. Nehmen wir nur das Wort, mit dem wir den universitären Wissensvermittlungsvorgang bezeichnen, tritt der Nachklang des Dogmas an unser Ohr: das »Seminar« (von lateinisch semen, »Samen«) wiederholt den Vorgang der Ohrenbefruchtung, die Vorstellung, dass eine überirdische Weisheit sich durchs Ohr in den Kopf des Adepten ergießt. Dies im Ohr, versteht man, warum Europa sich für den Buchdruck erwärmte und warum die Menschen des Mittelalters, von einer allgemeinen Maschinenbegeisterung infiziert, den lieben Gott zum Uhrmachergott umgeschult haben. Kurioserweise mag das Frohlocken über den Sieg einer übernatürlichen Reproduktionsweise selbst den Tod der Religion zu überdauern. So ist beispielsweise der Philosoph Descartes nach der Begegnung mit der »Himmelsmaschine« felsenfest davon überzeugt, dass auch die Tiere nichts weiter seien als natürliche Automaten. Weil die Maschine, wie die Liebe, also eine Himmelsmacht ist und im Gegensatz zu allem Irdischen Ewigkeit verheißt, werden Liebesgeschichten denkbar, die die klassische Konfiguration (»boy meets girl«) weit hinter sich lassen.
Wie also beginnt die Geschichte, von der wir nun hören werden? Vielleicht lassen wir sie im Jahr 1812 beginnen, als der 21-jährige Charles Babbage in der Bibliothek des Trinity Colleges sitzt und vor sich hinträumt. Von einem Freund gefragt, wovon er denn träume, antwortet er – mit einem kurzen Blick auf die Logarithmentafel vor sich –, er träume davon, dass alle Logarithmen von einer Maschine berechnet werden könnten. Tatsächlich lässt uns die Lebensgeschichte des Mathematikers daran zweifeln, ob er je aus diesem Traum aufgewacht ist. Denn sein ganzes arbeitsames Leben wird darum kreisen, eine solche, immer monströser anmutende Maschine auszuarbeiten.
Während Babbage in seinen Wachträumen mit der Idee einer solchen Rechenmaschine schwanger geht, ist eine junge Dame in London damit beschäftigt, Zukunftspläne zu schmieden. Bei diesen Plänen geht es im Wesentlichen um die Wahl des richtigen Ehemanns – und aus irgendeinem Grund ist ihr begehrlicher Blick auf einen jungen Mann gefallen, der die Gesellschaft gerade mit einem großen Gedicht erobert hat: »Childe Harold’s Pilgrimage«.
Weil George Byron ihr der interessanteste Mann scheint, den sie je kennengelernt hat, glaubt sie, mit ihm jenes »mathematische Kind« zeugen zu können, das sie sich, als »Prinzessin der Parallelogramme«, schon immer erträumt hat. Nach einem überaus komplizierten, fintenreichen Eroberungsfeldzug (der nur deswegen erfolgreich ist, weil der verarmte, von Gläubigern heimgesuchte Dichter eine Mitgift und eine vermögende Gattin zu schätzen weiß) muss sie herausfinden, dass sie sich in ihrem Geliebten vollends getäuscht hat: Denn statt einer reinen und überlegenen Vernunft begegnet sie einem von Ängsten und Albträumen geplagten Nervenbündel, das nur mit einem Revolver unter dem Kopfkissen schlafen kann. Jedoch kommt die Einsicht zu spät: Unterdessen nämlich ist die junge Dame, zur Lady Byron geworden, bereits schwanger. Also kommt im Dezember des Jahres 1815 die kleine Ada zur Welt, just zu der Zeit, da ihre Mama überzeugt ist, dass ihr Mann entweder wahnsinnig sei oder an einem Wasserkopf leide. Um sich von ihrem Gatten zu trennen, bricht sie einen Skandal vom Zaum – denn urplötzlich behauptet sie, dass Byron mit seiner Schwester ein inzestuöses Verhältnis unterhalte. Der Skandal ist riesig. Byron ist genötigt, seine Bibliothek zu verkaufen und das Land zu verlassen.
Während Lady Byron sich anschickt, ihr Töchterchen (das nie etwas von seinem Vater erfahren soll) zu einem »mathematischen Kind« heranreifen zu lassen, ist Charles Babbage auf seine Weise mit dem obskuren Objekt seines Begehrens beschäftigt. Obwohl ein großartiger Mathematiker, hat er einer bescheidenen Abschlussnote wegen keine Aussicht auf eine Professur. Gottlob hat er vermögend geheiratet, ist also frei, seinem Traum nachzugehen: der Konstruktion seiner Rechenmaschine. Zu einer Zeit, da noch nicht einmal eine genormte Schraube existiert, ist das ein Sisyphos-Unterfangen, das Babbage in einen lebenslangen Kleinkrieg mit diversen Werkzeugmachern stürzt – was die Sache nicht gerade erleichtert. Immerhin gelingt es ihm, im Jahr 1822 einen ersten Prototypen seiner Maschine fertigzustellen. Die Regierungsvertreter, denen er sie präsentiert, sind so beeindruckt, dass sie ihm eine größere Geldsumme zur Verfügung stellen.
Während Babbage sich an den Bau seiner großen Maschine macht, wächst die kleine Ada heran. Das Kind ist kränklich. Lange Zeit kann es seine Beine nicht bewegen, es leidet an Aphonie, Anorexie, Asthma, in der Adoleszenz kommen Nervenzusammenbrüche hinzu. Deshalb konsultiert die Mama eine ganze Armada von Spezialisten. Vor allem aber ist sie, die noch immer von einem mathematischen Kind, einer sozusagen menschlichen Rechenmaschine, träumt, um die Verstandeskräfte der Tochter bemüht. Weil sie sich auf die Phrenologie eingeschossen hat