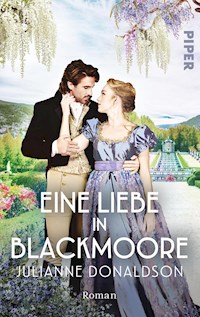
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wunderbar romantischer Roman im Regency-Stil, der von e»iner emanzipierten, freigeistigen jungen Frau erzählt, die letztendlich lernt, ihrem Herzen zu folgen. Für alle LeserInnen, die nicht genug von viktorianischen Romanzen à la »Bridgerton« kriegen können »Immer, wenn ich einen Vogel sehe, denke ich an dich. Dann frage ich mich, wohin dich deine Flügel eines Tages tragen werden, wenn du sie erst ausgebreitet hast, und wie weit fort von mir. Ich fürchte mich vor diesem Moment, um meinetwillen, und gleichzeitig sehne ich ihn herbei, um deinetwillen.« England, 1820. Kate Worthington hat sich geschworen, niemals zu heiraten. Sie möchte frei sein und die Welt bereisen. Ihre Mutter missbilligt das, schließlich ziemt sich das nicht für eine junge Frau. Als Kate jedoch auf das Anwesen Blackmoore eingeladen wird, lässt sie sich auf eine Wette mit ihrer Mutter ein: Gelingt es Kate, drei Heiratsanträge in Blackmoore zu bekommen – und sie alle abzulehnen –, ist sie frei. Wenn nicht, entscheidet ihre Mutter über ihre Zukunft. Ein Kinderspiel, denkt Kate. Doch kaum in Blackmoore angekommen, merkt sie, dass es gar nicht so leicht ist, in wenigen Tagen drei Männerherzen zu erobern – und zu brechen. Und als sie schließlich einen Antrag bekommt, stellt sie mit Entsetzen fest, dass ihr Herz etwas ganz anderes will als ihr Verstand ... »Was für ein wunderschönes, absolut mitreißendes Buch mit tollem Plot aus der Regencyzeit, der zugleich lustig aber auch unglaublich berührend ist.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ein rundum gelungener historischer Roman in good old England!Spitze!Absolute Leseempfehlung!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Eine Liebe in Blackmoore« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem Englischen von Heidi Lichtblau
© Julianne Clawson Donaldson 2013
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Blackmoore« bei Shadow Mountain, Salt Lake City, Utah 2013
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2018,2021
Published by arrangement with Rights People, London
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Alexa Kim "A&K Buchcover"
Covermotiv: Period Images; shutterstock.com und depositphotos.com (Kavring; scis65; antonel)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Für Träumer allüberall
1. Kapitel
Lancashire, England, Juli 1820
Die Waldlerche kündet von Herzeleid. Der melodische Gesang der Misteldrossel zeugt von ihrer Kühnheit. Und das Lied der Amsel gleicht dem fröhlichen Pfeifen eines Heimkehrers.
An diesem Tag war es die Waldlerche, die mich in meinem unsteten Umherwandern innehalten ließ und ans Fenster lockte. Ich lehnte mich hinaus, lauschte ihrer Geschichte von Herzschmerz und Kummer und spürte, wie meine Ruhelosigkeit für einen kurzen Moment nachließ. Das Lied mit seiner abfallenden Tonfolge endete nie glücklich, ganz gleich, wie oft ich die Waldlerche singen hörte.
Kein Vogelgesang gefiel mir so gut wie ihrer, doch heute machte mich die traurige Weise nervös. Ich trat vom Fenster zurück und warf einen weiteren Blick auf die Uhr am Kaminsims. Erst drei! Ich verfluchte das langsame Kriechen der Zeit an diesem Tag, der außer Warten nichts für mich bereitzuhalten schien. Es dauerte noch etliche Stunden, bis die Nacht anbrach und ich mich schlafen legen konnte, um tags darauf endlich nach Blackmoore aufzubrechen. Eigentlich hätte es mir nichts ausmachen dürfen, mich gedulden zu müssen – schließlich wartete ich schon mein Leben lang auf einen Besuch in Blackmoore. Doch an diesem letzten Tag kam es mir unerträglich vor.
Ich öffnete meinen Reisekoffer, nahm die Mozartnoten heraus, die ich dort am Morgen schon verstaut hatte, und verließ mein Gemach. Draußen hörte ich lautes Gejammer. Ich eilte den Gang entlang und hastete die Treppe hinunter, wo ich um ein Haar über Maria gestolpert wäre, die bäuchlings auf einer Stufe lag.
»Was ist denn los? Was ist passiert?« Ich beugte mich über sie und malte mir im Geiste allerhand Katastrophen aus, die meiner jüngeren Schwester zugestoßen sein mochten, während ich in meinem Zimmer ziellos umhergelaufen war.
Sie rollte sich zu mir herum. Das dunkle, wellige Haar klebte ihr an den feuchten Wangen, und sie schluchzte so heftig, dass sich ihre Brust hob und senkte. Ich packte sie am Arm und schüttelte sie leicht. »Erzähl schon, Maria! Was ist passiert?«
»Mr Wilkes ist abgereist und kehrt womöglich nie mehr zurück!«
Ich lehnte mich zurück und betrachtete sie ungläubig. »Ernsthaft? Du weinst wegen Mr Wilkes?«
Sie antwortete mit einem weiteren Schluchzer.
Ich zog mein Taschentuch aus der Tasche und drückte es ihr in die Hand. »Komm, Maria. Kein Mann ist so viele Tränen wert.«
»Mr Wilkes schon!«
Das wagte ich zu bezweifeln. Ich wollte ihr das Gesicht mit dem Taschentuch abtupfen, doch sie stieß meine Hand weg. »Du weißt schon, dass es zum Weinen bequemere Orte gibt als die Treppe?«, bemerkte ich seufzend.
»Mama! Kitty ist wieder garstig zu mir!«, schrie sie und ballte die Hände zu Fäusten.
»Kate!«, erinnerte ich sie. »Und ich bin nicht garstig. Nur praktisch veranlagt. Apropos praktisch …« Wieder näherte ich mich mit dem Taschentuch ihrem Gesicht. »Wie kann man mit so viel Flüssigkeit im Gesicht überhaupt atmen?«
Wimmernd schob sie das Taschentuch weg. »Bleib mir mit deiner praktischen Veranlagung vom Hals. Ich will sie nicht!«
»Natürlich nicht.« Mir riss der Geduldsfaden. »Lieber liegst du auf der Treppe und heulst einem Mann hinterher, dem du nur fünfmal begegnet bist.«
»Mama! Kitty ist wieder unerträglich!«, kreischte sie und funkelte mich an.
Nun wurde es mir endgültig zu bunt. »Ich heiße Kate! Nach Mama kannst du im Übrigen lange rufen, die ist unterwegs und macht Aufwartungen. Und wenn du nicht Vernunft annehmen willst, dann will ich dich auch nicht trösten. So, nun entschuldige mich bitte. Ich muss ein Mozartkonzert üben.«
Maria fixierte mich mit ihrem Blick und rührte sich kein Stück, sodass ich gezwungen war, mich am Geländer festzuhalten und über sie hinwegzuspringen, um den Treppenfuß zu erreichen. Mit einem angewiderten Kopfschütteln betrat ich den Salon und zog die Tür fest hinter mir zu. Im nächsten Moment setzte sich das Klagen meiner Schwester fort, schrill und laut. Meine Katze, die auf dem Pianoforte kauerte, machte einen Buckel und stimmte mit ein. Ich warf ihr einen empörten Blick zu. »O nein, nicht du auch noch!«
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Mozart falsch zu spielen, hingegen nur eine richtige. Nämlich so präzise, als ginge es um eine mathematische Gleichung, und in regelmäßiger Manier, als sei jeder Ton ein kleiner, gehorsamer Soldat, der nur seine vorgegebene Zeit beanspruchen dürfe. Für den verstörenden Einfluss der Leidenschaft gab es bei Mozart keinen Platz. Ebenso wenig wie für eine Katze namens Cora, die sich in dem Wunsch, dem Lärm zu entfliehen, an meine Schulter krallte. Und ganz gewiss gab es bei Mozart keinen Platz für Schwestern, die genau dann vor der Salontür greinten, wenn ich zu üben versuchte.
Nachdem ich mich etliche Minuten abgemüht hatte, Marias lautes Gewimmer zu übertönen, spielte ich Mozart eindeutig verkehrt, ja, ich hämmerte mit so viel Leidenschaft auf die Tasten ein, dass mir ein Fingernagel brach.
»Verflixt!«, murmelte ich, und aus der Halle ertönte ein weiterer Schluchzer. Ich legte den Kopf zurück und brüllte: »So sollte man Mozart nicht spielen! Er würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er das hören müsste!«
Vor der Tür waren eilige Schritte zu hören, und Marias Schluchzen verwandelte sich in klagendes Gebrabbel. »Kitty war so garstig, Mama! Sie hat kein Mitleid mit meinem Liebeskummer und sagte, ich solle anderswo heulen, wo doch jeder sehen kann, dass ich in diesem Moment einfach weinen musste und mich zufällig gerade in der Nähe der Treppe aufhielt, als es mich überkam, und ich mir den Ort also nicht etwa ausgesucht habe …«
»Oh, nicht jetzt, Maria!«
Beim Klang der Stimme meiner Mutter sprang Cora von meiner Schulter zu Boden, schoss wie ein Blitz durch den Raum und versteckte sich unter einem Stuhl. Im nächsten Moment flog die Tür auf, und Mama kam hereingerauscht. Sie hatte sich nicht einmal die Zeit genommen, die Haube abzulegen, und atmete so heftig, dass sich ihre Brust in fast schon ungestümer Manier hob und senkte.
»Ist das wahr?« Sie legte sich die Hand auf den wogenden Busen. »Kann das wirklich wahr sein, Kitty?«
»Kate«, erinnerte ich sie und spielte weiter. Mozart erfordert Konzentration, und ich gedachte den Umstand zu nutzen, dass sich Marias Gejammer mittlerweile zu Wimmern abgeschwächt hatte.
Doch Mama eilte umgehend zum Pianoforte und riss das Notenbuch herunter.
»Mama!« Ich schoss hoch und griff nach den Noten, doch sie wich zurück und hielt sie sich über den Kopf. Als ich ihr ins Gesicht blickte und ihre Miene sah, pochte mein Herz schneller vor Angst.
»Ist es wahr?«, fragte sie erneut mit leiser und bebender Stimme. »Hat dir Mr Cooper einen Heiratsantrag gemacht, und du hast abgelehnt? Ohne mich auch nur zurate zu ziehen?«
Ich schluckte meine Nervosität hinunter und zuckte beiläufig mit den Schultern. »Weshalb hätte ich dich zurate ziehen sollen? Du weißt, was ich von der Ehe halte.« Ich schnappte nach meinen Noten, doch Mama hielt sie nur umso höher, weshalb sie für mich, die ich ein Stück kleiner war als sie, nun unerreichbar waren. »Außerdem sprechen wir von Mr Cooper! Der schon mit einem Bein im Grab steht und vermutlich kein weiteres Jahr mehr erleben wird, wenn überhaupt.«
»Umso besser! Hätten doch alle meine Töchter solch ein Glück! Wie hast du dir diese Gelegenheit nur entgehen lassen können, Kitty?«
Angewidert schürzte ich die Lippen. »Ich habe es dir bereits mehrfach erklärt, Mama. Ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden zu heiraten! Und nun gib mir bitte meine Noten zurück. Du möchtest doch gewiss, dass ich in Blackmoore anständig vorspiele!«
Sie kniff die Lippen zusammen, lief rot an und schleuderte meine Noten hinunter. Die Blätter landeten ungünstig auf dem Holzboden und knickten dabei um wie die Flügel eines verwundeten Vogels.
»Mama! Mozart!« Ich bückte mich und beeilte mich, die Seiten einzusammeln.
»Oh, Mama! Mozart!«, imitierte sie mich mit schriller Stimme und wedelte mit den Händen vor ihrem Gesicht herum. »Mama, ich habe keine Lust auf etwas so Vernünftiges wie eine gute Partie! Mama, ich will nur nach Blackmoore reisen, Mozart spielen und mein Leben vergeuden, anstatt die wenigen sich mir bietenden Gelegenheiten zu ergreifen!«
Ich erhob mich mit heißem Gesicht und drückte mir meine Noten an die Brust. »Ich finde nicht, dass man meine Lebensziele, sosehr sie sich von deinen auch unterscheiden mögen, als Vergeudung bezeichnen sollte …«
»Deine Lebensziele! Meine Güte, das ist ja zum Schießen!« Sie schritt vor mir auf und ab, und ihre Schuhe gaben bei jedem Schritt ein Klackern von sich, als würde sie meinen Willen zertrampeln wollen und meine Stimme desgleichen, wenn sie es denn könnte. »Was genau sind denn deine Lebensziele?«
»Du kennst sie«, murmelte ich.
Sie blieb vor mir stehen und stemmte die Hände in die Seiten. »Welche meinst du? Andere Menschen zu enttäuschen? Wertvolle Ressourcen zu verschwenden? Eine alte Jungfer zu werden wie deine Tante Charlotte?« Sie zog die dunklen Augenbrauen zusammen. »Habe ich in dich investiert, um im Gegenzug nichts zurückzubekommen – außer einem törichten Mädchen, das sich nur für Blackmoore und Mozart interessiert?«
Ich reckte das Kinn und betete darum, dass es nicht zitterte. »Das stimmt doch gar nicht. Ich interessiere mich für mehr als das. Zum Beispiel für Indien, und mir liegt an Oliver, und ich …«
»Kind, erwähne bitte nicht Indien. Nicht schon wieder!« Sie warf die Arme in die Höhe. Unwillkürlich zuckte ich zusammen. »Unglaublich, dass Charlotte gewagt hat, dich gegen meinen Wunsch einzuladen. Indien! Als wärst du mir nicht ohnehin schon Last genug mit deiner Dickköpfigkeit und deiner …« Sie wirbelte herum und stolzierte wieder auf mich zu. Ich ermahnte mich, nicht vor ihr zurückzuschrecken, drückte Mozart an mich, reckte weiterhin krampfhaft mein Kinn und hielt ihrem Blick stand.
»Jetzt ist Schluss, Kitty.« Sie hob einen Finger und wedelte damit vor meinem Gesicht hin und her. »Mir reicht es mit deinem Eigensinn. Ich werde dir zeigen, dass ich weiß, was das Beste für dich ist, und ich werde unverzüglich damit beginnen. Du wirst nicht nach Indien reisen. Deiner Tante Charlotte werde ich persönlich schreiben und ihr erklären, dass ich endlich eine Entscheidung getroffen habe. Und …« Sie packte mich am Kinn und drückte es nach oben, sodass sich mein Mund schloss, den ich bereits geöffnet hatte, um zu protestieren. Sie kam mir mit dem Gesicht so nahe, dass ich den schalen Tee in ihrem Atem riechen konnte, und flüsterte: »Und du wirst nicht nach Blackmoore fahren. Du wirst hierbleiben und lernen, wo dein Platz ist. Und versuch bloß nicht, mit deinem Vater darüber zu sprechen, oder du wirst in noch größeren Schwierigkeiten stecken als ohnehin schon.«
Mit einer schwungvollen Bewegung entließ sie mich aus ihrem Griff. Ihre dunklen Augen leuchteten triumphierend auf.
Mit heftig klopfendem Herzen schüttelte ich den Kopf. »Nein, Mama. Bitte. Nicht Blackmoore. Bitte nimm mir nicht Blackmoore weg …«
»Ach nein?« Sie brachte mich mit einem kalten Blick zum Schweigen. »Geh in dein Zimmer, und pack deine Sachen wieder aus, Kitty.«
Ich sah ihr in die Augen. Sie besaßen dieselbe Farbe wie die alte, verrostete Falle, die ich mit sieben im Wald entdeckt hatte. Ein Kaninchen hatte sich zwischen ihren Eisenzähnen verfangen. Als ich das Tier entdeckte, kämpfte es zwar nicht mehr, doch es atmete noch. Ich beugte mich darüber, und da bewegte das kleine Wesen die Augen. Hektisch versuchte ich, es zu befreien, doch das rostige alte Metall widersetzte sich all meinen Bemühungen, es aufzustemmen.
Schließlich war ich in meiner Verzweiflung zum Delafield Manor gerannt und hatte Henry geholt. Beim Anblick des Kaninchens schüttelte er den Kopf. Dann hob er einen großen Stein auf und bat mich, mir die Ohren zuzuhalten und mich umzudrehen. Ich weinte, tat aber wie geheißen.
Wenige Augenblicke später legte er mir die Hand auf die Schulter. Ich öffnete die Augen und senkte die Hände. Er sagte, es sei das Beste gewesen, was wir für das arme Ding hätten tun können. Vermutlich hatte Henry die Falle später fortgeschafft. Jedenfalls sah ich sie nie wieder, wenngleich ich fast jeden Tag im Wald verbrachte. Aber ihren Anblick vergaß ich nie. Die großen Zähne, die rostige Farbe und ihr hartnäckiger Griff gingen mir nicht aus dem Kopf.
Dieselbe kalte Hartnäckigkeit entdeckte ich nun in den Augen meiner Mutter. Sie würde mir Blackmoore genauso wegnehmen wie die Hoffnung auf Indien – und sie würde sich durch nichts abhalten lassen. All meine Versuche, mich gegen ihren Willen aufzulehnen, wären vergebens.
»Ich heiße nicht Kitty, sondern Kate!«, zischte ich, griff nach meiner Katze und verließ den Raum. Ich hatte ganz vergessen, dass Maria noch immer auf der Treppe lag, und stolperte über sie. Dabei fiel ich auf beide Ellbogen, da ich weder Cora noch meine Mozartnoten loslassen wollte.
Ich weinte nicht, obschon mir der Schmerz an beiden Armen hochschoss und mir Cora in dem Versuch, sich aus meinem Griff zu winden, die Wange zerkratzte. Ich weinte nicht, als ich mich wieder aufrappelte, begleitet von Marias Geschrei, ich solle doch aufpassen, wohin ich träte. Und ich weinte nicht, während ich die restlichen Stufen emporlief, den Gang entlang zum letzten Schlafgemach rechter Hand hastete und die Tür hinter mir zusperrte.
Ich setzte Cora auf dem Boden ab und warf meine Noten aufs Bett. Meine Ellbogen und Schienbeine pochten schmerzhaft, doch das war nichts verglichen mit dem Schmerz, den ich angesichts meiner Ohnmacht und Hilflosigkeit verspürte. Ich hielt mir den Kopf, ging auf und ab und kämpfte gegen die Tränen an. Etwas in der Art hätte mir schwanen müssen. Es war so typisch für Mama: Just in dem Augenblick, da ich dachte, mein Herzenswunsch ginge endlich in Erfüllung, kam sie daher und zerstörte alles. Noch mehr als ihr Einschreiten machte mir jedoch meine vollkommene Machtlosigkeit zu schaffen. Mit siebzehn war ich eine Gefangene dieses Hauses aus Stein und Glas, aus verhärteten Gefühlen und Erwartungen, die ich nie erfüllen würde.
Am liebsten hätte ich laut losgeschrien. Blinde Zerstörungswut packte mich, doch dann hielt ich inne. Das letzte Mal, als ich einem derartigen Drang nachgegeben hatte, bereute ich es anschließend. Mein Blick fiel auf das lose Bodenbrett unter dem Fenster. Dann sah ich zur Holztruhe an meinem Bettende. So lange schon war sie verschlossen gewesen. Doch jetzt hatte ich nichts mehr zu verlieren, wenn ich hineinsah.
Mit zitternden Händen zog ich an dem losen Dielenbrett unter dem Fenster, bis es sich mit einem Knarzen aus seinen Nuten löste. Ich schob meine Hand in das Loch und schrammte mit den Fingerspitzen über das alte, zersplitterte Holz, bis sie sich um das glatte Metall des Schlüssels schlossen, der wie immer schwerer war als in meiner Erinnerung. Ich kniete mich damit vor die Holztruhe und betrachtete das Schloss, das ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr geöffnet hatte. Nach einem tiefen Atemzug steckte ich den Schlüssel hinein, drehte ihn und hob den Deckel.
Zederngeruch stieg mir in die Nase. Er erinnerte mich an meine Kindheit, an Geheimnisse. Mit angehaltenem Atem hob ich das Holzmodell aus der Truhe und stellte es auf dem Boden ab. Dann schloss ich die Truhe wieder und platzierte das Modell behutsam auf ihrem Deckel.
Ich kniete mich hin und betrachtete es mit einer Mischung aus Bewunderung und Bedauern. Ich liebte das Holzmodell und bedauerte es zugleich für das, was ich ihm angetan hatte. Vorsichtig fuhr ich mit dem Finger die Kontur des Daches nach und hielt inne, als ich die Stelle erreichte, an der es zersplittert war. Ich hob den Finger und setzte ihn erst da auf, wo das Modell wieder unbeschädigt war. »Das ist Blackmoore«, flüsterte ich. »Es hat fünfunddreißig Räume, zwölf Kamine, drei Etagen, zwei Flügel …«
2. Kapitel
Vier Jahre zuvor
»Es ist für mich so schwer auszuhalten, dass du jeden Sommer nach Blackmoore fährst und ich noch kein einziges Mal dort war. Ich hatte gedacht, du würdest deine Mutter darum bitten, dass ich diesen Sommer mit von der Partie sein darf.«
Von ihrem Fensterplatz aus beobachtete mich meine beste Freundin Sylvia mit gekräuselter Stirn. »Ich weiß«, entgegnete sie und streckte eine tröstende Hand aus, die ich nicht wollte. »Es tut mir leid, Kitty! Ich habe Mama Dutzende Male gefragt. Sie hat aber leider Nein gesagt. Wie letztes Mal.«
»Aber weshalb? Ich weiß, dass es in Blackmoore viele Gästezimmer gibt. Ich esse nicht viel und wäre auch nicht im Weg. Warum hat sie abgelehnt? Hat sie etwas gegen mich? Ist das der Grund, warum ich nicht eingeladen werde?«
Sylvia zuckte die Achseln und schüttelte vage den Kopf. »Das kann ich dir nicht sagen.«
Ich warf mich neben sie auf die Polsterbank, schlug die Hände vors Gesicht und gab einen erstickten Schrei von mir.
Schritte erklangen, dann war Henrys Stimme zu hören. »Was ist das für ein Geschrei?«
»Kitty sehnt sich danach, Blackmoore kennenzulernen. Wieder einmal.« Sylvia sprach, als würde ihre Geduld auf eine Probe gestellt, was mich veranlasste, mich aufrecht hinzusetzen und die Hände zu senken.
»Ihr versteht das nicht. Keiner von euch.« Ich sah von ihr zu Henry und wieder zurück. Beide starrten mich an, als wäre ich nicht ganz bei Sinnen. »Ihr habt immer dort hinreisen können, ich hingegen nie.«
Sie konnten nicht nachempfinden, wie es war, Sommer für Sommer zurückgelassen zu werden. So war es schon gewesen, solange ich mich erinnern konnte. Sie konnten sich das erdrückende Gefühl nicht vorstellen, das mich überkam, wenn ich mir ausmalte, wie sie die Küste, die Heidelandschaft und das große Haus mit seinen Geheimgängen erforschten, während ich auf dieselben Steinwände und dieselben Hecken starren musste wie schon mein Leben lang.
»Es ist doch nur ein Haus, Kitty«, sagte Sylvia.
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist es eben nicht.« Denn das war es auch nicht. Nicht für mich.
Für Sylvia war Blackmoore einfach nur das großväterliche Anwesen, der Ort, an dem die Familie die jährliche Sommerfrische verbrachte. Für mich jedoch wäre es eine wenigstens zeitweise Flucht vor der endlosen Monotonie meines häuslichen Lebens gewesen.
»Was denn dann?«, fragte Henry, der mich mit seinen grauen Augen ernster musterte als gewöhnlich. So als wäre ihm meine Antwort wichtig.
»Es ist Abenteuer«, erklärte ich, und das Wort schmeckte wie Freiheit. »Ich habe nicht einmal die Grafschaft verlassen, in der ich geboren wurde, habe noch nie das Meer oder die Moorlandschaft gesehen. Und jeden Sommer brecht ihr zu diesem großartigen Haus auf, das auf einer Klippe mit Blick aufs Meer thront und das Heidemoor im Rücken hat. Und ihr zieht mich auf …« Ich bedachte Henry mit einem spitzen Blick, und er grinste schelmisch zurück. »Ihr zieht mich mit Gerüchten über Gespenster im Moor, Geheimgängen und Schmugglern auf und weigert euch, mir zu sagen, ob irgendetwas davon wirklich stimmt.« Ich seufzte. »Ich würde alles dafür geben, mit nach Blackmoore zu dürfen.«
»Alles?« Henry sah mich zweifelnd an. »Du übertreibst ja wohl.«
»Keineswegs, Henry! Ich schwöre dir, ich würde alles dafür geben!«
»Was denn zum Beispiel?«
Ich versuchte, mir etwas Passendes zu überlegen, damit sie die ganze Tiefe meiner Gefühle verstehen könnten, und sah an mir herab. Nein, nicht meine Finger. Für das Musizieren am Pianoforte brauchte man sie alle. Einen Zeh? Vielleicht einen kleinen?
»Ich würde einen kleinen Zeh hergeben, um Blackmoore sehen zu können«, erklärte ich.
Sylvia wurde blass, doch Henrys Augen leuchteten interessiert auf.
»Einen kleinen Zeh? Keinen großen?«
Ich kaute auf meiner Unterlippe. »Nein, große Zehen sind fürs Gleichgewicht unentbehrlich, glaube ich.«
Mit spitzbübisch glitzernden Augen lehnte Henry sich vor. »Und wie würdest du vorgehen, um den kleinen Zeh abzutrennen?«
»Henry!«, protestierte Sylvia.
Er hielt eine Hand hoch, um sie zum Schweigen zu bringen, und sah mich herausfordernd an.
Ich schluckte. »Ich würde … Ich würde Cook fragen, ob sie ihn mir abschneidet.«
Sylvia schaute entsetzt. »Blut? In der Küche? Nein, Kitty. Ausgeschlossen.«
Tapfer versuchte ich, mich mit dem Gedanken anzufreunden. »So schlimm wäre es gar nicht«, erklärte ich. »In einer Küche gibt es hie und da gewiss ohnehin Blut, von rohem Fleisch etwa oder …«
Sylvia hielt sich die Ohren zu und schüttelte den Kopf. »Ich bitte dich, kein Wort mehr davon!«
Henry konnte sich das Grinsen kaum verkneifen. »Und was würdest du mit dem kleinen Zeh tun, Kitty? Gibt es irgendwo einen Markt für kleine Zehen im Austausch gegen Fahrten nach Blackmoore?«
Meine maßlose Enttäuschung schlug in Zorn um. Ich packte das Kissen an meiner Seite und schleuderte es in seine Richtung. Zu meinem Verdruss schlug er es mühelos beiseite. »Ich weiß nicht, ob es solch einen Markt gibt, Henry Delafield. Vielleicht kannst du es mir ja sagen, da du Blackmoore eines Tages besitzen wirst. Na, gibt es einen Markt für kleine Zehen?« Ich beugte mich vor und fing an, die Bänder meines Schuhs zu lösen. »Weil ich ihn mir nämlich gleich abschneiden lasse und damit meine Fahrt dorthin bezahle, ganz gleich, ob eure Köchin etwas gegen Blut in der Küche hat oder nicht!«
Wegen meiner zittrigen Finger brachte ich mit den Schnürbändern, die sich irgendwie verknotet hatten, nichts zuwege. Mit glühendem Gesicht und tränenverschleiertem Blick zerrte ich erfolglos an ihnen. Plötzlich kletterte Henry über Sylvia, schob sie zur Seite und setzte sich neben mich. Er ergriff meine Hände und zog sie von meinen Schuhen weg.
»Kitty«, sagte er leise. »Hör auf. Hör damit auf!« Halbherzig versuchte ich, ihm meine Hände zu entziehen.
»Es tut mir leid«, flüsterte er und lehnte den Kopf nahe an meinen. »Ich hätte dich mit Blackmoore nicht aufziehen dürfen. Ich weiß, was du empfindest.«
Seine Worte hatten dieselbe Wirkung auf mich wie Wasser, das man in ein Feuer schüttet. Ich entriss ihm meine Hände, hielt sie mir vors Gesicht und atmete tief durch. Wieder einmal hatte ich überreagiert. Das war eine meiner großen Schwächen. Genauer gesagt: eine der großen Schwächen aller Worthington-Frauen. Und nun, da mein Zorn verraucht war, schämte ich mich, war deshalb jedoch nicht weniger traurig. Und fühlte mich nicht weniger beraubt, nicht weniger enttäuscht. Im nächsten Moment spürte ich, wie Henry die Hand leicht auf meinen Hinterkopf legte.
»Komm, Kitty. Gestalten wir den Tag lieber unblutig.« Sein Ton war locker und schmeichelnd. »Lass uns stattdessen überlegen, was du während unserer Abwesenheit tun könntest. Du solltest ein großes Abenteuer planen, damit du bei unserer Rückkehr etwas Aufregendes zu erzählen hast.«
Ich ließ die Hände fallen und funkelte ihn an. »Du weißt genauso gut wie ich, dass es hier nichts Abenteuerliches gibt. Wenn doch, hätten wir es längst herausbekommen. Aber wie dem auch sei: Ein Abenteuer allein zu bestehen, macht keinen Spaß.« Missmutig und verbittert verschränkte ich die Arme vor der Brust. »Meine Frage lautet jedoch: Warum? Warum hat mir eure Mutter nie gestattet, euch zu begleiten?«
Henry und Sylvia schwiegen, obwohl ich sie eindringlich ansah. Ein hässlicher Verdacht schlich sich in meine Gedanken. Er soufflierte mir eine Frage, die mir so zuwider war, dass sich meine Mundwinkel nach unten verzogen, als hätte ich in etwas Saures gebissen.
»Wird Miss St. Claire in Blackmoore etwa wieder mit von der Partie sein?«
Henrys reservierte Miene beantwortete mir meine Frage. Sylvia warf mir einen mitleidigen Blick zu.
Mein Verdacht – meine Eifersucht – lachte schadenfroh auf und setzte sich bequemer hin, als plane sie einen sehr langen Besuch.
»Eure Mutter hat also nichts dagegen, Gäste einzuladen. Sie hat nur einfach etwas gegen mich!«
»Nimm’s nicht persönlich, Kitty. Du weißt doch, dass sie vorhat, Miss St. Claire und Henry …«
»Sylvia!« Henry warf seiner Schwester einen warnenden Blick zu.
»Was denn? Das ist doch kein Geheimnis! Das wissen wir alle schon seit Ewigkeiten.«
Betretene Stille trat ein. Ich betrachtete den gelben Sofabezug und dachte nur daran, wie sehr ich Miss St. Claire hasste, wenngleich ich ihr noch nie begegnet war.
Henry drehte sich so jäh zu mir, dass ich zusammenfuhr und ihn überrascht ansah. Seine grauen Augen wirkten stählern, und unvermittelt entdeckte ich etwas in ihnen, das mir noch nie aufgefallen war – einen eisernen Willen. »Eines Tages werde ich dich nach Blackmoore mitnehmen, Kitty. Versprochen.« Wieder ergriff er meine Hand und drückte sie fest. »Ich gebe dir mein Wort!«
Ich kniff die Lippen zusammen, um meine Zweifel für mich zu behalten. Mrs Delafield bekam ihren Willen. Grundsätzlich. Wenn sie mich in Blackmoore nicht zu sehen wünschte, würde ich auch nie hinkommen. Da Henry jedoch weiterhin meine Hand drückte und das allmählich wehtat, drückte ich im Gegenzug die seine. »Nun gut«, flüsterte ich, gab den Kampf auf und lächelte ihm zuliebe ein wenig.
—
Der folgende Monat verstrich so langsam, dass ich schier verrückt zu werden glaubte. Während dieses langen, faulen Sommermonats voller Müßiggang, Gleichförmigkeit und unaufhörlichem Nichts knirschte ich mit den Zähnen und fluchte in mich hinein, wann immer ich an die Delafields und Miss St. Claire in Blackmoore dachte. Eines Tages vernahm ich von einem Dienstboten, die Delafields seien zurückgekehrt. Ich lief die Treppe hinab, hielt mich am Geländer fest, um die Ecke zu umrunden, und sprang die abschließenden drei Stufen hinunter, bevor ich bemerkte, dass die Eingangstür offen stand.
Jameson, unser Butler, beugte sich vor und versperrte mir die Sicht auf die Tür. Als ich überrascht stehen blieb, rief jemand: »Wenn du das bist, Kitty, halt dir die Augen zu!«
Beim Klang von Henrys Stimme bekam ich Herzklopfen. Ich lehnte mich vor, um an Jamesons Rücken vorbeisehen zu können.
»Ich meine es ernst. Halt dir die Augen zu, oder ich mache kehrt und gehe auf der Stelle nach Hause. Dann wirst du deine Überraschung nie zu Gesicht bekommen!«
Seufzend hielt ich mir die eine Hand vor die Augen. »Ja gut. Ich halt sie ja schon zu!«
Ich hörte ein Schlurfen, das sich an mir vorbei Richtung Salon bewegte. Wie lang das dauerte! Nur die Angst, Henry könnte seine Drohung wahr machen, ließ mich die Augen weiterhin geschlossen halten, denn Geduld war noch nie meine Stärke gewesen.
»Kann ich jetzt gucken?«, bettelte ich.
Henry ergriff meine Hand. »Nein, halt dir die Augen weiter zu«, sagte er nahe an meinem Ohr. Mein Herz pochte schneller vor Aufregung. »Komm hier entlang.« Er führte mich an der Hand. Ich stieß an eine Wand, dann an einen Türpfosten und schließlich mit dem Knie an ein Möbelstück.
»Autsch! Kannst du mich nicht vorsichtiger führen?«
»Pst. Beschwerden sind nicht gestattet.«
Henry ließ meine Hand los und stellte sich hinter mich, drehte mich ein wenig und sagte dann: »Jetzt. Jetzt darfst du schauen!«
Rasch schlug ich die Augen auf und starrte verständnislos auf den Tisch vor mir. Henry hatte mich ins Esszimmer geführt, und auf dem Tisch stand etwas, das wie das Modell eines Hauses aussah.
Ich drehte den Kopf, um Henry einen fragenden Blick zuzuwerfen. Nur ein Monat war vergangen, doch er hatte sich verändert. Sein Haar war länger und dunkler als sonst. Dabei kam er immer mit hellerem, sonnengebleichtem Haar zurück. Doch dieses Jahr hatte es einen dunklen, goldenen Ton, der fast schon Braun genannt werden konnte. Die Sommersprossen auf seinen Wangenknochen waren verblichen. Nur seine grauen Augen mit dem dunkelgrauen Ring um die Iris waren dieselben geblieben. Und in diesem Augenblick war sein Lächeln so breit, dass es mich schier überwältigte.
Er trat um mich herum und deutete mit einer großartigen Geste auf das Modell. »Miss Katherine Worthington, hiermit stelle ich Ihnen Blackmoore vor.«
Mein Herz schlug so heftig, dass es wehtat. Ich sah von ihm zu dem Modell und wieder zurück, und als er grinsend nickte, fiel ich auf die Knie und brachte das Haus damit auf Augenhöhe. Das Holz war so bemalt, dass es wie Stein aussah. Die Fenster, die Eingangstüren, die Kamine – alles war vorhanden.
»Woher hast du das?«, fragte ich ehrfürchtig.
»Das habe ich gebaut!«
Ich sah ihn verständnislos an. »Das hast du gebaut?«
»Mein Großvater hat mir bei dem Entwurf geholfen«, versetzte er leichthin. »Und Sylvia am Ende beim Bemalen. Doch der Großteil der Handarbeit stammt von mir.«
Noch immer starrte ich ihn mit großen Augen an. »Das muss dich doch jede Tageslichtstunde deiner Ferien gekostet haben!«
Er hob die Schulter, doch sein halb unterdrücktes Lächeln sagte mir, dass ich ins Schwarze getroffen hatte. Was auch sein äußeres Erscheinungsbild erklärte. Ich wusste, dass Henry sich in Blackmoore eigentlich am liebsten im Freien aufhielt. Für gewöhnlich verbrachte er den ganzen Tag im Heidemoor und am Strand. Gern ging er mit dem Gärtner Vögel beobachten, und ich wusste, dass nur der größte aller Anreize ihn den ganzen Monat lang im Haus gehalten hätte.
Ich war überwältigt und hatte plötzlich einen Frosch im Hals. Ich räusperte mich. »Viel Zeit hast du wohl nicht mit Miss St. Claire verbringen können.«
Er kniete sich neben mir hin und verbiss sich ein Lächeln, wobei in seiner Wange eine kleine Kerbe erschien. »Nein. Nicht viel.«
Ich nickte und kaute auf meiner Unterlippe. Die Frage, die mir auf der Zunge lag, wagte ich nicht zu stellen. Ich wollte wissen, nein, ich musste wissen, ob er das Haus für mich gebaut hatte. Ob es etwas zu bedeuten hatte. Ob ich ihm etwas bedeutete.
»Ich schätze, nun stehe ich in deiner Schuld und muss eine Möglichkeit finden, mich zu revanchieren.« Ich hielt den Atem an, und mein Gesicht glühte vor Verlegenheit. »Da du deine Ferien und Miss St. Claire aufgegeben hast …«
Henry warf mir einen Seitenblick zu und sagte dann schmunzelnd: »Ich habe es nicht für dich gebaut, Kitty.«
»Nicht?« Ich war enttäuscht und erleichtert zugleich.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, du undankbares Gör, das habe ich nicht.«
Er beugte sich näher zu mir, legte den Kopf schräg und studierte das Modell. Dann ergriff er die winzige Türklinke an der Eingangstür.
»Ich habe es«, murmelte er und öffnete die Miniaturtür, »deinen Zehen zuliebe getan.«
Vor Freude schnappte ich nach Luft, neigte den Kopf und spähte durch die offene Eingangstür des Modells. Ich entdeckte einen schwarz-weißen Schachbrettboden, auf einer Seite einen Kamin und einen Türbogen am hinteren Ende des Raumes, der zu einer Treppe führte.
Ich verkniff mir ein Grinsen und zwinkerte dann heftig, um nicht loszuheulen. Es war einfach zu viel. »Meine Zehen danken dir«, flüsterte ich schließlich.
Obwohl ich Henry nicht ansah, konnte ich sein Lächeln spüren. Es glich einem Sonnenstrahl auf meinem Gesicht, und meine Wangen erglühten. Dann deutete er auf das Modell und sagte: »Es hat fünfunddreißig Räume, zwölf Kamine, zwei Flügel, einen Wintergarten, Ställe und einen erstklassigen Ausblick. Es heißt, es gebe einen Geheimgang, der während der Reformation von Priestern benutzt wurde. Ein Gerücht, das ich weder bestätige noch leugne, da du es zweifellos faszinierender und geheimnisvoller finden wirst, etwas zu haben, worüber du dir den Kopf zerbrechen kannst.«
Ich riss mich von dem Modell los und sah ihn an. Er sprach rasch und erklärte mir etwas von der Bibliothek, die über dreitausend Bücher hätte. Doch ich nahm nichts wahr außer Henrys leuchtenden grauen Augen, den vereinzelten Sommersprossen auf seinen Wangenknochen, dem goldbraunen Haar, das ihm in die Stirn fiel, und den Lippen, die sich auf eine ganz besondere Art wölbten, wenn er lächelte.
»Es steht dem Meer zugewandt und hat das Heidemoor im Rücken«, sagte er. »Nun weißt du es.« Ein triumphierender Unterton schlich sich in seine Stimme. »Nun weißt du genau, wie Blackmoore aussieht. Eines Tages wirst du es selbst sehen, wie ich es dir versprochen habe.« Er begegnete meinem Blick mit einem warmen Lächeln. »Bis dahin darfst du das Modell behalten.«
3. Kapitel
Ein Klopfen an der Tür – ein zweifaches Pochen, eine Pause, dann ein weiteres zweifaches Pochen. Das war Olivers Erkennungszeichen. Aus meinen Tagträumereien aufgeschreckt, riss ich den Kopf hoch. Vorsichtig öffnete ich die Tür, allerdings nur einen Spaltbreit, damit er nicht in mein Zimmer spähen und das zerstörte Modell von Blackmoore entdecken konnte.
Oliver stand gleich neben der Tür, die braunen Haare hingen ihm über die haselnussbraunen Augen. Er brauchte dringend einen Haarschnitt. Ich würde es Cook demnächst einmal sagen.
»Was gibt’s?« Ich hoffte, er würde meine niedergedrückte Stimmung nicht bemerken. Ihm zuliebe versuchte ich sogar zu lächeln, was ich für niemanden sonst getan hätte.
Mit einem schmutzigen kleinen Finger winkte er mich zu sich. Ich neigte den Kopf, und er flüsterte mir laut ins Ohr: »Mr Cooper kommt zum Dinner.«
Ich wich zurück. »Nein!«
Er nickte. »Ich habe gehört, wie Mama es zu Cook gesagt hat.«
Dieser abscheuliche Mr Cooper, den ich abgewiesen hatte, kam wieder? Mama musste ihm weisgemacht haben, ich hätte es mir anders überlegt. Mir blieb nichts anderes übrig, als das Weite zu suchen.
»Ich danke dir, Ollie«, sagte ich und seufzte.
Er streckte die Hand aus. »Hast du einen Penny? Für eine Leckerei? Bitte!« Seinem gewinnenden Lächeln konnte ich beim besten Willen nicht widerstehen. Ich nahm zwei Pennys aus meinem Retikül und legte sie ihm in die Hand. Bevor er diese zurückziehen konnte, schnappte ich sie mir und drehte sie mit einem missbilligenden Schnalzen um. »Geh und säubere deine Fingernägel, kleiner Mann. Die sehen furchtbar aus!«
Seine Augen glitzerten spitzbübisch. »Ich mag sie furchtbar!«, erklärte er lachend. Die beiden Pennys fest umklammert, rannte er den Gang entlang und polterte die Holztreppe hinunter. Unwillkürlich musste ich lächeln. Er war die einzige Person, die ich vermissen würde, wenn ich am nächsten Tag aufbrach, um nach …
Ich hielt inne. Nein. Ich würde morgen nicht nach Blackmoore aufbrechen. Erneut überkam mich Verzweiflung. Kein Blackmoore – und ich würde zum Dinner Mr Coopers Gesellschaft ertragen müssen? Das war eindeutig zu viel.
Just in diesem Augenblick erhob sich ein Pfeifen in der Luft und erfüllte den Raum. Der Gesang einer Amsel. Ich eilte ans Fenster, stützte mich auf die Fensterbank, lehnte mich hinaus und sah hinunter. Henry stand unter dem Fenster und hatte seine Hände beim Pfeifen wie einen Trichter um den Mund gelegt.
»Ich habe die Zielscheibe aufgestellt. Komm, wir üben Bogenschießen!«
Ich legte warnend einen Finger an die Lippen und wandte mich wieder dem Zimmer zu. Eilig verstaute ich das Modell in der Truhe, schloss sie zu und legte den Schlüssel in sein Versteck zurück, bevor ich zum Fenster zurückkehrte. Ich schwang ein Bein über die Fensterbank.
»Was tust du?«, rief Henry von unten zu mir herauf.
»Könntest du bitte die Stimme senken?«, zischte ich und schwang auch das andere Bein über die Fensterbank. »Wonach sieht es denn wohl aus? Ich verlasse das Haus!«
»Nein, Kate. Nicht durchs Fenster. Nimm doch einfach die Tür wie alle anderen auch!«
»Gott bewahre! Mama könnte mich bemerken.« Ich drehte mich um und hielt mich dabei an der Innenkante der Fensterbank fest, sodass mein Bauch am Holz ruhte. »Es ist nur ein bisschen schwieriger, seitdem das Spalier im letzten Sommer kaputtgegangen ist.« In diesem Augenblick beschloss Cora, meiner Notlage auf den Grund zu gehen, und sprang auf meinen Kopf.
»O nein. Nicht jetzt«, schimpfte ich. »Runter da!«
Doch nach einem Blick über meinen Kopf hinweg machte sie sich daran, bedächtig und elegant an meinem Rücken hinunterzusteigen. Henry lachte.
Die Neigung war offenbar zu steil für Coras Geschmack, und sie grub ihre Krallen in mein Hinterteil und meine Beine. Vor Schmerz zuckte ich zusammen, und sie verlor ihr Gleichgewicht. Unter kläglichem Miauen bemühte sie sich noch, sich wieder irgendwo festzukrallen, doch vergebens. Ich sah über meine Schulter und beobachtete, wie sie sich im Sturz drehte. Zum Glück konnte Henry sie auffangen, bevor sie auf dem Boden aufkam.
»Gut gemacht«, lobte ich ihn. Er stellte sie ab und streckte die Arme zu mir hoch.
»Lass dich einfach fallen, ich fange dich auch auf«, sagte er, während ich weiter mit dem Fuß nach meinem üblichen Halt tastete.
»Danke, nicht nötig. Lass mich nur diesen Spalt finden, dann kannst du mir deine Hand reichen …«
»Ist es wirklich so wichtig, wie viel Hilfe ich dir gebe? Ich helfe dir so oder so. Lass mich dich auffangen.«
»Eine Hand wird reichen.«
Er murmelte etwas. Ich entdeckte besagten Spalt, schob die Spitze meiner Stiefelette hinein und ließ die Hände an die Außenkante der Fensterbank gleiten. »Was murmelst du da?«
»Ach, nur etwas über eine dickköpfige junge Lady, die ich kenne.«
Aus dem Fenster über mir war das Geräusch von Schritten zu hören. Offenbar kam Mama, um mit mir zu reden, und nach den energischen Schritten zu urteilen, war sie noch immer aufgebracht. Ein lautes Klopfen erklang an der Tür meines Zimmers. In diesem Augenblick ging mir auf, dass ich vergessen hatte, die Tür wieder abzusperren, nachdem ich sie für Oliver geöffnet hatte. Ich stieß mich von der Wand ab und ließ mich fallen. Henry würde mich auffangen, ohne Zweifel. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie er einen Satz vorwärts machte. Gerade zur rechten Zeit packte er mich an der Taille, um meinen Sturz abzumildern. Beim Landen stolperte ich, doch er zog mich auf die Füße und rannte mit mir um die Ecke des Hauses. Ich drückte mich an die Steinwand und versuchte, möglichst leise zu atmen.
»Kitty? Kitty!«, erschallte Mamas Stimme aus dem offenen Fenster.
Henry sah auf mich herab, und die Belustigung in meiner Miene wich jäh Besorgnis.
»Dich bedrückt etwas«, stellte er fest.
Ich kniff die Lippen zusammen und weigerte mich, sowohl seine Feststellung zu bestätigen als auch sie zu leugnen. Seine Augen verengten sich. »Was ist der Grund?«
»Kitty!«, schrie Mama wieder, diesmal lauter. »Katherine Worthington! Antworte mir auf der Stelle! Wenn du wieder aus deinem Fenster geklettert bist …«
Im nächsten Moment ließ Henry mich auch schon stehen und stapfte um die Hausecke. Ich wollte ihn bremsen und streckte die Hand nach ihm aus, bekam ihn aber nicht mehr zu fassen. Daher konnte ich nur mucksmäuschenstill dastehen und atemlos abwarten. Cora wand sich miauend um meine Fußknöchel, und ich hob sie hoch, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Oh, Henry!« In Mamas Stimme schwang Entzücken mit. Ich sah es förmlich vor mir, wie sie sich das Haar glättete und sich weiter aus dem Fenster lehnte. »Ich habe gerade nach Kitty geschaut. Du hast sie nicht gesehen, oder?«
»Heute noch nicht. Vielleicht ist sie in die Stadt gegangen?«
»Hm. Vermutlich hast du recht. Ich werde sofort einen der Dienstboten nach ihr schicken. Danke, Henry. Du bist ein lieber Junge.« Nach kurzem Schweigen senkte sie die Stimme und verlieh ihr einen kehligen Klang. »Oje, du bist ja gar kein Junge mehr, nicht wahr? Und du wirst fraglos mit jedem Tag hübscher. Du musst heute Abend zum Dinner kommen. Ich weiß nicht, wie oft ich Kitty schon gebeten habe, dich einzuladen, seitdem deine Mutter und Sylvia nach London abgereist sind, doch sie hat mich ein ums andere Mal enttäuscht. Dabei habe ich dich so gern hier, lieber Henry«, gurrte sie. »So, so gern!«
Erst als Cora miaute und sich in meinen Armen wand, begriff ich, dass ich sie fest drückte – ja, fast schon erdrosselte. Ich lockerte meinen Griff, ließ sie aber nicht gehen, und vergrub das Gesicht in ihrem Fell. Noch lieber wäre ich vor Scham im Erdboden versunken, irgendwo weit, weit weg von meiner peinlichen Mutter.
»Vielen Dank für die Einladung, Mrs Worthington, aber ich muss leider ablehnen. George hat heute die Farnsworth’ zum Dinner eingeladen, und meine Anwesenheit wird ebenfalls erwartet.«
»Oh.« Ihre Stimme nahm einen vorwurfsvollen Ton an. »Bestimmt kommen dein Bruder und seine Gattin aber doch einen Abend auch mal ganz gut ohne dich aus?«
»Es tut mir leid. Vielleicht ein andermal. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen …«
»Nun gut. Aber ich lasse nicht locker. An einem dieser Abende, Henry, werde ich dich an meiner Seite haben.«
Einen Augenblick später bog Henry wieder um die Ecke, und ich sah ihm bang entgegen. Seine Wangen hatten sich gerötet, und er presste die Lippen zusammen, als könnte er sich nur mit größter Mühe eine Bemerkung verkneifen. Doch als er mich ansah, entdeckte ich in seinem Blick nichts als Freundlichkeit, und seine zusammengekniffenen Lippen verzogen sich zu einem raschen Lächeln.
»Wie schon gesagt, die Zielscheibe ist aufgestellt, und ich glaube, ich habe deine Mutter auf die falsche Fährte gelockt. Kommst du?«
Ich bebte vor Zorn und Beschämung und wünschte, ich könnte mich für meine Mutter entschuldigen. Damit hätte ich Mutters unziemliches Verhalten jedoch bestätigt, und das ging nicht an. Ich stellte Cora auf den Boden. »Das ist genau das, was ich jetzt brauche!«
Ich vergewisserte mich, dass uns aus den nächstliegenden Fenstern niemand beobachtete, und spurtete dann mit Henry zum Wald, mit Cora auf den Fersen. Die Lichtung befand sich fast genau auf halbem Weg zwischen unseren beiden Elternhäusern. Dort angekommen, zog Henry seinen Rock aus und hängte ihn über einen Ast. Die Zielscheibe hatte er bereits neben dem hohen Ahornbaum aufgestellt. Auf einem großen Baumstumpf lagen zwei Bögen und zwei Köcher mit Pfeilen bereit.
Alles sah genau so aus, wie an jedem anderen Tag, an dem wir auf dieser Lichtung Bogenschießen geübt hatten. Doch meine Wut auf Mama war so groß, dass ich bezweifelte, auch nur einen Treffer erzielen zu können. Henry stand neben mir und beobachtete mich schweigend. Noch immer zitterten meine Hände vor Zorn. Nach einem tiefen Atemzug legte ich den Pfeil auf, hob den Bogen, spannte die Sehne, zielte und ließ die Sehne schnellen. Der Pfeil flog weit daneben. Keine Überraschung, dennoch funkelte ich die unverschämte Zielscheibe böse an.
Nun legte Henry einen Pfeil auf, zog ihn zurück und visierte die Zielscheibe mit zusammengekniffenen Augen an. Sein Haar reflektierte das Sonnenlicht. Er schoss den Pfeil ab, der sich mit einem dumpfen Geräusch in die Zielscheibe bohrte. Henry verfehlte nie.
»Bist du jetzt bereit zu reden?«, fragte er.
Ich nahm mir einen weiteren Pfeil, spannte die Sehne und ließ mir seine Frage unterdessen durch den Kopf gehen. Während ich die Zielscheibe fixierte, stellte ich mir Mamas kalte Augen vor. »Es geht um meine Mutter.« Ich löste den Pfeil, der die äußere Kante der Scheibe traf. Armselig!
»Um wen auch sonst«, sagte Henry. »Aber was hat sie diesmal getan?«
Sein zweiter Pfeil traf genauso ins Schwarze wie der erste.
»Sie ist die gefühlloseste Mutter auf Erden!« Ich griff nach einem weiteren Pfeil. »Weder versteht sie meine Träume noch hat sie Sinn für meine Sehnsüchte. Sie möchte nur, dass ich heirate! Und du weißt, wie ich dazu stehe.« Ich schoss den Pfeil ab. Diesmal bohrte er sich ins Gras.
»In der Tat.«
»In der Tat!« Ich schnappte mir noch einen Pfeil und ärgerte mich, dass meine Pfeile ihr Ziel nicht erreichten und dass Henry so ruhig blieb, wenn ich wütend war. Vor allem aber ärgerte ich mich über Mama, die so überhaupt kein Verständnis für mich hatte. »Sag mir bitte: Wie oft hast du mich schwören hören, dass ich niemals heiraten werde?«
Er lächelte. »Wie oft? Ich habe nicht mitgezählt, Kate.«
»Dann schätz einfach mal.«
Er seufzte. »Nun gut. Ich schätze, seit letztem Weihnachten mindestens zwei Dutzend Male. Letztes Jahr vielleicht fünfzigmal. Insgesamt so um die hundert?«
Wenn das keine Leistung war! »Und glaubst du, dass ich es mit meiner Absicht ernst meine?«
»Ja, allerdings.« Mit verhärteter Miene starrte Henry auf den Pfeil in der Zielscheibe.
»Siehst du? Wenigstens du verstehst mich in dieser Angelegenheit, und dabei bist du nur ein Freund. Aber mein eigen Fleisch und Blut …!«
Er zuckte zusammen und riss den Kopf zu mir herum, wobei ihm der Pfeil aus dem Bogen fiel. Er senkte ihn und musterte mich durchdringend, und seine grauen Augen glitzerten wie Stahl. Dann hob er den Bogen wieder und richtete seinen Blick auf das Ziel. »Nur ein Freund?« Er kniff die Augen zusammen und presste die Lippen aufeinander, sodass sich in seiner Wange eine Kerbe bildete. »Ich habe weiß Gott einen besseren Titel verdient, finde ich.«
»Welchen denn zum Beispiel?« Ich sah ihn fragend an.
»Oh, ich weiß nicht.« Er löste seinen Pfeil. Ein weiterer Treffer. »Vielleicht ›Erfüller meines Herzenswunsches‹?«
Ich brach in entrüstetes Gelächter aus. »Erfüller meines Herzenswunsches? So werde ich dich nie nennen.« Ich nahm mir einen neuen Pfeil.
»Warum nicht? Ich habe mir diesen Titel redlich verdient. Ich finde, jedes Mal, wenn wir uns sehen, solltest du mich damit ansprechen!«
»Wie kommst du eigentlich darauf?«
»Ich habe dir die Katze geschenkt, die du über alles auf der Welt liebst.« Er deutete auf Cora, die neben uns im Gras lümmelte. »Deshalb habe ich dir deinen Herzenswunsch erfüllt.«
Ich sah ihn spöttisch an, spannte die Sehne und schoss den Pfeil ab. Er traf die Zielscheibe. Endlich. Ich lächelte voller Genugtuung. »Ich werde dich doch nicht Erfüller meines Herzenswunsches nennen. Das wäre zu lächerlich!«
Henry sah mich mit einem befriedigten Lächeln an. »Na bitte. Deine Augenbrauen haben wieder ihre normale Stellung.«
»Du sollst mich doch nicht wegen meiner Augenbrauen aufziehen, weißt du nicht mehr? Diesen Pakt haben wir vor fünf Jahren geschlossen.«
»Das war ein einmaliges Abkommen, nachdem du versucht hast, sie dir mit dem Rasiermesser deines Vaters wegzurasieren.« Er zog die Sehne seines Bogens zurück und konzentrierte sich auf die Zielscheibe. Henrys Gestalt hatte ich schon immer bewundert. Mit seinen zwanzig Jahren war sein Rücken breiter denn je. Seine Armmuskeln wölbten sich, und wieder war da diese Kerbe in seiner Wange – diese Kerbe, die mehr Falte war als Grübchen, und ich musste wegsehen. Als ich mich bückte und den letzten Pfeil aus meinem Köcher zog, hörte ich, wie sein Pfeil ins Ziel traf.
Mein letzter Pfeil war ebenfalls ein Treffer, und ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Schon besser. Anscheinend war ich wieder auf der Spur. Ich legte meinen Bogen weg und begab mich mit Henry zur Zielscheibe. Nachdem ich meine Pfeile herausgezogen und die verirrten aufgesammelt hatte, schlenderte ich zu dem Ahornbaum, der an einer Seite der Lichtung stand. Er war so hoch, dass sich selbst seine untersten Äste weit über meinem Kopf befanden. Ich lehnte mich an seine vertraute Rinde und seufzte tief auf. Meine Empörung hatte sich einigermaßen gelegt, doch Kummer und Groll brannten noch immer in mir.
Henry gesellte sich zu mir und lehnte sich ebenfalls an den Baum. Ich musterte die Federn der Pfeile in meinen Händen und wünschte mir nicht zum ersten Mal, ich könnte einfach wegfliegen. Ich spürte Henrys Blick auf meinem Gesicht.
»Was bereitet dir denn wirklich Kummer, Kate?«, fragte er leise. »Dieses Problem mit deiner Mutter ist doch nichts Neues. Was ist heute geschehen, das dich so mitnimmt?«
Ich ließ die Pfeilfedern zwischen meinen Fingern hindurchgleiten und kämpfte gegen neue Tränen an. Um meine Gefühle in den Griff zu bekommen, holte ich tief Luft.
»Sie hat gesagt, ich dürfe nicht nach Blackmoore reisen«, sagte ich schließlich.
»Was?« Unglaube vermischte sich mit Wut. »Warum denn nicht?«
Ich legte den Kopf zurück und beschirmte mit der Hand meine Augen, damit Henry meinen Kampf mit den Tränen nicht mitbekam. »Sie ist wütend auf mich, weil ich Mr Coopers Heiratsantrag abgelehnt habe.«
»Mr Cooper?« Henry klang entsetzt. »Der Mann ist krank!«
Ich lachte ein wenig, und aus dem einen Auge stahl sich eine Träne. »Ich weiß!« Bei der Erinnerung an seinen letzten Besuch revoltierte mein Magen. »Bei unserer vorigen Begegnung war sein Ohr verbunden. Wie kommt es, dass jedes Mal ein anderer Körperteil bandagiert ist?«
»Das kann ich dir nicht sagen«, erwiderte Henry in ernstem Ton. Ich sah ihn an und entdeckte in seinem Gesicht eine solche Abscheu, dass ich in Gelächter ausbrach.
»Der Verband war noch dazu voller Flecken«, fuhr ich fort und keuchte dabei vor Lachen. »Von grünlicher Farbe!«
Henry schüttelte den Kopf. »Halt. Sag nichts mehr!«
Ich lachte so heftig, dass mir die Tränen hinunterliefen. Doch dann erinnerten sie mich daran, worüber ich wirklich zu weinen hatte, und der Gedanke ernüchterte mich wieder.
»Es ist unfair«, sagte ich, »dass meine Mutter dem Ganzen jetzt, da wir deine endlich davon überzeugt haben, dass ich zu Besuch kommen darf, einen Riegel vorschiebt.«
»Wie recht du hast.« Er seufzte. »Wenn ich es also richtig verstehe, hat deine Mutter immer noch nicht akzeptiert, dass du einfach ziemlich dickköpfig bist. Sie meint noch immer, sie könne dich zu einer Heirat überreden, nicht wahr? Und dich in eine sittsame, gehorsame Tochter verwandeln? Wenn sie schon dabei ist, wird sie dann auch gleich die Ordnung des Universums umgestalten?«
Traurig lächelte ich. »Irgendetwas in der Art.«
»Du weißt, dass du mir nie erklärt hast, was dich zu deinem Entschluss bewogen hat, nie zu heiraten.«
Ich schüttelte den Kopf. Jedes Mal, wenn er mich in den vergangenen anderthalb Jahren danach gefragt hatte, verwehrte ich ihm eine Antwort. »Nicht heute, Henry. Wir haben wichtigere Schlachten zu schlagen.« Ich suchte seinen Blick. »Ich muss nach Blackmoore fahren. Ich muss! Ich glaube, wenn sie mich hier behält, hasse ich sie für den Rest meines Lebens.«
Er nickte mit grimmigem Blick, als wäre er sich über den Ernst der Lage vollkommen im Klaren. Wenn überhaupt jemand mich verstand, dann er. Schließlich hatte er mir das Modell gebaut. Ich wischte eine weitere Träne fort, und diesmal war ich mir gewiss, dass Henry sie gesehen hatte.
Er stupste mich mit dem Ellbogen an. »Ach komm. Zum Verzweifeln gibt es keinen Grund. Wir sind zwei intelligente Menschen und imstande, eine Mutter zu überlisten.« Er löste sich von dem Baum und ging davor auf und ab. »Was wünscht sich deine Mutter mehr als alles andere?«
»Dass ich heirate«, antwortete ich prompt.
»Und doch bist du wild entschlossen, es nicht zu tun.«
»Richtig.«
»Hm.« Er ging weiter auf und ab. Dann hielt er plötzlich inne und drehte sich zu mir. »Kannst du nicht vorgeben, du würdest heiraten wollen? Erzähl ihr doch, dass du in Blackmoore vielen heiratswürdigen Gentlemen begegnen und vielleicht den passenden Kandidaten finden wirst.«





























