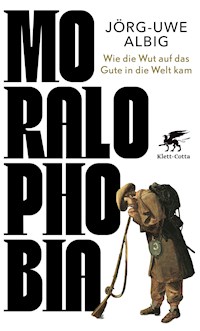12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jörg-Uwe Albig ist ein Meister der spektakulären literarischen Volte. In seiner Novelle erzählt er die Geschichte einer Liebe, die man mit Fug und Recht ungewöhnlich nennen kann – der Liebe zwischen einem Mann und einem Gebäude. Gregor Steinitz lebt als Paläontologe in einer ostdeutschen Kleinstadt. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Aktivisten kämpft er für den Erhalt der vom »Rückbau« bedrohten Bausubstanz der Stadt. Auf einem seiner Streifzüge durch Brachen und Plattenbausiedlungen trifft er Maria Magdalena. Sie ist klein und auf den ersten Blick unscheinbar, aber in Gregors Augen eine Schönheit – sie ist eine evangelische Kapelle. Greogor zieht es immer wieder zu ihr, er versucht möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen, mit ihr zu sprechen, sie zu berühren. Aber ihre Liebe ist bedroht – von Gregors Nebenbuhler, dem Pfarrer Dornkamp, und von einer Horde heidnischer Naturanbeter, die in den neuen Steppen des Ostens ihr Revier errichtet haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jörg-Uwe Albig
Eine Liebe inder Steppe
Novelle
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp, München
unter Verwendung eines Fotos von Arcangel/Benjamin Harte
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-96157-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10879-8
Der Mensch reagiert auf die Stummheit der Materie mit Panik.
(Georges Devereux: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften, 1967)
Platten hoben und senkten sich, rieben sich aneinander, höhlten sich aus, warfen Gebirge auf. Eine Schicht wuchs über die andere, dann noch eine, und wieder kam die Tektonik ins Spiel. Und wieder werden die Karten neu gemischt, dachte Gregor, als er über den aufgerissenen Gehweg stapfte.
In dem Augenblick, als er die Zetsche überquerte, das grüne, begradigte Gewässer hinter dem Parkhaus an der Baumleite, spürte er, wie die Luft leichter in seine Lungen drang. Er genoss den Wind, der alle menschlichen Gerüche dauerhaft vertrieb, und er wurde selbst zum Wind, der über die Prärie fuhr, hohe Wolken vor sich hertrieb und rollende Sträucher. Er passierte Straßenschilder, Straße des Fortschritts, des Friedens, der Kosmonauten. Sie markierten Verkehrswege ohne Verkehr, trugen Hausnummern, die längst keine Häuser mehr zählten. Wo Bauten gestanden hatten, wuchs jetzt Wiese; nichts erinnerte mehr an Aufbau, an Berg- und Richtfeste, an den Übermut der Konstruktion. Er ertappte sich dabei, wie er nach Anzeichen unterirdischer Aktivitäten forschte. Vielleicht gab es Schächte, Eingänge ins Erdinnere, versteckt hinter verbliebenen Trafokästen oder Kastanien, dachte er.
Er stellte sich vor, mit den verbliebenen Bauten allein zu sein, an irgendeinem Tag danach, als Letzter in einer Welt ungerührten Betons. Er stellte sich Feuerbälle am Horizont vor, Risse im Erdboden, verbranntes Gras. Er hörte das Zittern der Luft und die Ruhe danach; er hörte Hundegebell.
Nach der Schule war er oft so durch das Gelände seiner niederfränkischen Heimat gestreift, im Rucksack den Zimmermannshammer, die Brechstange für plattiges, den Spargelstecher für tonig-mergeliges Gestein. Er hatte das Geländebuch mitgenommen, Plastiktüten, alte Filmdosen und Klopapier für empfindliche Kleinfunde. Dort hatte er begonnen, die luftdichte Schönheit turritellider Schnecken zu verehren, der jurassischen Muschel Gryphaea arcurata oder der Spore Diatomozonotriletes magnus aus dem Unterkarbon. Diese Schönheit stellte keine Ansprüche, die sich nicht erfüllen ließen; sie verlangte nur, dass man sie sah. Und vielleicht war es das, was er auch an Judith schätzte.
Seine Gedanken übersprangen Jahrmillionen, und so merkte er erst, als sein Fuß an einem Grasbüschel hängenblieb, dass er jetzt mitten in einer Steppe stand. In großer Plötzlichkeit stand er da, in der offenen, semiariden Graslandschaft gemäßigter Zonen.
Hier gab es keine Wege mehr. Gregor pflügte durch stählernes Gras, trieb die Stiefel hinein, als könnte der Widerstand ihn zu Bewusstsein bringen. Er zuckte, als Disteln an seinen Knöcheln rissen, blieb in Maulwurfshügeln stecken und arbeitete sich heraus. Gestrüpp griff nach ihm. Er löste den Fuß und hob den Blick, und da sah er das Ding.
*
Später schämte er sich, dass ihm kein anderes Wort in den Sinn gekommen war in diesem Moment. Doch es war kein erhabener Anblick, der sich ihm bot; fast hätte er gelacht. Das Ding stand plump in der Steppe, eine Datsche mit Spitzdach und Maschendrahtzaun, eine weiß gekalkte Hütte mit gemauerten Stufen. Der Portikus mit den zwei viereckigen Pfeilern und dem flachen Giebel sah aus wie angeklebt. Und auf dem Dreiecksgiebel standen in Computerbuchstaben, Times New Roman, die Worte: St. Maria Magdalena.
Erst zuletzt sah er das Kreuz. Es war aus Messing, angeklebt auf der Stirnseite, halb mannshoch, eher Fernsehantenne als geistlicher Halt. Es wirkte aufgesetzt, ein Prinzessinnenkrönchen aus Goldblech, wie es sich kleine Mädchen ins Haar stecken.
Gregor drehte sich um. Sein Blick ging über die Steppe; die Entfernung zu den Häuserblocks schien kaum geschrumpft. Er glaubte, eine Staubwolke über der Prärie auszumachen, wie sie den Ansturm einer feindlichen Kavallerie oder Rinderherde anzeigt. Er öffnete das eiserne Gartentor, nahm den kurzen Betonweg und stand an der Pforte.
Er drückte die Klinke. Er zog und zerrte, glaubte, ein Knistern von drinnen zu hören, ein Rascheln, ein leises, klagendes Pfeifen. Die Tür blieb unbewegt, als wäre sie mit dem Rahmen verschweißt; er drückte noch einmal, dann trat er ein paar Schritte zurück.
Schwer atmend stand er vor der Kapelle. Er verspürte einen unerwarteten Stolz, als wäre der Bau sein Werk. Unverhofft stand das Objekt in der Steppe, die leer war, die alle Bedrohungen einebnete und verschluckte. Er glaubte, etwas überwunden zu haben, eine Distanz, eine Gefahr, eine Zeit.
Jetzt erst sah er den Schaukasten. Der Schaukasten stand auf zwei Holzbeinen am Zaun. Der Programmzettel mit der Gottesdienstordnung war vergilbt, der Bibelspruch, auf das Bild einer Waldwiese im Morgennebel gedruckt, zur Hälfte verdeckt. Darüber hing, bedruckt mit hysterisch kursiven Computerbuchstaben, ein lindgrünes Blatt: OFFENE KIRCHE MONTAGS 15 BIS 17 UHR.
*
Als Gregor Stenitz am Stadtmuseum von Zinnroda, in der Sprache der Urbevölkerung Cynowa Ruda, als Kustos für die Fossiliensammlung anfing, hatte er nicht gewusst, was ihn hier erwartete. Ihm war nur die Braunkohle eingefallen und ein Fußballverein, der nach dieser Kohle benannt war. Einst war die Stadt eine Mittelstadt gewesen. Jetzt war sie zur Kleinstadt geschrumpft, und die Nummernschilder der Autos trugen Kürzel, die keinen Ort mehr bezeichneten, sondern eine Landschaft, die sich unablässig auszubreiten schien.
Doch während das freie Feld um sie wuchs, blieben in Zinnrodas Altstadt die Räume eng. Die Straßen mit den zweisprachigen Schildern führten ihn an Ziele, ohne dass er eine Wahl gehabt hätte. Ferngesteuert glitt er zwischen den Fassaden hindurch, geführt vom Alten Zeughaus, der Leuchtreklame des Schlemmer-Back in der Schneidergasse, den horizontalen Beton- und Fensterbändern der einstigen Stadtbibliothek; es schwindelte ihn, und er rettete sich in die alberne Erkenntnis, dass die Straßen in der Sprache der Urbevölkerung ja droga hießen.
Schlimmer als die Enge aber war der Geruch nach geschmolzenem Käse. Es war ein Geruch, den er noch aus seiner niederfränkischen Heimatstadt kannte, der Geruch der Pizzen und Schlemmerzungen, der Schinken-Chester-Stangen, der Debrecziner-Laugenstangen. Dieser Geruch war es ja, aufdringlich, vertraut und auf verschlagene Art nah, der die Menschen in Massen anzog, der ihnen entsprach, der sie in die Fußgängerzonen und Einkaufszentren lockte, die jetzt auch Zinnroda beherrschten. Längst hatte Gregor sich damit abgefunden, dass dieser Geruch das Pheromon des Menschen war.
Schon in seiner Heimat hatte sich Gregor nach einem Wind gesehnt, der diesen Geruch fortrisse, und von der Seefahrt geträumt. In diesen Phantasien war er in Häfen gelandet, um sie möglichst schnell wieder zu verlassen, hatte im Mastkorb gesessen, hoch über der Mannschaft, ihrem Kautabak und ihren gestockten Leidenschaften. Horizonte hatten ihn umkreist, sichtbar und fein wie gedachte Linien und zugleich in größtmöglicher Entfernung zu seinem Leib. Doch am lautesten sang sein Herz, wenn ein Sturm aufkam und mit einem Hieb diese Horizonte verwischte und auflöste und so absolut machte, zu reiner Entfernung, die gegen unendlich ging.
Weil aber ein Meer in Niederfranken weit und breit nicht zu sehen war, hatte er früh begonnen, das Weite auf der Zeitachse zu suchen. Er versetzte sich in entrückte Epochen, uferlos wie der Ozean, der Mensch nicht zu ahnen, noch versteckt hinter dem Horizont der Jahrmillionen. Im Geist durchstreifte er kambrische Wattlandschaften, devonische Kontinente, die kollidierten, sich quetschten und himmelwärts wölbten; karbonische Urwälder, dampfend in der Mittagshitze, die Stille bleiern, bis schließlich eine Riesenechse platschend ins Moorwasser glitt.
*
Dass es Leben jenseits der Zetsche gab, war Gregor nie in den Sinn gekommen. Erst Le Bertram hatte ihn und Judith in die Zone geführt. Ihr kriegt ja so was sonst nie zu sehen, hatte Le Bertram gesagt, und wir wahrscheinlich bald auch nicht mehr.
Gregor war berauscht von der Leere, mit der ihn die Zone empfing. Im Volvo flogen sie über die Ebene, ein gleitender Punkt auf weißer, sich weitender Fläche. Unbegrenzt dehnten sich Fahrbahnen über Bordsteine hinaus, über Rasenflächen, über verwaiste Bürgersteige. Zwischen gelben Wiesen brachen Schneisen auf, Tankstellen rollten vorbei und verwaiste Lagerhallen, auf deren Mauern in aschgrauen Buchstaben NAZIS RAUS stand oder KOHLE, Baracken mit glaslosen Fenstern, Schießscharten mit verkohlten Rändern. Die Großgaststätte Völkerfreundschaft hieß jetzt Casablanca und stand leer wie die Landschaft; auf der trapezförmigen Glasfassade der früheren Kaufhalle standen jetzt in blassroten Klebebuchstaben die Worte Bennos Preis-Rakete. Von der Fassade, hinter der einmal, wie Le Bertram verriet, die Volkssolidarität ihren Platz gefunden hatte, leuchtete jetzt eine rote Sonne, darin das weiße A mit verlängertem Aufstrich.
Über den großspurigen, leeren Straßen aber stand ein Himmel, den Gregor nicht kannte. Auf seiner festen, glatten Fläche schienen die Wolken schneller zu fliegen, von Widerständen befreit. Kurz tauchte der Wagen durch den Schatten elfstöckiger Betonkästen. Doch gleich war wieder das Licht da und die Wärme nur ein anderer Zustand der Helligkeit, die über der Landschaft lag.
Wo einst die Innenhöfe der Häuserblocks gewesen waren, standen jetzt Quadrate aus Hofbäumen, Birken und Kastanien, plötzlich nackt, wie zusammengedrängt gegen das Anbranden der Steppe, die an ihnen nagte wie Wellen an den Kreidefelsen von Rügen. Gregor spürte das Licht mit einer Gewalt, die ihm endlich erlaubte, sprachlos zu sein. Es gab kein Hindernis, keine Ablenkung; zum ersten Mal überfiel die Erkenntnis, dass all das hier einmal Meer gewesen war, mit unwiderlegbarer Macht Gregors Leib.
Ihm war, als hätte er plötzlich sehen gelernt. Er dachte an die Trilobiten, die einst das Auge erfunden hatten, ein Verbundauge aus fünfzehntausend Einzellinsen. Mit ihm war das Licht in die Welt gekommen. Zwar beharrte Judith darauf, dass es kein Auge braucht, damit das Licht existiert. Doch vor den Trilobiten hatte die Welt im Dunkeln gelebt. Hier durfte sich Gregor wie der erste Mensch fühlen, der aus dem Schatten trat.
*
Dass Judith Sievers, Beauftragte für Museumspädagogik am Stadtmuseum, klüger als er war, machte Gregor nichts aus. Längst hatte er aufgehört, darüber nachzudenken, was sie an ihm fand; er hatte sich an die Annahme gewöhnt, dass sie das an ihm liebte, was auch ihm täglich von neuem gefiel, wenn er in den Spiegel sah. Wahrscheinlich liebte auch sie seine Statur, seine ammonitische, doch zugleich schmale Nase, sein karbonisches Kinn. Und wahrscheinlich liebte sie sein Schweigen, dachte er; es fiel ihm nicht schwer, ihr zu geben, was sie sich wünschte.
Gregor hatte bald beschlossen, sich in den Geschenken zu erkennen, mit denen sie ihn schmückte. Einmal brachte sie ihm einen Kugelschreiber mit, Dialog 1, Richard Sappers Design für Lamy von 2003. Was ist das, fragte er, während er das Buchenholz-Etui in die Hand nahm und vorsichtig drehte. Nicht was, korrigierte Judith. Wer.
Gregor öffnete das Etui, nahm den Stift in die Linke, strich gerührt über das matte Titanium-Finish. Gehorsam bewunderte er die abgerundeten Kanten, die charakteristische Dreiecksform. Judith strahlte, als er den abgefederten Edelstahlclip knipste und die Großraummine unter der schrägen Kapuze zum Vorschein kam, vorwitzig und erektil. Gregor breitete die Arme aus, und Judith verkroch sich an seine Brust, rein und greifbar und uneindeutig. Er schloss die Arme und nahm das Geschenk an, das Geschenk des Kugelschreibers, das Geschenk ihrer selbst.
Er sah den Stift an, der noch immer in seiner Hand lag, erforschte seine Stringenz, seinen Optimismus, seine pfeilförmige Teleologie. Er forschte in Judiths flämischbraunen Augen, ihrem Licht und ihrem Schatten, forschte nach ihrer inneren Mauer, ihrem inneren Raum. Wie immer konnte er nichts erkennen. Manchmal versteh ich dich nicht, Judith, sagte er, und er konnte an ihrer Gesichtsfarbe sehen, wie glücklich sie dieser Satz machte.
*
Dass Judith vorwiegend aus Farbtönen bestand, die er aus seiner Arbeit kannte, gab Gregor ein Gefühl der Ruhe. Ihre Haare waren blond, die Augen braun, die Brauen schwarz; die Hautfarbe changierte, je nach Jahreszeit, zwischen Kalk, Löss, Lehm und Mergel. Nicht einmal von stumpfen Gegenständen bekam sie blaue Flecken. Dass ausgerechnet das Blau ihrer Heimat, der Strom und das nahe Meer, auf der Palette ihres Körpers fehlte, half Gregor dabei, auch seine eigene Herkunft so gründlich zu vergessen, wie er es einmal vorgehabt hatte.
Von ihrer Kindheit und Jugend in der Hafenstadt erzählte Judith Gregor ohnehin nicht viel. Das einsame Kind, das auf dem Rad über sommerbleiche Kais gerollt war, Schiffsmeldungen der Lokalzeitung im Rucksack, konnte er in der heutigen Judith nicht mehr erkennen. Im Hafen hatte sie Löschvorgänge verfolgt, hatte auf chinesische Vasen gehofft, persische Teppiche, Motorräder aus den USA. Hinter den Stahlwänden der Container waren die Schätze jedoch nur zu ahnen. So hatte Judith ihre Phantasie geschult und ihre Neugier; und das war vielleicht der Grund gewesen, dass sie sich dem Studium der Kulturwissenschaften verschrieb. Im Rahmen der Regelstudienzeit brachte sie es hinter sich.
Dass das Studium sie nicht weiter geführt hatte als in den Museumspädagogischen Dienst am Stadtmuseum Zinnroda, begriff sie nicht als Niederlage. Ihre Gedanken, das war ihr am breiten Strom ihrer Heimatstadt aufgegangen, brauchten Raum zur Entfaltung. An einer Universität wären sie gegen andere Gedanken geprallt wie Körper im Schwimmbad, behindert von Rentnern, Sportkraulern, kleinen Mädchen, die ihre ersten Züge versuchten. Sie hätten ausweichen müssen, untertauchen. Und schließlich hätten sie sich eingereiht in die Bahn, sorgfältig abgetrennt mit Trennleinen aus Styroporkugeln, der einzige Ausbruch manchmal eine verstohlen tollkühne Wende am Beckenrand.
In Zinnroda aber konnten die Gedanken sich ungebremst ausbreiten. Judith wusste es zu schätzen, dass auch Sören Jespersen, der Direktor des Museums, nie einen Gedanken verriet, der mit ihren in Kollision geraten konnte. Du sbinns ja, Judith, sagte Jespersen nur, wenn sie ihre Theorien entfaltete. Dann setzte er sein nordisches Strahlen auf und stellte eine Platte Bauernkuchen im DIN-A2-Format auf den Konferenztisch.
*
Le Bertram war es, der Judith und Gregor eines Freitags zur Rückbaustelle an der Sigmund-Porischke-Straße 55–61 führte. Den Volvo stellten sie außer Sichtweite ab, und mit gefasster Miene stand Le Bertram am Zaun und erzählte von seiner Zweiraumwohnung in einem Elfstöcker in Wohnkomplex VII, die er fünf Jahre lang mit Birgit bewohnt hatte. Das Haus war gleich mit der ersten Abrisswelle gefallen, noch im Jahr der Einheit; zwei Wochen lang hatte er täglich am Abbruchzaun gestanden, ein belegtes Baguette vom Backshop in der Hand. Er hatte gewartet, dass sie sich den dritten Stock vornähmen, Wohnung 2/306, die zwanzig Jahre seines Lebens gesehen hatte, Glück und Unglück seiner Liebe. Und er hatte verfolgt, wie seine Wände am Haken schwebten, nackt, so wie er sie einst mitgeschaffen hatte, vor der Wende, als er noch Ingenieur im Betonplattenwerk war.
Nach einer Woche hatten die Abrissarbeiter ihn gegrüßt. Sie hatten ihn sogar zu einem Geburtstagsumtrunk in den Bauwagen geholt. Irgendwie haben wir schließlich den gleichen Job, hatte er gesagt und Le Corbusier zitiert: Die Stadt ist eine Bestie, das Bauen wie eine Naturgewalt, wie ein reißender Fluss.
Seine späte Leidenschaft für den Titanen der Moderne hatte Bertram Strau seinen Kampfnamen beschert: Le Bertram. Manchmal erzählte er von seiner alten Arbeit im Plattenwerk, Wände und Decken für acht Wohneinheiten pro Tag, über zweitausendeinhundert Wohneinheiten pro Jahr, wenn alles gut lief, zweitausendfünfhundert. Er erzählte von der Schönheit der Platten, die wie Bauklötze waren. Gregor verstand kein Wort, wenn Le Bertram von Steueranlagen sprach, vom Zeitrelais R 5, von Kippformen und Gussformen. Doch er mochte Bertrams Stolz auf die Dinge, die ihm keiner mehr nehmen konnte, wie er sagte: das Wissen um das Gewicht einer Betonplatte, die Temperatur ihrer Oberfläche, das Drehmoment, wenn sie am Kran hing und alles noch möglich war.
Dass Birgit ihn noch im selben Jahr verließ, vier Monate nach dem Umzug in die überteuerte, geschmacklos sanierte Ausweichwohnung in der Altstadt, hatte Le Bertram auf die Zukunft zurückgeworfen. Erst die Trauer um die Zukunft hatte ihn wirklich zum Zukunftsfreund gemacht, so wie man die Liebe zu einer schwierigen Mutter oft erst entdeckt, wenn sie gestorben ist.
Mit zweiundfünfzig Jahren hatte Le Bertram erkennen müssen, dass diese Zukunft vielleicht den größten Teil seines Lebens ausgemacht hatte. Sie war sein Beruf gewesen, jahrzehntelang; jetzt lag sie in der Vergangenheit. Doch in dieser Vergangenheit, fern von den Erosionen der laufenden Zeit, war die Zukunft noch unversehrt enthalten. Es kam nur darauf an, sie zu befreien. Es wäre Verrat gewesen, sie im Stich zu lassen. Es hätte bedeutet, zu einer Gegenwart überzulaufen, die außer Transferleistungen nichts für ihn vorsah.
Le Bertram kannte die Unterschiede zwischen Flächen- und Skelettbauten, zwischen gelenkig und ungelenk gelagerten Decken, zwischen den flexiblen WBS 70 und der preisgekrönten Serie P 2 mit parallel zu den Fassadenflächen angeordneten tragenden Wänden, den Mittelganghäusern mit ihren Kleinstküchen und markanten Aufzugstürmen, den Punkthochhäusern vom Typ WHH 17 Dresden, mit siebzehn Stockwerken und Keramikmosaiken im Eingangsbereich. Er war überzeugt, dass diese Unterschiede genügten, um die Welt zu beschreiben. Alles Neue ist besser als alles Alte, sagte Le Bertram oft. Wer sagt das, hatte Gregor einmal gefragt. Brecht, hatte Le Bertram geantwortet.
Das war ja nun wohl auch schon fast hundert Jahre her.
*
Sie starrten auf den Block, die schwarzen Höhlen der herausgebrochenen Fenster. Durch manche der Öffnungen schimmerten Tapeten, Treppen, Notausgangsschilder; durch die im obersten Stock lugte schon blauer Himmel. Manchmal erschien ein gelber Helm darin, hallte ein Schrei daraus über freies Feld, und Judith zuckte zusammen.
Judith ließ jetzt seine Hand los. Sie schritt den Bauzaun ab, die Augen zusammengekniffen. Gregor hörte, wie ihr Atem schneller und schwerer wurde, wie immer, wenn ihr etwas einfiel.
Männer in gelben Overalls sprachen und horchten in Headsets. Ein kleiner Bagger tanzte über das Dach, vor und zurück und im Kreis, knabberte an noch aufrecht stehenden Betonplatten, schob Brocken über die Kante, die prasselnd zu Boden rieselten.
Die Platten sind schon gelöst, aber noch mit Querstreben gesichert, erklärte Le Bertram, als das Auto mit dem Logo der Abrissfirma neben ihm parkte. Kann ich Ihnen helfen, fragte der Mann mit dem Zwirbelbart und der Lodenjacke, der dem Wagen entstieg und nach gekochten Eiern roch.
Danke, nein, sagte Gregor. Alles klar, sagte er. Kein Problem. Sanft strich er mit den Fingern über den Zaun.
Der Mann trat neben ihn; sein Eiaroma umgab ihn wie Dotter. Gregor wich zurück, doch der Bauzaun hielt dagegen. Darf ich fragen, was Sie dann hier machen, fragte der Mann in einem Ton, der Gregors Erlaubnis nicht abwartete. Nein, antwortete Le Bertram für ihn. Nein, wirklich nicht, wiederholte er, und der Mann wandte sich ab, um in sein Handy zu sprechen.
Als er wieder verschwunden war, sahen die drei am blauen Teleskopkran empor, der noch tuckernd auf seinen Moment wartete. Die Männer auf dem Dach richteten eine Platte auf, zogen Ketten durch Bohrlöcher, zurrten sie am Haken fest.
Das sind keine Löcher, sondern Anschlagpunkte, dozierte Le Bertram. Die werden mit Pressluft freigelegt. Und das nennt man nicht Ketten, sondern Gehänge, legte er nach. Einer der Arbeiter senkte den Daumen; die Kranwinde schnarrte, und langsam und graziös schwebte ein Betonrechteck der Erde entgegen. Ein Arbeiter in orangefarbener Weste nahm es in Empfang, dirigierte die letzten Meter und löste die Ketten. Matt sank die Wand an den Stapel aus schräggestellten Platten, die schon auf den Abtransport warteten. Mit klirrendem Gehänge stieg der Haken von neuem in die Luft, bereit zum nächsten Flug.
Eine Küchenwand senkte sich herab, drehte sich noch einmal in der Luft, eine Pirouette. Gregor erkannte die Türöffnung, die Kachelverkleidung, die Aussparung für die Spüle. Den Kran brauchen sie nur für die obersten Stockwerke, sagte Le Bertram. Ab Etage sieben reicht der Longfrontbagger.
Gregor hörte das Scharren und Kratzen aus den benachbarten Gebäuden. Sie wurden noch ausgeweidet – ein Dröhnen und Röhren, eine Agonie. Dann wieder entfernter Steinschlag, ein Aufprall, ein dumpfer Fall. Gregor sah keine Staubwolke, keinen Kollaps. Das wahre Geschehen rollte unsichtbar ab.
Bagger wühlten in Schutthaufen. Wählerisch ließen sie ihre Schnäbel über dem Gestein kreisen, ruckten mit den Kiefern, den Unterlippen, schwenkten wie ausgelassen die Köpfe. Schließlich stießen sie zu, zerrten eine Platte heraus, scheinbar willkürlich und doch planvoll. Stählerne Nerven ragten zitternd aus dem Beton, Wind raschelte in den Drähten, Kanten schabten wütend übers Geröll. Die Bagger schlenkerten ihre Beute durch die Luft, ließen sie dann fallen, zerknackten sie wie Knäckebrot zu Krümeln. Harter Regen fiel in gelbe, rostgeäderte Container. Lkws rollten mit den Kästen vom Schlachtfeld, pflügten beschwert davon durch den Schlamm.
In zwei Wochen ist hier nichts mehr, sagte Le Bertram. Dann sind auch die Heizkanäle aus dem Boden raus. Die ganze Straße ist dann weg. Dann wird der Rasen eingesät, sagte Le Bertram, und Gregor fragte sich, ob wirklich Bedauern aus ihm sprach oder doch eine Art Stolz, der solidarische Stolz des Handwerkers auf gute Arbeit.
Sie liefen den Bauzaun entlang. Ausgebaute Türen lehnten an Fichten im Schlamm; ein Vogelnest fror in der noch kahlen Erle. Über einen Stapel heimatloser Badewannen hinweg starrte eine Holzskulptur großäugig durchs Gitter.
Gregor sah die Graffiti auf den Mauern im Erdgeschoss, auf rostrote Kacheln gesprüht: BSG KOHLE. Sie waren die letzten Signale der Menschen, Notrufe aus dem Untergang, bevor die Gebäude sie abgeschüttelt hatten. Es hatte ihnen nichts geholfen. Jetzt nahmen die Menschen noch einmal Rache.
Le Bertram ignorierte die Dixiklos, stellte sich breitbeinig an den Zaun und riss die Hose auf. Judith plapperte, um das Plätschern nicht zu hören; sie sprach über Artenschutz, Diversität, die Stabilität von Ökosystemen. In der Zone seien die Häuser ausgewildert, wieder Fels geworden, endlich erweckt zu artgerechtem Dasein. Häuser, das zeige sich hier, könnten auch ohne den Menschen leben, stray houses, schlau und zäh wie Straßenhunde in Rumänien. Geschöpfe ihrer selbst, die keinen Menschen mehr brauchten; und das sei der Grund, weshalb die Menschen ihnen mit Ausrottung drohten.
Le Bertram las das Schild vor, das am Zaun hing: Bund-Land-Programm Stadtumbau Ost. Teilprogramm Rückbau. Für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen.
Noch auf der Umgehungsstraße Richtung Altstadt gab Le Bertram keine Ruhe. Aha, sagte er, als wäre es ihm gerade erst eingefallen, es gibt also lebenswerte Städte und lebensunwerte. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
*
Mit seinen Zwischenrufen hatte Le Bertram Judiths Vortrag über Zinnrodas Baudenkmale gestern und heute im Multimediasaal des Museums gesprengt. Insgeheim war Judith ihm dankbar gewesen dafür. Sie hatte Anekdoten erzählt, von der kursächsischen Postdistanzsäule aus dem Jahr 1730; vom mittelalterlichen Pulverturm, jetzt Sitz eines Sonnenstudios; von der Sankt-Markus-Kirche am Altstadtmarkt, 1446 als spätgotischer Backsteinbau mit Sakramentenhäuschen errichtet, später mit Turm und Anbauten im barockem Stil ergänzt. Sie hatte historische Aufnahmen gezeigt, vom stillgelegten Bahnhof aus dem Jahr 1880 mit Jugendstilelementen in der nachträglich angefügten Eingangshalle, von der baufälligen Greifen-Apotheke, dem ältesten Fachwerkhaus der Stadt. Sie war sich sicher, nichts vergessen zu haben.
Aufmunternd hatte sie die drei Rentner mit den zitternden Mundwinkeln angeschaut in der Hoffnung, auch sie könnten etwas beitragen. Doch die Veteranen schwiegen, ebenso wie das Touristenpaar, das sich pausenlos umsah, unschlüssig, in welcher Stadt es gelandet war. Schließlich hatte sie es mit Le Bertram versucht, der massig in der Ecke saß mit seinen verschränkten Armen, seinen Segelohren, der knorrigen Nase und der Dreitageglatze. Er hatte sie von oben bis unten gemustert und endlich zwischen den Zähnen hervorgepresst: Das sind Häuser, aber keine Architektur.
Die Stille, die seinen Worten folgte, beendete er selbst. Er sagte, dass ein Haus wie ein Ozeandampfer sein müsse, ein Auto, ein Flugzeug; ein Gefäß der Gesundheit, der Logik, Kühnheit und Vollkommenheit. Le Bertram pries die Sachlichkeit, die Primärformen, das Raster aus rechten Winkeln und geraden Linien. Sie seien Ausdruck freien menschlichen Schaffens, des Willens und der Energie. Der Mensch, der Geraden ziehe, beweise, dass er sich selbst begriffen habe und eintrete in die Ordnung. Stil sei das Gegenteil von Baukunst, sei frivol, schneide Grimassen in einer Welt, die Organisation, Werkzeuge, Mittel brauche. Ein Haus müsse praktisch sein wie eine Schreibmaschine, hatte Le Bertram gesagt, und Judith hatte sich gefragt, ob dieser Mann wohl tatsächlich noch eine Schreibmaschine besaß.
Im Museumscafé war er dann an ihren Tisch getreten, ein leeres Glas in der Hand. Sie schenkte ihm aus ihrer Bierflasche ein, so voll, dass er gezwungen war, stehen zu bleiben. Minutenlang starrte er auf den Schaum. Sie kommen sicher aus dem Westen, sagte er dann. Aus dem Norden, sagte Judith und lächelte.
Le Bertram stellte dann sein Bierglas vor ihr ab und redete in schleppendem Tonfall in die Ferne, eine Viertelstunde lang. Drei Tage später, als sie ihn Gregor vorstellte, klang ihre Begeisterung, als hätte sie ein seltenes Stück vom Flohmarkt erworben.
*
Im Biergarten am Fluss hatte Le Bertram seinen Plan des gewaltlosen Widerstands entwickelt. Die Leute würden erst wach, stimmte Judith zu, wenn es dem Weltkulturerbe an den Kragen gehe. Es sei wie beim Tierschutz: Wenn die Würfelnatter aussterbe, rege sich kein Händchen. Aber wenn der Eisbär auch nur einen Ton brauner werde, rolle gleich Greenpeace mit den Schneemobilen an.
Bald darauf rückten, in fiebrigen Nächten, die Freunde mit seinem Beamer zu den bedrängten Wohnblocks vor. Sie warfen Bilder berühmter Gebäude auf die bedrohten Mauern, vom Tempel Baal Schamin in Palmyra, vom Kloster Mar Elian in Karjatain, vom Tempel in Hatra bei Mossul, kurz bevor der Islamische Staat auch dort überall flächendeckend den Rückbau begann. Den Generator hatte Le Bertram in einer Lagerhalle seines abgewickelten Werks gefunden, zu der er sich beizeiten den Nachschlüssel verschafft hatte.
Drei Nächte lang standen sie mit dem Beamer an den verlassenen Blocks der Sophie-Moldenhauer-Straße 25–31. Sie aßen Bananen und Erdnüsse, warfen Kriegsverbrechen aus dem Nahen Osten an die Fassade. Sanftblauer Himmel legte sich auf den Beton, darin der Tempel von Palmyra, gekrönt von der weißen Rauchsäule und der schwarzgrauen, quellenden Wolke.
Gregor sah sich um, und in den umliegenden Blocks gingen die letzten Lichter aus.
*
Am Tag nach seiner Begegnung mit der Kapelle stellte Gregor bestürzt fest, dass es ihm plötzlich unangenehm war, mit Judith und Le Bertram in die Zone zu fahren. Er konnte sich nicht erklären, was ihm den Magen eng machte; unbehaglich stand er am Straßenrand, als die Freunde den Generator in den Volvo hievten. Weißt du nicht, welcher Tag heute ist, sagte Judith in sein langes Gesicht. Der zehnte März, sagte er abwartend. Aber hier drin, trumpfte sie auf und zeigte auf den Projektor, ist der elfte September.
In der Sophie-Moldenhauer-Straße 25–31 warf Le Bertram dann nach Einbruch der Dunkelheit den Beamer an. Auf der Fassade zerschellten die Boeings, wuchs der Feuerball, sprangen die schwarzen Silhouetten, klein wie Katzen, aus den schwarzen Fensterlöchern der Serie WK 72.