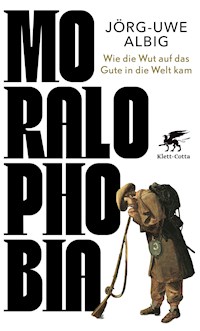15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Risikoscheu war Jörg-Uwe Albig als Schriftsteller noch nie." Richard Kämmerlings Jörg-Uwe Albigs Groteske entführt uns in die unendlichen Weiten des Spätkapitalismus, dorthin, wo sich Profitstreben und mentale Selbsterkundung gute Nacht sagen. Die tragische Heldin, Business-Coachin Katrin Perger, hat in jeder Hinsicht die richtigen Überzeugungen, doch beim Versuch, das System zu unterwandern macht sie sich zur Komplizin. Katrin Perger ist studierte Psychologin ohne Diplom. Ihre Abschlussarbeit "Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus" ist lediglich in Fragmenten auf einem linken Blog erschienen. Immerhin performt sie mit ihrem optimierungs- und motivationsbasierten Business-Coaching-Modell bei den Mittelständlern und Hidden Champions in Stuttgart und Umgebung nicht schlecht. Ihre neueste Kundin ist Sabine Seggle, die als Inhaberin des Dienstleisters Human Solutions ihren schwäbischen Unternehmerethos mit moderneren Management-Techniken auffrischen will. Katrin Perger findet heraus, dass das Geschäftsmodell von Human Solutions auf Entführungen beruht und sie angeheuert wurde, um tragfähige Lösungen für die "Kundenbindung" zu entwickeln – das Stockholm-Syndrom ist schließlich ihr Spezialgebiet. Zwar steht die Entführungsindustrie immer wieder in der Kritik, aber gilt das nicht auch für die Fleisch- und die Rüstungsindustrie? Und für einen Autozulieferer hat Perger sogar schon mal gearbeitet. Also was soll's.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Ähnliche
Jörg-Uwe Albig
Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER & RASP Kommunikation GmbH, München
Unter Verwendung eines Fotos von © gettyimages
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98416-3
E-Book: ISBN 978-3-608-12092-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Und vielleicht waren sie sich darüber klar,dass sie, wenn sie das Gefängnis schlecht ertrugen,es auch schlecht ertragen würden, daraus entlassen zu werden,weil sie sich schuldig fühlten.
Pauline Réage Rückkehr nach Roissy
Touristenfalle, brummte Herr Klein. Er war so schlecht gelaunt, dass ich mich schämte, erst für ihn und dann für mich. Er hätte die Schwindmühle in Trainach vorgezogen, zehn Kilometer entfernt, doch der Personalchef hatte gemahnt, von den Kosten her zu denken.
Das Hotel Forsthaus lag sechs Kilometer oberhalb von Bruckenschwang; ein dröhnender Bach und eine steile Auffahrt trennten uns vom Dorf. Während Herr Klein den Serviceplan durchging und telefonisch mit den Leihkräften von Reinboth Professionals die Modalitäten für das Housekeeping absprach, streifte ich durch den Ort. Ich starrte in die Schaufenster der Skigeschäfte. Ich stellte mir vor, ich könnte Ski laufen, braun gebrannt ins Tal gleiten, schneller als alle prüfenden Blicke. Dann lief ich keuchend, aber mit wachsender Geschwindigkeit, drei Kilometer den Wanderweg Nummer vier Richtung Schirfhorn hinauf. Ich atmete erst durch, als ich auf der Alm stand und das Dorf von oben sah.
Abends saß ich vor dem Zimmerfernseher. Die Abendschau des Bayerischen Rundfunks brachte einen Bericht über den Eröffnungsabend der Art Alpin. Ich hörte Ausschnitte der Auftaktrede des Regierungsrats für Erziehung, Kultur und Umweltschutz, sah das Interview mit dem Galeristen Franz Rottenegger, dem Mastermind der Messe. Mit Sonnenbrille, lachsfarbenem, um Mund und Kinn geschlungenem Chiffonschal saß ich vor dem Gerät, trank eine kostbare Limonade aus der Minibar und klatschte großzügig. Ich genoss das Gefühl, dass es auf meinen Beifall nicht ankam.
Halb wartete ich darauf, dass Sendmühl im Bild erschiene. Natürlich erschien er nicht. Natürlich war er schon bei der Preview gewesen, beim Vorglühen für den ausgewählten Kreis. Ich folgte der Kamera zur Koje von Zoigl Contemporary, bestaunte eine Installation aus Ballonseide, Ölkanistern und einer armamputierten Gipsfigur aus dem Gartenbaumarkt, schaltete auf einen Musikkanal um und den Ton stumm.
Das lautlose Wirbeln der tanzenden Körper machte mich müde. In dieser Nacht schlief ich so gut, dass ich am nächsten Morgen das Gefühl nicht loswurde, etwas vergessen zu haben.
Am Morgen war der Himmel weiß. Er sah aus wie ausgewaschener Stoff, Menschen und Dinge wie ausgeschnitten und auf einen neutralen Hintergrund geklebt. Ich war froh, dass das Weiß mein Gefühl für den Ort auslöschte. Dieser Ort konnte irgendwo sein. Er fühlte sich an wie ein Alibi.
Auf dem Weg zur Hütte, einer der Reinboth-Männer saß am Steuer des Jeeps, fühlte ich mich wieder verantwortlich für das Gespräch. Herr Klein starrte nur heldisch aus dem Seitenfenster, als wollte er die Landschaft bewundern oder bezwingen. Er sah aus, als wäre für ihn jeder Eröffnungssatz das Eingeständnis einer Niederlage gewesen.
Ich gab der Reise die Schuld für sein Schweigen. Dass Herr Klein nicht gern verreiste, hatte ich von Anfang an geahnt. Sein Kleidungsstil, seine unerschütterlich cognacfarbenen Budapester, seine konsequent beigefarbenen Slacks, seine entschieden hellblauen Hemden, seine Brille, randlos bis zur Unsichtbarkeit, zeigten sein Misstrauen gegen alles, was sich veränderte. Der Weg führte jetzt steil bergauf.
Der Reinboth-Mann, der uns fuhr, trug eine schwarz-rotkarierte Holzfällerjacke. Herr, begann ich und sah ihn auffordernd an. Bachmayr, ergänzte der Mann fast enttäuscht. Bachmayr, wiederholte ich und fragte ihn nach seinem Sternzeichen. Als er Fisch sagte und dann weiter schwieg, konnte ich nur noch nicken.
Wie gefällt es Ihnen denn so da oben auf der Location, fragte ich dann. Lässt sich dort arbeiten.
Schon, sagte Bachmayr.
Unbehaglich sah ich aus dem Fenster. Endlich fand auch Herr Klein Worte. Er sprach über das Haus im Schlickinger Moos, ein Fundstück seiner Frau. Die Frau war Steuerberaterin, mit einem Händchen für Immobilien. Man bleibt ja nicht ewig vierzig, sagte Herr Klein, während der Jeep den Forstweg verließ und einer schlammigen Schneise durch den Wald folgte. Und meine Frau, sagte Herr Klein in fast menschlichem Ton, träumt schon seit Jahren von einem Stall voller Hühner.
Auf dem Handy zeigte er mir ein Bild seiner Frau. Sie hatte selbst etwas von einem Huhn; den kleinen Kopf, den spitzen Mund, der direkt in den Hals überging. Wovon sie träumte, war nicht zu erkennen. Aber es musste ein Traum sein, der in Bodenhaltung ablief.
Es gibt ein großes Zimmer mit Nordlicht da draußen, ergänzte Herr Klein. Vielleicht komm ich dort endlich mal zu meinen Aquarellen.
Der Servicemanager sah mich an, als erwarte er ein Kompliment. Enttäuscht schaute er dann wieder in den Wald, auf die Stämme. Immer enger drängten sie sich aneinander, und Herr Klein zog den Kopf ein.
***
Als ich zum ersten Mal bei Human Solutions vorsprach, in Glimpflingen, eine gute Autostunde von Stuttgart entfernt, wusste ich nichts über die Firma. Ihr Online-Auftritt bestand aus nichts als dem blau-weißen Logo: die Initialen in Dauerrotation, das H, freundlich wie ein Mann in Latzhose, das neugierig fragende S. Ich fand keinen Link zur Produktpalette, keine Stellenangebote, keine Firmengeschichte, kein Wir über uns. Ich fand keine Erklärung der Mission, der Vision, der Werte. Die Seite war eine einzige Absage an das Internet, an die moderne Kommunikation.
Ich kannte die Fortschrittsskepsis dieser mittelständischen Betriebe. Ich kannte ihren Stolz auf die Tradition. Aber es war mir ohnehin egal. Für meine Arbeit war es ohne Belang, ob ein Betrieb Ölfässer reinigte oder Backteiglinge herstellte oder Finanzprodukte, die ich nicht verstand. Auch das Leben selbst kümmerte sich ja nicht darum, ob es durch einen Schornsteinfeger floss oder den Präsidenten der Ärztekammer, und ich hütete mich, allzu aufdringlich nachzufragen.
Ich kannte den Stolz der hidden champions auf ihre bequeme Randlage. Je kleiner die Öffentlichkeit, desto größer das Ansehen in der Branche. Das Versteck in der Nische sahen sie als Wettbewerbsvorteil, und ich wusste ja selbst, wie wichtig eine Nische war, in die niemand hineinschauen konnte.
Ich passierte die klobige Kirche, den fachwerkumkränzten Marktplatz, sprachlose Fünfziger-Jahre-Häuser mit Satteldächern und winzigen Fenstern, ein Bürgerhaus und eine Sidol-Tankstelle. Der Betrieb lag in einem Businesspark am Ortsrand, jenseits der Umgehungsstraße, zwischen Mais- und Sonnenblumenfeldern, Streuobstwiesen und einem Fußballplatz. Über den Flachdächern stieg die grüne Tribüne der Weinberge an, gesäumt von einem Schopf aus Wald.
Ich durchquerte den Businesspark, fuhr an fünf- bis sechsstöckigen Betonquadern mit horizontalen Fensterstreifen vorbei. Hinter den Fenstern standen niedrige Topfpflanzen, einmal auch eine rote Gießkanne. Ich sah eine Cafeteria mit Panoramafenstern, davor einen scharfkantigen Teich mit Schilf und Seerosen und einem Holzsteg, der auf eine kiesüberhäufte Insel führte. Junge Linden säumten die Wege, bewacht von kaum älteren Ahornbäumen. Es gab die üblichen Schilder, Straße A bis Straße E, Achtung Videoüberwachung und Betreten auf eigene Gefahr.
Wie in allen diesen Parks fand die Arbeit unsichtbar statt. Deutlich war allein die Ruhe der Anlage, die Leere zwischen den Gebäuden. Nur von Zeit zu Zeit fuhr irgendwo ein FedEx-Lieferwagen vor, tauchte irgendwo ein kleiner Mensch auf, stand rauchend vor einer Drehtür oder schnürte geduckt und hastig über einen Parkplatz. Zwei Männer strebten, mit einer Armlänge Abstand, an mir vorbei auf die Kantine zu; einer lachte, es klang wie eine Espressomaschine.
Es gab nichts zu sehen. Nicht einmal die Vögel aus den umliegenden Feldern ließen sich auf diesen Straßen blicken. Ich sah nackte Fassaden mit heruntergelassenen Rollläden, die das spärliche Sonnenlicht von den Bildschirmen abhalten sollten, und ich dachte an die Körper hinter diesen Fassaden, zwischen diesen Hydrokulturen, den Töpfen mit Bogenhanf und Efeutute und Röhrchen für die Feuchtigkeitsanzeige, den Wasserspendern, Getränkeautomaten und Kaffeemaschinen, ihren verzweifelten Rufen: Bitte entkalken! Bitte entkalken! An die Körper, beobachtet von ihren Displays, aufgelöst in Pixel, die sich jederzeit neu zusammensetzen ließen.
Ich war zehn Minuten zu früh dran, saß noch lange im Auto und starrte durch die Frontscheibe. Und ich dachte Gedanken, die wie Wolken schnell in weiche Fetzen zerrissen, auseinandergetrieben vom Wind, gehoben von thermischen Strömungen.
Human Solutions fand ich in Haus 18, zwischen Schill Memometrics und Kryonic Konsult. Frau Perger ist hier, sagte die Assistentin ins Telefon und nickte. Dann wandte sie sich wieder mir zu: Frau Seggle ist sofort bei Ihnen.
Was mir an Sabine Seggle zuerst auffiel, war ihr Laufschritt. Es war kein Gang, sondern ein Galopp, eine Art Hüpfen mit starkem Beckeneinsatz. Eine Mischung aus Kindlichkeit und Unerbittlichkeit lag darin, die sie gleichzeitig nutzen und vergessen zu wollen schien. Vielleicht lag es an diesem Laufschritt, dass ich sie am Anfang unterschätzte, vielleicht aber auch nur an dem ehrwürdigen Faxgerät, das auf einem Rollschrank hinter dem Empfangstresen thronte wie auf einem Altar.
Frau Perger, sagte sie. Ich grüße Sie. Mit ausgestreckter Hand kam sie auf mich zu, führte mich in ihr Büro und ließ mich dort stehen, unter den Dämmplatten an der Decke, im Licht der Neonkacheln. Sie selbst setzte sich auf den Drehstuhl, ordnete liebevoll drei Dokumente auf ihrem Schreibtisch, legte das unterste nach oben und das nun mittlere ganz nach unten. Dann schaute sie zu mir auf.
Ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt, sagte Frau Seggle.
Sind Sie jetzt enttäuscht, fragte ich flau.
Ganz und gar nicht, antwortete Frau Seggle und setzte ein Strahlen auf, das ich noch fürchten lernen sollte. Ich habe nur Angst gehabt, da kommt so eine Schönheit, die nichts kann als gut aussehen.
Machen Sie Ihren Mitarbeitern auch solche Komplimente, wollte ich zurückgeben. Dann sollten Sie sofort damit aufhören.
Aber ich sagte nur: Dann kanns ja losgehen.
In dieser knappen Stunde in Sabine Seggles Büro erfuhr ich so gut wie nichts. Wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen, fragte ich, und mit einem Grinsen sagte sie: fünfzig Prozent. Ihren Andeutungen konnte ich nicht einmal entnehmen, womit die Firma ihr Geld verdiente. Sagen wir so, sagte Frau Seggle. Wir vertreiben Waren mit hohem Servicebedarf. Wir beackern eine Nische, ergänzte sie, zugegeben. Aber in dieser Nische sind wir ganz weit vorn.
Was den eigentlichen Zweck der Firma betraf, hielt sie sich entschlossen zurück. Über die alltäglichen Arbeitsabläufe verlor sie kein Wort. Ein hochsensibler Geschäftszweig, verriet sie nur; alles beruht auf Diskretion, auf dem Vertrauen unserer Kunden. Sie werden verstehen, sagte Frau Seggle und schloss die Augen, als könnte sie damit auch meine Einblicke verhindern, meinen Blick auf das allzu deutliche Detail.
Wir wissen schon, was wir tun, sagte sie und nickte zur Bestätigung. Sie sollen uns nur sagen, wie wir es am besten tun.
Ich hörte die übliche Legende vom bodenständigen Familienunternehmen. Ich hörte das Märchen von Frau Seggles Großvater Konstantin, dem Firmengründer und Hobby-Archäologen, der nach dem Krieg mit einem einzigen hörgeschädigten Mitarbeiter in einer umgebauten Scheune die ersten Kunden betreut hatte. Von dem großen Jahr 1954, als er mit zwei Schulfreunden die Firma ins Leben rief, aus Liebe zum Handwerk, ohne große Technologie, aber mit viel Herzblut. Vom Jahr 1980, als ihr Vater Theodor das Geschäft übernahm, ein unzufriedener Idealist, der lieber Schriftsteller geworden wäre.
Eine Ausbildung im Betrieb, sagte Frau Seggle, kam für mich nie infrage. Als Lehrling in der eigenen Familie, sagte sie, wirst du entweder ausgebeutet oder liegst den ganzen Tag auf der faulen Haut. Stattdessen habe sie eine Banklehre absolviert, dann BWL studiert. Überhaupt sei sie eher zahlenaffin.
Vor elf Jahren habe sie die Firma schließlich übernommen. In letzter Minute, sagte sie. Weil sich die Branche gewandelt habe, sei der blauäugige Führungsstil des Vaters nicht mehr zu retten gewesen. Aber die Verantwortung habe der Vater nur zögerlich abgegeben. Frau Seggle wurde Assistentin der Geschäftsleitung, vier Jahre später Geschäftsführerin, zwei Jahre darauf alleinige Inhaberin des Unternehmens. Und auf Anraten eines jungen Mitarbeiters habe sie die Seggle GmbH dann in Human Solutions umbenannt.
Man hat mir gesagt, ich müsse mit der Zeit gehen, sagte Frau Seggle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da recht hatte.
Sie sah mich an, als müsste ich mich durch diese Banalität provoziert fühlen.
Aber jetzt wollen wir uns neu aufstellen, sagte sie dann und legte die Finger auf den Tisch wie auf eine Klaviertastatur.
Wollen Sie oder müssen Sie, fragte ich.
Touché, sagte sie und strahlte, als hätte sie nichts anderes erwartet.
Wie beiläufig erzählte Frau Seggle dann von dem wichtigen Kunden, der ihr abgesprungen sei. Ärgerlich, sagte sie. Keine Katastrophe, aber noch mal darf das nicht passieren.
Jetzt endlich bot sie mir einen Platz an. Vorsichtig, als könnte sie es sich gleich wieder anders überlegen, ließ ich mich auf den Stahlrohrsessel sinken. Vielleicht war ein Bewegungsmelder in diesen Sessel eingebaut, denn prompt kam eine Assistentin mit einem Tablett und stellte zwei Tassen Kaffee auf den Schreibtisch, ohne mich zu beachten. Sabine Seggle wiederum beachtete die Frau nicht, hob nicht einmal die Hände von der Tischplatte, um Platz für die Tassen zu schaffen. Offenbar hatte sie meine Irritation bemerkt, denn sie sah mich fragend an, als wäre mit mir etwas nicht in Ordnung.
Ich riss mich zusammen, zwang mich zum Lächeln und sah ihr in die blassblauen Augen. Was würden Sie an Ihrem Unternehmen ändern, fragte ich, wenn Sie zaubern könnten.
Frau Seggle überlegte. Ich hoffte jetzt doch, sie würde etwas von einer Kapitaldecke sagen, die zu strecken wäre, von einem Monopol für ihren Geschäftszweig, das sie ergattern wolle, von ihrem Management, das sich vielleicht gegen die Führungsetage von Microsoft austauschen ließe.
Stattdessen sagte sie: Ich möchte einfach nur in Ruhe meine Arbeit machen.
Wie abwesend fuhr sich Frau Seggle durch die langen, buchenholzblonden, geradezu kalifornisch gewellten Haare. Sie passten so gut zu dem blonden Kostüm, den blonden Pumps, dem blonden Schreibtisch, dass ich begann, mich wohlzufühlen in ihrem Büro. Ich war erleichtert, dass ich nicht nachbohren musste, dass ich meinem Grundsatz treu bleiben konnte: dass der Kunde nun mal König war und dass ein König eben durch das Geheimnis regierte, das Geheimnis seiner Macht.
Darauf können wir uns einigen, sagte ich.
***
Am 23. August 1973 betritt der entflohene Häftling Jan-Erik Olsson mit einer großen braunen Perücke, einer Brille aus dem Spielzeugladen, einem Koffer und einer geladenen Maschinenpistole die Zentrale der Sveriges Kreditbank am Stockholmer Norrmalmstorg und gibt mehrere Schüsse in die Decke ab. Olsson stellt ein Transistorradio auf den Schaltertresen, dreht den Regler auf volle Lautstärke und ruft: »Jetzt geht die Party los.« (Lang 1974)
Nach einer Umfrage aus dem Jahr 2017 werden 73 Prozent der deutschen Angestellten während der Arbeitszeit regelmäßig mit Musik beschallt. 82 Prozent der Mitarbeiter schreiben den Klängen eine produktivitätssteigernde Wirkung zu. 72 Prozent sagen, dass ihnen Musik dabei hilft, motiviert zu bleiben. 40 Prozent fühlen sich kreativer, wenn sie sich musikalisch begleiten lassen. 34 Prozent geben an, die Musik erhalte die Konzentration aufrecht. Als besonders motivierend wurde der Song »Welcome to the Jungle« von Guns N’ Roses empfunden, gefolgt von dem Toto-Hit »Africa« und »Wonderwall« von Oasis.
Olssons Satz »Jetzt geht die Party los« findet sein Echo im »Work hard, play hard« des individualisierten Kapitalismus. Das »Spiel« soll so »hart« sein wie die Arbeit, die es kompensieren soll, und verschmilzt so mit ihr. Es wird so allgegenwärtig wie die Tischtennisplatten und Flipperautomaten, die Billard- und Kickertische der Start-up-Kultur, die dem Angestellten seine ständige Verfügbarkeit, seine Überstunden und Unterbezahlung als Teil eines Party-Kontinuums schmackhaft machen sollen. Die Verschmelzung in der Härte macht Spiel und Arbeit so ununterscheidbar wie Schmerz und Lust in der sadomasochistischen Interaktion.
Wie beim Überfall auf die Stockholmer Kreditbank behauptet auch im Einzelhandel Musik die Unentrinnbarkeit und Unhinterfragbarkeit eines usurpatorischen Regimes. Der mentale Raum, in dem das Individuum vom Markt unabhängige Gedanken fassen könnte, wird durch Töne ausgefüllt. »Programmed music can be said to territorialize the Mall« (Sterne 2003): Musik teilt den öffentlichen Raum in ein freundliches Innen und ein feindliches Außen. Weil böse Menschen keine Lieder haben, ist dort, wo keine Musik herrscht, das Reich des Bösen. Das vermeintlich Gute wird vom Subjekt durch längere Verweildauer und verstärkte Konsumaktivität honoriert und macht so den Konsum selbst zur guten Tat.
Auch der Bankräuber Olsson orchestriert und legitimiert seine Geiselnahme konsequent mit Musik. Bei jeder Gelegenheit bringt er das Kofferradio zum Einsatz. Oft tanzt Olsson zu den Klängen aus dem Gerät. Manchmal singt er auch selbst. Besonders gern intoniert er Roberta Flacks »Killing Me Softly with His Song«. (Lang 1974)
Die Musik, die an jenen Tagen im August 1973 durch die Schalterhalle der Sveriges Kreditbank dröhnt, macht aus dem Überfall eine Aufforderung zum Tanz. Die Unterwerfung wird zur Geselligkeit, die Entmündigung eine Lizenz zum Amüsement. Die Musik bildet das Hintergrundgeräusch für eine psychosoziale Transformation, die einst unter dem Namen »Stockholm-Syndrom« in die Kriminalgeschichte eingehen wird.
***
Die Hütte stand in einer grasbewachsenen Senke knapp hinter der Baumgrenze. Vor der Tür, in die ein großes Herz eingraviert war, schlug ein kleiner, aber sehniger Mann mit einer Axt auf Holzscheite ein. Die Axt wirkte zu schwer für ihn, und nach jedem Schlag ließ er sie kraftlos auspendeln. Ich bin Katrin Perger, sagte ich und streckte meine Hand aus. Mit wem habe ich das Vergnügen.
Gursky, antwortete der Mann, warf die Axt zu Boden, und sein Gesicht zeigte ein unangenehm kleinliches Strahlen. Ich komm von Reinboth Professionals. Erleichtert hielt er uns die Hüttentür auf. Nach Ihnen, sagte Herr Klein, und gleich noch einmal: Nach Ihnen. Dann rieb er sich, bevor er das Innere betrat, auf der Matte die kaum beschmutzten Sohlen seiner Budapester ab und nieste.
Ich sah ihn an, und mir wurde klar, dass wir gemeinsam einen neuen Lebensabschnitt beschritten. Jetzt war ich froh, dass ich ihn besser kennengelernt hatte in den vergangenen Wochen. Ich hatte mich an seinen Seitenscheitel gewöhnt und an seine Haut, beide gleichermaßen qualitätsvoll gebräunt, und an seine fliederfarbenen Pullis, die Ärmel in sorgfältiger Lässigkeit um den Hals geschlungen, eine beiläufige, aber zuverlässige Umarmung. Und ich hatte mich an seine Marotte gewöhnt, wichtige Sätze zu wiederholen.
Jetzt standen wir in einem karg möblierten Raum. Rechts, in einer Art Herrgottswinkel, gruppierten sich Eckbank, Tisch und zwei rustikal gemeinte, aber blendend polierte Stühle unter einem Kruzifix. An der Decke hing eine Petroleumlampe, und für einen Moment war ich so sentimental, es schön und authentisch zu finden, dass es keinen Strom in der Hütte gab.
Übertrieben leise schloss der Reinboth-Mann die stahlverstärkte Eingangstür. Er griff in ein Regal, händigte Herrn Klein und mir die Masken aus und zog sich selbst wieder vor die Hütte zu seinem Holz zurück.
Es waren Schweißermasken aus elfenbeinfarbenem Leder, mit runden, schwarz getönten Augengläsern, über das Kinn bartartig verlängert. Meine Maske roch streng nach Tier. Ich setzte sie auf und kam mir fast nützlich vor, Gesellin eines ehrbaren Handwerks. Ich sah Herrn Klein an und musste feststellen, dass er mit seiner Maske wie ein Henker aussah. Ich konnte mir vorstellen, wie ich selbst mit meiner Maske wirkte, doch was ich mir nicht vorstellen konnte, war, von einer wie mir wirklich erschreckt zu sein.
Herrn Kleins Käferaugen starrten in meine, die sich von seinen in nichts unterschieden. Nur sein Rasierwasser, beißend und didaktisch, verriet noch die Persönlichkeit, die unter der Maske lag und die sich von meiner unterschied.
Dann wollen wir mal, sagte Herr Klein. Wir wollen mal. Ich sah die Muskeln, die sein Blauhemd spannten und für die er dreimal wöchentlich die 35 Kilometer von Biesenbronn ins Stuttgarter Gentleman’s Gym auf sich nahm, und folgte ihm ins Durchgangszimmer. Ich sah die Stockbetten für die Leihkräfte und am Ende des Raums eine Tür, die verschlossen war. Feierlich trat Herr Klein noch einen Schritt vor und schob mit penetranter Lautlosigkeit den Schlüssel ins Schloss.
Trotz meiner Maske schlug mir der Geruch ins Gesicht wie eine Ohrfeige. Es musste Sendmühls Parfum sein, das ganze maskuline Programm aus Tabak, Leder und Schrot. Jetzt, über Stunden komprimiert auf sechs Quadratmetern, explodierte es geradezu und drängte sogar Herrn Kleins angriffslustiges Rasierwasser aus dem Feld.
Frido von Sendmühl hockte auf seiner Pritsche und starrte mich finster an. Sein graues Gesicht, das seine Bartstoppeln noch grauer machten, sah aus, als hätte er keine Minute geschlafen. Er trug eins der rebellischen T-Shirts, die ich von den Fotos kannte, ich las den Aufdruck Limbic Front. Der metallicgraue Anzug war zerknittert, aber fast unversehrt. Nur die schlammbedeckten Hosenbeine, die verkrusteten Lackschuhe und das zerrissene linke Revers deuteten auf Missverständnisse mit den Servicekräften hin.
Herr Klein hielt es nicht für nötig, mich vorzustellen. Er nickte und verließ ohne ein Wort den Raum. Kurz darauf hörte ich von draußen auch wieder Gurskys quälend schleppende Axtschläge. Ich war mit Frido von Sendmühl sehr allein. Schweigend starrten wir uns an.
Das Schweigen war immer das Schlimmste. Aber ich hatte gelernt, es auszuhalten. Es führte kein Weg am Schweigen vorbei, ohne das Schweigen ließ sich nicht arbeiten. Ohne das Schweigen ließ niemand die Maske fallen. Im Schweigen wurde der Klient reif für den Prozess, für die Lösung.
Frau Seggle hatte mir nicht viel erzählt. Aber es war genug, um mich neugierig zu machen. Es brauchte nicht viel, um mich neugierig zu machen, und es reichte, dass sie Sendmühls Sammlung erwähnt hatte, die hochkarätigen Tildens, Bonobovskys und Martials. Sie hatte die adlige Kindheit auf der westfälischen Wasserburg erwähnt, die Schulzeit in der International School Wittlaer und dem Internat in den schwellenden Jurahügeln über Neuchâtel. Sie hatte von seiner Stiftung erzählt, dem Sendmühl Endowment for the Arts, von der Sendmühl-Akademie, der Sendmühl-Malschule für Kinder und Jugendliche, dem Sendmühl-Kunstpreis, den Stipendien für Jungkünstler und Jungkünstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie hatte von den jährlichen Treffen auf Burg Stuckrath berichtet, mit Out-of-the-Box-Denkern und Künstlern, mit Größen aus Wirtschaft und Politik. Sogar seine Geburt im Jahr 1971 klang aus ihrem Mund wie ein Verdienst.
Sie hatte von Sendmühls Familie erzählt, von seinem Vater Gero, dem legendären Kunsthändler, von seiner französischen Mutter Mathilde, zwölf Jahre lang Erste Liebhaberin an den Tübinger Kammerspielen, bis zu ihrem Tod Schirmherrin und Ehrenvorsitzende des Sendmühl Endowment for the Arts. Und von seinen Geschwistern, dem Kunsthistoriker Philipp, der Bauunternehmerin Sophie-Marie und dem Halbbruder Moritz, der mit 24 in irgendeinem Surferparadies verschollen war.
Auch ich hatte seitdem meine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte Zeitungsberichte durchkämmt, Homestorys, Interviews. Ich hatte Videos von öffentlichen Auftritten gesehen, Art Basel, Art Miami, FIAC Paris. Ich hatte die Fotos gesehen; Sendmühls schwere, lebensmüde Lider, die festen, freundlichen Bäckchen, die hängende Unterlippe, den Hund (Bildunterschrift: Auch Airedale-Terrier Toby genießt das Familienleben). Sendmühl mit seiner Ehefrau Geneviève, ihre röhrenförmig um das Gesicht gefönten Haarwellen, ihr fanatisches Kinn, ihre pyramidalen Augenbrauen. Sendmühl beim Tango mit Ricarda Born-Blitzenstein beim Benefizball für Terre des Chiens. Sendmühl am Steuer des karmesinroten Jaguars, wie gestrandet vor dem sommerlich gesträubten Weizenfeld, am Heck in asphaltlangem, passend rotem Kleid Geneviève, die so tat, als stünde sie zu ihrem Mann und schöbe das Gefährt auf die Bahn zurück.
Vor allem ein Foto war es, das mir Zuversicht gab: Sendmühl beim Spaziergang im elterlichen Rhododendronpark mit dem Vater, vor barocker Pastellkulisse, beide in eibengrünem Janker und eierschalenfarbener Hose. Die väterliche Rechte lag wie lenkend auf der linken Schulter des Sohns. Ich sah Sendmühls Quallenlächeln, die gefrorenen Lachfalten um die Stupsnase, und ich glaubte, schon in diesem Bild Anzeichen einer Wut zu finden, die ihn offenbar antrieb wie ein Propeller, die ihn schon weit durch die Welt getragen hatte und mit der sich sicherlich arbeiten ließ.
Ich sah auf die Uhr und beschloss nach sieben Minuten, das Schweigen zu brechen.
Herr von Sendmühl, sagte ich.
Fast hätte ich meine Stimme, gedämpft vom weichen Leder, selbst nicht mehr erkannt. Ich freue mich, sagte ich, dass wir jetzt zusammenarbeiten werden. Und Sie können sich denken, dass es nicht zuletzt von Ihnen abhängt, ob unsere Arbeit erfolgreich sein wird.
Sendmühl stemmte die Hände auf die Knie. Kraftlos sah er mich an. Nur seine Finger, die sich in die Hose krallten, zeigten seine Wut. Bringen Sie mich hier raus, sagte Sendmühl tonlos, und mit gepresster Stimme fügte er hinzu: Sie werden das hier so was von bereuen.
Jedes Verhalten, das war mir klar, ist in einem bestimmten Kontext ein sinnvolles Verhalten. Es ging nun darum, dass Sendmühl erkannte, wie dieser Kontext sich verändert hatte; in welchem Kontext er jetzt saß, drohte und zeterte, die Bartstoppeln sträubte und die Halsfalten spannte. Dann erst wäre er in der Lage, sein Verhalten zu ändern.
Sie haben sich also entschieden, Dinge, die Ihnen missfallen, nicht in sich reinzufressen, sondern offen auszusprechen, sagte ich durch meine Maske. Das ist schon mal ein guter Ansatz.
Sendmühl senkte den Kopf und grunzte verdruckst. Wollen Sie mich verarschen, sagte er und tat, als bemühte er sich weiter, seine Hände ruhig zu halten.
Sie sind enttäuscht, sagte ich. Das verstehe ich. Vielleicht sehen Sie das aber mal als Chance, Herr von Sendmühl, sich zu fragen, wie wir beide zu mehr gegenseitigem Vertrauen beitragen können.
Vertrauen, schnaufte Sendmühl. Zu wem soll ich denn hier Vertrauen haben.
Haben Sie das Gefühl, wir missbrauchen Ihr Vertrauen, Herr von Sendmühl, fragte ich. Vielleicht wäre das ein Ansatz. Vielleicht möchten Sie mit mir darüber sprechen. Vielleicht möchten Sie mit mir über Missbrauch sprechen.
***
Gleich am ersten Tag hatte mich Frau Seggle in die gemeinsame Cafeteria des Businessparks geführt, Resopaltische, umstellt von schwarzen, weißen und lindgrünen Plastikstühlen in Zweier-, Vierer- und Achtergruppen. Sie nahm Tagesgericht I, Schnitzel Wiener Art mit Kartoffeln und Erbsen, dazu Möhrensalat; ich entschied mich für Tagesgericht II, Rotbarsch mit Reis. Sie sah sich um und steuerte einen Vierertisch an, in der dunkelsten Ecke des Raums, weit weg von den Panoramafenstern, vom Blick über die Felder. Ergeben folgte ich ihr, das dreieckige Tablett vor der Brust.
Ich musste staunen, wie entschlossen sie auf dem Tisch Ordnung schuf. Alles, was sie störte, Salz- und Pfefferstreuer und das laminierte Programm der Russischen Woche, das in einem Metallhalter stand, schob sie von ihrer Tischseite auf meine hinüber. Beherzt zerteilte sie das Schnitzel, und die letzte Silbe ihres abgehackten Einen Guten verschmolz schon mit dem ersten Bissen.
Wie sind Sie eigentlich auf mich gestoßen, begann ich vorsichtig.
Persönliche Empfehlung, antwortete sie. Sie sah kurz vom Schnitzel auf, das, wie ich befremdet feststellte, die Form eines Menschenohrs hatte. In der Mittelstandsvereinigung erzählt man sich, Sie wirken Wunder.
Ich glaubte ihr kein Wort. Sie wissen, dass ich gelernte Familientherapeutin bin, sagte ich.
Belustigt sah Frau Seggle mich an. Dann drückte sie mit betonter Langsamkeit ein Zitronenviertel über ihrem Schnitzel aus. Kreiselnd ließ sie den Saft auf die Panade tropfen, und mitten beim Pressen sagte sie: Wir sind ja auch ein Familienunternehmen.
Ganz richtig, sagte ich. Ich ignorierte ihren Versuch, witzig zu sein. Lieber nahm ich ihr Stichwort auf. Sie sagen Familienunternehmen, sagte ich. Aber Ihre Firma gehört nicht nur einer Familie. Sie ist eine Familie.
Natürlich nickte Frau Seggle, und jetzt hatte ich sie, wo ich sie haben wollte. Ich bin hier, um Ihnen eine neue Sichtweise anzubieten, sagte ich.
Ich hörte mir selber dabei zu, wie fürsorglich ich sprach, wie ruhig, wie deutlich ich meine Konsonanten artikulierte. Wir, Sie und ich, wollen in den nächsten Wochen nicht an Ihrem Produkt arbeiten und nicht am Preis, sagte ich. Wir wollen an dem gesamten großen, pulsierenden Organismus arbeiten, der sich Firma nennt.
Frau Seggle sah mich so interessiert an, dass mir klar war, dass sie nichts begriff. Aber es war mir längst egal, ob die Klienten meinen Ansatz verstanden. Ich breitete ihn nur aus, damit sie wussten, dass es einen gab. Sie fühlten sich wohler in dem Gefühl, die Krankheit ihrer Firma wäre so außergewöhnlich, dass nur die ausgefallensten Rezepte anschlugen. Sie liebten das Gefühl, sie hätten auch noch im Wettbewerb der Probleme die Konkurrenz aus dem Feld geschlagen.
Sehen Sie, fuhr ich geduldig fort und nahm jetzt erst den ersten strategischen Bissen von meinem Rotbarsch. Jede Organisation ist letztlich aufgebaut wie eine Familie. Es gibt Vater und Mutter. Es gibt das artige und das schwierige Kind. Manchmal gibt es auch das missbrauchte Kind. Es gibt den dementen Großvater, die gutmütige Tante, den neidischen Onkel. Aber es gibt keinen Schuldigen. Nie ist ein Einzelner schuld, sondern immer das Gesamtsystem. Das System Familie. Diesem System kann keiner entkommen.
Frau Seggle sezierte ihr Schnitzel und ließ mich reden. Nicht mit sich ließ sie mich reden, sondern mit meinem Rotbarsch, und sie ließ mich merken, dass ich die Frau war, die mit toten Fischen sprach.
Aber das ist nicht alles, fuhr ich geduldig fort. Die Firma ist nicht nur ein System aus Personen. Sie ist selbst eine Person. Sie ist ein lebendiges Geschöpf, ein Körper, mit Organen, einem Kreislauf, Bedürfnissen und Wünschen. Ein physisches System und ein psychisches, wenn Sie so wollen, aus Es, Ich und Über-Ich.
Ich merkte, wie es mir half, nur noch mit dem Fisch zu reden. Es ist doch seltsam, sagte ich. Es gibt Betriebspsychologen. Aber die untersuchen Mitarbeiter, keine Betriebe. Warum interessiert sich keiner für die Neurosen einer Firma, ihre Scham und ihre Schuld, ihre Verdrängungen, ihre frühkindlichen Störungen. Warum interessiert sich keiner für ihre Eifersucht, ihre Güte, ihren ewigen Trotz. Warum schaut sich keiner den zwischenmenschlichen Raum an, die Spannung zwischen Subjekt und Objekt, das Spiegelbild, das sich zwischen Betrachter und Glasscheibe spannt und immer wieder verschwimmt.
Ich sah vom Fisch hoch und suchte ihre Augen. Ihre Augen aber suchten nur nach dem Salz. Als sie es gefunden hatte, puderte sie eine kräftige Prise auf den Rest ihres Schnitzels.
Was denkt die Firma, fragte ich sie, was geht in ihr vor. Was will sie vom Leben.
Frau Seggle sah mich belustigt an. Geld, sagte sie.
Geld, gut, sagte ich, entschlossen, nicht mehr lockerzulassen. Aber wovon träumt sie. Wofür wäre sie gerne berühmt.
Zum ersten Mal sah ich, wie Frau Seggle, die Schnelle, die Entschiedene, tatsächlich nachdachte. Sie spitzte die Lippen und überlegte, Messer und Gabel wie ein Kind senkrecht auf den Tisch gestellt. Die Firma glaubt an Werte, sagte sie schließlich.
Was sind das für Werte, fragte ich nach. Erfolg. Qualität. Kundenzufriedenheit. Fairness. Innovation.
Der Wert an sich, sagte Frau Seggle mit leiser Ungeduld. Der Wert des Menschen.
Sehr gut, sagte ich mit verkniffener Munterkeit. Und hier greift jetzt mein ganzheitlicher Ansatz.
Mein Gott, antwortete Frau Seggle. Sie sah mich an, als suchte sie nach einem Grinsen in meinem Gesicht. Dann aß sie weiter, schob die Erbsen an den Tellerrand und sagte: Ich hasse die Dinger.
Neidisch sah ich ihrer prächtigen Mahlzeit zu, ihrem pharaonischen Säbeln, ihrem Schaufeln und Schlingen, dem Schwung, mit dem sie sich Medium-Mineralwasser ins taillierte Glas goss. Als sie Schmeckts fragte, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass sie mir zuhörte.
Aber im Ernst, fuhr sie fort. Die Firma ist mein Leben. Ohne sie könnte ich nicht existieren.
Sie wandte sich dem Apfel-Möhrensalat zu, pflügte ihn um, mischte die bereits gründlich gemischten Späne noch einmal, als traute sie der Mischung nicht. Spöttisch prostete sie mir mit ihrem Medium-Mineralwasser zu, als hätte sie mich durchschaut, was wahrscheinlich der Wahrheit entsprach.
Weiß Ihre Firma, was Sie für sie empfinden, fragte ich. Lassen Sie Ihre Firma das spüren, Frau Seggle.
Frau Perger, sagte sie. Ich fange morgens um sieben Uhr mit der Arbeit an. Vor acht, neun Uhr abends komme ich nicht nach Hause. Und Sie fragen mich nach meinem Verhältnis zu meiner Firma.
Trotzig starrte sie auf die zerpflückten Reste ihres Möhrensalats.
Ich möchte Sie für den Gedanken gewinnen, dass die Firma Ihr Partner ist, sagte ich schnell. Gegensätze mögen am Anfang einer Beziehung noch anziehend wirken. Aber langfristig sind sie Gift für die Partnerschaft. Letztlich sehnen wir uns nach dem Gleichen im Gegenüber. Wir sehnen uns nach uns selbst.
Frau Seggle stand auf, um Kaffee zu holen.
Ich wartete und beobachtete einen Angestellten (Schill Memometrics? Kryonic Konsult?), der mit seinem Tablett, das bis hin zu meinem Platz nach Tagesgericht III roch (Jägerbraten, Spirelli, grüner Salat), demonstrativ suchend durch den Raum streifte und sich dann hinsetzte, als hätte er auch keine Einladung erwartet. In einer Sechsergruppe fiel mir ein Mann mit Sonnenbrille und lachsfarben geblümtem Hemd auf, der in der Runde kein Gehör fand und sich schließlich an seinen Nebenmann wandte, der sich nicht wehren konnte. Ich sah die Frau mit den bleich geschminkten Lippen und dem entrückten Lächeln, gefangen zwischen einem gelockten Dicken und einem kahlen Hageren, die erst offenbar ergebnislos auf sie einredeten und dann einander ins Visier nahmen, mit steigender Gewaltbereitschaft. Und ich sah den Mann im hellblauen Hemd, der den Kopf auf seine Arme gelegt hatte, weggetreten zum Power Nap.
Als Frau Seggle mit den beiden Tassen zurückkam, nahm ich den Faden wieder auf. Sie brauchen mir nicht zuzustimmen, sagte ich und setzte ein Lächeln auf. Ich lade Sie ein, mich an meinen Resultaten zu messen. Aber behalten Sie mein Modell ruhig einmal im Kopf. Vielleicht passiert dann etwas mit Ihnen.
Oder mit dem Modell, antwortete Frau Seggle.
***
Das Stockholm-Syndrom ist keine Krankheit. Es ist auch kein pathologischer Ausnahmefall. Nach Soskis und Ochberg (1982) entwickelt rund die Hälfte aller Opfer von Geiselnahmen das Stockholm-Syndrom. Da die Geiseln anschließend nicht immer gezielt auf das Syndrom hin befragt werden konnten, könnte der Anteil auch deutlich höher sein (Graham 1994).
Das Stockholm-Syndrom ist Normalität. Es ist die plausible Antwort auf eine Situation. Das Stockholm-Syndrom entspringt einem grundlegenden Ausstattungsmerkmal des Menschen: dem Willen zu überleben.
Das Stockholm-Syndrom reagiert auch auf die Unentrinnbarkeit eines Marktregimes, das wie die Stockholmer Bankräuber alle Fluchtwege blockiert hat. Der Markt hat die Liebe, die Freundschaft und das Abenteuer besetzt und so die Befreiungen obsolet gemacht, die Liebe, Freundschaft und Abenteuer versprechen. Er hat Lebensfunktionen wie Geburt und Tod, den Ruhm des Künstlers, die Forschungen des Wissenschaftlers und den Erfolg des Politikers unter seine Kontrolle gebracht. Von seiner Gnade, seiner Willkür von Angebot und Nachfrage, hängt die Verteilung von Lebensnotwendigkeiten wie Wasser, Luft und Erde ab. Er ist so allgegenwärtig, so selbstverständlich und natürlich, dass jede Vorstellung eines Lebens jenseits von ihm seine Insassen um ihr Leben und ihre psychische Integrität fürchten lässt.
»Ich fühlte mich oben im Haus wie in einem Aquarium«, schreibt das Entführungsopfer Natascha Kampusch über ihre Gefangenschaft. »Wie ein Fisch in einem zu kleinen Behälter, der sehnsüchtig nach draußen sieht, aber nicht aus dem Wasser springt, solange er in seinem Gefängnis noch überleben kann. Denn die Grenze zu überschreiten, bedeutet den sicheren Tod.« (Kampusch 2010)
Seit dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist auch für den Kapitalismus das Bild einer Außenwelt verschwunden. Der Verlust des Außen hat die Werte und Maßstäbe der Innenwelt zu absoluten gemacht. Die Weltsicht des Marktes gewinnt alleinige Deutungsmacht, an deren Koordinaten sich Ziele von Produzenten, Dienstleistern und Konsumenten orientieren. Die Anstrengung, die zur Erreichung dieser Ziele nötig ist, erzeugt die Illusion des freien Willens.
Wie die Bankräuber von Stockholm, die ein Gebäude mit Personenaustausch zur Außenwelt in ein homogenes Territorium verwandeln, in dem nur das Gesetz der Geiselnehmer gültig ist, annihiliert der Markt die öffentliche Sphäre. Er verstellt sämtliche Wege, alle realen und virtuellen Räume, alle Fluchtwege und Schlupflöcher mit Reklame. Alle potenziellen Transzendenzen und Transgressionen verklumpen zu Produkten. Noch im entlegensten Winkel der Welt liegt eine unzerstörbare Cola-Dose im Gras, ein unverweslicher Nike-Schuh. Dass die Insassen dieser ausweglosen Welt dann auch selbst Cola-Dosen und Nike-Schuhe haben wollen, ist schließlich kein Zeichen von Begehren mehr, sondern von Erschöpfung.