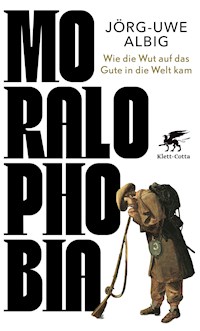
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein optimistisches Plädoyer für eine moralische Moderne Moral begegnet uns im Alltag, in der Politik, in der Gesellschaft. Doch über Moral wird häufig nur noch geschimpft. Bissig, mitreißend und klug argumentierend hält Jörg-Uwe Albig dagegen. Moralfeinde, die um ihre Privilegien bangen, hat es immer gegeben. In lebhaften Bildern schildert er ihre tragischen, mitunter skurrilen Kämpfe und zeigt, wie die Auflehnung gegen die Moral immer dann zu bremsen versuchte, wenn die Zivilisation einen Schritt nach vorne machte. Ein hochaktuelles, längst überfälliges Plädoyer für die Moral als notwendiger Motor des Fortschritts! In aktuellen Debatten um Klimapolitik, Geflüchtete bis hin zu Corona wird regelmäßig ein Schreckbild beschworen: das Gespenst des Moralismus. Jörg-Uwe Albig zeigt, dass die Klage über Moralisierung der Politik, »Gutmenschen« und »Moraldiktatur« nicht neu ist, sondern so alt wie die Jeremiaden über die Technik, die Massen oder die »Jugend von heute«. Doch ohne die Moralisierung der Politik hätte es keine Abschaffung von Sklaverei oder Folter gegeben, keine Ächtung von Eroberungskriegen oder der Prügelstrafe für Kinder. Der Autor deutet das Unbehagen an der Moral als Protest gegen den Zivilisationsprozess: Anhand historischer Moral-Rebellen von Götz von Berlichingen über Nietzsche bis Trump erzählt er die tragischen Kämpfe dieser Streiter gegen die Idee von Gut und Böse. Ein eindringlicher Appell, die Zukunft nicht jenseits von Moral, sondern nur mit deren Hilfe zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jörg-Uwe Albig
MORALOPHOBIA
Wie die Wut auf das Gute in die Welt kam
KLETT-COTTA
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung des Bildes »The Lost Cause« von Henry Mosler © Morris Museum of Art, Augusta, Georgia/Bridgeman Images
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-96585-8
E-Book ISBN 978-3-608-11915-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
1. Einleitung
»Widernatürliche Vereinbarungen der Menschen«
2. Götz von Berlichingen
»Wehe dem Jahrhundert, das dich von sich stieß!«
3. Niccolò Machiavelli
»Wer gut sein will, muss zugrunde gehen«
4. Marquis de Sade
»Ich meinte, alles müsse sich mir fügen«
5. Der Krieg für die Sklaverei
»Weil sie richtig und natürlich ist«
6. Friedrich Nietzsche
»Ach, dieser Schmutz der Seele zu zweien!«
7. Bertolt Brecht
»Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«
8. Arnold Gehlen
»Sich von den Institutionen konsumieren lassen«
9. Al Capone und Donald Trump
»Niemand nimmt die Dinge persönlicher als ich«
10. Schluss
»But I like living in the past«
1. Einleitung
»Widernatürliche Vereinbarungen der Menschen«
What’s so funny ’bout peace, love and understanding?
Nick Lowe
Es gab eine Zeit, da war die Revolte gegen die herrschende Moral eine wilde Sache. Sie sang »Love Me Tender« und ruckte und zuckte dabei so obszön mit den Hüften, dass das Fernsehen sie nur noch von der Taille aufwärts zeigen mochte. Sie trieb widernatürliche Unzucht mit Menschen des gleichen Geschlechts und erntete dafür Haftstrafen, trug lange Haare und bezog dafür Prügel. Später lungerte sie mit Gleichgesinnten und Gitarren in Fußgängerzonen, prostete schon morgens fleißigen Passanten mit Lambrusco zu. Dann wälzte sie sich in Kommunen gruppenweise übereinander, kiffte sich den Mandelkern aus dem Hirn und posierte kollektiv mit nacktem Hintern für die Sensationspresse.
Irgendwie sieht der Aufstand gegen die Moral heute anders aus als damals. Er ist nicht leiser geworden, aber grimmiger, grauer, gesetzter. Er trägt Tweedjackett, senffarbene Hosen oder die schwarze Kulturuniform. Er pflegt mit Hingabe seinen Sportwagen oder seinen Schrebergarten, weiß einen guten Barolo zu schätzen oder das hart verdiente Feierabendpils. Er schlägt schon auch mal über die Stränge, wenn es um unvernünftige Investitionen in einen BBQ-Hydra-900-Gartengrill geht oder ein Auto, das eigentlich zu groß ist für die Stadt. Aber im Allgemeinen hält er die Füße still, versteht nur manchmal lauthals die Welt nicht mehr.
Sein Protest ist keine Demo, aber auch kein Gesang, kein Tanz und keine Überschreitung. Er zeigt sich, je nach Temperament und Sozialstatus, in einem Naserümpfen, einem Murren, einem Grollen und Grummeln. Er fordert die Moral nicht heraus, sondern beschwert sich über sie – in spitzlippigen Aperçus über »Moralismus« und »Moralisierung«, in missbilligenden Komposita wie »Moralkeule«, »Moralprediger« und »Moralelite«, in der rasch gezeichneten, aber desto unverwüstlicheren Karikatur des »Gutmenschen«. Und in den zahllosen Büchern, die in den vergangenen Jahren – mal rechts, mal grün, mal links grundiert, aber immer in das erbitterte Kopfnicken einverständiger Leser hineingeschrieben – Normalität gegen Moralität ausspielen: »Die Moralfalle«, »Hypermoral«, »Die Diktatur der Moral«, »Erst die Fakten, dann die Moral«, »Kritik der Moralisierung« oder »Das sogenannt Gute. Zur Selbstmoralisierung der Meinungsmacht«. Oder, noch bündiger: »Keine Macht der Moral!«
Es sind Politiker genauso wie Taxifahrer, die diesen mürrischen Krieg führen. Es sind Schriftstellerinnen und Philosophen, Studienräte und Vertriebschefs, Rechtspopulistinnen und linke Klassenkämpfer, aber auch Stützen linksgrüner Milieus. Es sind Chefredakteure und deren Leser und Leserinnen, die sich in den Online-Portalen mit Kommentaren zu Wort melden. Es sieht aus, als wäre das Wort »Moral« bei ihnen zum Fluch verkommen, zur Beleidigung, zum five-letter word. Als wäre die Ethik zum Ekelobjekt geworden, etwas, das man nur ungern anfassen möchte, ein Gegenstand des Abscheus oder der Phobien, wie Spinnen oder Clowns.
Was ist passiert, das diesen Aufstand gegen die Moral erklären könnte? Hat »die Sitte« das Land wieder im Griff? Kommen neuerdings, wie noch in den 1960er Jahren, wieder Eltern vor Gericht, wenn der Freund der Teenager-Tochter über Nacht bleibt, oder wird die Wirtin bestraft, die ein Paar ohne Trauschein übernachten lässt? Ist wieder der Bikini verboten, wie an den Mittelmeerstränden der 1950er Jahre, oder der Minirock, wie bis in die 1970er Jahre in Schweizer Hotels, Zoos und Kirchen? Werden wieder, wie vor 1974, Abtreibungen umstandslos mit Gefängnis bestraft?
Tobt wieder der Bundestag wie noch 1970, als zum ersten Mal eine Frau in Hosen am Rednerpult stand? Hagelt es wieder Mord- und Bombendrohungen wie im selben Jahr, als eine Kandidatin der Spiel-Show »Wünsch dir was« in durchsichtiger Bluse vor die Kamera trat? Ist der Paragraph 175 wieder in Kraft, der bis 1994 »homosexuelle Handlungen« verbot und dessentwegen noch 1990 96 Bundesbürger verurteilt wurden und zehn im Gefängnis saßen?
Werden wieder junge Männer gegen ihren Willen in Kasernen gesperrt, wie vor der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011? Ist es wieder verboten, im Fernsehen »ficken« oder »Scheiße« zu sagen oder die Bundesrepublik Deutschland mit »BRD« abzukürzen, dieser »kommunistischen Agitationsformel« (Hans Karl Filbinger), die noch in den 1970er Jahren in Schulaufsätzen als Fehler angestrichen wurde?
Wahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall.
Wahrscheinlich war noch nie in Deutschland so viel erlaubt wie heute. Frauen dürfen, anders als in den 1960er Jahren, ohne Zustimmung des Ehemanns einen Beruf ergreifen und Verträge unterschreiben. In der Gastronomie gibt es, anders als vor nicht allzu langer Zeit, keine nächtlichen Sperrstunden mehr. Seit 1995 dürfen Jugendliche in Niedersachsen bei Kommunalwahlen wählen, seit einigen Jahren in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein auch bei Landtagswahlen, und bald sollen auch bundesweit 16-jährige an die Urnen gelassen werden. Seit 2017 dürfen alle erwachsenen Deutschen frei ihre Ehepartner wählen, unabhängig von deren Geschlecht, und seit Dezember 2018 auch ihre eigene sexuelle Identität. Sogar die Legalisierung von Cannabis steht unmittelbar bevor.
Eigentlich sieht es aus, als läge der Gipfel der Freiheit nur noch ein paar Serpentinen entfernt. Und ausgerechnet jetzt wittern gerade die, denen diese Bergtour zum Mount Selbstbestimmung immer eher zu schnell als zu langsam vorangegangen ist, überall nur noch »Verbotskultur«.
Denn wer heute gegen die »Diktatur der Moral« in den verdrossenen Widerstand geht, fordert in der Regel nicht mehr (einvernehmlichen) Sex, Drogen oder Rock’n’Roll. Er verlangt auch nicht, dass das Tanzverbot an Karfreitag fällt oder das Verbot, weggeworfene Lebensmittel aus Abfallcontainern zu klauben.
Meistens wünscht er sich nur zurück, was er zu wünschen gelernt hat. Er verteidigt lieb gewordene Privilegien – die er dann gar nicht unbedingt selbst wahrnehmen muss: Es genügt, dass sie Leuten wie ihm im Prinzip zustehen. Etwa das Recht, Frauen gegen deren Willen anzufassen (»Sex nur noch mit Zustimmung?«, fragte erschrocken die »Neue Zürcher Zeitung« noch im Mai 2021 auf ihrer Titelseite), mit »1000 ganz legalen Steuertricks« den Staat abzuzocken, öffentliche Erholungsfläche unter hässlichen Eigenheimen zu begraben, mit 250 und Lichthupe über die Autobahn zu brettern oder tonnenweise Kerosin in die Luft zu blasen.
Der Moral-Rebell des 21. Jahrhunderts sorgt sich um die Freiheit, Minderheiten zu verunglimpfen, Mitmenschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder mit einem bösen Virus anzustecken und, wenn man ihm auch diesen letzten Spaß noch nehmen will, mit Fackeln und Trommeln vor dem Fachwerkhaus einer Gesundheitsministerin aufzumarschieren.
Natürlich ist das ein Hohn auf die klassische Definition der Freiheit, wie sie die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 formuliert: »Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet.« Es ist eine geizige, eine kleinliche, eine missgünstige Freiheit, die nur für den Empörer selbst gelten soll. Eine Schrumpfform der Freiheit, die den einzigen kargen Genuss verfolgt, das Tafelsilber gewohnter Vorrechte zusammenzuhalten.
In diesem Zerrspiegel-Kabinett von Freiheit kann jeder sein eigener Diktator sein – der sich wie ein kleiner Putin, Erdoğan oder Orbán die »Einmischung« in seine »inneren Angelegenheiten« verbittet, wenn die Weltgemeinschaft einmal ganz unverbindlich die Menschenrechte aus dem Diplomatenkoffer kramt.
Nur selten geht es in den neuen Kulturkämpfen noch um das, was einmal »Selbstverwirklichung« hieß. Es geht nicht mehr um Rocklängen, Berufs- und Partnerwahl oder sexuelle Vorlieben. Niemand kritisiert Menschen für ihre Sehnsucht, sich zu erotischen Zwecken mit Scheiblettenkäse zu belegen. Niemanden geht das etwas an als diese Enthusiasten selbst, und deshalb würde ihnen auch der strammste Moralist nicht in diese Form der Freizeitgestaltung hineinreden.
Es geht vielmehr um Selbstbehauptung – gegen den Rest der Welt. Nicht um die Freiheit, über das eigene Leben frei zu verfügen – sondern um die Gewalt über das Leben anderer Leute, die unter dieser Freiheit dann zu leiden haben. Es geht nicht um das liberale Projekt, möglichst viele Rechte für möglichst viele Menschen zu garantieren, sondern um den libertären Narzissmus, möglichst umfassende Rechte für sich selbst und die eigene Gruppe zu konservieren – auf Kosten jener, die nicht kräftig, ungeniert oder zeitig genug zugegriffen haben.
Dabei geht die neue Moralskepsis nicht so weit, etwas zu riskieren. Misstrauisch zieht sie sich in die Reservate des gesunden Menschenverstands zurück. Ihre Sprüche und Schriften sind keine Herausforderungen des Hergebrachten wie Flauberts »Madame Bovary«, Baudelaires »Blumen des Bösen« oder Genets »Notre-Dame-des-Fleurs«, nicht einmal Wilhelm Buschs »Fromme Helene«. Sie rebelliert nicht gegen die Fesseln der Konvention, schüttelt nicht den Ballast traditioneller, überkommener Normen und Regeln ab. Im Gegenteil: Sie beklagt eine Moral, die lebt, die sich bewegt – und das offenbar schneller, als es die Kondition der Zurückgebliebenen erlaubt. Schwer atmend und gebeugt, eine Hand in der stechenden Seite, die andere fuchtelnd in der Luft, schimpft sie den enteilenden Sitten hinterher.
So wird die neue Skepsis gegen »Moralismus« und »Moralisierung« vor allem dann wach, wenn die Moral sich um Menschen kümmert, die bislang nicht besonders weit oben auf der Agenda gesellschaftlicher Anteilnahme standen. Wenn sie sich für Geflüchtete einsetzt (auch wenn es viele sind), missbrauchte Frauen (auch wenn sie Minirock tragen), Minderheiten (auch wenn ihre Sitten und Trachten dem Geschmack der Mehrheit nicht entsprechen) oder nachkommende Generationen (auch wenn sie noch nicht geboren sind).
Und so spukt das Schreckgespenst der »Moraldiktatur« durch eine Vielzahl aktueller Debatten – ob sie von Klimapolitik handeln oder #MeToo, von Seenotrettung im Mittelmeer oder geschlechterneutralen Toiletten.
Doch auch der Moralist hat seine Gestalt gewechselt. Früher galt als »Moralist« der ehrenwerte Zeitgenosse, der – wie etwa Pascal, Montaigne oder der Held von Erich Kästners Roman »Fabian« (Untertitel: »Die Geschichte eines Moralisten«) – die Sitten seiner Umgebung mit (wenn auch durchaus parteiischer) Neugier betrachtete oder begutachtete. Heute ist »Moralist« zum Schimpfwort für den bekennenden Veganer geworden oder die lästige Passantin, die sich über den Sportwagen auf dem Gehweg beschwert – ein anderes Wort für den »Gutmenschen«, die »Lifestyle-Linke«, die »Woko Haram«, den »virtue signaller«, den »social justice warrior«.
Und er hat neue, bevorzugt weibliche Inkarnationen gefunden wie Greta Thunberg, die Flüchtlingskomplizin Angela Merkel, die Seenot-Piratin Carola Rackete oder die gendernde Fernsehhexe Petra Gerster. Denn die Moral ist für die unwirschen Verteidiger des Abendlands seit jeher die Domäne der Frau. Und das Vordringen moralischer Fragen in das sachliche Herrenzimmer der Politik deshalb gleichbedeutend mit Verweiblichung – und mit deren Jahrhunderte altem Beigeschmack von Dekadenz.
Die »Kritik des Moralismus« der Philosophieprofessoren Christian Neuhäuser und Christian Seidel definiert den Moralismus unter anderem als »Kompetenzüberschreitung« (»Eine Person, die gar nicht zuständig oder kritikberechtigt ist, urteilt moralisch über andere oder übt moralische Kritik«). Manchmal trete er auch als »kategorial deplatziertes moralisches Urteil« auf, mit dem »etwas zu einer moralischen Angelegenheit aufgeladen wird, das keine moralische Angelegenheit ist«. Als Beispiel nennen sie Kunst oder internationale Politik.
Moral ist also etwas für Fachleute oder besondere Gelegenheiten. Und Moralismus liegt vor, wenn entweder der Falsche von Moral spricht oder der Richtige zum falschen Thema oder zur falschen Zeit. Er ist, so lässt sich zusammenfassen, Moral, wo sie nicht hingehört.
Moralismus ist also, entsprechend der Definition der Anthropologin Mary Douglas, Schmutz – nämlich »Materie am falschen Ort«. Er ist Unordnung, ja geradezu eine Ordnungswidrigkeit. Er ist unrein, hybrid, ungehörig und störend – ein Verstoß gegen die politische Hygiene, die sich um die pragmatische Sauberkeit etwa der Außenpolitik bemüht.
Diese Stoßrichtung der Moralkritik ist nicht neu. Sie ist mindestens so alt wie die Klagen über den Siegeszug der Technik, die Verflachung der Kultur, die dummen Massen oder die »Jugend von heute«. Sie ist so alt wie jene zeitlose Bitterkeit, die man »Kulturpessimismus« nennt – und so treffen sich in ihr die Anti-Moralisten des 21. Jahrhunderts mit Moralfeinden aus allen Epochen.
Schon die Sentenzen, die Plato in seinen Dialogen den griechischen Sophisten des fünften Jahrhunderts v. Chr. in den Mund legt, spielen das Recht des Stärkeren gegen die moralischen Normen aus: Egoismus, zitiert Plato zum Beispiel einen von ihnen (er heißt Kallikles), sei ein »Gesetz der Natur« – alles andere seien »widernatürliche Vereinbarungen der Menschen«.
Diese Kritik gilt demselben Feind, den später Friedrich Nietzsche, der wohl einflussreichste Moralhasser der Ideengeschichte, vor Augen hatte, als er 1881 seinen »Feldzug gegen die Moral« ankündigte. Sie richtet sich gegen die »Goldene Regel« (»Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst«), die zahllosen Philosophien vom alten China über Indien, Ägypten bis zum antiken Griechenland gemeinsam ist. Oder jenen banalen Satz, den Schopenhauer zum »Prinzip aller Moral« erklärte: »Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst.« Oder schlicht gegen das, was der Philosoph Rafael Capurro als »Moralität« definiert: »die freie Grundhaltung des Gutseinwollens«.
Doch genau diese naive, uncoole, selbstlose, universalistische Moral ist es, die weiten Teilen der Welt nach und nach den Abschied von Folter und Todesstrafe gebracht hat, von Sklaverei und Mord an neugeborenen Mädchen, von Duellen und der Prügelstrafe für Kinder, von Menschenopfern, Harems und Freak Shows, von Zwangsehen, Apartheid und der Verstümmelung der Füße chinesischer Frauen. Die es nach Tausenden Jahren Gemetzel endlich geschafft hat, Eroberungskriege wenigstens für illegal zu erklären – und so erst dem Eingreifen der Alliierten gegen Hitlers Expansion eine Grundlage gab. Die das Frauenwahlrecht und die Ehe für alle gebracht hat und dazu den zunehmend akzeptierten Konsens, dass Diskriminierung von Minderheiten unanständig ist. Und dass Menschenrechte gefälligst nicht nur für die eigenen Leute gelten sollten, sondern auch für den Rest der Welt.
Kurz: Es geht um die Moral als Ächtung der Gewalt – und als stetige Ausweitung des Feldes, das wir mit dem Wort »Gewalt« umreißen. Galten noch vor kurzem sogar die Hinrichtung, die Kopfnuss für den vorlauten Schüler oder der Schusswechsel im Morgengrauen als friedensstiftendes Verhalten, erstreckt sich heute die Definition von Gewalt auch auf ihre weniger handgreiflichen Formen wie Rassismus, Sexismus, Ausbeutung, Umweltzerstörung oder Auto-Terror.
Damit erhärtet sich ein Verdacht. Ist womöglich der Kleinkrieg gegen »Moral«, »Moralismus« und »Moralisieren« ein Rückzugsgefecht? Ist er vielleicht im Grunde nichts anderes als ein Protest gegen jenes Zusammenspiel von Aufklärung, Fortschritt und ständiger Überprüfung überkommener Gewissheiten, das wir »Moderne« nennen? Gegen das, was der Soziologe Norbert Elias in seinem gleichnamigen Klassiker als »Prozess der Zivilisation« definiert?
Denn auch für Elias ist die Zivilisation nicht so sehr Auto und Zentralheizung, sondern der lange Weg, auf dem die »Gewalttat langsam von der offenen Bühne des gesellschaftlichen Alltags zurücktritt«. In seinem Buch beschreibt er, wie vom elften Jahrhundert an die Menschen, unterstützt durch Aufklärung und Wissenschaft, aber vor allem durch Gewohnheit und Nachahmung, zunehmend ihre Impulse in den Griff bekommen.
Sie werden, kurz gesagt, das, was man nach heutigen Maßstäben »erwachsen« nennt. Sie bequemen sich dazu, auch die langfristigen Folgen ihrer Taten zu bedenken und die Gedanken und Gefühle anderer. Sie lernen Empathie, das probeweise Einnehmen fremder Standpunkte und Kooperation auch mit Menschen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören.
Dieser »Prozess der Zivilisation«, wie Elias ihn versteht, ist nicht, wie Leute mit einem heimlichen Faible für schwarze Pädagogik wohl unterstellen, das Ergebnis von Drill, von Dressur, von Triebunterdrückung durch ein Über-Ich oder andere Besserwisser. Er kennt keinen Mastermind, keine allmächtige harte Hand. Er ist auch kein besonders heroischer, sondern ein ganz pragmatischer, geradezu opportunistischer Vorgang – »eine aus der Verschränkung vieler Absichten hervorgehende, primär ungeplante, ziel- und zwecklose Veränderung der sozialen Standards der individuellen Selbststeuerung«.
Dieser Prozess unterdrückt keine Affekte, sondern baut neue, sinnvollere auf. Er erzwingt keinen Gehorsam, sondern kalibriert den allgemeinen »Standard des Triebhaushalts« nach – im Interesse des geschmeidigeren Zusammenlebens einer Tierart, die sich von Jahr zu Jahr enger aneinanderdrängt.
Er ähnelt darin der biologischen Evolution: Moral als Frage der fitness, der Passgenauigkeit mit einer Umwelt, die sich ja ebenfalls entwickelt. Der Unterschied ist nur, dass diese Evolution nicht neue Arten von Lebewesen hervorbringt, sondern neue Varianten menschlichen Verhaltens – Quantensprünge der Empathie, Revolutionen der gegenseitigen Rücksichtnahme.
Zwar ist an dieser Evolution, so Elias, auch die staatliche Zentralmacht nicht ganz unschuldig, die nach und nach das Gewaltmonopol an sich reißt – und damit ihren Untertanen die Lizenz entzieht, nach privatem Gutdünken andere zu verstümmeln, zu erniedrigen oder zu versklaven. Vor allem aber profitiert die Zivilisation, so erklärt es Elias, von der wachsenden Komplexität der Gesellschaft, ihrer zunehmenden Vernetzung: Je differenzierter die Arbeitsteilung, je enger verzahnt die gegenseitigen politischen, beruflichen, wirtschaftlichen und privaten Interessen und Verpflichtungen, je mehr die Menschen voneinander wissen und voneinander abhängen, desto fairer muss ihr Umgang miteinander werden, um noch einigermaßen reibungslos zu funktionieren.
Je beweglicher also Ideen und Menschen zirkulieren, desto gewaltfreier und rücksichtsvoller muss auf Dauer der Umgang der Leute werden, die dabei aufeinandertreffen. Dieser permanenten Migration der Einflüsse ist es dann beispielsweise zu verdanken, dass eine grausame, archaische Sitte wie Blutrache irgendwann nur noch in schwer zugänglichen Gegenden wie in Gebirgen oder auf Inseln überleben kann.
So folgt auf die Differenzierung der Gesellschaft fast automatisch eine Differenzierung des Gefühls. Und so entstehen, schreibt Elias, nicht nur immer humanere Normen, sondern auch immer neue »Veränderungen in der Modellierung des plastischen, psychischen Apparats«. Eine kontinuierliche Reform des kollektiven Begehrens, in deren Verlauf die Gewaltlosigkeit zur »zweiten Natur« wird.
Eine Evolution – die sich irgendwann so selbstverständlich in Köpfen und Körpern einnistet, dass sich der heutige Mensch schon gewaltig anstrengen muss, um die massenhafte Begeisterung bei einer Hinrichtung nachzuvollziehen. Oder den Jubel beim Anblick brennender Katzen, der bei den großen Volksbelustigungen im Paris des 16. Jahrhunderts zuverlässig das Publikum ergriffen hat: »Die Zuschauer, darunter Könige und Königinnen«, berichtet der britische Historiker Norman Davies, »quietschten vor Lachen, wenn die Tiere, die vor Schmerzen heulten, versengt, gebraten und schließlich verkohlt waren.«
Aber: »Die Zivilisation ist noch nicht abgeschlossen«, heißt es am Ende von Elias’ Buch. Und es ist auch kein Gesetz der Geschichte, dass es in ihrem Verlauf immer nur geradeaus geht. Die wachsende Vernetzung, von der Elias spricht, sorgt zwar dafür, dass auch Egoisten die Vorteile von Fairness und Rücksichtnahme irgendwann nicht mehr ignorieren. Aber Netze können auch dünn werden, Löcher kriegen und schließlich reißen.
»Atomisierung« hat Hannah Arendt diese Gefahr mit Blick auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg genannt. Menschen verwandeln sich unter einem solchen Trauma, das die Nervenbahnen der Gesellschaft zerreißt, »in eine unorganisierte, unstrukturierte Masse verzweifelter und hasserfüllter Individuen«. Die gesellschaftlichen Schichten driften auseinander, und wo Massen arbeitslos sind, braucht man keine Arbeitsteilung mehr. Das Gefühl wächst, die vormals verzahnten politischen, beruflichen, wirtschaftlichen und privaten Interessen nicht mehr miteinander aushandeln zu können, sondern nur noch gegeneinander.
In diesem Schockzustand schwindet die zivilisierende Bindungskraft der Moral. In ihrer Orientierungslosigkeit rebellieren die fragmentierten Massen, so Arendt, nicht nur gegen die Eliten, sondern auch gegen deren moralische Imperative, an denen die Elitären womöglich selbst scheitern – die »Heuchelei der guten Gesellschaft«. Und sie sind bereit, einem Volkstribun zu folgen, der sich, wie Hitler, die Verachtung der »Gutmeinenden« auf die Fahnen geschrieben hat: Ihm verzeihen sie seine Lügen und Betrügereien nicht nur, sondern sind sogar »stolz darauf, Führer zu haben, die so souverän andere Leute an der Nase herumzuführen« verstehen. Wir werden solchen Volkshelden der Unmoral auch in diesem Buch begegnen.
Der russische Überfall auf die Ukraine ist ein aktuelles Beispiel für einen Fall, bei dem sich Geschichte im Krebsgang bewegt. Der Zeitpunkt, da Elias sein Großwerk verfasste, fiel selbst in eine solche rückläufige Phase: In Deutschland gelangte Hitler an die Macht. In schwindelerregendem Tempo drehten die Nazis den Zivilisationsprozess um. Sie predigten wieder das Recht des Stärkeren, feierten die nackte Gewalt, die Macht des »Blutes« und eine Volksseele, die, wie Hitler forderte, »bewusst wieder zurückfindet zum primitiven Instinkt«.
Als die Nazis 1933 das Institut für Soziologie an der Frankfurter Universität schlossen, an dem Elias lehrte, ging er erst nach Paris und dann nach Großbritannien ins Exil. Der Verleger Fritz Karger publizierte den »Prozess«, obwohl es keine Aussicht gab, das Buch eines jüdischen Autoren in Deutschland zu verkaufen. Jahrelang zog Elias von Universität zu Universität, unterrichtete an Abendschulen und ließ sich zum Psychotherapeuten ausbilden, bis er an der Universität Leicester landete und dort bis zu seiner Pensionierung 1962 lehrte.
Erst 1981, neun Jahre vor seinem Tod, erschien die Studie des Politikwissenschaftlers Ted Robert Gurr, die Elias’ Arbeit eine völlig neue Relevanz verlieh: Gurr hatte Tötungsstatistiken in 30 verschiedenen Epochen englischer Geschichte verglichen und festgestellt, dass die Mordrate seit dem 13. Jahrhundert tatsächlich steil und stetig gefallen war. Mittlerweile ist »Der Prozess der Zivilisation« eins der einflussreichsten Werke der Soziologie.
2011 legte der Harvard-Psychologe Steven Pinker in einer 1200-seitigen Studie namens »Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit« noch umfangreicheres statistisches und historisches Material zur Entbrutalisierung der Welt nach: In dem Buch rechnet er vor, wie über die Jahrhunderte weltweit die Zahl der gewaltsamen Todesfälle zurückging, sich humanitäre Standards und Menschenrechte durchsetzten und die Bewohner der Welt sich mehr und mehr auf Kooperation und rationale Konfliktlösung verlegten. »Ihre Normen für alltägliches Verhalten«, fasst er zusammen, »wechselten von einer Machokultur der Ehre, in der Kränkungen mit Gewalt zu beantworten waren, zu einer Gentlemankultur der Würde, in der man Status gewann, indem man Anstand und Selbstkontrolle zur Schau stellte.«
Es wäre naiv zu erwarten, dass gewaltige, geradezu tektonische Prozesse wie der zivilisatorische Fortschritt ohne Rumpeln ablaufen. Wo das Recht des Stärkeren eingeschränkt, Privilegien planiert, Höflichkeit, Empathie und Kooperation eingefordert werden, bleibt für die, die dabei etwas zu verlieren haben, ein Gefühl der Kränkung zurück. Es gibt Niederlagen, Verletzungen und geknickte Egos. Es gibt den Jetlag, den das Überfliegen moralischer Zeitzonen erzeugt. Es gibt die sprichwörtlichen Reisen, bei denen die Seele nicht Schritt halten kann.
Dabei muss es nicht gleich ein manifestes Gefühl der Bedrohung sein, das den Widerstand auslöst. Oft genügt ein Unbehagen, eine Irritation, eine gefühlte Perforation der Komfortzone. Es genügt ein leiser Stress der Überforderung. Es ist wie bei einer Spinnenphobie, die als Anlass zur Panik nicht unbedingt die tödliche Brasilianische Wanderspinne braucht, sondern der auch eins der 97 Prozent völlig harmlosen Exemplare als Auslöser reicht. Die sogar schon anspringen kann, wenn die Freundin zerstreut mit krummen Fingern auf die Tischplatte trommelt.
Wie jede Phobie hat auch der Abscheu vor Moralität, »Moralismus« und »Moralisierung« einen zweckmäßigen Kern – und eine irrationale Ausprägung. Eine Phobie wie die Spinnenangst, sagen Wissenschaftler, habe dem Urmenschen geholfen, sich vor gefährlichen Tieren in Acht zu nehmen. Aber heutige Phobiker ziehen aus ihrem Nervenflattern nur noch wenig gesundheitlichen Nutzen.
Jeder Fortschritt hat seine Maschinenstürmer – zornige Beharrer wie die englischen »Ludditen«, von der Industrialisierung überrollte Handwerker, die im 18. und 19. Jahrhundert in gerechtem Zorn Wollschermaschinen, Strumpfwirkstühle und mechanische Sägemühlen zertrümmerten. Die Anti-Moralisten sind so etwas wie die Ludditen des Zivilisationsprozesses – immer in Gefahr, mitsamt dem verhassten Spinnapparat das ganze Stadtviertel abzufackeln.
Gegen das Flüssige, das Unberechenbare, das Immer-neu-zu-Verhandelnde, das den Zivilisationsprozess ausmacht, pochen sie auf das Dauerhafte, das Stabile, das Unveränderliche – die »menschliche Natur«, die Fakten, den ewigen Sachzwang. Dabei ist die Moralkritik alles andere als die »Realpolitik«, als die sie sich selbst gern darstellen will. Sie hat selbst einen irrationalen Kern. Sie ist das, was manche ihrer Vertreter besonders hitzig verteufeln: Identitätspolitik. Aber sie identifiziert sich nicht mit verachteten oder an den Rand gedrängten Gruppen, sondern mit historisch aufgeblähten Ich-Ideen, die vom Zerplatzen bedroht sind.





























