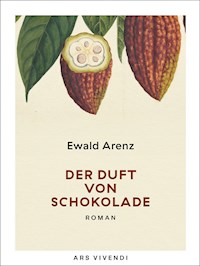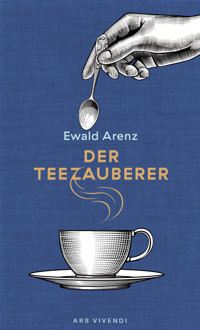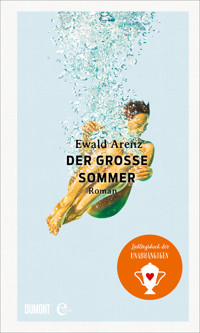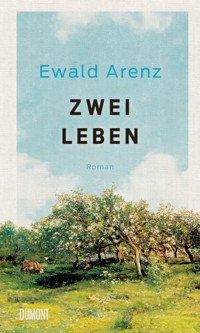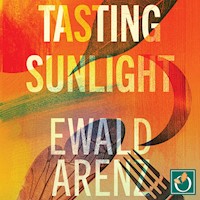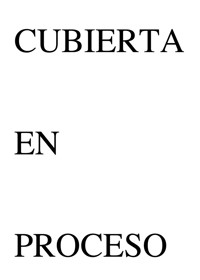Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schönsten Erzählungen von Bestsellerautor Ewald Arenz in einem Band. Über die Liebe, das Lesen und die Suche nach dem Glück: Ewald Arenz ist nicht nur ein gefeierter Romanautor, sondern schreibt auch herausragende Erzählungen. Dieser Band versammelt die besten davon in einem Band und bietet zudem neue, bisher unveröffentlichte Kurzgeschichten. Sprühender Witz, hintergründiger Humor, ein natürliches Talent für Atmosphäre und klassische Erzählkunst zeichnen Arenz' Texte aus, in denen er die Leserinnen und Leser u. a. mit dem Teezauberer und einem ganz besonderen Kurschatten bekannt macht, die Freuden eines flirrenden Sommertags entfaltet und den Traum vom richtigen Leben träumt. Ein idealer Begleiter für den Strandkorb und ein wunderbares Geschenkbuch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ewald Arenz
Eine Urlaubsliebe
Erzählungen
ars vivendi
Einige der Erzählungen wurden bereits in früheren Bänden bei ars vivendi veröffentlicht: »Bücherliebe« in Meine wunderbare Buchhandlung, hrsg. von Dirk Kruse, Cadolzburg 2010; »Tod in Venedig« in To die or not to die, hrsg. von Thomas Kastura, Cadolzburg 2014; »Der Traum vom richtigen Leben« in Mein Song, hrsg. von Steffen Radlmaier, Cadolzburg 2005. »Der Teezauberer« erschien als eigenständige Erzählung 2003.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage April 2020)
© 2020 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Covergestaltung: ars vivendi
Einbandfoto: © Jovana Rikalo / Trevillion Images
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0157-2
Eine Urlaubsliebe
Inhalt
Eine Urlaubsliebe
Bücherliebe
Mittsommerliebe
Tod in Venedig
Maryllis
Der Traum vom richtigen Leben
Der Teezauberer
Der Autor
Eine Urlaubsliebe
Es war einer dieser klaren Tage, die es im Herbst nur im Süden geben kann. Die Stadt war still geworden, die meisten Touristen waren längst wieder zu Hause, und allmählich gehörten die Straßencafés und die Strandpromenade wieder den Einheimischen. Im Hotel war es angenehm ruhig, selbst wenn man nicht so früh aufstand wie ich und der graubärtige Herr, den ich jeden Morgen um die gleiche Zeit durch die Lobby kommen sah. Ich nahm an, dass er Maler war oder vielleicht Filmregisseur oder etwas mit dem Theater zu tun hatte. Es war so eine künstlerische Aura um ihn und seine schöne Frau, die meist etwas später zum Frühstück kam.
Er trat aus der Tür und nahm sein Handy heraus, als der kleine streunende Hund, der vorhin an meinem Tisch gebettelt hatte, wie der Blitz zu ihm hinüberschoss und an seinem Bein hochsprang. Ganz offensichtlich schien er sich zu freuen. Der Mann sah etwas unsicher lächelnd auf ihn hinunter, weil er das zwar sehr nett fand, der Hund aber andererseits nicht aufhörte, sich zu freuen. Der Mann tätschelte beruhigend den Kopf des Hundes, was den aber nur zu verstärkter Freude zu ermuntern schien. Um genau zu sein, freute sich der Hund jetzt ausgiebig und recht heftig. Der Mann schüttelte zaghaft sein Bein. Er wollte dem Hund nicht wehtun. Er tat dem Hund nicht weh. Der Hund war ganz im Gegenteil begeistert davon, dass das Bein seine Liebe zu erwidern schien. Der Mann versuchte, auf seinem verbliebenen Bein das Gleichgewicht zu halten und dabei nicht wie ein Clown auszusehen. Es funktionierte nicht gut.
»Aus jetzt!«, befahl er dem Hund wenig energisch. Der Hund sah verständnislos auf und verdoppelte dann seine Anstrengungen. Das mochte daran liegen, dass es ein italienischer Hund war, der vermutlich kein Deutsch verstand. Ich verbarg mein Lächeln hinter der Zeitung. Der Mann sah zu mir herüber und hob in einer hilflosen Geste die Hand, woraufhin der Hund sofort zurückschreckte und sich leise winselnd duckte. Offensichtlich war er schon oft geschlagen worden. Dem graubärtigen Herrn tat das Missverständnis so leid, als wäre der Hund ein Mensch gewesen. Spontan kniete er sich hin und murmelte Beruhigendes, was ich von meinem Sessel in der Lobby aus nicht verstehen konnte, aber der Hund kam zögernd zurück und leckte ihm zaghaft die Hand. Es war eine sehr sympathische Szene, die ich aber trotzdem bald wieder vergessen hätte, wäre nicht die schöne, weißhaarige Dame gekommen, um mit ihrem Mann zu frühstücken. Sie sah ihn vor dem Hund knien und ihn streicheln und kam quer durch die Lobby.
»Hast du einen neuen Freund gefunden?«, fragte sie mit einer weichen Stimme, die gut zu ihrem eleganten Aussehen passte.
Der Mann richtete sich auf, deutete auf den Streuner und sagte, während er sich Hundehaare von der Hose klopfte:
»Na, es sieht eher aus, als hätte er einen neuen Freund gefunden. Er liebt mein rechtes Bein.«
Die Dame ging in die Knie und streichelte den Hund.
»Ein kluges Tier«, sagte sie, »ich mag deine Beine auch.«
Der Mann lächelte.
»Ich weiß. Am Geld kann es nämlich nicht gelegen haben. Komm, wir frühstücken.«
Der Hund musste auch das missverstanden haben, denn er begleitete die beiden zum Frühstückstisch und wich auch dann nicht von ihrer Seite, als er reichlich mit Brötchen, Schinken und Wurst gefüttert worden war und eigentlich hätte satt sein müssen. Es schien, als hätten sich da wahre Freunde gefunden. Ich faltete meine Zeitung zusammen und seufzte. Ich kannte das. Die übliche Tragödie der Urlaubsflirts. Eine Woche Glück, und dann kamen die Tränen, sobald man nach Hause musste. Auch wenn es bei mir meistens keine Hunde gewesen waren, mit denen ich schöne Urlaubstage verbracht hatte: Der Blick der schönen, weißhaarigen Frau war unverkennbar gewesen. Sie hatte sich verliebt.
Der September schritt fort. Über die schon etwas staubige Landschaft Apuliens war ein hoher, herbstlich blauer Himmel gespannt. Mittlerweile wartete der kleine Streuner schon immer in der Lobby auf das deutsche Paar, das nun auch jeden Morgen zusammen vom Zimmer kam. Er strich auch vorher nicht mehr um die anderen Tische herum; es war, als wüsste er, dass er schon zu seinem Frühstück gelangen würde, wenn denn erst seine neuen Freunde kamen. Einmal warf einer der Brotfahrer einen Stein nach ihm, um ihn vom Eingang des Hotels zu verjagen; er traf ihn hart am Rücken, und winselnd floh der kleine Hund um die Ecke, nur um dann, eine ganze Zeit lang später, ein wenig hinkend und vorsichtig an den Tisch des graubärtigen Herrn und der weißhaarigen Dame zu traben.
Als ich an diesem Tag von einem langen Spaziergang am Spätnachmittag ins Hotel zurückkehrte, passierte ich die Terrasse des deutschen Paares. Den Hund konnte ich nicht sehen, aber anscheinend lag er zu Füßen der beiden, die eben Kaffee tranken, denn das Gespräch schien sich um ihn zu drehen.
»Wir können ihn nicht mitnehmen«, erklärte der Mann geduldig, »ich weiß, wie sehr du ihn magst. Aber vielleicht darf ich dich daran erinnern, dass wir zu Hause bereits einen Hund haben.«
»Aber er ist verletzt«, antwortete die Frau mit ihrer weichen Stimme. Ihr Gesicht tauchte nach unten. Wohliges Knurren drang durch die Hecke. Vermutlich wurde eben ein Hund ausgiebig gestreichelt.
»Verletzt und ein Rüde«, gab der graubärtige Mann zu bedenken, »aber nur die Verletzungen heilen …«
»Hm«, kam es nachdenklich von unter dem Tisch, »ich weiß. Aber er ist so ein schöner Hund …«
»Frauenlogik!«, knurrte jetzt auch der Mann, aber es klang nur wenig unfreundlicher als das Knurren von unter dem Tisch. Ich ging melancholisch lächelnd weiter. So liefen diese Geschichten immer. Es machte den Reiz solcher Urlaubslieben aus, dass man sich vorstellte, wie es wäre, wenn sie eben nicht nach zwei Wochen zu Ende gingen. Die Unmöglichkeit der Zukunft gab der Gegenwart diese wunderbare, unvergleichliche Süße.
Vielleicht lag es an den allmorgendlichen Begegnungen, vielleicht daran, dass mich diese Geschichte an eine längst vergangene Sommerepisode aus meiner Jugend erinnerte, und vielleicht auch ein wenig daran, dass der Hund zuallererst an meinem Tisch gebettelt hatte, aber irgendwie nahm ich mehr Anteil an dieser Geschichte, als ich eigentlich vorgehabt hatte. Der Tag meiner Abreise kam näher, und auch die unvergleichlichen Farben Apuliens begannen durchsichtiger zu werden. Der Herbst war da. Am vorletzten Tag schließlich kam zum ersten Mal seit einer Woche der Mann wieder alleine zum Frühstück. Er sah übernächtigt aus, und vielleicht hatte er sich mit seiner Frau gestritten, denn er grüßte nur mürrisch in meine Richtung. Bevor er sich setzte, sah er sich um. Richtig. Jetzt bemerkte ich es auch. Der Hund war nicht da. Der Mann stand tatsächlich noch einmal auf und ging vor dem Hotel auf und ab, doch der Hund war nirgends zu sehen. Als er zurückkam, zuckte ich teilnehmend die Schultern.
»Vielleicht hat er einen anderen Frühstückstisch gefunden«, versuchte ich ihn mit einem Scherz zu trösten, wie es Fremde eben so tun. Der Mann schüttelte den Kopf. Auf einmal sah er sehr traurig aus.
»Er ist immer gekommen«, sagte er bestimmt, »vielleicht ist er überfahren worden. War meine Frau schon hier?«, fragte er dann übergangslos.
Ich war überrascht.
»Oh«, sagte ich, »nein. Ich dachte, sie wäre vielleicht noch im Zimmer.«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Nein«, sagte er knapp, »wir … wir haben uns gestritten. Wegen des Hundes. Wäre wohl gar nicht mehr nötig gewesen.«
Er deutete auf den leeren Platz unter seinem Tisch, wo sonst der Hund lag. Ich hätte gerne etwas Aufmunterndes gesagt, aber er hatte sich schon abgewandt und ging auf seinen Tisch zu. Zum Glück hatte ich schon gefrühstückt, und deshalb brach ich gleich jetzt zu meinem letzten Ausflug über Land auf. Ich hatte keine Lust, mir die Stimmung durch das unglückliche Ende einer Dreiecksbeziehung verderben zu lassen, von der ich nicht einmal ein aktiver Teil war.
Spät am Abend kam ich zurück und sah im Vorbeigehen halb erleichtert, halb bedauernd, dass die Stühle der Terrasse bereits aufgeräumt waren und der Tisch hochkant gestellt war. Das Paar war wohl schon abgereist. Unter dem Tisch stand eine vergessene Untertasse, in der noch immer etwas Wasser war. Auf eigenartige Weise rührte dieses kleine Überbleibsel einer besonderen Urlaubsliebe mein Herz an wie ein Lied aus halb vergessenen Zeiten, und an diesem Abend trank ich an der Bar mehr als sonst.
Am nächsten Tag kam ich später in die Lobby als sonst. Obwohl es Samstag war und damit ein Tag des Bettenwechsels, war es doch sehr ruhig im Frühstücksraum. Ich aß ein wenig Toast, las zerstreut ein wenig Zeitung und sah viel aus dem Fenster. Abschied, dachte ich. Aber dann sah ich zu meinem großen Erstaunen meinen bärtigen Freund, wie er das Auto vorfuhr. Seine schöne, weißhaarige Frau wartete mit den Koffern am Eingang. Ich zögerte kurz, aber dann stand ich doch auf, um hinauszugehen. Wenigstens verabschieden wollte ich mich von ihnen.
Irgendwie hatte ich ja mit ihnen gefühlt und war über sie zu einem entfernten Freund des kleinen Streuners geworden, der jetzt wohl irgendwo in einem Straßengraben lag. Ich trat zum Auto.
»Gute Reise!«, wünschte ich der Dame.
»Danke«, sagte sie mit ihrer weichen Stimme, die ich so warm fand.
»Ich … es tut mir leid wegen des Hundes«, sagte ich noch schnell und sehr verlegen.
»Ach«, sagte sie lächelnd und hob einen großen Weidenkäfig hoch, aus dem ein müdes, aber wohlbekanntes Winseln zu hören war, »es geht ihm schon viel besser!«
Ich war vollkommen verblüfft. Ihr Mann hatte jetzt geparkt und war ausgestiegen. Er sah vergnügt aus und sehr viel besser als am Tag zuvor.
»Aber«, stotterte ich, »ich dachte …?!? Sie nehmen ihn mit? Sie nehmen ihn wirklich mit?«
Der Mann sah mich lachend an.
»Ja!«, sagte er, »meine Frau hat ihn kastrieren lassen. Gestern, statt mit mir zu frühstücken. Ein hoher Preis«, grinste er plötzlich bübisch, »den die beiden da bezahlt haben, damit er ein Zuhause bekommt. Und meine Frau ihren Don Corleone!«
»Don Corleone«, lächelte ich und beugte mich vor, um noch einmal zu dem kleinen Hund hineinzusehen und mich von ihm zu verabschieden.
»Scheint, als ob alle Verletzungen heilten«, murmelte ich ihm ins Ohr.
»Wie bitte?«, fragte die Dame etwas überrascht.
»Nichts«, sagte ich, »gute Reise!«
Und dann ging ich zurück an meinen Tisch. Ich hatte plötzlich einen gewaltigen Hunger.
Bücherliebe
1
Es war ein Regentag im späten Frühling, ein leerer Samstagnachmittag. Sie wanderten ziellos durch verlassene Straßen und wurden ein bisschen nass, aber das machte gar nichts.
»Eigentlich«, sagte er zur Baroness, die seit über zehn Minuten mit einem Taschenschirm kämpfte, »kann man eine Stadt nur an verregneten Nachmittagen wirklich kennenlernen.«
»Ja«, sagte die Baroness trocken und fluchte über den Regenschirm, genauso wie den Geliebten. »Im Sommer ist nämlich alles schön. Es sind die trostlosen Regentage, an denen man weiß, ob man mit ihnen zurechtkommt.«
»Ihnen?«, erkundigte er sich vorsichtig. »Wen meinst du? Und warum die Mehrzahl?«
Die Baroness antwortete nicht, sondern war an eine Mülltonne herangetreten, hatte den Deckel geöffnet, hielt den Schirm darüber und teilte ihm ernst mit: »Das ist jetzt deine letzte Chance. Öffne dich.«
Der Schirm erkannte entweder die Gefahr nicht oder war der Ansicht, dass man für seine Überzeugungen sterben sollte. Er entfaltete sich auch diesmal nicht, als die Baroness den Knopf drückte.
»Na gut«, sagte sie knapp, »Tschüss für immer.«
Der Regenschirm fiel dumpf in die Tonne. Dann wandte sich die Baroness an ihren Begleiter.
»Die Stadt und den neuen Geliebten. Denn, wenn sie bei schlechtem Wetter nicht funktionieren …« Ihr Blick wanderte bedeutungsvoll zur Mülltonne.
Er musste lächeln.
»Mein Lieb’«, sagte er dann in gefasstem Ton, »ich bin nicht dein neuer Geliebter.«
»Das stimmt«, unterbrach sie ihn herzlos, »du bist alt!«
Er hob nun den Zeigefinger und sah streng aus: »Lass mich ausreden, undankbares Stück, das ich erst aus der Gosse auflesen musste …«
Die Baroness riss in gespielter Empörung Augen und Mund auf und heuchelte Fassungslosigkeit, aber dann musste sie lachen und hakte sich bei ihm unter. Er legte schnell den regennassen Zeigefinger erst auf seine, dann auf ihre Lippen. Ein Fernkuss. So war alles zwischen ihnen. Der Ton. Die Unterhaltungen. Die Namen und die Sprache. Die Baroness hatte natürlich einen bürgerlichen deutschen Namen, wie es sich für eine Studentin der Philosophie gehörte. Am Anfang war es so eine heimliche Liebe gewesen, von der keiner wissen durfte, daher kam es wohl, dass er »Peter« genannt wurde und sie »Baroness«. Vielleicht war es aber auch nur des Spielens und der Bücher wegen. Es war so eine Liebe, die sich vor allem aus der Sprache nährte. Wenn sie sich nicht hatten sehen können, hatten sie sich geschrieben. Hunderte von SMS. E-Mails. Chats. Er, dessen erste Verliebtheit in eine Zeit gefallen war, in der es das alles noch nicht gegeben hatte und man in erster Linie stundenlang in Telefonzellen gestanden war, um miteinander zu reden und zu schweigen, staunte manchmal darüber, wie sehr das geschriebene Wort wieder zum Träger von Liebe geworden war. Und aus der Kürze, die einem SMS aufzwangen, hatte sich eine Grammatik und ein Wortschatz ihrer Verliebtheit entwickelt, die sonst niemand verstand und die sie auch jetzt noch mit großer Lust am Spiel weiterführten. Manchmal konnte ihnen wirklich kein anderer mehr folgen.
»Mage mir?«, fragte die Baroness mit der ganz kleinen Mädchenstimme, über die sie durchaus auch verfügen konnte.
»Mond, Sterne, alles was duftet«, antwortete er liebevoll, aber etwas zerstreut, denn er hatte auf der anderen Straßenseite eine Buchhandlung entdeckt. In einer Buchhandlung hatten sie sich kennengelernt. Aber nicht deshalb ging er gerne in Buchhandlungen, sondern weil sie beide gerne Bücher kauften. Es regnete jetzt stärker. Die Baroness schien, nachdem sie den Schirm aufgegeben hatte, den Regen ignorieren zu wollen. Der Himmel war tief und grau; von den Dächern triefte es. Sein Kragen begann feucht zu werden.
»Da wäre eine Buchhandlung«, sagte er und versuchte, ihre Finger aus seinem Gürtel zu lösen, die sie soeben eingehakt hatte. Sie machte das manchmal und behauptete dann, sie sei festgewachsen und er könne sie nie mehr loswerden. Wenn er dann feierlich erklärte, dass das ja auch niemals seine Absicht gewesen sei, verzog sie das Gesicht und jammerte zufälligen Passanten weinerlich zu, dass der alte Mann sie gefesselt hätte.
»Bücher haben mich niemalen interessiert!«, sagte sie jetzt. »Dieweilen du die Bücher mehr liebst als mir. Aber bitte«, fügte sie dann hinzu, »geh du zu deinen Büchern und lass mir allein im Regen stehen. Es ist ja nicht so, dass ich auf dich angewiesen wäre.«
Sie machte allerdings keine Anstalten, den Gürtel loszulassen. Peter war bereit, den Gürtel aufzugeben und öffnete die Schnalle.
»Fang dir einen neuen Geliebten«, schlug er vor, »oder komm jetzt sofort mit. Es regnet, und du hast unseren Schirm weggeworfen. Du bist anstrengend, und ich werde nass.«
»Ich bin anstrengend, doch sehe ich gut aus«, korrigierte die Baroness in gehobenem Ton, aber dann gab sie nach und rannte über die Straße. Das Wasser spritzte, wo sie in Pfützen trat. Er musste wieder lächeln. Manchmal war sie ganz ernsthafte junge Dame, klug und schlagfertig, manchmal ein kleines, gedankenlos spielendes Mädchen. Er lief ihr nach, holte sie kurz vor den drei Stufen zum Eingang des Ladens ein und versuchte sie zu küssen. Die Baroness drehte sofort den Kopf weg und hob den Zeigefinger: »Wie oft wurde dir bereits erklärt, dass dieses unziemlich ist? Hm? Wie oft?«
Er wollte etwas Kluges antworten, aber der Regen nahm auf einmal zu und das Wasser begann, von den Dächern herabzustürzen, weil die Dachrinnen die Mengen nicht mehr fassen konnten.
»Lass mich rein!«, sagte er halb lachend, halb ärgerlich. »Ich bin schon klitschnass!«
Die Baroness gab lächelnd den Weg frei, und sie traten gemeinsam durch die Tür.
Im Buchladen waren jetzt, da es draußen in Strömen regnete, alle Regale in ein graues, diffuses Licht getaucht. Die Farben der Buchrücken waren um ein paar Nuancen gedämpft. Auf dem Holzboden lag in der Mitte des Raumes sogar ein richtiger Teppich, der allerdings hie und da Falten warf. Dann gab es ein paar Tischchen, auf denen nachlässig, aber nicht ohne ein Auge fürs Detail, Neuerscheinungen arrangiert waren, und es gab natürlich die Regale an den Wänden. Das heißt, es war anzunehmen, dass die Regale an Wänden standen, denn man sah diese nicht. Die Buchhandlung war wohl früher einmal eine herrschaftliche Wohnung gewesen, denn sie bestand aus drei oder vier großen Zimmern, durch die sich nun die Bücherwände zogen. Man konnte jetzt auch sehen, dass die hinteren Räume hohe Fenster hatten, die auf einen alten Garten hinausgingen. Es knarzte, wenn man ging; die Räume waren alle mit hundert Jahre altem Parkett ausgelegt. In einer Ecke stand etwas verschämt eine durchaus moderne Verkaufstheke mit einem leise summenden Computer und einer Kasse.
»Das«, sagte Peter beeindruckt, »ist aber nett hier.«
»Ja«, meinte die Baroness in lässigem Ton, »ist ganz okay«, was bedeutete, dass sie diese Buchhandlung auch mochte. Sie wollte eben ein Buch von einem der Tischchen nehmen, als aus dem Nebenzimmer eine körperlose Stimme ungnädig sagte: »Wenn Sie auch nur eines meiner Bücher mit Ihren regennassen Fingern berühren, fliegen Sie hier achtkantig raus.«
»Hoppla!«, sagte die Baroness überrascht und hielt inne. Sie und Peter sahen sich belustigt an. Er hob die Augenbrauen ein kleines Stück, sie drehte die Augen um ein Winziges nach oben – die kleinen Zeichen des gegenseitigen Verstehens, der gemeinsamen Verschworenheit der Verliebten gegen den Rest der Welt. Die Baroness wollte etwas sagen, wurde aber von der Stimme unterbrochen, die barsch befahl: »Bleiben Sie in der Mitte des Raumes stehen, tropfen Sie mir den Teppich nicht voll und versuchen Sie, möglichst still zu sein. Ich nehme an, dass nur der Regen Sie hier hereingetrieben hat und Sie wahrscheinlich das erste Mal in so einer Art Laden stehen. Meinetwegen können Sie den Regen abwarten, aber fassen Sie nichts an.«
Es lag jetzt mehr als Belustigung in dem Blick, den die beiden tauschten. Man hätte von ungläubiger Begeisterung sprechen können. Die Baroness grinste.
»Ich habe in meinem Leben bereits das eine oder andere Buch gekauft!«, rief Peter mit einiger Ironie in den nächsten Raum.
»Das mag sein«, kam es trocken zurück, »aber sicher nicht bei mir. Aus meiner Sicht sind Sie so nutzlos wie ein Analphabet.«
Die grünen Augen der Baroness weiteten sich vor Überraschung und Vergnügen.
»Der Mann scheint dich zu kennen«, flüsterte sie Peter boshaft zu, »und ich mag, wie er denkt. Er findet dich auch nutzlos. Wie er wohl aussieht?«
»Ich nehme an, wie Benito Mussolini«, flüsterte Peter zurück. Er musste auch grinsen.
»Ich habe das gehört«, kam die Stimme wieder, und dann knarrte das Parkett im Nebenzimmer. Da war jemand aufgestanden.
Die Baroness und Peter wechselten einen kurzen Blick und warteten. Der Mann, der aus dem anderen Raum kam, war hager und hatte einen dünnen Bart. Außerdem hielt er ein Glas Wein in der Hand. Er sah kein bisschen aus wie Mussolini.
»Ich sehe Mussolini nicht im Geringsten ähnlich!«, sagte er mürrisch und musterte Peter und die Baroness unfreundlich, aber doch ein wenig neugierig.
»Stimmt«, sagte die Baroness, »abgesehen von dem schwarzen Hemd sind Sie nicht so der charmante Verführer der Massen.«
Peter sah überrascht, dass es um die Mundwinkel des Buchhändlers kurz zuckte. Seine Stimme klang aber nicht weniger mürrisch, als er Peter mit einem abschätzigen Blick auf die Baroness boshaft fragte:
»Ist Ihre Beziehung zu der Dame eher karitativer Natur oder ist Ihre Verliebtheit auf fortgesetzten Alkoholmissbrauch zurückzuführen?«
Peter und die Baroness sahen sich diesmal komplett ungläubig an. Der Mann war von so atemberaubender Unverschämtheit, dass sie beide einen Augenblick lang nicht wussten, was sie sagen sollten.
Die Baroness fasste sich als Erste.
»Ich beginne zu verstehen, warum dieser Laden so leer ist«, sagte sie maliziös, »mal abgesehen von den etwa 10.000 Büchern, die wahrscheinlich noch viele Jahre in diesen Regalen lagern werden. Ist Ihnen das Prinzip eines Buchladens nicht klar, oder wollen Sie einfach keine Bücher verkaufen?«
Peter warf der Baroness einen halb bewundernden, halb besorgten Blick zu. Vielleicht war sie etwas zu weit gegangen. Er hatte keine Lust, hinausgeworfen zu werden. Es gab einen kleinen Augenblick der Stille. Draußen rauschte der Regen. An den Schaufensterscheiben liefen schmale Bäche hinunter und ließen die Außenwelt verschwimmen.
»Ich werde«, sagte der hagere Buchhändler nach einer Pause gelassen, während er sich zu einem der Regale umdrehte, »heute mit Sicherheit noch zwei Bücher verkaufen. Und zwar an Sie.«
»Ich will Sie nicht entmutigen«, sagte jetzt Peter, »aber selbst Ihnen müsste klar sein, dass Sie an einen Analphabeten keine Bücher verkaufen können! Vor allem nicht, wenn Sie den Analphabeten eben massiv beleidigt haben.«
Der Buchhändler lehnte sich gegen ein Regal, trank einen kleinen Schluck seines Weines und betrachtete die beiden. Die Baroness und Peter fühlten sich eindringlich gemustert, aber sie wollten sich auch nicht die Blöße geben, wegzusehen. Das gedämpfte Prasseln des Regens gab der Stimmung zwischen all diesen Büchern etwas von der Welt Abgeschiedenes, einen Hauch von Strenge, so, als sei man in ein Museum oder in eine Kirche geraten. Die Baroness betrachtete den Buchhändler und fand, dass er trotz seiner Unverschämtheiten nicht boshaft aussah. Er hatte etwas Ernstes. Vielleicht bekommt man das ganz von allein, dachte sie, wenn man sein Leben lang von Büchern umgeben ist. Da wandte der Mann sich an Peter und fragte gelassen:
»Sagen Sie, fürchten Sie nicht, dass Ihre kleine Geliebte einen so viel älteren Mann irgendwann satt hat? Wenn die Faszination für die intellektuelle Überlegenheit nachlässt …«
Peter sah, dass sich die Augen der Baroness einen winzigen Augenblick weiteten, als sie ihm ihr Gesicht zuwandte, wie um ihn ihrer Solidarität bei einer Antwort auf diese unglaubliche Unhöflichkeit zu versichern, aber er konnte trotzdem nicht sofort etwas sagen. Auf irgendeine Weise hatte ihn dieser Mensch mit seiner lächerlichen Bemerkung im Innersten getroffen. Es war, als hätte er diese kleine, geheime Furcht vor dem Alter, vor dem Versagen, vor der Schwierigkeit dieser Liebe zur Baroness sofort entdeckt und ans Licht gezerrt. Er holte tief Luft und versuchte, überlegen zu lächeln, aber da hatte sich der Buchhändler schon an die Baroness gewandt und genauso überheblich gefragt: »Und Sie, meine Liebe? Glauben Sie noch, dass Sie wirklich seine letzte große Liebe sein werden? Und dass Sie die Blicke der anderen immer aushalten werden? Oder dass Sie sich wirklich nie mehr verlieben werden? In einen anderen, jüngeren, frischeren Mann?«
Peters und der Baroness’ Blicke trafen sich. Er konnte sehen, dass sie genauso betroffen war wie er, und das wiederum verunsicherte ihn. Und es war ja so, dass ihn diese Bemerkung nicht weniger berührte als sie. Er konnte ja nicht sicher sein … vielleicht war es wirklich nicht die ganz große Liebe. Und wer wusste, wie es für sie war … sie sahen auf einmal beide weg.
»Wir müssen ja nicht hier sein«, sagte Peter und versuchte, gelassen zu klingen, aber es gelang nicht so ganz, als er die Baroness fragte: »Kommst du?«
»Das geht Sie nichts an!«, sagte sie fast gleichzeitig und scharf zu dem Buchhändler, der immer noch an seine Bücher gelehnt dastand, hager, leicht gekrümmt und mit wachen Augen hinter altmodisch spiegelnden Brillengläsern.
»Ich weiß«, sagte er, »ich weiß. Aber Sie. Kommen Sie mit!«
Er stieß sich leicht vom Regal ab und ging in den nächsten Raum seines Ladens. Peter und die Baroness folgten ihm nach einem kurzen Zögern. Es war, als sei plötzlich eine kleine Unsicherheit zwischen sie getreten. Peter wollte nach ihrer Hand greifen, aber sie machte – unabsichtlich oder nicht – gerade eine schnelle Bewegung, sodass er ins Leere fasste.
Der Buchhändler war an dem schmalen Regal zwischen den beiden hohen Fenstern stehen geblieben. Die große Weide im Garten triefte. Der Regen fiel so dicht, wie es nur ein Frühlingsregen kann: rauschend und so, dass alles Grün im Garten wie durch einen dichten Schleier zu leuchten schien. In dem hohen Raum wiederholte sich das Grün im dämmrigen Nachmittagslicht, das alle Konturen unsicher machte. Der Buchhändler war auf eine Trittleiter gestiegen und holte ein Buch aus einem der oberen Regale. Dann stieg er herab, ging sicher zwei Regale weiter und nahm auch dort ein Buch heraus.
»Das hier kann ich Ihnen heute empfehlen«, sagte er trocken, als er sich zu den beiden umdrehte. »Bitte!«
Er reichte der Baroness und Peter je ein Buch. Peter drehte seines um, sodass er den Titel lesen konnte. Und dann war er doch überrascht. Die Baroness, stand da in kühler Schrift über dem weißen Umschlag gedruckt, Roman.
»Ach nee«, sagte er einigermaßen beeindruckt. Dann sah er neugierig auf das Buch in der Hand der Baroness.
»Doch«, sagte sie, denn sie war wie immer etwas schneller gewesen und hatte seinen Titel schon gelesen, bevor er ihren hatte lesen können. Sie hielt das Buch hoch.
»Peter«, sagte sie, »Roman.« Halb ironisch, halb verunsichert fügte sie an: »Nett, hm?«
Sie ging dem Buchhändler hinterher, der schon wieder in den ersten Raum wechselte, wo die Verkaufstheke war.
»Wie haben Sie das gemacht?«, fragte die Baroness neugierig. »Das ist nicht schlecht. Wirklich nicht.«
»Er hat uns auf der Straße gehört«, sagte Peter hastiger als nötig, »bevor wir reingegangen sind.«
Der Buchhändler war jetzt hinter seiner Verkaufstheke, stellte das Glas Wein achtlos auf einem Prospekt ab und bückte sich nach einer Tüte.
»Was Sie da haben«, sagte er, als er mit zwei kleinen weißen Plastiktaschen wieder auftauchte, »ist der Lebensroman Ihres Geliebten. Oder Ihrer Geliebten. Von Anfang bis Ende. Das macht dann jeweils 19,80 Euro. Wenn Sie ihn haben wollen«, fügte er nach einer kleinen Pause noch an.
»Blödsinn«, sagte Peter, legte das Buch auf die Theke und sah zur Baroness hinüber.
»Sie müssen es nicht kaufen«, sagte der Buchhändler gelassen und streckte die Hand nach dem anderen Buch aus. Die Baroness zögerte einen kleinen Augenblick, dann reichte sie ihm das Buch hin und sagte:
»Doch. Ich finde das lustig. Obwohl es Quatsch ist. Los«, sagte sie, »sei kein Spielverderber! Nimm das Buch. Und bezahl alles!«
Peter lachte, als er das Portemonnaie herausnahm, aber so unbefangen wie sonst klang es nicht.
»Bisschen billig, so ein Trick!«, sagte er zu dem Buchhändler, der das Geld in Empfang nahm, in der Kasse kramte und dann herausgab.
»Viel Vergnügen beim Lesen«, erwiderte der hagere Mann aber völlig unbeeindruckt, und es klang so, als hätte er es in diesem Ton schon seit 20 Jahren zu jedem Kunden gesagt.
2
So abrupt, wie er begonnen hatte, hatte der Regen auch wieder aufgehört. Sie gingen auf der glänzenden, dampfenden Straße in die Stadt hinunter. Im Westen war der Himmel aufgerissen und die späte Nachmittagssonne herausgekommen. Es war ein unwirkliches Licht wie nach einem Gewitter.
»Er hat uns gehört«, sagte Peter nachdenklich, während sie nebeneinander hergingen, jeder mit seiner kleinen weißen Plastiktüte in der Hand.
»Ich weiß nicht«, sagte sie nach einer Weile, »hast du ›Baroness‹ zu mir gesagt?«
Er zuckte die Schultern. Dann nahm er das Buch noch einmal aus der Tüte.
»Naja«, sagte er dann, »Die Baroness. Wahrscheinlich gibt es hundert Romane, die so heißen.«
»Ja«, sagte die Baroness, »genau wie Peter.«
Sie waren auf der Brücke angelangt, wo sie sich immer trennten. In der Mitte, unter der Statue des Weltreisenden. Es hatte jetzt, zum Abend hin, richtig aufgeklart. Nur noch wenige Wolken wurden rasch über den Himmel getrieben, und auf einmal war eine kleine Fremdheit zwischen ihnen.
»Bis Dienstag dann«, sagte Peter.
»Bis Dienstag, alter Mann«, antwortete die Baroness lächelnd, aber Peter war sich nicht sicher, ob es so leicht klang wie sonst.
Als er durch den hellen Frühlingsabend nach Hause ging und wie nebenbei die Frühlingsgerüche von nassem Gras und blühenden Robinien in der klaren Luft wahrnahm, die vor einem Jahr zu ihrer allerersten Verliebtheit gehört hatten, ärgerte er sich auf einmal, dass sie in die Buchhandlung gegangen waren. Dieser unglaublich arrogante Mensch hatte ihnen den Tag verdorben. Er trat, plötzlich sehr wütend, nach einer Dose, die auf dem Gehsteig lag, blieb mit der Sohle hängen und stieß sich den Zeh. Fluchend über die eigene Dummheit und endgültig schlecht gelaunt, kam er zu Hause an.
Später, als er am offenen Fenster saß, in einer seltsamen Mischung aus Wehmut und Ärger in den Abend sah und ihm immer wieder Bilder der Baroness dazwischenkamen, dachte er nach. Was war es denn eigentlich gewesen? Zwei Worte eines unfreundlichen, arroganten und mehr als indiskreten Buchhändlers, der seine Bücher verkaufen wollte. Aber noch als er das dachte, wusste er schon, dass das nicht stimmte. Es war einfach so, dass der Mann es so genau getroffen hatte. Seine geheimen Ängste und Gedanken. Seltsam. Peter straffte sich und sah aus dem Fenster über die Stadt. Allmählich wurde es ganz dunkel und überall gingen die Lichter an. Eigentlich sah es so friedlich aus, wenn man über die Dächer sah. Aber er war unruhig. In solchen Augenblicken war auf einmal alles unsicher und düster. Was tat er mit seinem Leben? Und was tat er mit dem Leben der Baroness? War es wirklich so, dass sie sich selbst – und damit den anderen – belogen? Er trommelte mit den Fingern unruhig auf die Fensterbank, dann drehte er sich kurz entschlossen um und holte das Buch aus der weißen Tüte, die er auf den Tisch gelegt hatte, als er nach Hause gekommen war. Dann ging er wieder ans Fenster.
»Die Baroness«, las er den Titel noch einmal. Das hatte er schon geschickt gemacht, dieser Buchhändler. Peter wog das Buch in der Hand. Ihr Leben sollte darin stehen, hatte er behauptet. Was für ein Blödsinn! Er schlug es aufs Geratewohl auf und las:
»Sie sah ihm hinterher und ärgerte sich nicht zum ersten Mal über das braun-rot karierte Jackett, das er schon vor Jahren hätte wegwerfen sollen.«
Peter hielt inne. Ein eigenartiges Gefühl war da plötzlich in ihm; so ein Gefühl, wie man es von nächtlichen Spaziergängen kennt, wenn man auf einmal merkt, dass da jemand hinter einem geht. Wie weit konnten Zufälle gehen? Er hatte ein braun-rot kariertes Jackett. Er konnte sich gerade nicht erinnern, ob er es schon jemals angehabt hatte, wenn er die Baroness gesehen hatte, aber er hatte eines, und so, wie er sie kannte, würde es ihr nicht gefallen. Verunsichert wog er das Buch in der Hand. Zufall? Wie viele braun-rot karierte Durchschnittsjacketts gab es in der Welt? Er schlug es ein ganzes Stück weiter vorne auf und las:
»Die Strömung im Fluss war viel stärker, als sie gedacht hatte. Sie gab sich Mühe, nicht in Panik zu geraten und schwamm in gleichmäßigen, kraftvollen Zügen, aber sie sah am vorbeiziehenden Ufer, wie schnell sie abgetrieben wurde. Die Doppelspitze des Doms verschwand allmählich, als unter der Brücke der Lastkahn auftauchte …«
Er hielt das Buch geöffnet in der Hand. Das sonderbare Gefühl der Beklemmung war jetzt noch stärker. Er erinnerte sich an einen Tag, an dem sie auf einer Brücke gestanden waren, Hand in Hand, und ins Wasser gesehen hatten und die Baroness auf einmal leichthin gesagt hatte: »Soll ich dir erzählen, wie ich einmal fast ertrunken bin?«
Und sie war in Köln aufgewachsen. Am Rhein. Peter zwang sich zur Vernunft. Es gab auch in anderen Städten einen Dom. Jeder war schon einmal fast ertrunken, weil er leichtsinnig im Meer oder im Fluss geschwommen war. Zufall. Koinzidenz. Natürlich setzte er jetzt alles in Beziehung zur Baroness, weil der Buchhändler behauptet hatte, in dem Buch stehe ihr Leben. Trotzig blätterte er fast bis zum Schluss und las:
»Der Friedhof war voller blühender Bäume und der kühle Aprilwind bewegte die jungen Blätter wie …«
Erschrocken, hastig und mit einem Gefühl wie von plötzlicher Scham klappte er das Buch zu. Wenn, nur einfach mal so gedacht, wenn in dem Buch wirklich ihr Leben stand, wollte er dann wissen, in welchem April es endete? Wollte er das wirklich wissen? Wollte er wissen, was mit ihnen beiden geschah? Wollte er wissen, was ihre Zukunft war und seine, so lange sie mit ihm war, und schließlich: Ob es überhaupt eine gemeinsame Zukunft gab?
Es war jetzt ganz Nacht geworden. Neumond, und der Himmel schwarz. Peter löschte das Licht und stand im Dunkeln, immer noch das Buch in der Hand. Las sie gerade sein Leben? Sie war so neugierig … Und er? Sollte er wissen, was mit ihr geschah? Und was geschehen war? All die kleinen Geheimnisse, die man so hat? Die vergangenen Geliebten, die alten, nur halb vergessenen Lieben? Die Sehnsüchte, die nichts mit einem selbst zu tun hatten? Und wenn sie es las, sollte er dann nicht auch alles über sie wissen? Es würde alle Unsicherheit wegnehmen, die da manchmal zwischen ihnen war. Und er würde wissen, ob sie wirklich liebte. Er müsste ja vielleicht nicht alles lesen. Nur die Kapitel, die ihn angingen. Ob sie las? Ob sie der Versuchung widerstehen würde, und ob sie es überhaupt wollte? Er überlegte, ob er sie anrufen solle, aber dann blieb er doch einfach am Fenster stehen und sah in die Nacht. Irgendwie konnte er jetzt nicht mit ihr sprechen. Er spielte unentschlossen mit dem Buch. Die Baroness. Roman. Dann, mit plötzlicher Entschlossenheit, warf er das Fenster zu und machte in der ganzen Wohnung Licht.
3
Im Sonnenlicht eines richtigen Frühlingstages hatte der Buchladen nicht mehr Zauber als ein Buchladen eben hat, aber dafür sah er jetzt viel freundlicher aus als noch vor drei Tagen. Der alte Parkettboden leuchtete dort, wo die Sonne durch die Fenster hereinfiel, und wie in allen Buchläden glitzerte der Staub in den Lichtbahnen. Die Tür war offen gestanden, als Peter eingetreten war, und so lag der typische Geruch jedes Buchladens nach Papier und ein wenig nach Leinen von den Buchrücken neben den Blütengerüchen von draußen nur wie eine Erinnerung in der Luft. Peter stand in der Mitte des Raumes, hatte das Buch in der Hand und wusste nicht genau, wie er sich fühlen sollte. Es war kein sehr schönes Wochenende gewesen. Sie hatten nicht einmal telefoniert, es war, als hätten die beiden Bücher ihnen mit einem Mal die Sprache genommen. Er hatte die Baroness nicht anrufen können; eigentlich wusste er selbst nicht, wieso. Aber drei Tage Schweigen – das hatten sie bisher noch nie gehabt.
Wieder war der Besitzer nicht zu sehen, und Peter trat ziellos zu den Regalen und sah sich die Bücher an, die dort standen. Die Klassiker in Leinenbindung hier: Goethe, Hesse, Schiller, Mann. Im Regal daneben die leuchtend bunten Taschenbücher mit modernen Titeln wie Seide, Schnee oder Tausend Sachen, die man bei Frauen falsch machen kann! Peter verzog den Mund zu einem halben Lächeln. Davon kannte er auch ein paar. Unschlüssig streifte er zwischen Regalen und Tischchen hin und her, nahm mal dieses, mal jenes Buch auf und wartete höflich, dass sich der Ladenbesitzer zeigte.
»Ach«, kam es aus der Tür zum Nebenzimmer, »sehen Sie, Sie sind doch wiedergekommen.«
Der Ladenbesitzer hatte diesmal kein Glas Wein, sondern eine ziemlich gebraucht aussehende, sehr große Kaffeetasse in der Hand, aus der er angelegentlich einen Schluck nahm, bevor er boshaft fragte:
»Ist meine böse Kundenfangstrategie aufgegangen? Wollen Sie jetzt doch Bücher bei mir kaufen?«
Peter antwortete nicht gleich, sondern sah den Mann sehr aufmerksam an.
»Nein«, sagte er dann langsam, »eigentlich wollte ich kein Buch kaufen. Ich wollte wissen …« Er hob das Buch, das er die ganze Zeit in der Hand gehalten und das ihn drei Tage lang gequält hatte, »… ich will eigentlich nur … also, was ich wirklich wissen will, ist …«
Der Buchhändler unterbrach ihn.
»Beim letzten Besuch haben Sie viel mehr geredet. Was für eine heilsame Kraft Literatur doch haben kann. Also, was genau wollen Sie wissen?«
»Na, das würde auch mich interessieren«, kam es vom Eingang. Peter drehte sich um. Da stand die Baroness. Im Morgenlicht leuchtete ihr Haar. Peter fühlte einen kleinen Stich, als er sie ansah.
»Hallo«, sagte er.