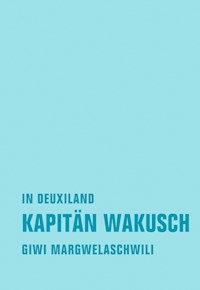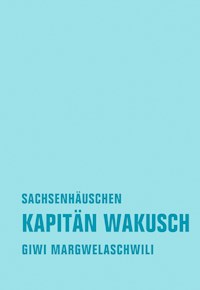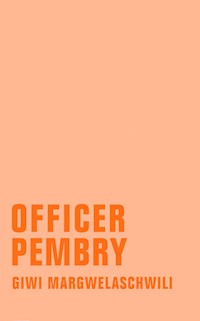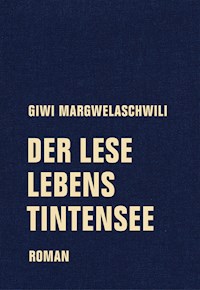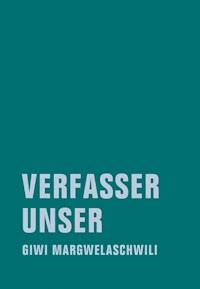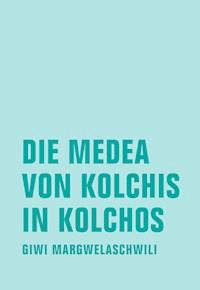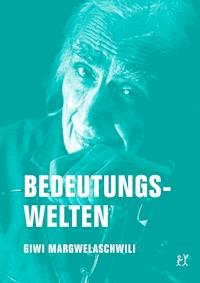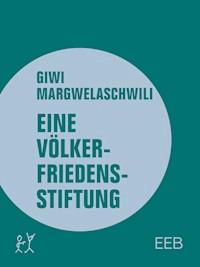
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Elektrobibliothek
- Sprache: Deutsch
Die Fünfzigerjahre: Wakusch sitzt in Makopse am Schwarzen Meer, wohin er mitsamt seinen Freunden gereist ist, doch trotz des tollen Wetters ist er betrübt. Denn er ist wie seine Freunde aus der sowjetischen Republik Georgien hergekommen, und diese hat in der restlichen Sowjetunion einen schlechten Ruf, seit die tausendfachen Verbrechen des georgischstämmigen Diktators Stalin bekannt geworden sind. Die anderen Badegäste schneiden also die vier Freunde – und diese wissen zunächst nicht, wie sie Kontakt aufnehmen sollen. Dann verfallen sie auf eine radikale Idee… Die Erzählung "Eine Völkerfriedensstiftung" ist ein eigenständiger Teil von Margwelaschwilis "Wakusch"-Komplex. "In Deuxiland" und "Sachsenhäuschen", die ersten beiden Bände der autobiographischen Serie "Kapitän Wakusch", sind bereits erschienen. Zwar schreibt er in diesen über sein Leben in Deutschland und Georgien, erzählt dabei aber nicht bloß seine Erinnerungen, sondern reflektiert den Akt des autobiographischen Schreibens selbst. So hält es der deutsch-georgische Philosoph auch in dieser kurzen vergnüglichen Erzählung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 38
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giwi Margwelaschwili
Eine Völkerfriedensstiftung
Erzählung
Vorwort
»WÄRE DASliterarische Werk Giwi Margwelaschwilis in den sechziger oder siebziger Jahren in Georgien publiziert worden, wäre die georgische Literatur heute eine andere«, meint der Autor Zurab Karumidze. Dabei kennt er nur einen Bruchteil dieses Werkes, denn der polyglotte Karumidze spricht nicht Deutsch.
Auf georgisch beziehungsweise russisch aber sind nur wenige Texte Margwelaschwilis erschienen, sein Roman »Muzal« (1991) etwa oder seine 1973 veröffentlichten Arbeiten über »Die Sujetzeit und die Zeit der Existenz« sowie diverse Untersuchungen zur Ontologie Martin Heideggers und zu Edmund Husserl. Schriften, von denen Karumidze behauptet, daß schon ihre Titel der sowjetischen Obrigkeit höchst suspekt gewesen seien.
Giwi Margwelaschwili schrieb in der Sowjetunion und schreibt noch heute hauptsächlich auf deutsch. Deutsch ist, wie er sagt, seine »Vatersprache«. Er wurde 1927 in Berlin geboren; seine Eltern mußten vor der Roten Armee aus Georgien fliehen; seine Mutter starb, als er vier Jahre alt war. Sein Vater, Titus von Margwelaschwili, der in Deutschland studiert hatte, lehrte als Professor für Philosophie und Orientalistik an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und arbeitete für die Exilzeitung »Der Kaukasus«. Zudem war er einer der führenden Köpfe der georgischen Emigranten.
Der kleine Giwi wuchs also von deutschen Kinderfrauen behütet auf. In den Kriegsjahren früh erwachsen geworden, trieb sich der Pubertierende nachts in der halb klandestinen Jazzszene Berlins herum. Schon damals bemerkt er, welche immense, alle ideologischen Grenzen überschreitende Macht der Musik innewohnen kann. Besonders der italienische Saxophonist Tullio Mobiglia, der mit seiner Combo bis 1943 in Berlin auftrat, hatte es ihm angetan.
Gegen Kriegsende floh er mit seinem Vater nach Italien, später kehrten sie jedoch nach Westberlin zurück. 1946 wurden beide von sowjetischen Agenten verhaftet. Nach Monaten in sogenannten Speziallagern in Berlin-Hohenschönhausen und im ehemaligen KZ Sachsenhausen wurde Giwi ohne Anklage und ohne ein einziges Verhör nach Tiflis verschleppt und zu seiner Tante gebracht, da er noch nicht 21 und somit minderjährig war und in Deutschland auch keine Verwandten mehr hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits ermordet, was er jedoch erst in den neunziger Jahren in Erfahrung bringen konnte. Bis dahin war ihm jede Auskunft darüber verweigert worden.
In Tiflis beschäftigte sich Giwi Margwelaschwili, der kaum Georgisch und Russisch sprach, notgedrungen mit den Büchern, die sein Vater seinerzeit in Georgien zurückgelassen hatte. Er mußte sich im wahrsten Sinne des Wortes mit ihnen unterhalten. Wenn man ein Buch nämlich auf die richtige Weise befragt, kann es auch antworten, so daß ein echter Dialog entsteht, meint er.
In diesem Sinne entwickelte er in den sechziger Jahren die Lehre von der Ontotextologie, die er anschließend vertiefte und verfeinerte. Inzwischen war ihm erlaubt worden zu studieren und hernach am Tifliser Philosophicum zu lehren, promovieren aber durfte er nicht. Seine Interessen waren für die damalige Zeit ungewöhnlich, auch für einen Dozenten an der Universität Tiflis, der in der Spätphase der Sowjetunion unter dem Schutz des Philosophen Merab Mamardaschwili stand.
Husserl, Heidegger, Derrida, Guattari und Deleuze standen bei der Ontotextologie Pate. Doch Margwelaschwilis Philosophie entfernt sich weit von ihnen. Er selbst beschreibt seine Theorie in nuce so: »Mich beschäftigt seit Jahrzehnten die ontotextuelle Verfassung des Menschen, also das Prinzip, nach dem der Mensch als textlich prädeterminierter, mithin als Textweltmensch existiert, abhängig etwa von den textuellen Grundlagen der großen Religionen (also des Buddhismus, des Hinduismus, des Juden- und Christentums, des Islam), abhängig jedoch auch von anderen Texten der weltanschaulich-ideologischen Art, wie sie vor allem den geschichtlichen Gang des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmt haben.« (»Der verwunderte Mauerzeitungsleser«, 2010) In seinen literarischen Texten geht es ihm jedoch vor allem um die Textmenschen in der Buchwelt, die mehr noch als reale Menschen von ihrer textlichen Prädetermination geprägt sind. Dies vor allem durch ihren Schöpfer, den Autor. Doch auch Buchfiguren ist es – oft mit Hilfe des Lesers – möglich, gegen ihr Schicksal anzukämpfen. Manchmal gelingt es ihnen, einen regelrechten Aufstand gegen ihre buchweltliche Wirklichkeit anzuzetteln. Bei aller Schwere bleibt Margwelaschwili ein Spieler. Mit viel Humor erzählt er von guten und von schlechten Lesern, von den Hoffnungen der Nebenpersonen und den Revolten der Hauptpersonen.
Anfang der neunziger Jahre kehrte er nach Berlin zurück, im Gepäck eine große Zahl unveröffentlichter Manuskripte. Seitdem erschienen mehr als ein Dutzend Bücher und unzählige Artikel in seiner »Vatersprache«. Er wurde mit vielen Auszeichnungen geehrt, etwa dem Brandenburgischen Literaturpreis und der Goethe-Medaille, zuletzt mit dem Italo-Svevo-Preis. 2013 übersiedelte er wieder nach Tiflis. Seit 2014 trägt ein Preis, mit dem das Tifliser Goethe-Institut Verdienste um den deutsch-georgischen Kulturaustausch würdigt, seinen Namen. Für seine Vermittlerrolle erhielt er das Bundesverdienstkreuz.