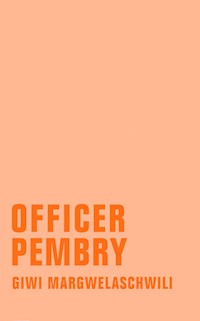Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Was geschieht, wenn eine Buchfigur in einer Geschichte leben muss, die kaum noch gelesen wird? Muss sie an Leserschwindsucht sterben? Und was, wenn sie sich dessen bewusst ist? Warum hängt ein vielarmiger Staubsauger am Himmel? Und warum sind in diesem Text neben der Buchfigur Wakusch zwei weitere Wakusche aktiv? Und wieso soll eine Medea-Statue am Schwarzmeerstrand das Medea-Buch von Christa Wolf lesen? All diese Fragen beantwortet der Philosoph Giwi Margwelaschwili, der Erzähler der Erzähltheorie, in diesem kleinen, überaus heiteren und verspielten Roman – und erklärt zugleich, warum die Buchfiguren oft sehr wütend auf ihre Verfasser sind. Außerdem erweitert und erhellt er hiermit ein weiteres Mal den Kosmos seiner vielfach gelobten und autobiographisch gefärbten Wakusch-Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giwi Margwelaschwili
Die Medea von Kolchis in Kolchos
Bronzefarben erhebt sie sich aus den blauen Wellen der Pizundaer Bucht. Eine riesenhafte Skulptur (fast ein dreistöckiges Häuschen hoch), die, ein Stück über die Strandlinie hinausgeschoben, sozusagen als sagenhafte Küstenwache von Kolchis (das heutige Pizunda liegt ja in der maritimen Landschaft dieses antiken Namens) vor den immer tiefer werdenden Wogen des Schwarzen Meeres emporragt.
Mir war das gigantische Kunstwerk des georgischen Bildhauers Merab Berdzenischwili zuerst völlig entgangen. Nicht daß ich es nicht bemerkt hätte. Die Medea ist eine Riesin und so ist es gar nicht möglich, sie zu übersehen. Aber mein künstlicher Brückenleserkopf war hier zunächst mit ganz anderen Sachen beschäftigt, zum Beispiel mit dem ideologischen Staubsaugerdienst des Polypen Polymat. »Was ist das denn?«, muß jeder reale Leser staunend denken, der zum ersten Mal in eine Wakuschgeschichte hineinsieht. »Polyp Polymat und ideologischer Staubsaugerdienst? Was soll das bedeuten?« Und dann würde er entweder die Lektüre empört abbrechen oder neugierig weiterlesen. Im ersten Fall hätte sich der Leser als ein realistisch gestimmter erwiesen, der nicht bereit ist, symbolisch geprägte Lesestoffe zu akzeptieren. Im zweiten hätte es ihn wahrscheinlich interessiert, zu erfahren, was sich hinter dem Ausdruck »symbolischer Staubsaugerdienst des Polypen Polymat« versteckt. Die beiden Fälle brauchen wir uns hier gar nicht weiter auszumalen, denn daß sich ein realer Leser jemals bis hierher verirrte, ist kaum anzunehmen. Der Lesestoff ist auch viel zu alt, einer aus dem vorigen Jahrhundert, der von Dingen erzählt, welche heute, wo die Welt vor Selbstmordattentätern zittert, wo atomare Raketen, die gegen alle aufgestellt werden können, den Medien immer neuen Anlaß geben, das mundane Katastrophenbewußtsein anzuheizen, längst niemanden mehr interessieren, keine Lesermenschenseele mehr anziehen, außer einer einzigen: und die bin ich. Als künstlicher Leser des realen Autors Wakusch, also als ein für den Leserdienst an seinen Stoffen extra ausgedachter, geistere ich durch die Geschichten dieses Verfassers, bemüht, sie nur irgendwie am Leben zu erhalten, am Lese-Leben also, denn in Geschichten und Gedichten leben alle Wesen nur, wenn sie gelesen werden, nur als Lese-Lebewesen. Der Polyp Polymat nun ist eine Maschine, eine Art Flugzeug und was ihn mir ein bißchen ähnlich macht, ist, daß er auch von dem realen Autor Wakusch ausgedacht wurde genauso wie ich. Und genauso wie ich von ihm nach einem realen Vorbild, nämlich nach der allgemeinen Vorstellung eines realen Lesers geformt bin, so wurde der Polyp Polymat von Wakusch auch nach einer realen Vorlage lesekörperstofflich erschaffen, nämlich nach einem Apparat, der dazu dient, Pasten, Flüßigkeiten und jede Art von breiiger Masse in Tuben abzufüllen, aber auch umgekehrt funktioniert: jeden zähflüssigen Inhalt aus seinem Behälter wieder abzusaugen. Das erfolgt über elektrisch betriebene Schläuche mit Saug- und Füllköpfen, die, der Tubenöffnung eingesetzt, das Auf- oder Abfüllen verrichten. Der Name dieses, aus der modernen Nahrungsmittelindustrie heute nicht mehr wegdenkbaren, Apparates ist »Polymat«. Diesem Apparat hat der reale Autor Wakusch in einer seiner Wakuschgeschichten eine leicht umfunktionierte lesekörperstoffliche Gestalt gegeben. Als lesestofflicher vermag sich der Apparat in die Lüfte zu erheben, ist also ein gedankenkybernetisch steuerbares Flugzeug, das fähig ist, in der Buchwelt in jeglicher Höhe überallhin zu fliegen. Seine Schlaucharme mit Auf- und Abfüllköpfen an den Enden kann dieser Mechanismus blitzschnell beliebig weit ausstrecken und wieder einziehen. Darum wird er bei Wakusch auch als Polyp bezeichnet. Im Unterschied zu dem realweltlichen Polymat hat der buchweltliche es nicht mit Nahrungs-, sondern Ideenstoffen, vor allem weltanschaulichen, zu tun. So wird sie zum Beispiel in den Wakuschgeschichten von ihrem Autor Wakusch im Luftraum der sowjetischen Riviera (grob gesagt, die ganze buchweltlich-kaukasische Schwarzmeerküste) systematisch hin- und herdirigiert, um diesen Raum von seinen weltanschaulich-lügnerischen Ausdünstungen zu reinigen, um den Staub – unter dem sich hier der Marxismus-Leninismus versteht – dort ab- und aufzusaugen, damit es sich in der herrlichen Luft auch geistig besser (freier) atmen läßt. Seinen Polypen Polymat nennt der Autor Wakusch auch »einen fliegenden Staubsauger« und den ideenstofflichen Staub, den er aus den Köpfen wegputzt, auch »den Goglimogli« des 20. Jahrhunderts. Dabei handelt es sich um ein georgisches Wort, das eine aus Eigelb und Zucker bestehende Babyspeise bezeichnet und in den Wakuschgeschichten als Symbolwort für das schlimme politische Rührei(n) steht, das es im europäischen Osten ab 1917 gegeben hat. Die russische Form desselben Wortes klingt wie »Gogelmogel« und führt das Trügerische an diesem politökonomischen Rührei eigentlich noch besser vor Augen, denn dieses Rührei hat ja gemogelt wie selten ein anderes in der Weltgeschichte. Es gibt eine Wakuscherzählung, die ganz dem Polypen Polymat gewidmet ist. Ja, dort ist der Polyp bestimmt an seinem Platz, da gehört er hin und kann – weil das weltanschauliche Großreinemachen, mit dem er da beschäftigt ist, sehr eingehend beschrieben wird – durchaus recht eindrucksvoll auf den realen Leser wirken. Aber in anderen Wakuschgeschichten finde ich den Polypen überflüssig. Zum Beispiel in dieser hier, die doch von der Medea von Kolchis handeln soll, genauer von der besagten Bronzefigur am Badestrand von Pizunda, können wir ihn ohne weiteres entbehren. Und so habe ich unseren realen Autor Wakusch (ich sage »unseren«, weil ja Wakusch uns beide, also den Polypen Polymat und mich, seinen künstlichen Leser, schreibend erschaffen hat, weil er also unser Autor ist) schon mehrmals in dieser Angelegenheit angesprochen, habe ihm dargelegt, wie unnötig der Polyp Polymat bei der Medea sei und mit dem eindringlichen Rat verknüpft, den Apparat aus ihrer Geschichte abzuziehen. Das mag verwundern, aber Wakusch nimmt auch gern mal Ratschläge von mir entgegen, besonders wenn sie geeignet sind, seine Geschichten lese-lebensmäßig zu verbessern, sie den realen Lesern interessanter zu machen. Dabei mangelt es mir nicht an Gelegenheiten, denn neben der Sinnhaftigkeit, den seine Texte zweifellos besitzen, ist es leider eine Gewohnheit des Autors, auch viel Unsinn abzuliefern, Dinge, die ein realer Leser nicht oder nur sehr schwer verkraften kann und die ihn dazu veranlassen können, das Lesen bei uns einzustellen und die Wakuschgeschichten auf Nimmerwiedersehen zu verlassen.
»Was schickst du den Polypen immerzu in Texte, wo er thematisch gar nichts zu suchen hat?«, habe ich den realen Wakusch mehr als einmal frustriert gefragt. »Hast du vergessen, daß er eine irr- oder surrealistische Maschine ist, mit der man in der heutigen Textwelt, weil der Lesergeschmack ein weitgehend realistischer ist, die Leser nur noch aktuell und faktuell Verständliches sehen und erleben wollen, nur sehr sparsam umgehen darf? Oder legst du überhaupt keinen Wert mehr auf reale Leser und begnügst dich nur noch mit mir, deinem künstlichen Leser, bei dem du sicher sein kannst, daß er alles von dir schluckt, alles hinnimmt, selbst den Polypen Polymat in jeder Wakuschgeschichte? Wenn du das denkst, so irrst du dich, mein Lieber. Alles mach ich mit dir nicht mit! Den Polypen Polymat auf jeden Fall nicht! Denn er ist – habe ich dir das nicht schon tausendmal gesagt? – der reale Leserschreck. Auch das habe ich dir schon mehrmals gemeldet, ohne bei dir Gehör zu finden. Wenn der Polyp auftaucht, verläßt jeder realistisch denkende Leser – und das sind in unserem Zeitalter die meisten – fluchtartig deinen Text. Wenn heute ein großer Teil der Wakuschgeschichten schon seit langem leserlos daliegt und bloß noch vom Gelesenwerden durch mich, deinem künstlichen Leser, lebt, so ist daran auch, vielleicht sogar vor allem, der Polyp Polymat schuld. Zwar habe ich immer, wenn der Apparat sich plötzlich am Himmel deiner Texte zeigte, dagegen gehalten, habe versucht ihn mit meiner Leserphantasie abzuwehren, aus der Geschichte hinauszudrängen. Aber meine Einbildungskraft ist nur die eines künstlichen Lesers, also eine Kraft, welche gegen widerspenstige lesestoffliche Störfaktoren auf Dauer nichts auszurichten vermag. So ist denn der Polyp von meinen Anweisungen, die Wesen und Dinge in deinen neueren und neuesten Wakuschgeschichten in Ruhe zu lassen, völlig unbeeindruckt geblieben und das bedauerliche Resultat dieser Entwicklung ist, daß sich dort teilweise schon über beunruhigend große Zeitspannen keine realen Leser mehr eingefunden haben. Wenn das so weitergeht, lieber Wakusch, bin ich überfordert, denn als einziger Leser, noch dazu als künstlicher, wird es mir unmöglich, so viel Text am Lese-Leben zu erhalten, die einzige Lese-Lebensquelle so vieler vereinsamter, in die totale Leserlosigkeit abgestürzter, Wakuschgeschichten zu sein.«
Zu solchen Ausbrüchen lächelt der reale Wakusch stets ganz unbekümmert, denn er erachtet meine Beschwerden über den Polypen Polymat als völlig grundlos, nein, er ist da gar nicht meiner Meinung und auch nur selten aufgelegt, die Sache mit mir genauer zu besprechen.
»Wir müssen einfach mehr Geduld haben!«, sagte er eines Tages, als er entgegen seiner Gewohnheit in diesem Punkt mir gegenüber gesprächiger wurde. »Ja, du magst recht haben. Noch finden die Leser nichts besonderes an dem Polypen, noch verdrießt es sie, wenn er in meinen Geschichten plötzlich vom Himmel fällt und in ihrer Semantik hin- und herfliegt. Aber ich sage dir: Das wird sich ändern! Wenn die Leser erst merken, was für eine gute Arbeit der Polyp Polymat in den Lufträumen meiner Erzählungen verrichtet, werden sie zu einer viel besseren Ansicht über ihn gelangen. Sie werden ihn für die freie, deideologisierte Atmosphäre, die er immer wieder schafft, loben und sich wünschen, daß er immer in ihrem Blickfeld bleibt, solange sie sich lesend bei uns aufhalten.«
»Aber guter Wakusch!«, rief ich zu diesen Worten meines realen Schöpfers höchst verwundert, doch auch ungehalten, aus. »Glaubst du denn wirklich, daß die Leser von dem atmosphärischen Wechsel, der von dem Polypen in deinen Geschichten ausgeht, lese-lebensmäßig etwas mitbekommen? Daß sie ihn überhaupt erschnuppern können? Dann wiegst du dich in Illusionen. Die Leser – jedenfalls die meisten von ihnen – lesen bei dir nur von diesem Wechsel und erleben ihn nicht selber, mit eigener Nase und Intuition erfahren sie nichts davon. Und so kann es ihnen im Grunde auch vollkommen egal sein, ob der Polyp in deinen Wakuschgeschichten umherfliegt oder nicht. Aber er ist ihnen leider nicht egal, hörst du? Sie finden die Maschine abscheulich und wie sie mit ihren Dutzend aufgerichteten Rüsseln, an deren Ende die Saugköpfe blinken, dahersegelt, ist sie auch erschreckend genug. Zudem empfinden die Leser den Polymat auch als unrealistisches, sinnloses und übertriebenes Symbol, mit dem sie sich, eben wegen seiner Hyperbolie, nicht weiter anfreunden wollen. Höre darum endlich auf meinen Rat! Ziehe den Polypen aus deinen Geschichten ab und lasse ihn nur in der einen, die seinen Namen trägt! Nur da können die Leser ihn noch halbwegs ertragen. In allen anderen deiner Erzählungen ist er überflüssig und verscheucht dir bloß die Leser.«
»Ach du!«, winkte Wakusch hier kopfschüttelnd ab. »Was verstehst du schon von dem Polypen Polymat? Ich sage dir: Er ist die große Nummer in allen meinen Geschichten und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis die Leser das merken. Dann geht das Lese-Leben in diesen Texten erst richtig los, dann werden sie überlaufen sein von immer neuen und nicht mehr abreißenden Leserbesuchen und du bist dort dann überflüssig. Jawohl, so wird das sein. Weißt du, was ich glaube? Du hast die Vermutung, daß, wenn der Polyp sich einmal bei den realen Lesern durchsetzt, du in meinen Geschichten nicht mehr notwendig bist. Deswegen willst du ihn loswerden. Gib es zu! Natürlich schüttelst du jetzt heftig den Kopf, rollst empört die Augen und streitest das ab. Aber du machst mir nichts vor. Gerade so verhält es sich und nicht anders. Dazu lass dir sagen: Deine Befürchtungen sind vollkommen grundlos. Ich bin nicht so naiv zu glauben, daß meine Geschichten ohne dich jemals auskommen könnten. Auch der Polyp wird seine Anziehungskraft auf reale Leser irgendwann einmal wieder verlieren. Dann werde ich wieder auf dich zurückgreifen müssen, auf deine künstliche Lese-Lebensunterstützung. Hieraus folgt für dich in aller Evidenz nur eines: Für meine Geschichten bist und bleibst du unabdingbar, ihre – wenn niemand anders mehr zum Lesen für sie da ist – allerletzte Lese-Lebensquelle. So! Bist du jetzt zufrieden? Nein? Na, hör mal! Du hast von mir eben das denkbar Beste für dich gehört und bist noch immer nicht zufrieden? Was willst du noch von mir, vielleicht eine Lese-Liebeserklärung? Schlag dir das aus dem Kopf! Wir haben ein Arbeits- und kein Gefühlsverhältnis miteinander. Und das, lieber Freund, kann – wenn es mit dir so weitergeht – auch bald ein jähes Ende nehmen. Ich finde nämlich, daß du in letzter Zeit viel zu viel in meine Texte hineinredest und viel zu wenig liest. Bringe das, bitte, wieder in Ordnung! Und jetzt entschuldige mich! Ich habe zu schreiben.«
Das waren damals – das einzige Mal übrigens, daß wir über den Polypen Polymat so lange und eingehend gesprochen haben – die Worte meines realen Schöpfer-Autors Wakusch. Harte Worte, denn sie besiegelten genau das Gegenteil von dem, was ich mir gewünscht hätte, nämlich das praktisch unbeschränkte Herumgeistern des ideologischen Staubsaugers in allen Wakuschgeschichten. Kann man so blind sein wie der alte Wakusch für das, was in der Buchwelt heute lese-lebensmäßig noch geht und was nicht? Kann man sich der Tatsache, daß die realen Leser heute grundsätzlich nur noch eine realistisch aufgezogene Buchwelt akzeptieren und das Phantasmagorisch-Visionäre darin ablehnen, so hartnäckig verschließen, wie er es tut?
»Ach, was redest du da!«, fällt er mir immer ins Wort, wenn ich davon anfange. »Sieh dir ›Harry Potter‹ an! Ist das vielleicht kein Märchenbuch heutiger Zeit und etwa kein Leseriesenerfolg? Und folgt daraus nicht auch ganz unabweisbar der Schluß, daß es in der realen Leserwelt gerade heute ein enormes Begeisterungspotential für das Ir- oder Surrealistische in der Buchwelt gibt? Daß wir nur Geduld haben müssen, bis alles, was wir in diesem Genre auch auf Lager haben, Gefallen bei den Lesern findet? Ich glaube, man kann als Autor heute gar nicht genug Hoffnung in bibliobiologische Phantastik investieren. Das wird, ja das muß, sich schon in nicht all zu langer Zeit bezahlt machen.«
Vergeblich halte ich ihm dann vor, daß »Harry Potter« ein Märchen-, sprich Kinderbuch sei, sich also an ein Millionenvölkchen richtet, das zu allem Phantastischen ein ganz natürliches Verhältnis hat und – wenn es gut geschrieben ist – sich auch immer hell begeistert davon zeigt, während die Wakuschgeschichten ihre Leserschaft bei Erwachsenen suchen müssen, bei realen Lesern also, die heute jeden Geschmack an symbolischen Hypostasen verloren haben und sich aus übermäßigen Phantasiesprüngen gar nichts mehr machen. Vergeblich versuche ich den realen Wakusch davon zu überzeugen, daß er mit solchen Kinkerlitzchen wie dem Polypen Polymat seine Geschichten nur der absoluten Leserlosigkeit überantwortet, was gleichzeitig bedeutet, daß ich dort einspringen muß, damit das Lese-Leben in dem Stoff wenigstens nicht ganz erlischt. Aber – und ich versäume natürlich nicht, ihm das bei allen solchen Gelegenheiten besonders deutlich zu machen – es bedeutet auch, daß ich von der Aufgabe, bei ihm den künstlichen Lese-Lebensretter zu spielen, langsam überfordert bin, daß sich meine ohnehin nur sehr schwachen und begrenzten Lesekräfte langsam erschöpfen und einmal der Moment kommen muß, an dem selbst auch die provisorische Lese-Belebung seiner Wakuschgeschichten nicht mehr klappen kann.
»Dann wirst du nicht einmal mehr einen künstlichen Leser haben«, warne ich den realen Wakusch immer. »Deine leserschwindsüchtigen Geschichten werden sich rasch in völlig leserlose verwandeln und der unvermeidliche Lesetod wird in allen deinen lesestofflichen Erzeugnissen Einzug halten. Willst du das riskieren?«
»Ja, mein Freund!«, erwidert er mir dann immer auf diese Frage. »Ganz bedenkenlos. Denn das Risiko ist gar nicht so hoch, wie du es dir vorstellst. Es ist im Gegenteil sehr gering. Hoch, sehr hoch sogar, ist aber der Gewinn, der für uns dabei herausspringen kann, nämlich der plötzliche massenhafte Besuch von realen Lesern in meinen Geschichten. Und daß du, mein künstlicher Leser, dann dadurch arbeitslos und überflüssig würdest, brauchst du auch nicht zu befürchten. Denn ein oder zwei Geschichten werden sich immer finden, in die ich dich als Buchperson unterbringe und du regel-, ja vielleicht sogar übermäßig gelesen werdend völlig sorglos leben kannst wie dann auch alle anderen Buchpersonen in meinen Büchern.«
»Wenn du mich, deinen künstlichen Leser, nur in einer von deinen Geschichten und dort auch bloß ganz kurz als Buchperson den Lesern vorführst, wirst du damit dein eigenes Lesetodesurteil unterschrieben haben«, habe ich dem realen Wakusch darauf erwidert. »Denn dann wäre ich ja so was Ähnliches wie der Polyp Polymat, ja noch viel unrealistisch-unsinniger und deinen Lesestoff verkomplizierender als er, denn wenn schon ein realer Leser in der Buchwelt nichts lesekörperstofflich Anschauliches ist, trifft das auf einen künstlichen in doppeltem Sinne zu. Wie sollen sich realistisch denkende reale Lesepersonen – frage ich dich – mich jemals als Buchperson vorstellen können und auch je vorstellen wollen? Einen Leser, der auch und gerade noch als künstlicher in keiner lesekörperstofflichen Konfiguration unterzubringen ist, von einem realistisch zu denken gewohnten Realgeist jedenfalls nicht. Müssen solche Geister, wenn sie mich dann in deinen Geschichten auftauchen sehen, nicht baß erstaunt sein, ihren realen Leserkopf schütteln und sich fragen, was so ein wunderliches Lese-Lebewesen überhaupt bedeuten soll? Müssen sie dann nicht alle ausnahmslos glauben, daß es sich um ein pathologisch-dekadentes Hirngespinst handelt, mit dem als normaler Leser etwas zu tun zu haben, sich einfach nicht lohnt? Und müssen sie deine Geschichten dann auch nicht alle fluchtartig verlassen und sie danach meiden?«
»Du hast viel zu wenig künstlich-künstlerisches Leserselbstvertrauen«, erwiderte mir einmal der reale Wakusch zu diesen oder ähnlichen Vorhaltungen. »Davon, daß ich in dieser Angelegenheit recht habe, wirst du dich wohl nur überzeugen lassen, wenn du mit deinen eigenen Leseraugen siehst, was für einen großen Erfolg der Polyp Polymat und auch du selber, in buchpersonifizierter Form, bei meinen realen Lesern haben werdet. Also, mehr Geduld bis dahin! Mehr kann ich dir dazu nicht sagen.«
Was soll man nur dazu sagen? Ich weiß es nicht. Nur eines steht fest: Der alte reale Wakusch ist unbelehrbar. Und auf eine Buchpersonifizierung, die er mir noch in irgendeiner seiner Geschichten – vielleicht auch in mehreren, wenn nicht sogar in allen – verpaßt, habe ich mich bei ihm ebenfalls gefaßt zu machen. Mit dieser Idee trägt er sich ja schon länger und weil er so steif und fest glaubt, daß es eine gute Idee ist, wird er sie eines Tages auch bestimmt verwirklichen. Dann erscheine ich, von ihm buchpersonifiziert, neben dem Polypen Polymat und möglicherweise auch neben der Medea von Kolchis in Kolchos. Allein die Vorstellung macht mich fuchsteufelswild und gleichzeitig überkommt mich ein Grauen: Ich fange an zu zittern, meine künstlichen Leserzähne klappern und der kalte Angstschweiß bricht mir aus. Als Buchperson in Wakuschs Textwelt zu stehen, ist nämlich kein Zuckerschlecken. Man wird ja von niemandem gelesen, außer vielleicht hin und wieder mal von dem realen Wakusch selber, wenn er sich in seine eigenen Texte vertieft. Das geschieht aber, weil er mehr schreibt als liest, ziemlich selten, sodaß man als seine Buchperson hauptsächlich sich selbst überlassen bleibt. Ohne mich hätten Wakuschs Buchpersonen ein quasi leserloses Dasein zu führen, und daß ein solches bei grundsätzlich leserabhängigen Lese-Lebewesen nicht besonders angenehm ist, wird man sich vorstellen können. Nun mache ich für seine Buchpersonen sicher nicht viel, aber ein bißchen munterer werden diese Personen schon, wenn ich bei ihnen vorbeischaue (was aber auch nur in großen Zeitabständen geschieht, denn erstens hat Wakusch sehr viel geschrieben und zweitens ist die Überlese-Lebenskraft seiner Buchpersonen individuell sehr verschieden. Es gibt solche, die jeden zweiten Augenblick eine Lese-Lebensenergiespritze benötigen, da sie sonst schnell im Sterben liegen; daß ich mich bei solchen häufiger und länger aufhalten muß, wird jeder verstehen).
Nehmen wir jetzt einmal an – Gott behüte! – der reale Wakusch hat mich in einer seiner Geschichten, sagen wir sogar in dieser hier über die Medea von Kolchis in Kolchos, seine Buchperson werden lassen, was würde das dann nicht nur für mich (von mir rede ich in diesem Kontext an letzter Stelle), sondern für alle Buchpersonen seiner Geschichten, wie auch für diese Geschichten selber, bedeuten? Nur das Abträglichste, also Verheerendste. Denn dadurch würden meine ohnehin schon unzureichenden Kräfte als künstlicher Leser der Wakuschtexte auf das Fatalste beeinträchtigt, mindestens um die Hälfte verringert werden. Ich wäre dann kaum noch, ja vielleicht überhaupt nicht mehr, imstande, Wakuschs Buchpersonen richtig lesend zu beleben und damit wäre auch die allerletzte Energiequelle, welche die Wakuschgeschichten noch nährt, praktisch versiegt.
Das war der Grund, warum ich in dem Textweltgebiet, das der Medea von Kolchis in Kolchos gewidmet ist, meine ganzen künstlichen Leserkräfte darauf verwandte, den Polypen Polymat, der auch in diesem Gebiet umherschwirrt und uns die wenigen realen Leser verscheucht, von allem auf Abstand zu halten. Weil der Polyp durch die Gedankenkraft unseres Autors voranbewegt wird, also niemand anders als der reale Wakusch in dem Apparat telepathisch am Steuer sitzt, nehme ich – wo immer ich das Vehikel sehe – die Gelegenheit wahr, ihm meine Gedanken einzutrichtern, sie ihm sozusagen in seine Saugarme hineinzustopfen und auf diese Weise an den realen Wakusch weiterzuleiten. Der Polyp ist also auch eine Art transzendentales Telephon zwischen unserem realen Autor und mir: Er leitet alle meine Reflexionen, wenn ich sie ihm zudenke, sofort voll umfänglich und verständlich an Wakusch weiter. Diese Art der Kommunikation mit dem realen Wakusch über den Polypen Polymat ist eine relativ neue Entwicklung in unseren Lese-Lebensverhältnissen. Er selbst hat mir in einem Gespräch, das wir in einer seiner Wakuschgeschichten führten, diese Möglichkeit enthüllt und mich sogar aufgefordert, unbegrenzt davon Gebrauch zu machen. Das war das eine unikale Mal, als sowohl der reale als auch der irreale Wakusch zugleich in einer Geschichte zugegen waren, als sie mir in der sonnigen lesestofflichen Küstenlandschaft des Schwarzen Meeres zusammen begegnet sind. Halt! Nicht zusammen natürlich, sondern nacheinander.
Zuerst war es der irreale, lesekörperstoffliche und auch um so viel jüngere, Wakusch, den ich dort sah und den ich – wie ich mich erinnere – auch ein bißchen lese-lebensenergetisch aufpulvern mußte, denn die reale Leserlosigkeit in seiner Geschichte hatte dem Armen schon so zugesetzt, daß er nur noch schwankend umherging und nach jedem zweiten Schritt schnaufend stehenblieb, um seine schwachen Lese-Lebensgeister wiederzuerwecken. Meistens lag er stundenlang nur am Strand oder auf seinem Hotelzimmer, völlig apathisch, außerstande dem Freund, der mit ihm da war (ich glaube, es war Reso), seinen Zustand genauer zu erklären. Weil er sonst normal aussah, keine Blässe, kein Fieber, nicht die geringsten Schmerzen hatte, hielten alle, er mit eingeschlossen, sein Befinden für die Folge einer Übermüdung, für etwas, das nur Zeit brauchte, um wieder in Ordnung zu kommen. Wakusch hatte Bücher mit, in die er sich versenkte (viel Thomas Mann, Heinrich Böll, Günter Grass, aber auch Franzosen, wie Robbe-Grillet und Butor waren dabei). Mit dem Schreiben hatte er aufgehört, weil ihn dann sofort Schwindelanfälle quälten und sein allgemeiner Zustand ganz offenkundig mieser wurde.
»Dir fehlt ein Mädchen«, sagte der Freund (von dem ich glaube, daß es wirklich Reso gewesen sein muß. Ich werde ihn deshalb von jetzt an immer so nennen). »Ich besorge dir eins und dann wirst du wieder munter werden.«
Aber Wakusch schüttelte nur energisch den Kopf. Nein, er wollte kein Mädchen. Weil für ihn offenbar selbst das Reden zu anstrengend war, sagte er nichts zu Resos Vorschlag und beließ es bei der ablehnenden Geste.
»Was hat er bloß?«, fragte sich der Freund ratlos, als er aus dem Hotelzimmer ging, in dem die beiden sich eingemietet hatten. »Keinerlei Beschwerden. Nur Körperschwäche. Was ist das?«
Nun, ich wußte, was mit Wakusch los war. Ihn, den lesekörperstofflichen, plagte die Leserschwindsucht. Weil kein realer Leser seine Geschichte las, lag er kraftlos darnieder. Nur weil lesende Realpersonen schon lange nicht mehr in ihr erschienen waren, um an seinem Lese-Leben an der sowjetischen Riviera teilzunehmen, war er praktisch an sein Hotelbett gefesselt. Man könnte sich wundern und fragen, warum Reso dann so munter dort umherging, das Baden im Schwarzen Meer ausgiebig genoß und so ungezwungen mit den Damen, oder Pipas, (wie die beiden Wakusche in ihren Schriften auch sagen) am Strand schäkerte. Ja, warum der ganze Badebetrieb in dieser Geschichte, überhaupt das Leben dort, so ungestört weiter funktionierte, während Wakusch, leserschwindsüchtig wie er war, das Bett hüten mußte, sein Essen meistens im Zimmer einnahm und die horizontale Lage allen anderen Körperzuständen vorzog. Waren denn alle Leute um ihn herum nicht ebenso Buchpersonen wie er, die Landschaft in ihrer Gegenständlichkeit und die Promenade am Meer, wo zu jeder Tageszeit Ströme von Touristen und Hotelgästen entlangdefilierten, nicht auch aus demselben Lesestoff wie er? Ja, natürlich. Aber der lesekörperstoffliche Wakusch war die Hauptperson in dieser Geschichte, alle anderen nur ihre Nebenpersonen; alles andere – nur ihre Nebensachen. Und die Leserschwindsucht greift vor allem und zuerst die Hauptperson(en) der Lesestoffe an, diese ist (sind) immer ihr erstes Opfer. Darum ging es allein dem Wakusch so übel, alle anderen spürten nichts – noch nichts. Darum war auch alles andere in dieser Geschichte (das ganze maritime Panorama ihres Vordergrundes und die weite Gebirgslandschaft in ihren Hintergründen) dort immer noch wie gehabt, nämlich voller Leben und berückend schön. Noch. Denn wenn das Übel weiter andauerte, mussten auch alle Nebenpersonen und Nebensachen der Geschichte davon befallen werden, alle Lese-Lebewesen an zunehmender Schwäche und Kraftlosigkeit, alles lesestofflich Anorganische an Substanz- und Konsistenzverlust restlos zugrundegehen. In der Buchwelt macht die Leserschwindsucht und der Untergang alles Lesekörperstofflichen, den sie im Gefolge hat, keine Ausnahmen. Nun hatte mich der pure Zufall – Gott sei Dank! – gerade noch rechtzeitig in die Geschichte verschlagen, in der der lesestoffliche Wakusch schon so leserschwindsüchtig das Bett hütete und sein Essen von Reso herangetragen bekam, weil er zu schwach war, in den Speisesaal des Hotels zu gehen.