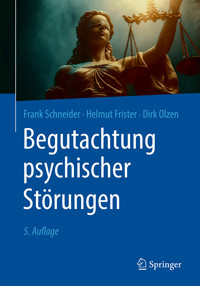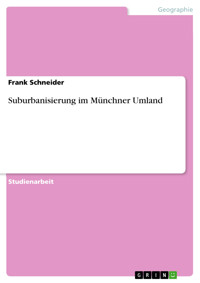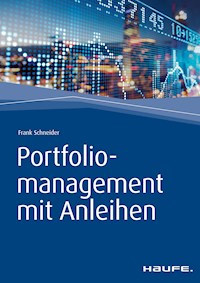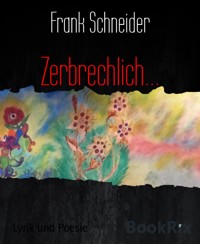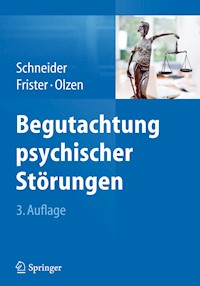Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ist die Königsdisziplin der Kammermusik, und seit dreißig Jahren zählt das 1985 in Ost-Berlin gegründete Vogler Quartett zu den international renommiertesten Streichquartetten – in unveränderter Besetzung. Diese Gespräche mit Frank Schneider, dem langjährigen Intendanten des Berliner Konzerthauses, zeigen, wie ein gemeinsames Musikerleben über eine so lange Zeit die Spannung halten kann. Eine sehr persönliche Künstlerbiografie, mit Reflexionen zum musikalischen Selbstverständnis, kunstpolitischen Engagement und, natürlich, dem Alltag zu viert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANK SCHNEIDER
Eine Weltauf sechzehn Saiten
Gespräche mit demVogler Quartett
BERENBERG
VORWORT
EINS / Durch die Zeiten
Gründungen (1985 – 1989)
Ende mit Wende (1989/90)
Im vereinten Deutschland (1990 – 2000)
Neue Bahnen (2000 – 2014)
ZWEI / Profil und Programm
Kanonische Tradition
Neue Musik
Klangstile: Wir und Andere
Erweiterungen und Ausbrüche
DREI / Alltag und Abend
Aus der Instrumenten-Werkstatt
Proben-Impressionen
Vor und nach dem Konzert
Leben ohne Bühne
VIER / Monologe – Selbstporträts
Stephan Forck
Stefan Fehlandt
Frank Reinecke
Tim Vogler
ANHANG
VORWORT
Das Vogler Quartett kann auf drei Jahrzehnte ununterbrochener Konzerttätigkeit in immer gleicher Besetzung zurückblicken und auf eine glanzvolle internationale Karriere im vornehmsten und zugleich sensibelsten Bereich instrumentaler Kammermusik verweisen. Obwohl ein solches Jubiläum gewiss keine künstlerische Zäsur bedeutet, mag es ein willkommener Anlass sein, im öffentlichen Medium eines Buches an prägende Ereignisse zu erinnern, berufliche Erfahrungen zu vermitteln und einem sicherlich nicht kleinen Kreis interessierter Hörer Einblick in ein sehr spezielles Künstlerleben »a quattro« zu ermöglichen.
Das äußerst stabile Innenleben, die andauernde Präsenz auf den Podien des klassischen Konzertlebens, die Bewährung in den Stürmen einer politischen Zeitenwende und schließlich das zunehmend wichtige pädagogische und kunstpolitische Engagement verdienen eine eingehende Darstellung. Gerade der erfolgreiche Wechsel eines zunächst staatlich geförderten Ensembles in die harte Welt des freien Musikmarktes bedeutet – meiner Meinung nach – eine exemplarische Leistung der Musiker. Dabei wird ein widerspruchsvolles Zusammenwirken von autonom-musikalischen, individuellbiographischen und zeitgeschichtlich-heteronomen Komponenten lebendig erfahrbar. In diesem Rahmen soll auch der keinesfalls konfliktfreie Dienst von vier aufeinander eingestellten, weil aufeinander angewiesenen Künstlerexistenzen sowohl gegenüber der Kunst als auch im Hinblick auf ein oft eigenwilliges Publikum nicht zu kurz kommen. Im Übrigen gibt es der Anekdoten genug, die den Leser erfreuen und erfrischen können.
Die Idee des Buches stammt von den Musikern. Sie basiert auf ihrem Wunsch nach authentischer Rede und persönlicher Äußerung. Ihre Anfrage, ob ich Lust hätte, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, fiel auf bereitwilligen Boden, obwohl mir als Musikwissenschaftler fast ausschließlich die kompositorische Ebene in der Musikgeschichte vertraut war und ich den interpretatorischen Problemen keine erstrangige Bedeutung zubilligen wollte. Allerdings war mir die Erstrangigkeit des Vogler Quartetts spätestens bewusst und andauernd präsent, seit ich als künstlerischer Intendant des Berliner Konzerthauses tätig war und mit dafür sorgte, dass das Ensemble dort seinen ersten Abonnements-Zyklus etablieren konnte. Aus dieser Verbindung und gewissermaßen beiderseitiger Zuneigung kam das Buch-Experiment zustande. Ich entwarf einen thematischen Plan, der alle wesentlichen Aspekte eines Quartettlebens berücksichtigt. Da der Titel für das Buch relativ früh gefunden war, ließ auch ich mich von der Magie der Besetzungszahl der Gattung und der Saiten der Instrumente faszinieren – nicht zuletzt von der Notwendigkeit überzeugt, den Zufälligkeiten der Interviews durch ein strenges und klares Fragegerüst zu begegnen. So schlug ich für den Verlauf der Interviews, die wir gemeinsam in einem ruhigen Spreewald-Hotel absolvierten, viermal vier Kapitel vor: Das erste Kapitel dient als chronologische Basis, zwei weitere Kapitel thematisieren Problemfelder des künstlerischen und aufführungspraktischen Bereichs und das letzte präsentiert in vier Monologen Selbstporträts der Musiker. Sie gründen zwar ebenfalls auf Dialogen, aber da in Einzelgesprächen allen die gleichen Fragen gestellt wurden, schien eine Verwandlung angebracht, um Wiederholungen zu vermeiden.
Es ist mir ein Bedürfnis, mich bei denen zu bedanken, ohne die das Buch nicht zustande gekommen wäre. Der erste Dank gilt dem Quartett für seine geduldige Mitwirkung bei der Metamorphose des gesprochenen Wortes in das geschriebene, was nicht ohne gewisse schöpferische Veränderungen möglich war. Gleichwohl sollten sich die Musiker in den Formulierungen wiederfinden, obwohl der Autor sie gelegentlich – ihrem Denken gemäß – auch erst finden und erfinden musste. Diese Arbeit fußt auf einer diplomatisch genauen Abschrift der aufgezeichneten Gespräche, die die Eltern von Tim Vogler unter bewundernswerter Anstrengung besorgten. Nicht minder dankenswert war die zeitaufwendige Redaktion des Textes, die meine Frau in intensiver Zusammenarbeit mit den Musikern besorgte. Schließlich gilt der besondere Dank dem Verleger für sein spontanes Interesse an diesem besonderen Gegenstand, für seine Ratschläge und insgesamt für das musische, den Künsten gewogene Klima, bei dem man sich seit dem ersten Kontakt mit dem Projekt geborgen fühlen konnte.
FRANK SCHNEIDER
Berlin, im Herbst 2014
Evian am Genfer See 1986, mit Eberhard Feltz
EINS / Durch die Zeiten
Gründungen (1985 – 1989)
Beginnen wir unsere Gespräche über die Geschichte des Vogler Quartetts mit der stets naheliegenden Frage, wie alles begann, wie es zur Gründung dieser doch spektakulären und nun schon dreißig Jahre erfolgreichen Unternehmung gekommen ist. Vielleicht schildern Sie erst einmal alle vier Ihre Erinnerung an eine Stunde Null in der Hoffnung, dass Ihre Berichte besser übereinstimmen als diejenigen der Evangelisten.
TIM VOGLER (TV): Eine Stunde Null ist schwer zu definieren. Es liegt schon sehr lange zurück, dass wir uns zusammenfanden. In der Berliner Spezialschule für Musik begegnete ich zwölfjährig meinem Mitschüler Stephan Forck, denn wir gingen beide in dieselbe Klasse. Ein Jahrgang über uns war Frank Reinecke, den wir auch bald besser kennenlernten. Mein Geigenlehrer, Professor Eberhard Feltz, der später an der Hochschule ebenfalls Franks Lehrer wurde, legte sehr viel Wert darauf, dass wir jungen Leute Kammermusik spielen, und so haben wir uns im Rahmen unserer Violin-Klasse in unregelmäßigen Abständen und in wechselnden Gruppierungen getroffen, um zu musizieren. Es wurden auch Bratscher und Cellisten eingeladen. Und eines Tages, es mag 1983 zu Beginn des Studiums an der Berliner Musikhochschule gewesen sein, setzte Feltz zum ersten Male den folgenreichen Satz in die Welt: »Burschen, ihr müsst Quartett spielen!« Und sein Wille geschah – auch in der Hinsicht, dass ich, bereits lange Zeit sein Schüler, die 1. Violine übernehmen sollte.
STEPHAN FORCK (SFO): Was das Cello anbelangt, so hast du mich gefragt. Aber ich war damals gerade anderweitig an ein studentisches Streichtrio gebunden (unter Anleitung deines Vaters übrigens), so dass ich aus Gründen der Loyalität zunächst absagen musste.
TV: Bei der Überlegung, mit wem man – immer noch erst als Teil des Studiums, zu Übungszwecken, als Proben ohne spätere Aufführungen – im Quartett spielen möchte, habe ich mit Frank gesprochen, und wir haben den Plan zur Gründung eines Quartetts entwickelt. Gemeinsam mit meinem Cousin Jan haben wir dann überlegt, wer der Bratscher sein könnte. Da sich Stefan Fehlandt seit Beginn seiner Hochschulzeit einen guten Namen gemacht hatte, haben wir ihn angesprochen und konnten ihn gewinnen. Stephan Forck stand anfangs nicht zur Verfügung, deshalb kam als erster Cellist Jan Vogler in Frage, der etwa ein gutes Jahr, bis zu seinem Weggang nach Dresden, mit uns spielte.
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Tim Vogler, Frank Reinecke und Stephan Forck besuchten die Spezialschule für Musik (das heutige Musikgymnasium »Carl Philipp Emanuel Bach« Berlin) als gezielte berufliche Vorbereitung für das Hochschulstudium, Ersterer als Berliner von Haus aus, Frank Reinecke und Stephan Forck mussten als Auswärtige das zugehörige Internat belegen. Doch Sie, Stefan Fehlandt, kamen nach zehnklassiger Normalschule direkt zum Studium an die Berliner Hochschule und wohnten in Karlshorst in einem Internat.
STEFAN FEHLANDT (SFE): Ich habe an der Hochschule etwa zur gleichen Zeit studiert, zusammen im Studienjahr mit Jan Vogler und Bernhard, einem Bruder von Stephan Forck. Als ich zum ersten Mal während eines sozialistischen Ernteeinsatzes, den alle Musikstudenten im ersten Studienjahr absolvieren mussten, zu abendlichem Zeitvertreib Kammermusik mitspielte, hatte ich sofort Blut geleckt und bildete mit Kommilitonen anschließend ein Streichquartett – als lockeres Zusammenfinden zu studentischen Übungen, schon mit einigem Ehrgeiz, aber ohne wirkliches Ziel. Danach bin ich dann von Tim und Frank gefragt worden.
SFO: Meine Begeisterung für Kammermusik reicht sehr weit zurück, bis ans Ende der Kindheit und den Beginn meiner Schulzeit in der Spezialschule. Vier Kommilitonen luden mich ein, mit ihnen das grandiose Streichquintett von Franz Schubert zu spielen. Das waren an den beiden Violinen mein sechs Jahre älterer Bruder Dieter sowie Matthias Rechenberg, an der Bratsche Joachim Knispel und am ersten Cello Christoph Bachmann. Es war eine intensive Arbeit an diesem tollen Stück, welches wir dann auch aufführten; mich hat das geradezu umgehauen. Endgültig verfallen bin ich dem Kammermusikspiel jedoch durch ein zweites Erlebnis aus dieser Zeit, als ich mit meinem anderen geigenden Bruder Bernhard und einem Bratscher bei uns zu Hause späte Beethoven-Quartette vom Blatt zu spielen probierte. Eine unglaubliche, unvergleichliche Klangwelt, schwer zu spielen und noch schwerer gedanklich zu fassen! Aber allein die langsame Einleitung zum Kopfsatz des a-moll-Quartetts fand ich so unbegreiflich rätselhaft, dass mein Interesse für dieses ganze Repertoire endgültig geweckt war – ich kehrte später immer wieder zu den enigmatischen Gebilden des späten Beethoven zurück und suchte sie ein wenig zu entschlüsseln.
Jeder hat also – weil Pflichtpensum an der Hochschule – zunächst in üblicher Weise solo bei einem Hauptfachlehrer sein Instrument studiert. Ich gehe davon aus, dass es im Hinblick auf eine feste Anstellung in einem der Spitzenorchester der DDR geschah. Das Quartettspiel ergab sich nebenbei, als Ergänzung, als Kür, weil es dem weisen und weitblickenden Rat eines Lehrers folgte, der der richtigen Meinung war, dass gerade ein Orchestermusiker auch später regelmäßig Kammermusik pflegen solle, wenn er sein Spielniveau wirklich halten will. Von einem Berufsleben als Quartettspieler war, denke ich, zunächst noch gar keine Rede.
TV: Bei mir war es so: Man hat eigentlich in den Tag hinein gelebt, hat gemacht, was einem vorgesetzt wurde. Ich habe mein Studien-Programm geübt und eingesehen, dass Streichquartettspiel auch sein muss. Es machte Spaß, mit den Kollegen zusammen zu musizieren – ganz stoisch vom Blatt selbstverständlich, weil man die Quartett-Literatur vorher nicht übte. An eine solistische berufliche Zukunft habe ich dabei überhaupt nicht gedacht. Das gemeinsame Spiel kam tatsächlich durch die Anregung von Professor Feltz zustande; und wie gesagt, in der heutigen Besetzung trafen wir uns zum ersten Mal im Januar 1985, am 4. oder 5., da sind wir uns nicht ganz einig. Es war jedenfalls kalt und es lag Schnee. Wir probten allein, ohne Lehrer, im Funktionsgebäude der Komischen Oper Unter den Linden. Auf den Pulten lag Debussys Streichquartett, das wir genauer kennenlernen wollten. Diese Januartage betrachten wir heute als unser Gründungsdatum, obwohl wir anderen drei ohne Stephan schon etwas länger beisammen waren.
FRANK REINECKE (FR): Hinsichtlich Tims bescheidener Zukunftsvision möchte ich nur noch anmerken, dass sie auch für mich zutrifft. Ich habe anfangs ebenso in den Tag gelebt – mit der Hoffnung, einmal in einem sehr guten Orchester zu landen. Dort spielte man die Literatur, die mir ans Herz gewachsen war, große sinfonische und konzertante Musik, und dort gab es, von Freunden neidvoll bewundert, die Chance zu Reisen in ansonsten für uns verschlossene Regionen der Welt. So galt das Quartettspiel als schöne Bereicherung, angeregt durch den Lehrer. Wir sind einfach so hineingewachsen, haben dann das vorher geprobte Debussy-Quartett in einem ersten öffentlichen Auftritt im Ungarischen Kulturzentrum gespielt und danach über die Meinung von Kommilitonen nachgedacht: »Menschenskinder, ihr seid ja richtig gut, bleibt doch zusammen.«
Einerseits dürfte es nicht lange gedauert haben, bis Sie ein gutes Gefühl füreinander hatten und zusammenbleiben wollten. Aber etwas länger werden Sie sicher gebraucht haben, um wirklich einen gemeinsamen Weg ins Auge zu fassen – ich meine gerade nicht als Nebenjob im Orchesterdienst, sondern frei jonglierend ohne Halteseil als Quartettspieler im Hauptberuf, mit allen Risiken und unkalkulierbaren Nebenwirkungen einer solchen Existenz. Gab es in der Musiklandschaft der DDR da überhaupt ein Vorbild?
SFE: Quartette existierten in der DDR nur aus Orchestern heraus, gebildet von Konzertmeistern mit Sonderverträgen. Wirklich freischaffende Quartette gab es nicht. Wir betraten da einfach Neuland, zumal wir gerade erst um die zwanzig und am Anfang des Studiums waren. Als wir zu spielen begannen, war unsere Motivation also noch nicht in eine utopische Ferne gerichtet, sondern ziemlich pragmatisch orientiert: Wir wollten erstens etwas von dem großartigen Repertoire einer Gattung kennenlernen, die zu Recht als Königsgattung gilt und den genialsten Kompositionsbestand versammelt, den uns die Musikgeschichte geschenkt hat. Zweitens hat uns die Intensität und Kontinuität der Arbeit gereizt, die zur interpretatorischen Beherrschung dieser Hohen Schule großer Musik unbedingt notwendig ist. Und zum Dritten war da die Aussicht, einmal an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen und neue Erfahrungen sammeln zu können, vielleicht auch nicht bis zum Rentenalter warten zu müssen, um die westliche Welt kennenzulernen, ein mächtiger, uns beflügelnder Impuls, diese neue Aufgabe ernsthaft anzugehen. Jedenfalls kam die Idee, einen Lebensberuf sui generis daraus zu machen, erst viel später.
SFO: Die berufliche Frage hing meines Erachtens mit unserem Abschneiden beim Internationalen Streichquartett-Wettbewerb in Evian am Genfer See zusammen. Wir hatten ihn 1986 gewonnen, ohne damit gerechnet zu haben. Als Studenten konnten wir ja nicht einmal daran denken, überhaupt dorthin reisen zu dürfen, und bis zum Tag der Abreise blieb ungewiss, ob wir die notwendigen Reisepässe wirklich erhalten würden. Aber nach dem Sieg dann schien die Welt für uns plötzlich eine ganz andere zu sein. In der Heimat waren sie stolz, es regnete Konzerteinladungen, es gab plötzlich keine Grenzen mehr, und wir fühlten uns wie im Traum, wie in ein Reich der Freiheit versetzt. Dadurch allerdings begannen wir uns mit der Frage zu beschäftigen, was wir mit diesem Erfolg eigentlich anstellen sollten, wie man ihn verstetigen konnte. So wurden wir uns bald darin einig, dass sich daraus eine dauerhafte Existenz gründen ließe, auf etwas tragfähigerem Boden als nur auf tönernen Füßen. Und so wuchs die Gewissheit, gerade auf Grund unserer Jugendlichkeit, dass sich das Glück vielleicht doch zwingen ließe. So verkündeten wir ringsum: Wir gehen jetzt einen neuen, einen völlig eigenen Weg. Uns gibt es jetzt als professionelles Quartett, wir fliegen fortan unerschrocken einer Zukunft entgegen, die uns gehört!
Von ihren Gefühlen her gesehen ist das sehr glaubhaft. Aber was wie ein Märchen im Sozialismus anmutet, von dem manche Hollywood-Träume vielleicht nicht weit entfernt liegen, hatte seinen Boden in einer durchaus greifbaren Realität, was Ursachen und Folgen dieses Coups anbelangt. Die Idee zur Teilnahme am Wettbewerb kam wahrscheinlich nicht von Ihnen selbst, obwohl Sie natürlich, trotz DDR, sicher wussten, dass es ihn gab.
TV: Da hat, wie ich mich erinnere, unser Lehrer Feltz eine große Rolle gespielt. Er meinte, wir müssten einen Wettbewerb mitmachen, weil sich das für gute und begabte Studenten so gehöre. Er war natürlich nicht ohne beruflichen Ehrgeiz und wollte Erfolge sehen, weil er sich auch mit anderen Hochschullehrern, nicht nur in Berlin, verglich, deren Studenten schon Erfolge gehabt hatten. Das ist menschliche Realität, zu keiner Zeit und nirgendwo auf der Welt anders.
Aber auch ein Professor Feltz, vielleicht besonders stolz auf einige seiner Schüler, konnte Sie, unter den damaligen Verhältnissen, nicht einfach nach Frankreich delegieren. Da kommt doch bestimmt mindestens noch die Hochschulleitung ins Spiel.
SFO: Das ist eine lange Geschichte. Um zu einem Wettbewerb fahren zu dürfen, musste man vor einer zentralen ständigen Jury aus Spitzenpädagogen der DDR in Leipzig, in der Alten Börse, spielen. Da Quartette eine absolute Nische darstellten – es gab außer uns ohnehin nur zwei oder drei, die in Frage kamen –, war für uns die Geigenjury mit zuständig. Das Ganze war Teil eines gut organisierten Systems der Talentefindung sowie der Nachwuchsförderung, und wenn man das positive Votum der Jury einmal hatte, war die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb denkbar. Die Kriterien waren streng; weniger Qualifizierte wollte man nicht schicken; auch kostete eine Delegierung in eine kapitalistische Region das Land einige Devisen für Reisen, Hotel und Verpflegung.
Diese Vorauswahl, die Sie bestanden hatten, fand ein Jahr vor dem Wettbewerb, also 1985, statt und war offenbar erst einmal ein recht abstraktes Votum, das aber für noch nichts garantierte.
SFO: Das ganze Procedere mit Beantragungen und dem ominösen Reisekader-Status begann erst danach. In diesem Punkt hatte ich eine einschlägige Erfahrung, als ich 1984 an einem Solo-Wettbewerb in Belgrad teilnehmen wollte – in Jugoslawien, das zwar deklarativ noch als sozialistisches, aber ökonomisch schon als kapitalistisches Land galt. Man brauchte also einen Reisepass und ein Visum. Eine Woche vor Beginn kam vom Rektor der Hochschule die Mitteilung, dass ich keinen Pass bekommen konnte, vermutlich hatte jemand etwas dagegen, einen Nicht-FDJler in den Westen reisen zu lassen. Deshalb nahm ich Kontakt mit Manfred Stolpe auf, damals Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, den ich über meinen Vater, der zu jener Zeit Bischof von Berlin-Brandenburg war, gut kannte. Ich wusste, dass Stolpe zum Staatsapparat berufsbedingte Beziehungen pflegte. Wenige Tage später erhielt ich vom Prorektor der Hochschule die Mitteilung, dass ich doch fahren könne – obwohl der Wettbewerb schon kurz vor dem Abschluss stand. Aber immerhin wusste ich nun, dass sich etwas bewegen ließ, und so sprach ich wegen des nahenden Quartett-Wettbewerbs sozusagen vorbeugend wieder bei Stolpe vor, weil mir klar war, dass ich ohne Mitgliedschaft in der Organisation der »Freien Deutschen Jugend« wieder Schwierigkeiten bekommen würde. Diese Extraunterstützung war notwendig, und Stolpe hat es offensichtlich hingekriegt, dass wir nach Evian fahren konnten.
Wie ging es Ihnen dort, was haben Sie konkret erlebt?
FR: Im französischen Evian fand der bedeutendste Wettbewerb für Quartette statt, und wir wollten von vornherein so auftreten (obwohl wir uns vielleicht etwas fremd und klein vorkamen), als ob wir uns hier richtig und wichtig fühlten – genau wie die anderen Teilnehmer mit ihren bisweilen etwas großspurigen Attitüden. Außer uns waren noch 15 weitere Quartette angetreten, die aus ganz Europa kamen. Wir haben ihnen aufmerksam zugehört, und ich dachte sehr oft – trotz meiner selbstkritischen Ader –, dass auch sie nur mit Wasser kochten.
SFO: Ein amerikanisches Quartett war wegen Tschernobyl nicht erschienen, weil die Mitglieder Angst vor atomarer Ansteckung bekommen hatten. Ein anderes, sehr berühmtes, war allerdings als Jury-Mitglied gekommen: das LaSalle Quartet.
Was haben Sie spielen müssen?
FR: In der ersten Runde Mozart, den ersten Satz aus dem A-Dur-Quartett KV 464, eines der Gipfelwerke seiner Quartettkunst aus dem Jahre 1785, als Pflichtstück, dann ein modernes Stück nach freier Wahl. Während die meisten Teilnehmer ein Quartett von Béla Bartók spielten, hatten wir uns für das 2. Streichquartett von György Ligeti entschieden, eines der Schlüsselstücke moderner Kammermusik aus dem Jahr 1967, welches übrigens unsere Juroren, das LaSalle Quartet, in Auftrag gegeben und 1968 uraufgeführt hatten.
SFO: Vielleicht war es ein Riesenglück, dass dieses LaSalle Quartet als gewichtigster Teil einer weitaus größeren Jury uns gehört hat. Wir haben das Stück offenbar so mühelos und engagiert gespielt, dass ihnen, die es doch wie niemand sonst kannten, irgendwie der Unterkiefer herunterhing. Als wir fertig waren, standen sie auf, die vier Berühmtheiten, und applaudierten, was im Rahmen eines Wettbewerbes sehr ungewöhnlich ist. Unter damals nicht unbedeutenden Mitbewerbern wie dem Ysaÿe Quartet, dem Martinu-, dem Verdi Quartett und anderen erhielten wir den 1. Preis, und ich bin sicher, dass wir ihn dem Werk von Ligeti verdankten, auch wieder einer nachdrücklichen Empfehlung von Professor Feltz folgend. Für mich war es psychologisch noch sehr wichtig, dass durch dieses Stück die Jury auf unserer Seite war und zumindest ein Preis in Aussicht stand, der – das war klar ausgesprochen worden – vom Kulturministerium auch unbedingt erwartet worden war! Insofern haben wir dann auch die 2. Runde entspannt angehen können.
FR: Es ist sicher richtig, was Stephan sagt, aber bei mir dominierte in der 2. Runde eher das bange Gefühl, dass es nun wirklich ernst wurde und um etwas Wichtiges ging. Es stieg die Nervosität, und tatsächlich lag es dann an mir, dass im letzten Satz vom Brahms-Quartett eine Stelle (mit diesen kleinen Einwürfen und Pausen) ganz schön geklappert hat. Neben Ligeti und Mozart, der in der letzten Runde komplett gespielt werden musste, gab es noch zwei weitere Pflichtstücke: das Streichquartett von Debussy und das a-moll-Quartett von Brahms – ein erstaunlich kleines, gedrängtes Programm übrigens, wenn man es mit den heutigen, extensiveren, wesentlich umfangreicheren Anforderungen bei Wettbewerben vergleicht.
Wollen Sie etwas über die Modalitäten des Preises verraten?
SFE: Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden: Wir bekamen in Evian den 1. Preis, plus den Preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stücks (also Ligeti), plus den Pressepreis. Wir fuhren also mit insgesamt drei Preisen nach Hause. Alle drei waren dotiert – das war schon einigermaßen spektakulär. Aber mindestens ebenso wichtig waren die internationalen Konzerte, die uns schon gleich in Evian von anwesenden Agenturen und dann gehäuft nach unserer Rückkehr angeboten wurden.
TV: Es war allerdings noch nicht so wie heute, dass gleich Manager mit am Tisch sitzen, Folgeverträge verteilen und Tourneen organisieren, die sowohl für die Veranstalter als auch für die Quartette, die gewonnen haben, günstig sein können – oft mit dem Nachteil, dass sie dann nach dem Jahresvertrag, den sie in der Regel bekommen, wieder in der kalten Luft stehen, denn dann gibt es die nächsten Wettbewerbssieger … Das Preisgeld in französischen Francs war relativ hoch, für unsere Ostverhältnisse wie ein Sechser im Lotto. Ich glaube allerdings, wir durften nicht alles in Originalwährung behalten.
FR: Ich weiß noch ganz genau, wie es war: Von der Gesamtsumme mussten 40 % eins zu eins in DDR-Mark umgetauscht werden. Das heißt, beim Preis kamen auf jeden ungefähr 10.000 DM und von diesem Geld wurden 4000 DM in Mark der DDR gewechselt, während wir den größeren Rest in West-Mark behalten durften. Es kam noch hinzu, dass wir in der Schweiz ein Folgekonzert hatten, mit Franken ordentlich vergütet, die wir gar nicht angegeben haben.
Das nenne ich einen fulminanten Start. Aber was sagte man in der Heimat?
SFO: Bei der Hochschulleitung war die Reaktion eher verhalten. Die Prorektorin wies mich anstelle eines Glückwunsches auf bevorstehende Wahlen hin, die ich wahrnehmen müsse, weil es auch für Preisträger keine Sonderrechte gäbe. Olaf Koch, unser Rektor bis 1986, war uns wohlgesinnt und hatte die Reise nach Evian befürwortet, aber sein Nachfolger Erhard Ragwitz, der komponierende Gatte der damals mächtigsten Kulturbeamtin im Zentralkomitee der SED, Ursula Ragwitz, behandelte uns mit erheblicher Missgunst, fast wie Aussätzige, und bestand pedantisch darauf, dass wir unser Studium korrekt abschließen. Auftritte im Quartett, Reisen, gar ins westliche Ausland, machte er vollständig davon abhängig. Man muss natürlich zugeben, dass wir in gewissen Nebenfächern, der eine in Philosophie, der andere in Politischer Ökonomie, ein dritter im Sport, nicht gerade rühmlichen Eifer entfalteten und Gefahr liefen, das Diplom verweigert zu bekommen. Aber wir unterstellen einmal, dass sein Groll vor allem daher rührte, dass wir freiwillig Musik von Ligeti – in seinen Augen skandalöserweise ein Dissident, ein Verräter am Sozialismus und ein Kapitalistenknecht – und nicht besser das Werk eines Komponisten aus der DDR, will sagen: von ihm selbst gespielt hätten.
Aber Sie haben Ihre Abschlüsse schließlich bekommen.
SFO: Dabei waren unsere Fachlehrer, die Professoren Alfred Lipka, Josef Schwab und Eberhard Feltz, extrem hilfreich, so dass wir in Windeseile doch alle unsere Abschlüsse bekamen und im Winter 1987 dann mit unserem Studium fertig wurden. Nach dem Evian-Erfolg waren wir zwar sofort in der Künstleragentur der DDR, der staatlichen Vermittlung von Konzerten, registriert worden, aber deren Vertreter, ein Herr Dr. Lang, kam mit Begleitung zu uns in die Hochschule und sagte: »Gentlemänner, es ist ja wenig erfreulich, dass Sie Ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben, so können wir natürlich nicht ins Geschäft kommen. Machen Sie erst einmal Ihre Hausaufgaben!« Wir haben sie dann gemacht, aber bis dahin wurden wir absolut restriktiv behandelt, so dass ich abermals zu Manfred Stolpe gehen und ihn bitten musste, uns zu helfen (was er getan hat!), um einer Einladung zum Schleswig-Holstein Festival 1987 folgen zu können. Dabei hat er höchstwahrscheinlich Kanäle nutzen müssen, die auch zur Staatssicherheit führten und die man ihm später, als er Ministerpräsident von Brandenburg war, zu Unrecht ankreidete. Diese Vorwürfe haben sicherlich ihren Grund darin, dass er Kontakte hatte, die inoffiziell waren. Aber die Frage ist ja, inwieweit und zu welchem Zweck er sie genutzt hat – im Sinne des Staates oder um damit Menschen, wie etwa auch uns, helfen zu können.
Nach dem Abschluss des Studiums hätte eigentlich jeder von Ihnen auch eine normale Laufbahn als Orchestermusiker antreten können. War das überhaupt ein Thema für Sie oder stand nun endgültig fest, dass Sie sichnicht mehr trennen und – mit Beethoven gesprochen – gemeinsam dem Schicksal in den Rachen greifen wollten?
SFE: Da gab es natürlich auch noch andere Überlegungen: Erstens konnte man versuchen, gute Orchesterstellen, vielleicht sogar einen Gemeinschaftsvertrag bei einem Orchester als Stimmführer zu bekommen. Oder als zweite Variante, was nach wie vor Neuland bedeutete, weil es in der DDR so etwas bis dahin nicht gegeben hatte: freischaffend Quartett spielen und damit unser Einkommen verdienen.
TV: Ich persönlich kann mich eigentlich an kein Gespräch unter uns vieren erinnern, in welchem wir das so richtig thematisiert und wirklich als Zukunftsvision erwogen haben. Meiner Erinnerung nach bestand da eine günstige Situation: Alles lief für uns wunderbar, alles, was passierte, schlug uns irgendwie zum Erfolg aus, wir wollten das Gegebene nutzen und ausbauen, aber nicht ändern oder preisgeben. Irgendein Schutzengel muss über uns gewacht haben, denn beispielsweise mussten wir alle vier keinen Armeedienst leisten, was keineswegs selbstverständlich für Musiker war. Wir wurden nicht ausgemustert, sondern immer wieder nur zurückgestellt – bis die Armee weg war und die Bundeswehr uns offensichtlich nicht mehr gebrauchen konnte. Erspart blieb uns auch die Erfüllung einer zu Beginn eines Studiums unterschriebenen Selbstverpflichtung, nach dem Abschluss zunächst für drei Jahre in ein Orchester zu gehen, welches der Staat für uns bestimmte, wenn man kein Probespiel für sich entscheiden konnte, damit die vielen Orchester – es waren am Ende immer noch über 80! – spielfähig blieben. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, auch nur zehn Jahre zusammen zu bleiben, und anstatt Visionen zu produzieren, sind wir Schritt für Schritt gegangen.
Hat Ihr Lehrer auch weiterhin den Lehrer gegeben oder besser: als Mentor gewirkt?
TV: Professor Feltz stand immer im Hintergrund mit seinem edlen Ehrgeiz, uns weiter und höher hinaus helfen zu wollen. Wie leicht kann ein Quartett auseinander fallen, wenn andere sichere Pfründe winken oder vielleicht eine Familiengründung schon vor der Tür steht. Da hat er stets gegengehalten: »Ihr müsst das machen, ihr seid dafür quasi geboren, man muss seinem Weg folgen, suchen, arbeiten, spielen. Dran bleiben. Ihr braucht ein Auto, müsst Konzerte spielen, müsst proben und Repertoire erarbeiten! Ihr müsst eine Musizierform, eine Spielart retten, die bei uns vom Aussterben bedroht ist!« Vielleicht bezog er sich dabei auf das Nasdala Quartett, das kurz vor uns sehr erfolgreich begonnen hatte, aber rasch zerbrach, als die Männer zum Wehrdienst eingezogen wurden. Er hat uns allen mit einer gemeinsamen Assistentenstelle geholfen, damit wir finanziell eine kleine sichere Lebensgrundlage und den Kopf für das Quartett frei hatten.
FR: Ich war mit meinen beruflichen Aussichten für das Quartett eine Zeitlang schon fast verloren. Noch während des Studiums war ich beim Berliner Sinfonie-Orchester mit einem Probespiel erfolgreich, aber unser Lehrer Feltz ärgerte mich mit seinen abfälligen Bemerkungen vom künftigen Musikerbeamten mit Häuschen am Müggelsee. Ich habe mich gleichsam nach Dresden geflüchtet und eine Stelle als stellvertretender 1. Konzertmeister angeboten bekommen. Schließlich habe ich darauf verzichtet und bin zum Quartett zurückgekehrt, weil ich das gemeinschaftliche Musizieren dieser herrlichen Kammermusik-Partituren ebenso wenig missen wollte wie die Gemeinsamkeiten einer Gruppe, in der man freundschaftliche Konstellationen vorfindet.
Ich gehe davon aus, dass die Künstleragentur der DDR auch Sie managte, da es ja überhaupt nur diese eine Vermittlungsstelle für Auslandsgastspiele gab, die auch die leidigen Pass- und Visa-Angelegenheiten zu regeln hatte.
TV: Sie hat die Einladungen aus dem Westen für uns bekommen, bearbeitet und mit uns abgestimmt. Ihre Arbeit unterschied sich nicht sehr von heutigen, privaten Konzertagenturen. Sie haben für uns Verträge gemacht, die im Prinzip sauber ausgehandelt waren, einschließlich der fälligen Provisionen. Es gingen 20 % an Provision ab, weitere 30 % mussten im Falle von Deviseneinkünften in Mark der DDR umgetauscht werden, den Rest hatte man in Originalwährung für sich. Nach der Wende 1989 reduzierten sich sowohl die Provision als auch der dazugehörige Zwangsumtausch auf je 12,5 %. Innerhalb des Systems der DDR konnten wir uns damit als privilegiert und sogar als reich betrachten.
SFO: Es gab die kurios-angenehme Praxis vonseiten des Innerdeutschen Ministeriums in Bonn, automatisch jedes Konzert eines ostdeutschen Musikers oder einer Musikergruppe mit 1000 DM zu bezuschussen. Ein schöner Wettbewerbsvorteil – denn uns einzuladen kam jeden Veranstalter um 1000 DM günstiger!
Für Leser, die mit den Lebens-Usancen in der DDR nicht vertraut sind, sollte einmal gesagt werden, was man dort mit diesem sogenannten Westgeld anfangen konnte, obwohl es ja keineswegs offizielles Zahlungsmittel war.
TV: Es war in der DDR außerhalb der sogenannten Intershops für Waren aus dem westlichen Ausland eigentlich nicht erlaubt, bares Westgeld als Zahlungsmittel zu verwenden. Man durfte das offiziell verdiente Westgeld nur auf einem Konto der Staatsbank der DDR haben und in Form von sogenannten Forumschecks wieder abheben. Forumschecks – das war eine Ersatzwährung, die eins zu eins zur D-Mark stand und mit der man im Intershop einkaufen konnte. Alles andere war im Prinzip illegal, aber es hat nie jemand auch wirklich kontrolliert, ob man Bares besaß und damit einkaufte, weil man es eben auch nahm. Der Staat war scharf auf jede Mark, in welcher Form auch immer! Und es war ein Widerspruch bis zum Nonsens, dass die Künstleragentur nie danach fragte, wie wir das handhabten. Natürlich brachten wir Bares über die Grenze mit nach Hause und hätten, entsprechende Summen vorausgesetzt, sogar Immobilien oder Autos en masse erwerben können – von Handwerker-Leistungen ganz zu schweigen, die man am Ende oft nur noch über bares Westgeld bekam.
Ich nehme an, dass Ihnen das Ausmaß Ihrer Privilegierung durchaus bewusst war. Das mag in vielerlei Hinsicht angenehm gewesen sein, gab es aber nicht auch Probleme, sie Ihrer Mitwelt plausibel zu machen?
SFO: Ja, das war durchaus der Fall. Wenn wir zu Hause oder im Kreis von Freunden von unseren Westreisen berichteten, gab es als Reaktion oft nur lange Gesichter. Auch meine Freundin war irgendwann erschöpft von der Begeisterung über das, was nicht sie, sondern der Partner erleben durfte. Also lernte man, seinen Überschwang zu dämpfen und zu kontrollieren, was man wie erzählt oder vielleicht gar nicht.
FR: Bei mir war das ähnlich. Natürlich freuten sich meine Familie, meine Eltern und mein Bruder ganz prinzipiell darüber, dass einer aus der Familie es geschafft hatte, die Verhältnisse sozusagen zu überlisten und mit zwei einander feindlich gesinnten Systemen zu leben. Doch wenn man in Erzählungen zu ausführlich, zu detailliert die andere Seite ins Paradiesische steigerte, verrieten die Augen eine Art Unbehagen und Missmut, die zur Rücksicht auf die Zurückgebliebenen ermahnte. Wir hatten im Dienstpass ein Dauervisum, mit dem man praktisch jeden Tag nach Westberlin fahren konnte. Ich bin aus Neugier eine Zeitlang – ohne Geige – fast jeden Abend zu einem Freund gefahren. Wir sind ins Kino, in die Philharmonie, den Tiergarten oder eine Kneipe gegangen. Solche Erlebnisse auf der falschen Seite der Mauer konnte man daheim wirklich niemandem erzählen!
TV: Wir standen permanent mit einem Bein im Osten und mit dem anderen im Westen und lebten mit zwei Währungen, die offiziell nicht kompatibel, aber in Phantasiegrößen illegal zu wechseln waren – was das Leben zu Hause noch einmal um vieles preiswerter für uns machte. Solche Privilegien (mit ungewollten Nebeneffekten) gewährte die DDR einer gewissen exklusiven Schicht von Künstlern und Wissenschaftlern, weil sie einerseits hoffte, dadurch deren Laune zu heben und den stets zu befürchtenden Weggang nach dem Westen zu minimieren. Andererseits wollte sie als ein weltoffener Kulturstaat gelten, der natürlich, wenn auch nur auf dem Papier, die Freiheit der Kunst anerkannte und die Freizügigkeit im Umgang mit den Künstlern, wenn auch strikt auf Spitzenkräfte beschränkt, damit unter Beweis stellte. Diese Art eines der Umwelt gegenüber etwas entfremdeten Lebens schweißte jedoch das ohnehin durch die Arbeit und das Reisen geförderte Gefühl von uns vieren als einer verschworenen Gemeinschaft noch enger zusammen; rückhaltlos über alles sprechen konnten wir ohnehin nur in unserem eigenen Kreis.
Gab es seitens der Agentur bei der Auswahl ihrer Engagements politisch begründete Bevorzugungen oder Vermeidungen einzelner Weltreligionen und gab es namentlich irgendeinen Proporz im Verhältnis von in- und ausländischer Präsenz?
SFO: Nicht dass ich wüsste. Wir haben überall in Europa und ab 1989 sogar in Amerika dort spielen können, wohin man uns eingeladen hatte. Für andere Sparten gab es möglicherweise Auftrittsbeschränkungen für die Bundesrepublik und noch stärker für Westberlin, aber für uns nicht. Wir haben auch in Westberlin gespielt, sogar Konzerte, die vom Sender Freies Berlin live übertragen worden sind, und wir haben in diesem Sender auch Aufnahmen produzieren können. Dort hat uns mal eine Journalistin anlässlich eines Interviews gefragt, ob wir ein freies Quartett seien. Sie meinte das im Hinblick auf den rechtlichen Status freischaffender Künstler, aber Frank hatte sofort mit süffisantem Bezug auf die politische Dimension die Gegenfrage parat: »Wie meinen Sie das – frei?«
TV: Innerhalb der DDR haben wir natürlich auch gespielt. Da gab es die Konzert- und Gastspieldirektion, das Inlands-Pendant zur staatlichen Künstleragentur. Sie vermittelte Auftritte in großen und kleinen Städten, oft hießen die Formate »Stunde der Musik«. Wir traten dort auf mit schönen, aber manchmal auch kuriosen Erlebnissen. Einmal sind wir nach Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern gefahren, wo ein kleiner Saal mit nur 15 Plätzen so ärmlich gefüllt war, dass genau so viele Stühle besetzt waren, wie Musiker auf dem Podium saßen. Vier vereinzelt sitzende Leute gegen eine musizierende Viererbande, das hätte eine theatralische Performance à la John Cage werden können, mit gegenseitigen kommunikativen Verlautbarungen oder Verstörungen, wenn nur dieses Rumpf-Publikum nicht so total verschüchtert dagesessen hätte und wir nicht so frustriert gewesen wären.
Wie haben Sie eigentlich die oft erheblichen Strecken bewältigt, die zwischen Berlin, Ihrem Wohnort, und den Orten Ihrer Konzerte liegen? Flugzeug? Eisenbahn? Autos?
TV: Alles, aber vor allem: Wir hatten ein gemeinsames Auto! Die DDR baute zwar selbst Autos, aber man musste auf sie, je nach Typus, zehn, zwölf oder mehr Jahre warten. Bei uns sah es nach dem Studium so aus: Wir hatten alle die Fahrprüfung gemacht, aber wir besaßen, mit Ausnahme von Frank, keinen fahrbaren Untersatz. Die Lösung bestand wiederum in einem Privileg: einige Auserwählte in der Kunst und in anderen Bereichen konnten, wenn sie zahlungsfähig waren, einen Westwagen bekommen. Wir erfuhren, dass der Dresdner Startrompeter Ludwig Güttler so etwas vermitteln könne (siehe S. 350 f.). Wir nahmen Kontakt mit ihm auf, und es stellte sich heraus, dass er tatsächlich etwas Passendes in Frankfurt / Main zu stehen hatte, einen Opel Senator mit Drei-Liter-Maschine, wunderbarer Reisewagen mit Vollausstattung. Der Deal musste zunächst beim Ministerium beantragt werden, und da unsere Gründe offensichtlich stichhaltig klangen, wurde nach monatelangem Warten, wieder ausnahmsweise, die Einfuhr eines Autos aus dem sogenannten nichtsozialistischen Währungsgebiet genehmigt. Zwei Bedingungen gab es: erstens Hinterlegung des Kaufpreises auf einem Konto der Staatsbank der DDR (was die Einzahlung der Summe in D-Mark bedeutete) und zweitens Vorlage des Fahrzeugbriefes im Original.
Was ja vollkommen verquer ist, denn Westgeld gab es doch als offizielles Zahlungsmittel eigentlich gar nicht.
TV: Eben, aber das war der Knackpunkt – vielleicht von uns ein Missverständnis damals –, dass wir im Prinzip ein Konto brauchten, um den Kaufpreis zu hinterlegen, und zusätzlich die gleiche Summe ein zweites Mal in bar, um das Auto zu kaufen und den Fahrzeugbrief zu bekommen. Den Kauf für 16.000 DM besorgte uns Ludwig Güttler mit einem Vorschuss, die gleiche Summe zahlten wir aus unserem eigenen Kapital in der Staatsbank der DDR ein, zuzüglich eines Zolls für den Gebrauchtwagen in Höhe von 18.000 Mark der DDR. Ich eröffnete also ein Valuta-Konto und zählte das Westgeld in baren Tausendern von unseren mitgebrachten Gagen auf den Banktresen – umringt von neugierigen Leuten, die in der Schlange standen, um polnische Zloty oder ungarische Forint einzutauschen und sich wohl argwöhnisch wunderten, wie reich manche Leute mit fremder Währung werden konnten. Jedoch kam der wirklich schwierige Punkt erst, als ich später das Geld wieder einlösen wollte, um unsere Schuld bei Güttler abzutragen. Das aber war überraschenderweise trotz der Genehmigung zur Wageneinfuhr nur entweder eins zu eins in DDR-Mark oder in Forumschecks für die Intershops möglich. Großer Schreck und erneute Eingabe, ganz nach oben, erneutes langes Warten, endlich auch diesmal ausnahmsweise Genehmigung! Wieder in der Bank ein quasi öffentlicher Vorgang vor Publikum, und ich vergesse weder die kalte Wut des Beamten, mit der er mir den Packen Westgeld auf den Tresen knallte, noch die an Lynchjustiz grenzende aufgereizte Stimmung der zuschauenden Menge, die nach solchen Summen baren Sehnsuchtsgeldes nur mit Erbitterung lechzen konnte. Auch Güttler war not amused, so lange auf sein Geld warten zu müssen, und beschied uns mit dem Wink: »Ihr Idioten, warum habt ihr das Geld überhaupt eingezahlt!«
Wohin ging die erste Fahrt?
FR: Nach Roussillon in Südfrankreich. Den Wagen haben wir in Hofheim am Taunus, wo er stand, erst ausgiebig bestaunt und dann zur Jungfernfahrt bestiegen. Ich hatte mit meinem Trabant die meiste Fahrerfahrung und durfte deshalb einen ersten Streckenabschnitt bewältigen. Danach wurde in genau gleichen Zeitabständen gewechselt, und gemeinsam drehten sich bei jedem Spurenwechsel die Köpfe in die gleiche Richtung nach hinten. Wir wollten nicht schneller als 130 km/h fahren, aber es wurden in diesem neuartigen Freiheitsrausch auch schon mal 200 km/h. Es war, die Musik nicht gerechnet, eine bis heute unvergessene Geschichte, die viel über DDR-Mentalität, auch unsere damals noch jugendliche, erzählt.
Roussillon 1987
Westberlin Mai 1986, mit vom Preisgeld in Evian erstandenen Hifi-Anlagen
Ende mit Wende (1989/90)
Zu den Gaben des Staates an begabte Nachwuchskünstler gehörten besondere Stipendien mit der Absicht, herausragende Leistungen zu prämieren und zu stimulieren. Man sollte aber dazu wissen, dass jeder Student in der DDR ein Grundstipendium bekam – es belief sich auf 210 Ostmark pro Monat und garantierte angesichts spottbilliger Mieten und niedriger Lebensmittelpreise ein im Grunde sorgenfreies Auskommen. Wie verhielt es sich mit dem Leistungsstipendium, das Sie zusätzlich zum normalen erhielten?
TV: Es wurde uns als Auszeichnung für den gewonnenen Wettbewerb in Evian zugesprochen, so wie jedem Preisträger eines internationalen Wettbewerbs. Dieses »Mendelssohn-Stipendium« belief sich auf über 400 Mark im Monat und ergab zusammen mit dem Grundstipendium fast das durchschnittliche Nettoeinkommen eines normalen Arbeiters oder Angestellten. Es war mehr als genug, wenn man noch die Preisgelder selbst und die laufenden Konzertgagen in Ost und West hinzurechnete. Als wir uns nach der Verleihungs-Zeremonie zur ersten Quartett-Probe wiedersahen, meinte einer von uns, wir sollten doch alle einmal unsere Konten beschauen. Zu unserer großen Verblüffung war der monatliche Betrag doppelt überwiesen worden, einmal vom Ministerium für Kultur, ein zweites Mal von unserer Musikhochschule, offenbar ohne voneinander zu wissen. Wir warteten noch den nächsten Monat ab – wieder doppelte Zahlung –, und wahrscheinlich wäre das endlos so weitergegangen, wenn nicht protestantisch-preußisches Pflichtbewusstsein und eine anerzogene Ehrlichkeit uns dazu angehalten hätten, davon Meldung zu machen. Im Gegensatz zu einigen anderen uns damals bekannten Fällen, wo man die Sache weiterlaufen ließ. Ohne Dank oder anderen Kommentar blieb es bei uns dann bei nur einer Zahlung.
FR: Hm … wir dachten aber, dass die Stasi unsere Ehrlichkeit testen wollte, haben ausführlich darüber beraten und kamen zu dem Schluss, dass man dies als Einzelstipendiat vielleicht noch »übersehen« haben könnte, wenn es auffliegt, nicht aber zu viert. Also haben wir es gemeldet, denn das konnte ja nur ein Test sein. Wir fanden später heraus, dass es schon jahrelang bei allen Stipendiaten so gelaufen war.
In gewisser Weise waren die Vorzüge Ihres Lebens in der DDR-Hauptstadt eine kleine Kompensation für die enormen Anstrengungen, die Sie auf sich nahmen, um als Berufsquartett zu bestehen. Ich denke dabei gar nicht in erster Linie an die Strapazen des Reisens oder die unerhörte Konzentration, die ein Konzertabend abverlangt. Sie waren von Evian de facto mit vier geprobten Stücken zurückgekommen und brauchten doch erst noch ein Repertoire, mit dem Sie professionell konzertieren konnten. Also müssen Sie in den ersten Jahren eigentlich ununterbrochen neue Werke einstudiert haben. Wo ist das geschehen?
SFO: Geprobt haben wir in der Regel bei meinem Vater in Berlin-Weißensee, der als Bischof eine Dienstwohnung hatte. Sie lag in einem enggeschossigen, langgestreckten Gebäude, das eher einer Baracke ähnelte. Innen sah es aus wie ein DDR-Neubau, mit relativ niedrigen Decken, aber auch einer ganzen Menge mehr oder weniger großer Räume. Eines der Wohnzimmer bot ausreichend Platz für uns – darin konnten wir bis spätabends üben, so oft und so lange wir wollten. Direkt daneben lag das Arbeitszimmer meines Vaters, der nach dem Tod meiner Mutter 1987 diese menschlich-akustische Belebung wohl nicht ungern sah und sie sogar einmal kurioserweise quasi dienstlich zu nutzen wusste. Als er einen Routinebesuch vom Ständigen Vertreter der Bundesrepublik bekam – es war damals Hans Otto Bräutigam –, bat er uns, irgendetwas Kräftiges und Lautes zu spielen, damit eventuell mitlauschende Sicherheitsbehörden größere Schwierigkeiten hätten, die Gespräche der beiden zu verstehen.
Ist das eine Vermutung oder wart Ihr tatsächlich verwanzt?
SFO: Wir wohnten Parkstraße 21 in direkter Nachbarschaft zur Parkstraße 22, in der die SED-Kreisleitung beheimatet war. Man hätte mit einem Richtmikrofon direkt auf unsere Fenster zielen können. Aber ich bin dem niemals nachgegangen.
FR: Aber ja, ihr wart verwanzt, ich erinnere mich. Da keiner von uns ein Telefon zu Hause hatte, bat ich einmal für einen dringenden Anruf um Benutzung des Diensttelefons im Büro deines Vaters. Als ich meine Nummer gewählt hatte, knackte es kurz in der Leitung und eine Stimme sagte – sie klang wie von nebenan: »Legen Sie bitte auf und wählen Sie noch einmal neu.« Da hatte sich einer verstöpselt, und erst beim zweiten Versuch klappte die Verbindung. Ein klarer Fall.
SFO: Im Grunde hat sich an der Proben-Lokalität bis heute wenig geändert, denn ich wohne wieder in der Parkstraße, allerdings in einem anderen Haus. Dort haben wir einen Probenkeller, der sehr geräumig und perfekt ausgestattet ist. Den nutzen wir, sooft es nötig ist. Wenn es zwischenzeitlich nicht möglich war, zu Hause zu üben, konnten wir manchmal, aber nicht sehr oft, in die Musikhochschule gehen; zumeist aber haben wir dann in der Stephanus-Stiftung in Weißensee proben können und die Miete in Form eines jährlichen Konzerts entrichtet. Diese kirchliche Stiftung, ein Pflegeheim für Senioren, ist nach der Wende stark umgebaut worden; Baulärm und Presslufthämmer haben uns nicht abhalten können, sie mit Klängen neuer Musik zu kontern, aber es war für uns damals eine ganze Zeit lang eine extrem stressige Situation.
Sie mussten sich, um konzertieren zu können, die Quartett-Literatur gleichsam von null auf hundert aneignen. Was und wie haben Sie geprobt?
TV: In der Tat hat uns Evian mit vier Stücken entlassen, es kamen noch ein Mozart und ein Beethoven dazu, die wir auch geprobt und als eine Art Reserve im Gepäck hatten. Ein viel zu kleiner Grundstock für eine Konzert-Karriere! Uns ist dann aber das ein Jahr währende, schikanöse Reiseverbot während des Studiums in gewisser Weise zum Vorteil ausgeschlagen, denn in dieser Zeit konnten wir uns nun erst einmal eine Reihe neuer Werke erarbeiten. Dennoch standen wir vor der veränderten Situation, dass der Mentor, Professor Feltz, der die Stücke für Evian intensiv mit uns erarbeitet hatte, danach nicht mehr in gleicher Weise zur Verfügung stand und wir gewissermaßen allein auf uns gestellt waren. Wir empfanden das, namentlich im Hinblick auf die großen, vielgespielten, aber schwer zu realisierenden Brocken wie etwa Schuberts »Der Tod und das Mädchen«, als eine ziemlich riskante Situation für uns Neulinge. Natürlich haben wir zur Kontrolle die Stücke hin und wieder Herrn Feltz oder auch meinem Vater einmal vorgespielt, um sicher zu sein, dass wir in der Stilistik der Interpretationen nicht ganz danebengegriffen hatten. Aber die eigentliche formale, inhaltliche, dramaturgische Durchdringung der Werke, auch die technischen Festlegungen vom Tempo über Dynamik und Agogik bis zum Bogenstrich, das alles musste nun überwiegend im internen Dialog unter uns vieren überlegt und festgelegt werden. Damals war es so, dass wir gegenüber den Veranstaltern meist selbst bestimmen konnten, wie unser Konzertabend aussehen soll, das heißt, es konnten die Stücke sein, bei denen wir uns besonders wohl fühlten, weil sie hinlänglich geprobt waren. Darunter befand sich stets ein Werk der neuen Musik, für die wir uns durch den Sieg in Evian mit dem Stück von Ligeti besonders prädestiniert fühlten – eines unserer Markenzeichen eigentlich bis heute.
SFO: Ich muss hier nicht gerade widersprechen, aber so ganz ohne erfahrene Anleitung waren wir dann doch nicht, und zwar auch über Professor Feltz und deinen Vater hinaus. Zum Beispiel haben wir direkt nach Evian eine Einladung vom LaSalle Quartet zu ihrem Meisterkurs nach Basel bekommen, wo wir ganz intensiv Haydns op. 20/4 und Beethovens »Große Fuge« erarbeiteten. Sie legten uns nahe, unbedingt die Quartette der Zweiten Wiener Schule zu studieren – was wir auch getan und später mit ihnen gemeinsam geprobt haben. Wir besuchten auch andere Kurse wie etwa das Orlando Festival in Kerkrade (Holland), wo wir durch Kontakte und Fachgespräche mit András Mihály, Arnold Steinhardt oder Sándor Végh durchaus viel gelernt haben.
Wir lernen Eberhard Feltz in den biographischen Monologen ausführlich als charismatischen Hauptfachlehrer für Violine kennen, an dieser Stelle sollten wir aber noch detaillierter etwas über seine Rolle als Mentor des Quartetts erfahren.
TV: Er war auch in der Quartettarbeit eine wirkliche Koryphäe und verstand es, mit uns wie ein Dirigent Partituren zu erarbeiten. Er studierte sie so lange, bis sie in Bezug auf Architektur, Harmonik, Polyphonie und auf das Verhältnis von Haupt- und Nebenstimmen vollständig transparent wurden. Er war ein Meister in ihrer psychologischen Ausdeutung, indem er quasi jeder Stelle einen inhaltlichen Sinn gab, der auch mit der formalen Position innerhalb des Ganzen korrespondierte und übereinstimmte. Dadurch hatten wir einen Wettbewerbs-Vorteil gegenüber anderen Gruppen, die vielleicht nicht weniger gut gespielt haben, denen aber, wie soll ich sagen, ein solches visionäres Konzept fehlte, das bei uns stets auch beim Spielen durch die Zusammenarbeit mit Feltz im Hinterkopf präsent war.
Sie haben also die Stücke erst einmal für sich bis zu einer gewissen technischen Reife geübt und sie ihm dann vorgetragen, um das Resultat gemeinsam zu diskutieren und in eine definitive Klangform zu bringen.
FR: Na ja, das von uns Gespielte wurde von ihm stets mit allerhöchster Aufmerksamkeit angehört und, wenn nötig, erbarmungslos erst einmal wieder auseinandergenommen und einem neuen Probieren ausgesetzt. Dabei ging es wirklich um alle Facetten des Quartettspiels. Vor allem aber immer darum, der Musik ein unverwechselbares Profil zu geben, Geschichten zu erzählen, erfüllt zu spielen. Seine Bilder zu bestimmten Stellen habe ich bis heute im Kopf. Und ich höre bis heute sein knurrendes, forderndes »noch!« während unseres Spiels. Wir dachten, dass wir bereits ziemlich gut ausführten, was er von uns verlangte. Er aber wollte mehr. Ich erinnere mich an den 2. Satz von Brahms Streichquartett op. 51/2. Es gibt einen großen dramatischen Dialog zwischen erster Geige und Cello. Das Cello war ihm nicht charakteristisch, vor allem nicht kräftig genug, und wir spielten die Stelle so lange, bis Stephan, schon mächtig in Rage, regelrecht mutwillig forcierte für unsere Ohren. Feltz sagte dann: »Ja, so war das Cello ein bisschen besser zu hören, aber 50 % mehr musst Du schon noch geben.« Er führte uns über unsere Grenzen hinaus. Und er stellte Aufgaben – ein wichtiger Teil des Unterrichts konnte seine lapidare und für ihn ganz typische Frage zu einer musikalischen Passage sein, »Was ist das?«, ohne sie zu beantworten. Und da wir natürlich keine Antwort wussten, schleppten wir die Frage verunsichert bis zum nächsten Termin mit uns herum. Heute denke ich, dass er genau das beabsichtigte: keine Antwort, sondern Nachdenken, das zu eigenen Einsichten und damit zu neuen klanglichen Visionen führen konnte.
SFE: In dieser Hinsicht möchte ich Tims Vater erwähnen. Die Feltz’schen Sentenzen – ihr Geiger kanntet ihn ja besser – blieben mir in ihrer Abstraktheit und Lakonie doch gelegentlich etwas rätselhaft. Dann war es Michael Vogler, der – wenn er uns als Quartett ebenfalls zeitweise betreute – solche enigmatischen Verlautbarungen ein wenig ausgedeutet und in eine praktische Richtung übersetzt hat.
SFO: Einen Tag vor der Abreise nach Evian haben wir Feltz noch einmal das a-moll-Quartett von Brahms vorgespielt. Seine Reaktion: »Ich weiß nicht, also der letzte Satz …« Er hat unsere ganze Konzeption des Finales gleichsam noch einmal auf den Kopf gestellt, und wir dachten: Muss das jetzt so kurz vor dem Wettbewerb noch sein! Er hatte das Gefühl, dass musikalisch irgendetwas noch nicht stimmte und anders gespielt werden müsste. Wir haben das dann auch probiert und wahrscheinlich – den schließlichen Erfolg bedenkend – war es etwas, das wir noch gebraucht haben. Aber man frage nicht, was es eigentlich war! So geht es eben manchmal mit der Musik.
SFE: Mir ist aus dieser ganzen Anfangs- und Aufbruchssituation vor allem der ständige zeitliche Druck in Erinnerung, unter dem wir probten und spielten. Und wir probten und spielten sehr viel, denn wenn unser Repertoire zunächst auch relativ klein war, so wollten wir es doch in maximaler Qualität erhalten und verbreiten. Wir haben immer an der Kante gearbeitet, mussten Neues einstudieren, Bekanntes repetieren, dieses lernen, jenes aufbereiten. Es gab Anfragen nach Stücken, die wir noch nicht konnten, und es gab Wünsche von uns selbst, gewichtige Lücken im Repertoire zu füllen, wofür allerdings die Zeit zunächst fehlte. In puncto planerische Logistik vollzog sich unser Quartettleben zumeist in harten, angespannten Situationen.
SFO: Natürlich, wir hatten Konzertverpflichtungen und ein dünnes Repertoire, also mussten wir lernen, zu jeder Zeit, bei jedem Wetter. Im heißen Sommer 1986 beispielsweise probten wir in meiner Pankower Wohnung, und jeder hatte eine Schüssel mit kaltem Wasser, in das wir die Füße tauchen konnten. Wir haben so lange geprobt, bis die Nachbarn an die Wand klopften. Nachdem sie uns aber einmal in der »Tele-Illustrierten« des Westfernsehens gesehen hatten, war großes Staunen und alles gut: Wir durften danach üben, so viel und solange wir wollten. Und wir nutzten auch jede Minute, um unser schmales Repertoire zu erweitern. Aber andererseits haben wir uns auf Reisen auch die Zeit genommen, Sehenswürdigkeiten zu betrachten und Museen zu besuchen, vor allem die von uns so besonders geliebten Impressionisten zu bestaunen. Man hatte ja immer das Gefühl, sich in einer Karriere auf Abruf zu befinden, vielleicht nicht wiederkommen zu dürfen. Jeder Besuch konnte der letzte sein – diese Verunsicherung hatte man immer mit im Gepäck, sozusagen als Drohung des Staates, sich im Ausland stets nach dessen Normen (die mitgegeben wurden) bei Strafe botmäßig verhalten zu müssen.
FR: Ich war während der Geigenstudienzeit erstmalig mit dem Quartett für ein paar Tage in Paris, obwohl ich mich auf das DDRinterne Auswahlvorspiel für die Teilnahme am Carl-Nielsen-Wettbewerb in Dänemark vorbereiten musste. Das berauschende Erlebnis der Stadt, ihr einzigartiges Flair, ihre phantastischen Museen, ihr gewaltiger Reichtum an Architektur wie an Restaurants ließen mich die Geige vollständig vergessen. Erst in Berlin holte mich die Realität wieder ein, als Professor Feltz mich nach dem Stand meiner Vorbereitungen fragte. Ich hatte noch gar nicht begonnen! Er muss entsetzt gewesen sein. Aber statt verärgert zu reagieren, hat er nur gesagt: Du schaffst das, ich helfe Dir. So haben wir dann in zwei Tagen und Nächten das Violinkonzert von Carl Nielsen op. 33 und den Rest meines Programmes einstudiert. Ich fuhr zum Vorspiel nach Leipzig, spielte für meine Verhältnisse außergewöhnlich gut und wurde für die Teilnahme am Wettbewerb nominiert.
TV: So etwas konnte vorkommen, aber trotzdem ging es uns normalerweise wie zum Beispiel Tennisspielern, in deren Welt nur Leistung und Erfolge zählen. Man denkt, die haben ein tolles Leben, verdienen Millionen. Aber in Wirklichkeit leben sie nur auf dem Tennisplatz; das nächste Spiel steht bevor; sie haben den Druck, dass sie gewinnen müssen, weil im anderen Fall das Aus kommt wie das Amen in der Kirche. Sie müssen also alles andere ausblenden und sich ausschließlich auf ihr Spiel konzentrieren. Ich denke, so sehr unterscheiden wir uns davon nicht.
Wie hat solche Fixierung Ihr Verhältnis zu anderen Menschen, besonders zu Ihnen nahestehenden geprägt, zu Frauen oder Freundinnen beispielsweise?
SFO: Quartett und Frauen – das war ein schwieriges Thema. Ich hatte damals etwa zeitgleich mit der Quartettgründung eine Freundin. Es ergab sich ganz klar eine Konkurrenzsituation in zweifacher Hinsicht: Man stelle sich vor, von den 365 Tagen haben wir vielleicht 350 Tage geprobt, meistens sogar zweimal am Tag jeweils drei, dreieinhalb Stunden. Dazu kamen die langen Fahrtwege in dieser trotz Halbierung großen Stadt. Das Problem bestand aber nicht nur in der puren zeitlichen Knappheit für anderweitige Zuwendung, sondern auch in der besonderen hermetischen Vertraulichkeit der Quartettsituation mit ihrem internen kommunikativen Reichtum, der einen Außenstehenden leicht eifersüchtig machen kann.
FR: Das kann ich nur bestätigen. Es gibt sehr viele Leute, die kaum weniger intensiv arbeiten als wir, und eine Frau, die sich mit uns einlässt, weiß eigentlich, was sie zeitlich erwartet. Schlimmer ist in der Tat dieser unterschwellige Neid auf die besondere Art von Intimität, die das Quartett bietet, auf eine bestimmte Intensität des Gefühls und unbeschreibliche Erfülltheit bei der Arbeit; Investitionen also, von denen der Partner gern glaubt, dass sie ihm entzogen seien. Er muss schon besonders großzügig veranlagt sein, um solche Gefühle nicht in sich zu nähren, und dennoch drohen die Beziehungen trotz ernsthaften Bemühens oft zu scheitern. Es ist schwer zu verkraften, dass das Quartett die Nummer 1 in unserem Leben stets war und bis heute geblieben ist.
Einmal angenommen, die ersten Hürden einer Beziehung waren glücklich überwunden, so musste man doch sogleich zur Endstation der Ehe gelangen, musste sie zumindest deklarieren, um überhaupt an eine der kostbarsten Raritäten im Arbeiter- und Bauernstaat zu gelangen: eine eigene Wohnung.
TV: Als Berliner Kind habe ich lange bei meinen Eltern gelebt, während die Auswärtigen im Quartett zur Untermiete oder im Internat wohnten. Ich will nicht fragen, wer im Hinblick auf erotische Versuchungen das bessere Los gezogen hatte, ich jedenfalls hatte ein Zimmer zu Hause; meine Eltern waren, wie das wohntechnisch hieß, »endversorgt«, und somit hatten im Haushalt heranwachsende Kinder keinen Anspruch auf eigenen Wohnraum. Mit ungefähr zwanzig wächst ganz natürlich der Drang, auf eigenen Beinen zu stehen, aber meine Chancen auf eine eigene Wohnung waren gleich null. Um die Geburtenrate zu erhöhen, woran dem Staat sehr gelegen war – er brauchte Arbeiter für die sozialistische Produktion und wollte wohl auch die hohe Zahl von Westabgängen kompensieren –, wurde die Ehe sehr gefördert; aber eigentlich erst, wenn der Nachwuchs sichtbar unterwegs war, begann sich die Bürokratie zu bewegen. Kurzum, es war wieder einmal – zwecks Familiengründung – eine Eingabe an den Stadtbezirk fällig, mit dem Hauptargument, dass ein solches Unterfangen nur gelingt, wenn man sich zuvor in einer gemeinsamen Wohnung ausprobieren könne. Wider Erwarten kam eine Genehmigung, und ich zog, im Glück eines ersten Schritts zur Selbständigkeit, mit meiner damaligen Freundin in eine eigene Wohnung. Geheiratet haben wir – als der Trick gelaufen war – allerdings erst später.
Zu diesem pikanten Thema fehlt nur noch Stefan Fehlandts Kommentar.
SFE: Zu jener Zeit war ich in dieser Hinsicht und auch anderweitig ein klassischer Spätstarter. Ich hatte noch keine Freundin, war mit Haut und Haar dem Quartett verfallen und hatte diesbezüglich also weniger Konflikte.