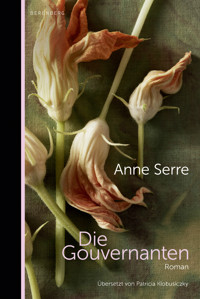Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kaum etwas produziert so viel Literatur wie das Reisen. Auch Anne Serre ist unterwegs, zum Literaturfestival, per TGV erster Klasse. Und schon geht's los: Unverhofft tauchen Familiendramen aus der Erinnerung, wenn der Zug irgendwo hält, wo sich das Leben gegabelt hat. Und dann ist da ein spanischer Kollege namens Vila-Matas, den sie gar nicht kennt, nur seine Bücher, die sie liebt. Sitzt er ihr gegenüber ? Den Hut im Gesicht ? Hat er im Hotel ein Zimmer nebenan bezogen und kommuniziert mit Klopfzeichen ? Ist er gar mit einem Mal Herr des Geschehens ? Wohin geht diese Reise überhaupt ? Ein federleichter Roman, in dem der Schmerz der Erinnerung mit der Wirklichkeit ein fröhlich surreales Spiel treibt. »Anne Serre ist eine veritable Entdeckung.« Meike Feßmann, Süddeutsche Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Serre
Einer reist mit
Roman
Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky
BERENBERG
INHALT
Vila-Matas leitet Ermittlungen ein
Gesamtansicht des Frühlings
Quellennachweise
Über die Autorin
Im Juli 2015 erhielt ich per Mail eine Einladung von Hélène Brigand, Vorsitzende des Vereins »Lettrines«, am zehnten Literaturfestival in Montauban teilzunehmen, das vom 20. bis 25. November stattfinden würde. Ehrengast des Festivals war die Schriftstellerin Inès Delattre, und in dieser Eigenschaft bat sie einige ausgewählte Autoren, dort mit ihr zu diskutieren. Ich kannte Inès Delattre kaum. Wir waren uns 2010 einmal begegnet, im Rahmen des Projekts »Die kleine gelbe Mauerecke«, bei dem ein Dutzend Schriftsteller und Schriftstellerinnen sich von einem im Louvre ausgestellten Kunstwerk zu einer Erzählung anregen lassen sollten. Anlässlich der Lesung unserer Texte im Auditorium des Museums hatten wir uns flüchtig gesehen, und ihr Gesicht, ihre Figur, ihre ganze Erscheinung hatten mir gut gefallen. Auf mich wirkte sie witzig und geistreich, was sich später bei der Lektüre ihrer Werke bestätigte. Also nahm ich die Einladung von Hélène, die in Wahrheit eine Einladung von Inès war, ohne zu zögern an und bereitete mich am 23. November darauf vor, am nächsten Tag nach Montauban zu reisen.
Ich stehe nicht gern früh auf. Seit nunmehr zehn Jahren bleibe ich so lange liegen, wie ich möchte, gut und gern bis neun, aber vor allem schätze ich einen ruhigen Vormittag ohne jede Störung. Wenn nichts Besonderes ansteht wie diese Reise nach Montauban mit einem Zug, der um halb neun abfährt, stelle ich mir nie den Wecker. Ich beende meine Träume gern ganz entspannt im Halbschlaf, bevor ich einen Fuß auf den Boden setze. Danach mache ich mir Kaffee und hänge dabei meinen Gedanken nach, ehe ich meinen Computer einschalte, oft ohne die Vorhänge in meinem Arbeitszimmer aufzuziehen, trinke meinen Kaffee, drei bis vier Tassen, esse zwei Stück Zwieback, während ich meine Mails lese, rauche ganz schnell eine Zigarette, dann zwei, dann drei. Ich bin morgens sehr gern allein zu Hause, denn wie Walser sagte, ist es »die Zeit der Unternehmung«, auch wenn ich in Wahrheit meistens nicht so viel unternehme, aber ich versinke in meinen Träumen, und das ist, wie der mexikanische Romancier Juan Torres meinte, »der Fluss der Wiedergeburt«.
Bevor ich mich zu einer literarischen Veranstaltung aufmache, erliege ich am Vorabend fast der immer gleichen Versuchung: mich davor zu drücken. Jedes Mal überlege ich mir zehn verschiedene Ausflüchte, und in einem von zehn Fällen suche ich mir eine aus und sage in letzter Minute ab, auf so dramatische Weise, dass alle Welt mir glaubt, sogar ich selbst. Meine Mutter sei gerade gestorben, mein Sohn (ich bin kinderlos) sei schwer erkrankt, ich hätte entsetzliche Rückenschmerzen (diese Ausrede verwende ich aber nur im Extremfall, denn ich bin abergläubisch), gleich komme ein Klempner, um meinen kurz vor der Explosion stehenden Boiler zu reparieren. Aber ich kann mich nicht immer drücken, zumal das gar keinen Sinn hätte: Ich schreibe, also muss ich öffentlich auftreten, heutzutage ist es nicht möglich, zu schreiben, ohne öffentlich aufzutreten. Und so gehe ich in acht oder neun von zehn Fällen tapfer hin, wie ein Soldat oder besser wie eine Schülerin, denn daran erinnert mich der frühe Morgen, wenn ich um acht das Haus verlasse und einer Menge Leute begegne, die zur Arbeit gehen: an die unendlich ferne Zeit, als ich »die Schule besuchte« und auf die Straße trat, obwohl es noch nicht richtig Tag war.
Wie jedes Mal war ich auch versucht, mich vor Montauban zu drücken. Am 23. war ich versucht, meine Mutter sterben zu lassen, wie schon zehn Mal geschehen (und da ich zwölf gewesen war, als sie starb, durfte ich diesen Trumpf nach so vielen Jahren wohl ungeniert ausspielen), doch zugleich lockte mich Montauban, wegen der so reizenden Einladung von Inès, und die Pyrenäen lockten mich wegen des Chansons Mes jeunes années von Charles Trenet. Wenn ich Charles Trenet singen höre, »Mes jeunes années courent dans la montagne«, meine Jugend läuft in den Bergen, breche ich in Tränen aus, was meinen Lebensgefährten rührt, aber ich habe meine Jugend nun mal auch in den Bergen verlebt, zumindest im Sommer, nicht in den Pyrenäen, sondern in der Auvergne, genauer gesagt im Cantal, trotzdem verfehlt das Chanson nie seine Wirkung. Also sagte ich nicht in letzter Minute ab, sondern stand in dieser durch und durch traurigen Stimmung des um sechs Geweckt-Werdens auf, denn so früh, zu nachtschlafender Zeit geweckt zu werden, erinnert mich unweigerlich an ein anderes Geweckt-Werden. In einer Dezembernacht waren wir lange vor dem Morgengrauen in Bordeaux losgefahren, um Ruys-en-Montagnes im Cantal zu erreichen, wo meine Mutter begraben werden sollte, und davon abgesehen, dass das Auto meines Wissens keine Heizung hatte, befand ich mich wegen der Niedergeschlagenheit meines Großvaters mütterlicherseits, der am Steuer saß, und der Erschütterung meines Vaters auf dem »Totensitz« in einer »eisigen Finsternis, aus der ich niemals herausgefunden habe«, wie Ricardo Pirez in jenem Roman schreibt, den er seinem viel zu früh verstorbenen Bruder Adriano Pirez gewidmet hat.
An diesem 24. November war es morgens aber weder so finster noch so eisig, und so verließ ich meine Wohnung immerhin mit einem Hauch von Vorfreude, weil ich Inès wiedersehen und an einem Literaturfestival teilnehmen würde, wo ich, erst einmal angekommen, sicher so weit zufrieden wäre wie bei jedem kollektiven Anlass, der mir ein wenig Anerkennung bringt. Offenbar würde man über meinen letzten Roman reden, der vor gut einem Jahr erschienen war, besser gesagt würde vor allem ich darüber reden müssen, indem ich die Fragen eines »Moderators« beantwortete. Ich hatte diesen Moderator gegoogelt, und er machte auf mich einen sympathischen Eindruck. Der Roman von vor gut einem Jahr war mir nicht mehr ganz präsent, erst recht, da ich just mit einem neuen begonnen hatte, der gewissermaßen dessen Fortsetzung bilden sollte. In meiner Vorstellung verschmolzen beide, daher hatte ich am Vorabend, also am 23. November, in meinem letzten Roman geblättert und ihn quergelesen, um ihn mir in Erinnerung zu rufen. Allmählich wurde er für mich zu einem »alten toten Ding«, wie meine Freundin Rita Desiderio ihren eigenen letzten Roman in einer Mail bezeichnete, die sie mir zwei Tage zuvor geschrieben hatte.
In meiner Reisetasche, einer schlichten Leinentasche, die ich vor mehr als zwanzig Jahren in Begleitung eines Geliebten in Aubusson erstanden hatte und stets bei solchen Kurzreisen verwendete, da sie nach wie vor nicht die geringsten Gebrauchsspuren aufwies, steckte außerdem der letzte Roman von Inès, den ich im Zug wieder anlesen wollte, um auch ihn besser präsent zu haben. Überdies hatte ich, das aber als Lebens-Mittel, einen der letzten Romane von Enrique Vila-Matas dabei, Kassel: eine Fiktion, den ich wie alle seine Bücher so gierig und so schnell gelesen hatte wie ein TGV, der durch die Landschaft pflügt. Seine Romane erfüllten mich mit einer solchen Freude, Energie, Zuversicht und Bereitschaft, mich mit der Welt und meinen Nächsten zu versöhnen, dass ich sie immer in Höchstgeschwindigkeit verschlang und dabei bedauerte, nicht ruhiger, gemessener, achtsamer zu sein und mir nicht die Zeit zu nehmen, sie mit Anmerkungen zu versehen, über jeden Absatz, jede Passage zu brüten. Ich war selbst der Meinung, dass meine Lektüre seiner Werke immer eine Art von Vergeudung war, denn ich las sie zu schnell, übersprang vermutlich sogar mehrere Sätze, so sehr entsprach diese Nahrung meinen Bedürfnissen, und so preschte ich entzückt vor, um mich zu vergewissern, dass auch nach zehn, nach fünfzig, nach hundert, nach zweihundert Seiten die Kunst von Enrique Vila-Matas meine liebste Kunst blieb, diejenige, die sich meinem Verlangen am besten fügte.
Ich gehe immer sehr frühzeitig aus dem Haus, wenn ich irgendwo verabredet bin, und erst recht, wenn ich mit dem Zug oder Flugzeug reisen muss. Sehr häufig treffe ich eine Stunde zu früh ein und nie nutze ich sie, um etwas Interessantes zu tun, ich koste lediglich die Zufriedenheit aus, so zeitig da zu sein. Als Jugendliche war ich ohne Frage immer gehetzt, es gab zu Hause so viele Notfälle, ständig, dass ich es schließlich leid war und mir vornahm, eines Tages, sofern möglich, alles so zu organisieren, dass mir diese Herzrasen verursachenden Notfälle künftig erspart blieben. Und so gehe ich alles äußerst gemächlich an und achte dabei auf jeden Umstand, der zu einer Verzögerung führen könnte, sodass ich ganz konzentriert wirke, als hätte ich gleich einen sehr wichtigen Termin. Nachdem ich meine Tasche gepackt hatte, die nur meine Unterlagen, einen Kulturbeutel und ein Nachthemd enthielt, für die eine Hotelübernachtung in Montauban, sowie ein Kleid für die abendliche Publikumsveranstaltung, stieg ich meine fünf Stockwerke hinab, wie vor jeder Reise mit dem Zug oder Flugzeug in der Hoffnung, keinem Nachbarn und keiner Nachbarin zu begegnen, die von mir ein paar höfliche Worte erwarten würden.
Montauban ist nicht Caracas, sagte ich mir, wie ich mir immer sage, Angers ist nicht Peru oder Lyon nicht das Ende der Welt, während ich also mit Weile, aber äußerst konzentriert zum Bahnhof eilte, nur um mir bewusst zu machen, dass es kein Drama wäre, sollte ich wider Erwarten meinen Zug verpassen, da meistens noch ein späterer Zug fährt. Aber in gewisser Hinsicht ist Montauban Caracas für mich, wie Angers Peru ist oder Lyon eine Art Patagonien. In seinem Roman Äther schreibt Ignacio Recardo, dass Zugreisen, beziehungsweise die Strecke von seinem Zuhause zum Bahnhof von Mendoza, ihn, vor allem, wenn er sie allein zurücklegt, immer in eine »entsetzliche Melancholie stürzen, als hätte er gerade Vater und Mutter verloren und als führten im Grunde alle Reisen zu einem Begräbnis«. Ich fühle mich Ignacio verbunden, denn selbst wenn ich für die Ferien in die Auvergne fahre, wie ich es regelmäßig und mindestens jeden Sommer tue, wird mir beim Aufbruch das Herz schwer, als trennte ich mich vom Leben; so ergeht es auch meinem Freund Mark, der das Problem praktisch gelöst hat, indem er Paris so gut wie nie verlässt.
In der Halle des Bahnhofs Montparnasse stieß ich unversehens auf Brigitta, die ich seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gesehen hatte, weil sie inzwischen in Berlin lebte und ich nie dorthin fuhr. Unter ihre kurzen Jacke aus orangebraunem Leder trug Brigitta eine gewagte gelbe Bluse, die ihr sehr gut stand; sie hatte schon immer ein großartiges Stilgefühl, und das rief mir die Zeit in Erinnerung, als wir alle auf Capri Urlaub machten (die sehr ferne Zeit unserer jugendlichen »Freundesbande«) und sie barfuß in einem altmodischen Nachthemd herumlief, zum Staunen der Italiener und der Touristen. Brigitta, die gerade einen Roman auf Deutsch veröffentlicht hatte, da sie in beiden Sprachen schrieb, »Französisch fürs Gefühl und Deutsch auch fürs Gefühl«, sagte sie, wenn man sie unermüdlich fragte, warum ihre Wahl auf diese oder jene Sprache gefallen war, fuhr ebenfalls nach Montauban, mit demselben Zug wie ich und vermutlich im selben Wagen, weil das Festivalteam die Reservierungen vorgenommen und bestimmt alle Gäste des Tages in einem Abteil versammelt hatte. Ich freute mich über das Wiedersehen mit Brigitta, wäre aber lieber allein gereist und sie wohl auch, daher fiel dieses Wiedersehen etwas verkrampfter aus, als wenn es bei gemeinsamen Freunden stattgefunden hätte. Ihren letzten Roman, Die Welt von tomorrow, hatte ich noch nicht gelesen, denn ich verstehe kein Deutsch (das englische Wort im Titel war ein Augenzwinkern), und er war bisher nicht ins Französische übersetzt, aber mir gefielen alle Romane von Brigitta, die mich gelegentlich, bei aller Einzigartigkeit, an die von Herta von Rett oder sogar an manche Romane von Okiewicz erinnerten. »Wir stammen aus dem gleichen Stall«, sagte sie ohne falsche Bescheidenheit, aber sie tat ja gut daran, nicht allzu bescheiden zu sein, denn ihr äußerst raffiniertes Werk ist wirklich fesselnd.
Zwar reiste ich lieber allein, aber nicht etwa aus Furcht, dass Brigitta mich langweilen würde. Sie war interessant und das Gespräch mit ihr immer ein Vergnügen. Ich reise nur generell nicht besonders gern in Begleitung, weil ich beim Reisen nicht gern rede, vor allem morgens nicht. Wie mein alter Freund Giacinto Scelsi, der italienische Komponist, den ich während einer Romreise mit zwanzig kennengelernt hatte und der am 8.8.88 gestorben war, weil die 8 in seinem Leben und seiner Bestimmung stets eine bedeutsame Rolle spielte, redete ich morgens zunehmend weniger. Giacinto hatte sich sogar entschieden, nicht vor drei Uhr nachmittags zu reden, aber da war er achtzig. Wenn man also bei ihm in der Via San Teodoro 8 wohnte, wie ich es jedes Mal tat, wenn ich ihn in Rom besuchte, stand einem der ganze Vormittag, das Mittagessen und der frühe Nachmittag zur freien Verfügung, bevor man ihn gegen fünfzehn Uhr aufsuchte, und dann durfte er das Gespräch beginnen, mit seiner klangvollen Stimme, die anmutig das »r« rollte und ebenso gut Italienisch sprach wie Französisch, Englisch und Spanisch. Weil ich noch keine achtzig bin, habe ich bisher nicht beschlossen, bis fünfzehn Uhr zu schweigen; ich begnüge mich vorerst mit zwölf Uhr mittags, bei den Menschen, die mir am nächsten stehen, bei beruflichen Kontakten und beim Telefonieren. Da inzwischen praktisch meine ganze Familie tot ist, meine Mutter, mein Vater, eine meiner Schwestern, gibt es in meinem Leben keine Notfälle mehr. Als sie noch lebten, zumindest mein Vater und meine Schwester, denn meine Mutter war sehr viel früher gestorben, hätte noch etwas passieren, hätte er oder sie einen Unfall haben können, und wenn das Telefon um vier Uhr morgens oder auch erst um acht oder elf Uhr klingelte, ging ich ran. Ich ging nur ran, weil ich dachte, dass es sich um einen familiären Notfall handeln könnte. Eines Tages um vier war es jedoch mein Freund Mark, der soeben vom Tod seiner Mutter in London erfahren hatte, um acht war es in der Regel meine alte Tante, die mit ihren neunzig Jahren in aller Frühe aufstand und meinte, der Vormittag sei bereits weit fortgeschritten, um elf sind es meistens Leute, die sich verwählt haben und mich für eine Pizzeria halten oder für einen Arzt namens Montano.
Ich wollte Brigitta nicht kränken und sie mich auch nicht, und so plauderten wir vor dem »Boarding« (das Vokabular unserer Eisenbahngesellschaft ist inzwischen seltsamerweise das der Luftfahrt, das seinerseits der Seefahrt entlehnt wurde) noch auf dem Bahnsteig, als wollten wir unbedingt plaudern, dabei wollten wir beide nur ungestört unseren Sitzplatz einnehmen, losfahren und uns in die Lektüre vertiefen, am Computer, auf dem Tablet, in Bücher und Zeitschriften. Was mich angeht, bin ich immer etwas hin und her gerissen zwischen der Beschäftigung mit den Büchern, die ich mitgenommen habe, und der Beschäftigung mit der Landschaft, denn sie ist »immerhin einen Blick wert«, wie es James Aspert bei einem Vortrag in Singall formulierte, er, der nie das Haus verlassen und zwölf Jahre lang keinen Fuß vor die Tür gesetzt hatte, genau wie Nathaniel Hawthorne in Salem. Manchmal träumte ich von diesen zwölf Jahren, die Aspert und Hawthorne zurückgezogen verbracht hatten, zusammengenommen vierundzwanzig Jahre, denn die Zahl zwölf beinhaltete für mich wie die Zahl acht für Giacinto Scelsi etwas Magisches und mir Vorbestimmtes. Meine Mutter war gestorben, als ich zwölf war, 2012 hatte ich mein zwölftes Buch veröffentlicht, das mir einen großen Erfolg bescherte, an einem 12. Dezember hatte ich mich von Guillaume, meiner großen Jugendliebe, getrennt, und an einem 12. war ich Thomas begegnet und immer so weiter. Bestimmt hatte ich beim Zählen noch viel mehr Zwölfen vergessen, trotzdem war nicht zu übersehen, dass diese Zwölf in meinem Leben eine so eigenartige wie beharrliche Rolle spielte.
Sobald ich las, dass ein Mann zwölf Töchter hatte, dass einer meiner geliebten Schriftsteller, beispielsweise Walser, beim zwölften Kilometer seiner Wanderung schneebedeckt den Heldentod gestorben war, dass jemand zwölf Mal versucht hatte, seine Mutter umzubringen, oder dass zwölf Zwölfjährige entführt worden waren, fühlte ich mich betroffen, als ginge es um meine Familie, um meine Notfallfamilie, die man unentwegt retten musste, vor dem Tod, vor dem Wahnsinn, vor dem Selbstmord, vor dem Unglück. Sobald von zwölf die Rede war, stand ich an Deck, denn ich hatte mich stets, natürlich vergebens, bemüht, meine Familie zu retten. Unsere Notlage, sinnierte ich im Zug, als Brigitta sich auf den Platz Nr. 38 setzte und ich mich auf den Platz Nr. 56 (auf meinem Ticket stand Nr. 45, aber das war gegen die Fahrtrichtung und ich habe nie gern gegen die Fahrtrichtung gesessen, ich befinde mich gern in Fahrtrichtung), unsere Notlage, sinnierte ich also und dankte zugleich dem Himmel, dass ich nicht verpflichtet war, mit irgendwem zu plaudern, war mit der Wahnhaftigkeit und Maßlosigkeit von beiden verknüpft: Meine Schwester oder mein Vater konnte jederzeit etwas vollkommen Unerhörtes, etwas völlig Unerwartetes tun, und da brauchte es eine vernünftige und maßvolle Person wie mich, um wieder Ordnung in die Unordnung zu bringen, jeden wieder an seinen Platz oder zumindest an einen schicklichen Platz zu rücken, und das bestimmte mein Leben bis zu seinem und ihrem Tod.
Anstatt wie geplant mein letztes Buch aufzuschlagen, um es mir vor der abendlichen Publikumsveranstaltung in Montauban in Erinnerung zu rufen, oder das von Inès, das ich mir ebenfalls in Erinnerung rufen sollte, oder das von Enrique Vila-Matas, Kassel: eine Fiktion, das ich in aller Ruhe wiederlesen wollte, weil ich ja fünf Stunden Fahrt vor mir hatte, eine erkleckliche Zeitspanne, und weil ich im Zug immer wunderbar lesen kann, besser als zu Hause, dachte ich an die beträchtliche Notlage meiner Familie, an den Alarmzustand, in dem ich immer gelebt hatte, bis sie alle gestorben waren, obwohl ich vor allem Ruhe und Frieden schätzte. Und da ich selten vom Gare Montparnasse aus fahre, meistens fahre ich vom Gare de Bercy aus in die Auvergne, früher vom Gare de Lyon, wollte ich auch ein wenig die Landschaft betrachten, zunächst die Faubourgs, die man nicht mehr als Faubourgs bezeichnet, sondern als Banlieu, und so betrachtete ich die Gebäude, die Villen und Reihenhäuser, während ich an die Notlage meiner Familie dachte, an den Alarmzustand, in dem ich im Grunde bis ins höhere Alter gelebt habe, denn als mein Vater starb, natürlich am 12.12.2012, hatte ich schon ein gewisses Alter erreicht.
Was war das eigentlich für eine Notlage, die mich an Deck hielt?, fragte ich mich, während die Reihenhäuser irgendeiner Banlieu an mir vorbeizogen. Was war das für ein ständiger Alarmzustand seit meiner frühesten Kindheit? Sie konnten seltsame Dinge anstellen, allen voran Selbstmord begehen oder wahnsinnig werden, nach Belieben. Und so horchte ich am Telefon als Erstes darauf. Ich horchte darauf, ob sie zurechnungsfähig oder wahnsinnig waren, und ich horchte darauf, ob gleich ein Selbstmord zu befürchten stand oder nicht. Ich spitzte die Ohren, meine Ohren waren darauf trainiert. Immer habe ich mich gefragt ob sie, mein Vater, meine Schwester, spürten, ob sie wussten, dass ich solche Ohren hatte und worauf ich horchte. Ich glaube, meine Schwester, die ungeheuer kluge, wusste es. Ich glaube, sie wusste, dass ich darauf horchte, und ich glaube sogar, dass sie damit spielte, mit meiner Verletzlichkeit und mit meiner Liebe. Bei meinem Vater glaube ich das nicht, aber man weiß ja nie. Sie steckten beide dermaßen tief in der Fiktion.
An all das dachte ich, während wir Paris hinter uns ließen, und wie so oft war ich zwischen meinen Gedanken und meinen Verpflichtungen hin und her gerissen, denn eigentlich sollte ich während der Fahrt meinen abendlichen Auftritt vorbereiten, mich auf mein Buch besinnen, auf das, was ich über dieses Buch