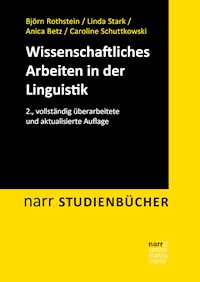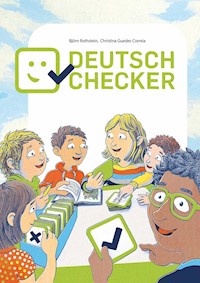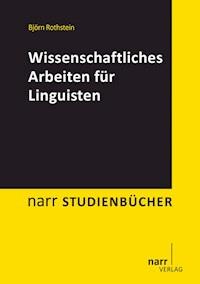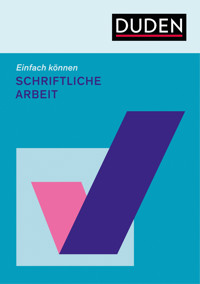
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Einfach können
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch liefert einen schnellen Überblick über alle Stufen des Schreibprozesses mit klaren Anforderungslisten und Bewertungskriterien. Es gibt Antworten auf häufige Fragen des wissenschaftlichen Schreibens und Orientierung für eine erfolgreiche Haus-, Seminar-, Fach- oder Abschlussarbeit. Die übersichtliche Darstellung hilft dabei, schnell zum gesuchten Punkt zu kommen und gezielt und einfach die Anforderungen zu erfüllen. Besonders eingängig sind dabei die vielen Fallerzählungen, die beim individuellen Schreiben zur Seite stehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Duden
Einfach können
SCHRIFTLICHEARBEIT
Von Björn Rothstein
1. Auflage
INHALT
Vorwort
IWISSENSCHAFTLICH ARBEITEN
Wissenschaftliche Texte erkennen
Korrekter Umgang: Plagiat versus Zitat
Literaturangaben machen
Forschung und Quellen finden
Wissenschaft lesen und verstehen
IIPLANEN
Sammeln und gliedern
Strukturieren
IIISCHREIBEN
Passend adressieren
In wissenschaftlicher Sprache schreiben
Formale Vorgaben erfüllen
IVÜBERARBEITEN
Den Text optimieren
Kriterien für die Bewertung
ANHANG
Literaturtipps
Nützliche Links
Register
Vorwort
Wissenschaft findet immer im ständigen Austausch mit anderen Forschenden statt, indem man miteinander spricht oder Texte voneinander liest, diskutiert, gemeinsam überlegt und manchmal auch streitet. Ich fahre deshalb gern auf Konferenzen. Und da sind es oft die Kaffeepausen oder die abendlichen Aktivitäten, die nicht nur lustig und unterhaltsam sind, sondern oft besonders gewinnbringend. In solchen eher informellen Gesprächen kann man auch fachliche Fragen und Nachfragen vertraulich stellen und diskutieren, ohne dass sie womöglich peinlich werden. Oft ergeben sich daraus weiterführende Überlegungen, manchmal sogar neue, eventuell gemeinsame Forschungsvorhaben. Solche informellen Gespräche sind also recht förderliche wissenschaftliche Momente, die aber in der hochschulischen Lehre wie auch im Unterricht viel zu wenig bedacht werden. Daher möchte ich sie in diesem Buch zumindest ansatzweise mit Fallbeispielen aufzeigen, im Sinne eines geschichtenbasierten Lernens. Im Übrigen sind wissenschaftliche Texte ebenfalls eine Art Gesprächsbeitrag, der über wissenschaftliche Ergebnisse informiert. Damit dabei keine Missverständnisse entstehen, gelten für sie – wie für jede Art von Kommunikation – bestimmte Regeln. Diese werden auf den folgenden Seiten erläutert.
Danken möchte ich dabei an erster Stelle Laura Neuhaus für ihre hilfreiche Unterstützung, Ingrid Furchner für ihre wertvollen Textkorrekturen und Alexandra Schmidt für ihre kluge Durchsicht des Textes aus studentischer Perspektive. Darüber hinaus geht auch diese Einführung auf Gespräche zurück, die ich mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe, mit ihren Lehrkräften und mit Studienanfängerinnen und -anfängern führen konnte. Diese Gespräche wurden unterstützt von der Robert Bosch Stiftung (Projekt Sprachwerk in der Förderlinie Denkwerk; Projekt Urban Gardening – Sich gemeinsam die Hände schmutzig machen in der Förderlinie Our Common Future) und der Dr. Hans Riedel-Stiftung (Lehrerfortbildungen für Facharbeiten in den MINT-Fächern). Beiden Stiftungen und allen Teilnehmenden danke ich herzlich für die Zusammenarbeit.
Mein Patenkind Alexis und ich sprechen (noch) nicht über Wissenschaft, aber sonst über so ziemlich alles, was das Leben ausmacht. Dafür kann ich ihm nicht genug danken. Ihm sei diese Einführung gewidmet.
Bochum
Björn Rothstein
I
WISSENSCHAFTLICH ARBEITEN
Wissenschaftliche Texte erkennen
Korrekter Umgang: Plagiat versus Zitat
Literaturangaben machen
Forschung und Quellen finden
Wissenschaft lesen und verstehen
Wissenschaftliche Texte erkennen
Die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung werden in der Regel anderen Forschenden und der Öffentlichkeit mitgeteilt, damit sie berücksichtigt und eventuell angewendet werden können. Das geschieht häufig durch wissenschaftliche Texte, die Ergebnisse werden also verschriftlicht. Da Wissenschaft sich häufig mit komplexen Themen auseinandersetzt, muss sie Wege finden, komplexe Sachverhalte korrekt, aber dennoch verständlich mitzuteilen. Deshalb gibt es Regeln oder Standards dafür, wie beispielsweise eine These formuliert oder Literatur zitiert wird.
Wissenschaftliche Texte werden auch geschrieben, um einen Schul- oder Studienabschluss zu erreichen (z. B. eine Facharbeit im Rahmen des Abiturs oder eine Hausarbeit im Studium). Solche Arbeiten sind in der Regel längere Texte, und sie müssen bestimmten inhaltlichen und formalen Anforderungen genügen, denn sie werden von einer Person, die an der Hochschule bzw. der Schule lehrt, betreut und bewertet. An diese Person kann man sich mit inhaltlichen, formalen und methodischen Fragen wenden. Sie hilft bei der Themenfindung, und am Ende begründet sie ihre Bewertung in einem Gutachten.
Erfahrungsbericht: Themenfindung
Mein Name ist Urbania und ich mache nächstes Jahr Abi. In meinem letzten Schuljahr muss ich eine Facharbeit schreiben, um das wissenschaftliche Arbeiten kennenzulernen. Für meine Facharbeit habe ich mir überlegt, über das Thema Urban Gardening zu schreiben. Ich interessiere mich dafür, wie man Urban Gardening an Schulen bringen könnte und ob das das Schulklima verbessert. Ich habe meiner Erdkundelehrerin, Frau Gardenia, das Thema für die Facharbeit vorgestellt und sie hat als Betreuerin zugesagt, weil das Thema so konkret und auch für unsere Schule nützlich ist. Das Thema habe ich entdeckt, als ich neulich einen Artikel über Urban Gardening gelesen habe und dann am gleichen Tag an einem neu angepflanzten Beet in der Stadt vorbeigelaufen bin. Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum wir kein Urban Gardening in der Schule haben. Wir haben als Forschungsfrage vereinbart, dass ich mit Interviews drei Schulleitungen anderer Schulen befrage, was die Urban-Gardening-AGs an ihren Schulen erreicht haben. Also habe ich im Internet nach Urban Gardening an Schulen gesucht und dann Telefoninterviews mit den Schulleitungen gemacht. Die Interviews sind meine wissenschaftliche Methode, also mein festgelegtes Verfahren, um zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen, die meine Forschungsfrage beantworten.
Wissenschaftliche Texte erfüllen dabei gewisse Merkmale, die die Textsorte auszeichnen. In der Regel lassen sich wissenschaftliche Texten an folgenden Kriterien erkennen:
Sie unterhalten nicht, sondern informieren über Ergebnisse. Daher beinhalten sie z. B. auch keine Ausschmückungen oder Bilder, die vom Inhalt ablenken.
Sie bearbeiten eine Fragestellung objektiv, präzise und nachvollziehbar.
Sie argumentieren nur auf der Basis von Fakten.
Sie beziehen sich auf andere wissenschaftliche Texte.
Sie sind in einer wissenschaftlichen Sprache verfasst.
Sie erscheinen zumeist an einem Ort – z. B. in einem Verlag oder auf einem Server –, der auf wissenschaftliche Texte spezialisiert ist, und oft in Reihen (d. h. thematisch zusammengehörenden Büchern) oder in Zeitschriften, die keine anderen, nicht wissenschaftlichen Textteile wie Witze, Schlagzeilen oder Reise-, Wetter-, Börsen- und andere Berichte enthalten.
Ihre Autorinnen und Autoren gelten als Expertinnen und Experten. Sie haben beispielsweise einen Doktortitel und/oder arbeiten in einer wissenschaftlichen Einrichtung (z. B. einem Forschungszentrum, einer Universität oder einer Fachhochschule).
Sie nennen in der Regel die Kontaktdaten (berufliche Adresse und E-Mail) ihrer Autorinnen und Autoren.
KONZEPTIONELLE VERSUS EMPIRISCHE ARBEITEN
Jede Fachrichtung (z. B. Architektur, Geografie, Mathematik oder Philosophie) hat ihre eigenen Standards, z. B. bestimmte Forschungsmethoden