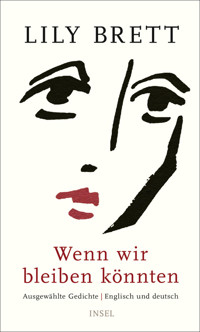11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einfach so erzählt die Geschichte einer Frau, die in New York zu Hause ist. Sie schreibt Nachrufe für eine Zeitung, lebt mit ihrem Ehemann, einem Künstler, in einem weitläufigen Loft, hat drei aufmüpfige, aber wohlgeratene Kinder, und wenig Außergewöhnliches, nichts Dramatisches drängt sich in den Ablauf ihrer Tage. Das Außergewöhnliche liegt in ihr selbst, in ihrer Art, die Umwelt wahrzunehmen: Soll sie ein koscheres Huhn kaufen, oder darf sie auf die Instanthühnerbrühe zurückgreifen? Kann sie sich von den reichen Gastgebern mit deren Mercedes zur Dinnerparty kutschieren lassen? Ihre Lebensgeschichte – sie ist die Tochter jüdischer Eltern, die den Holocaust überlebt haben – ist immer präsent, und ihr Beruf – durch den sie häufig Begräbnisse zumeist völlig fremder Menschen besuchen muß – verstärkt das Gefühl für die Zerbrechlichkeit des Glücks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Einfach so erzählt die Geschichte einer Frau, die in New York zu Hause ist. Sie schreibt Nachrufe für eine Zeitung, lebt mit ihrem Ehemann, einem Künstler, in einem weitläufigen Loft, hat drei aufmüpfige, aber wohlgeratene Kinder, und wenig Außergewöhnliches, nichts Dramatisches drängt sich in den Ablauf ihrer Tage. Das Außergewöhnliche liegt in ihr selbst, in ihrer Art, die Umwelt wahrzunehmen: Soll sie ein koscheres Huhn kaufen, oder darf sie auf die Instanthühnerbrühe zurückgreifen? Kann sie sich von den reichen Gastgebern mit deren Mercedes zur Dinnerparty kutschieren lassen? Ihre Lebensgeschichte – sie ist die Tochter jüdischer Eltern, die den Holocaust überlebt haben – ist immer präsent, und ihr Beruf – durch den sie häufig Begräbnisse zumeist völlig fremder Menschen besuchen muß – verstärkt das Gefühl für die Zerbrechlichkeit des Glücks.
»Lily Brett erinnert in ihrer Leichtigkeit an Woody Allen.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Lily Brett und ihre Protagonistin Esther haben etliche Lebensstationen gemein: Die Autorin wurde 1946 in Deutschland geboren, wo ihre Eltern, nachdem sie Auschwitz überlebt hatten, sich in einem Durchgangslager wiedertrafen. 1948 wanderte die Familie nach Australien aus. Mit neunzehn begann Lily Brett als Journalistin für ein Rockmagazin zu arbeiten. Sie hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann, einem Maler, in New York.
Als suhrkamp taschenbuch erschienen 1999 Einfach so. Roman, 2000 Zu sehen, 2001 New York, 2002, Zu viele Männer. Roman, 2004 Alles halb so schlimm! und Auschwitz Poems. Gedichte, 2005 Von Mexiko nach Polen, 2006 Ein unmögliches Angebot. Roman, 2007 Chuzpe. Roman und 2012 Lola Bensky, Roman.
Lily Brett
Einfach so
Roman
Aus dem Amerikanischen von Anne Lösch
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 10. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 3033.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Premium Stock Photography, Düsseldorf
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75066-7
www.suhrkamp.de
FÜR PARIS,
dessen Großvater ihn lieber Harry genannt hätte
Es ist bekannt, daß, wer zurückkehrt, niemals fort war,
also ging und ging ich auf den Spuren meines Lebens,
Kleider und Planeten wechselnd,
an die Gesellschaft mich gewöhnend,
an den großen Wirbel des Exils,
die große Einsamkeit des Glockenschlags.
Pablo Neruda, Abschiede
1
EDEK ZEPLER HATTE FRÜHER IMMER POLNISCHE MÄDCHEN gebumst. Die meisten von ihnen waren Dienstmädchen, und er hatte sie im Stehen in den Fluren der Häuser gebumst, in denen sie arbeiteten.
Esther Zepler hatte erst kürzlich davon erfahren. Sie saß in ihrem Büro und dachte über ihren Vater nach. Etwas feinfühliger wäre er ihr lieber gewesen. Sie verstand nicht, wie jemand Lust haben konnte, einen völlig fremden Menschen in einem Hausflur zu bumsen. Sie verstand sehr gut, warum die Mädels es machten. Die sparten sich die zwei Zloty jährliche Meldegebühr, die sie als Bewohnerinnen der Häuser zu entrichten gehabt hätten.
Es war Edeks Aufgabe, diese Gebühr einzuheben. Vor dem Krieg hatte Edeks Vater, Esthers Großvater, etliche Mietshäuser in Lodz besessen. Die Wohnungen waren an jüdische Familien vermietet, und die meisten dieser Familien hatten ein polnisches Dienstmädchen. Es gab also viele Dienstmädchen, die Esthers Vater in vielen Hausfluren bumsen konnte.
Esther war sich nicht einmal sicher, wie man im Stehen bumste. Sie stellte es sich sehr unbequem vor. Diese Art Bumsen nennt man Kniewackler, sagte ihr Mann. Vielleicht wackelten einem die Knie, dachte sie, weil man gegen die Schwerkraft ankämpfen mußte. Vermutlich war es der Mann, dem die Knie wackelten.
Das mit den Dienstmädchen und ihrem Vater hatte Esther nicht von ihm erfahren. Ihr Sohn erzählte es ihr. Ihr Vater, entschied sie, mußte das Ganze für eine Information unter Männern gehalten haben, die er an seinen Enkel weitergeben wollte. Mit Esther hatte er niemals über Sex gesprochen. Einmal erzählte er ihr, ihre Mutter, die vor einigen Jahren gestorben war, habe sich nicht viel aus Sex gemacht. »Es war ihr nicht wichtig«, erklärte er stolz. Damals hatte Esther sich gefragt, was er wohl sagen würde, wenn er wüßte, daß sie selbst über Jahre hinweg Tausende von Dollars dafür ausgegeben hatte, auf einer Analytikercouch unter anderem zu lernen, Sex als wichtig zu empfinden.
Sie hielt Sex nicht für unwichtig, sie dachte einfach nicht sehr oft daran. Sie genoß ihn, wenn er sich ergab, aber sie freute sich nicht darauf wie auf ein Essen oder eine Reise.
Eine Freundin erzählte ihr einmal, daß sie nach sieben Tagen ohne Sex völlig frustriert sei. Esther, die sexuelle Frustration nicht kannte, war beunruhigt, als sie das hörte. In den folgenden sechs Monaten schrieb sie jedesmal, wenn sie mit ihrem Mann geschlafen hatte, ein großes grünes S rechts oben auf die Seite ihres Taschenkalenders. Dann zählte sie die S zusammen. Es waren sechsundzwanzig. Also knapp einmal pro Woche. Esther war erleichtert.
Sex war wirklich etwas Seltsames. Da konntest du jede Nacht nackt neben einem Mann schlafen, ohne an Sex zu denken, aber wenn man dich nackt zu einem anderen ins Bett legen würde, hättest du nichts anderes mehr im Kopf als Sex. Seinen. Deinen.
In den Konzentrationslagern dachten die Häftlinge nicht an Sex. Esther wußte das, sie hatte es gelesen. Es erschien ihr logisch. Natürlich denkt niemand, dessen Leben in Gefahr ist, an Sex.
Sie wünschte sich, das Bild ihres Vater loszuwerden, wie er diese polnischen Dienstmädchen bumste. Es wurde ihr schlecht davon.
Sie betrachtete ihr Spiegelbild in einem glasgerahmten Druck von Cy Twombly, der an der Wand hing. Ihr neuer Haarschnitt gefiel ihr. Mit einundvierzig hatte sie immer noch dichtes Haar, obwohl es langsam dünner wurde. Sie hatte gelesen, daß bei Frauen zwischen sechzehn und fünfunddreißig die Haare am dichtesten seien.
Esther und ihr Mann lebten seit einem Jahr in New York. Ihr Mann war Maler, abstrakter Landschaftsmaler. Ein Künstler, dessen Bilder den Charakter einer Landschaft wiedergaben, nicht ihre Topographie.
Er gehörte zu den führenden abstrakten Malern Australiens. In Amerika hätte es großen Wohlstand bedeutet, ein bekannter Künstler zu sein. Nicht so in Australien. In Australien stellte er seit zweiundzwanzig Jahren aus – seit er zwanzig war.
Letztes Jahr hatte er seine erste Ausstellung in New York gehabt. Die New York Times hatte ihn »einen begabten Maler« genannt, »der etwas zu sagen hat«.
Esther räumte ihren Schreibtisch auf. Sie arbeitete als Nachrufredakteurin, Bereich Amerika, für den London Weekly Telegraph. Der Job war ihr von einem australischen Journalisten vererbt worden, einem alten Kollegen vom Melbourne Age. Sie hatte ihm tausend Dollar für eine Kopie seines New Yorker Adreßbuchs bezahlt.
Im allgemeinen gab ihr der London Weekly Telegraph vierundzwanzig Stunden Zeit für einen Nachruf. Esther mußte kleine Artikel verfassen, dreihundert bis fünfzehnhundert Wörter, abhängig von der Wichtigkeit der verstorbenen Person. Der Job wurde gut bezahlt. Für einen Nachruf von tausend Wörtern bekam sie dreihundertfünfzig Dollar. Sie schrieb zwei bis drei Nachrufe in der Woche.
Im Durchschnitt mußte Esther dreißig Telefonate führen, um die Informationen für einen Nachruf zusammenzubekommen. Das Wichtigste, was man über den Verstorbenen herauszufinden hatte, waren Geburtsdatum und -ort, Beruf, besondere Leistungen, eine Kurzfassung des Werdegangs, Familienstand, Anzahl und Wohnsitz der Kinder.
Dafür mußte sich Esther oft durch ein Gewirr von früheren und jetzigen Ehefrauen durcharbeiten und recherchieren, wer wo lebte. Dann mußte sie die Lebensleistung auswählen, deretwegen man sich an diesen Menschen erinnern würde.
Es war nicht besonders schwer. Sobald sie sämtliche Informationen beisammenhatte, rückte alles an seinen Platz, und das Leben dieses Menschen las sich so einfach wie eine Landkarte. Esther wunderte sich oft darüber, daß eine Fremde wie sie das Leben eines Menschen aus vierzig oder fünfzig Zeilen Notizen zusammenfügen konnte.
Die meisten waren Männer. Sie machte diesen Job jetzt seit einem Jahr, und das Verhältnis der Nachrufe auf Männer und Frauen, die sie verfaßt hatte, betrug zehn zu eins. Zehn Nachrufe auf Männer für jeden auf eine Frau. Und das lag, wie sie wußte, nicht daran, daß mehr Männer starben.
Wenn sie Nachrufe auf Frauen zu schreiben hatte, gab sie sich besonders Mühe. Sie schrieb fünfzig bis sechzig Wörter mehr, als verlangt wurden. Bis heute war nicht einer von ihnen gekürzt worden.
Nachrufe wurden stets in einer förmlichen, höflichen Sprache verfaßt, da die meisten Zeitungen höflich zu Toten waren. Aber unterschiedliche Nachrufe konnten durchaus unterschiedliche Bilder einer Person liefern. Esther hatte das Gefühl, durch die Auswahl dessen, was betont und wer zitiert wurde, die Art und Weise bestimmen zu können, in der die verstorbene Person der Welt präsentiert wurde.
Das Schreiben von Nachrufen galt als einer der niedrigsten Posten bei der Zeitung, aber Esther mochte den Job. Sie bezog eine merkwürdige Befriedigung daraus, die losen Fäden des Lebens fremder Menschen zu verknoten. Sie machte Ordnung für sie, brachte sie korrekt auf den Weg. Sie war sich nicht sicher, wohin dieser Weg führte. Sie versuchte, nicht darüber nachzudenken.
Die meisten Zeitungen verfügten über eine Kartei mit vorbereiteten Nachrufen. Diese Kartei hieß allgemein die Leichenhalle. Die Leichenhallen der Zeitungen waren voll von vorbereiteten Nachrufen auf berühmte und bedeutende Leute. Diese Akten enthielten Kommentare, Zitate, Erinnerungen und Fotos. Wurde ein solcher Nachruf gebraucht, fügte man ihm am Anfang einen neuen Absatz hinzu.
Esther war ständig auf der Suche nach wichtigen Leuten, die wahrscheinlich in absehbarer Zeit sterben würden. Wenn sie in Zeitungen und Zeitschriften Artikel über Prominente und Politiker las, achtete sie immer auf deren Gesundheitszustand. Sie legte sich kleine Biographien über Leute an, die ihrer Meinung nach bald sterben würden.
Esther selbst hatte mit dem Tod noch nicht viel zu tun gehabt. Nicht einmal ihre eigene Mutter hatte sie tot gesehen. Sie ging davon aus, daß die meisten Leute, über die sie schrieb, wahrscheinlich sehr teure Särge hatten. Vermutlich lagen sie in einem Nest aus weißen Satinrüschen. Vielleicht hatten sie ein paar Pretiosen neben sich im Sarg. Orden, Fotos, ein oder zwei Briefe. Sie wußte nicht, ob man die Menschen mit ein paar Dingen aus ihrem Leben oder ganz allein begrub.
Als Esther zehn Jahre alt war, starb der Vater von Caroline, ihrer besten Freundin. Caroline hatte ihrem Vater einen langen Brief geschrieben und ihre Mutter gefragt, ob sie ihm den in den Sarg legen dürfe. »Natürlich darfst du«, hatte Carolines Mutter geantwortet. »Vorausgesetzt, es steht nichts drin, worüber Dad sich aufregen würde.« Darüber hatte Esther noch lange nachdenken müssen.
Sie wußte nicht viel über den Tod und über Beerdigungen. Vor einigen Jahren hatte sie einen jungen Mann kennengelernt, der in einem Bestattungsinstitut arbeitete. »In dem Geschäft mußt du immer dran denken«, hatte er gesagt, »daß du vor einem Begräbnis auf keinen Fall was essen darfst. Wenn der Tote so ein Fettsack ist, und du hast gerade was gegessen, mußt du todsicher furzen, wenn du den Sarg aufhebst.«
Es war ein ruhiger Vormittag. Die Zeitung hatte kein einziges Mal angerufen. Sie nahm ein schmales Bändchen mit dem Titel Fakten des Holocaust zur Hand. Sie las schon die ganze Woche in dem Buch.
Ihre Eltern waren beide im Konzentrationslager gewesen. Man hatte sie im Ghetto von Lodz zusammengetrieben und eingesperrt, bevor sie nach Auschwitz verfrachtet wurden. Ihre Mutter war von Auschwitz nach Stutthof gebracht worden, ein Konzentrationslager in der Nähe von Danzig an der Ostsee.
Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater waren die einzigen Überlebenden ihrer jeweiligen Familie. Sie hatten ihre Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen, Neffen und Nichten verloren. Sie hatten alle verloren.
Alle verloren. Was für ein seltsamer Satz, dachte Esther. Ihre Eltern hatten ihre Familien nicht so verloren, wie man einen Schirm oder Handschuhe verliert. Ihre Verwandten wurden nicht irgendwo liegengelassen. Sie wurden vergast, verbrannt, verstümmelt, vergewaltigt und erschlagen. Auf Seite achtzehn las sie ein Zitat von Joseph Goebbels, der 1929 geschrieben hatte, daß der Jude, selbstverständlich, ein menschliches Wesen sei. »Aber auch der Floh ist ein Lebewesen – wenn auch kein angenehmes. Weil der Floh etwas Unangenehmes ist, braucht er nicht zu gedeihen, und wir brauchen ihn nicht zu erhalten, sondern es ist unsere Pflicht, ihn zu vernichten. So wie die Juden.«
Ihre Eltern sprachen kaum über die Vergangenheit. Sie erzählten nichts von ihrem Leben vor oder während dem Krieg. Ihre Mutter hatte ihr gesagt, daß die Zugreise vom Ghetto in Lodz bis nach Auschwitz vier Tage gedauert hatte. Die Juden, alte Männer, junge Mädchen, Säuglinge, waren in Viehwaggons zusammengepfercht und dort ohne Essen und Wasser eingesperrt gewesen. Als sie in Auschwitz ankamen, hatte es in ihrem Waggon über zwanzig Tote gegeben, und auf dem Boden stand die Scheiße und Pisse knöcheltief.
Esther wußte, daß ihre Eltern in Auschwitz getrennt worden waren und sich erst acht Monate nach dem Krieg wiedergefunden hatten.
Sie wußte, daß ihre Mutter in Auschwitz auf Holzpritschen geschlafen hatte und ihr die Ratten übers Gesicht gelaufen waren. Sie wußte, daß der Leib der ältesten Schwester ihrer Mutter so anschwoll, daß die Haut platzte und Sekret herausquoll, und daß ihre Mutter, in dem Versuch, sie zu retten, auf dem Fußboden in unverdauten Resten von Erbrochenem nach Eßbarem gesucht hatte, um ihre Schwester damit zu füttern.
»Du wirst niemals verstehen, was wir durchgemacht haben«, pflegte ihre Mutter zu sagen. Esther wußte, daß sie recht hatte. Sie würde es niemals verstehen.
Das Telefon läutete. Sonia Kaufman war am Apparat. Esther hatte Sonia in Melbourne nur flüchtig gekannt, aber hier in New York trafen sie sich ziemlich oft. Sonia und ihr Mann waren Rechtsanwälte. Sie arbeiteten in einer der größten Kanzleien von New York.
»Hallo, Esther«, sagte Sonia. »Stör’ ich dich?«
»Nein, gar nicht. Es ist ruhig heute. Ich sitz’ bloß so rum und lese.«
»Hört sich gut an«, sagte Sonia. »Ich wollte, ich könnte mich auch hinsetzen und lesen. Mein Büro ist zur Zeit ein Irrenhaus. Was liest du denn?«
»Ach«, sagte Esther, »bloß ein kleines Buch über den Holocaust.«
»Was ist los mit dir?« fragte Sonia. »Du schreibst Nachrufe von morgens bis abends und entspannst dich bei einer Lektüre über den Holocaust? Mein Gott, warum bist du so morbid?«
»Ich bin nicht morbid«, sagte Esther. »Möglicherweise ist es ein morbides Thema, aber es ist nicht morbid, darüber zu lesen. Es ist aufklärend.«
»Es ist morbid«, sagte Sonia. »Ich kenn’ das von anderen Kindern von Überlebenden. Die strahlen eine richtige Morbidität aus. Bei dir ist das was anderes, du bist nur ein bißchen morbid.«
»Vielen Dank«, sagte Esther. »Ich an deiner Stelle würde keine Pauschalurteile über die Kinder von Überlebenden fällen. Pauschalurteile können gefährlich sein.«
»Ich fälle keine Pauschalurteile«, sagte Sonia. »Ich hab’ fünf oder sechs Kinder von Überlebenden kennengelernt, und die sehen eigentlich alle so aus, als hätte ihnen wer einen Sack über den Kopf gezogen. Sie sind so vorsichtig, so gedrückt. Sie bewegen sich behutsam, sie sprechen langsam, mit leiser Stimme. Es ist, als ob sie ständig das Leben in sich unterdrücken müßten. Vielleicht fürchten sie sich davor, zuviel Lebendigkeit zu zeigen. Wenn sie halbtot aussehen, fühlen sie sich vielleicht den Toten enger verbunden und weniger schuldig, daß sie am Leben sind.«
»Die Jahre beim Analytiker hätte ich mir wirklich sparen können. Statt dessen hätte ich dich anrufen sollen, du hättest mich schon wieder in Ordnung gebracht«, sagte Esther.
»Sei bitte nicht böse«, sagte Sonia. »Ich wollte dich nicht kränken.«
»Tust du aber«, sagte Esther. »Es ist schon kompliziert genug, Eltern zu haben, die traumatisiert und gedemütigt wurden; da braucht man nicht auch noch oberflächliche Diagnosen von Amateurpsychologen. Meine Mutter hat mir von einer Frau aus ihrem Block erzählt, die zum Gaudium der Gestapo dazu gezwungen wurde, Sex mit einem der Wachhunde zu haben. Jahrelang habe ich mich gefragt, ob es nicht meine Mutter selber war, die von diesem Hund gebumst wurde. Ich habe mich so geschämt. Diese Erniedrigung, die sie erleiden mußte, hat mich fast umgebracht.«
Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Esther war rot geworden. Sie überlegte, ob sie nicht sagen sollte, es habe unten an der Tür geläutet und sie müsse jetzt auflegen.
»Was hast du gerade über den Holocaust gelesen, als ich anrief?« fragte Sonia.
»Ich las über die Reaktion der restlichen Welt auf die Notlage der Juden«, sagte Esther.
»Es hat keinen interessiert, oder?« fragte Sonia.
»Kein Schwein«, sagte Esther. »Roosevelt hat sich einen Scheißdreck gekümmert. Amerika hätte leicht jede Menge Juden aufnehmen können, aber die haben sich an ihre Einwandererquoten gehalten. Australien hätte Landarbeiter aufgenommen! Du kannst dir vorstellen, wie viele jüdische Landarbeiter es gab. Auf allen sieben Meeren kreuzten Schiffsladungen voll Juden auf der Suche nach Asyl. Die britische Regierung brachte ein Weißbuch heraus, das die jüdische Einwanderung nach Palästina einschränkte, und die britische Marine patrouillierte im Mittelmeer, um Flüchtlingsschiffe abzufangen. Chamberlain machte sich Sorgen, daß antisemitische Gefühle aufkommen könnten, falls er zu viele Juden nach England hereinlassen würde. Ist das nicht komisch? 1944 bot Eichmann eine Million Juden im Tausch für zehntausend Lastwagen und eine Ladung Tee an. Keiner hat sich dafür interessiert. Ich habe ein Zitat von Chaim Weizman gelesen, der während des Krieges Präsident der Zionistischen Weltorganisation war. Er hat’s ja sehr prägnant formuliert. Er sagte, für die Juden sei die Welt aufgeteilt in Länder, in denen sie nicht leben dürfen, und solche, die sie nicht reinlassen.«
»O Gott«, sagte Sonia.
»Tut mir leid«, sagte Esther. »Wahrscheinlich wär’s dir jetzt lieber, du hättest mich gar nicht erst angerufen.«
»Ich fühl’ mich schon ein bißchen flau«, sagte Sonia.
»Hast du immer noch diese Affäre mit dem Typen aus deinem Büro?« fragte Esther.
»Das ist keine Affäre«, sagte Sonia. »Wir schlafen nur ab und zu miteinander.«
»Für mich klingt das nach einer Affäre«, sagte Esther.
»Ist es aber nicht«, sagte Sonia. »Ich verbringe den größten Teil meiner Zeit mit Michael. Michael und ich sind absolut glücklich verheiratet. Wir schlafen regelmäßig miteinander, wir gehen zusammen einkaufen, ins Kino, wir nehmen unsere Mahlzeiten gemeinsam ein. Glücklich verheiratete Leute machen das doch so, oder?«
»Denke schon«, sagte Esther.
»Weißt du«, sagte Sonia, »ich kann es nicht ausstehen, wenn Michael an meinen Brustwarzen saugt oder meine Vagina berührt. Fred, so heißt der Mann aus dem Büro, kann mich ohne weiteres anfassen und bumsen. Wenn er mich gebumst hat, leckt er den ganzen Saft aus mir raus. Er ist so gründlich, daß ich nachher nicht zu duschen brauche.«
»Sonia, ich glaub’, ich muß auflegen«, sagte Esther. Sie war müde. Sonias Gerede hatte sie deprimiert. Sie wollte keine weiteren Details über Sonia und ihren Liebhaber hören. Es klang alles so schäbig. Und Sonia hatte sie so locker von oben herab als morbid bezeichnet. Sie jedenfalls war lieber morbid als schmutzig. Und Sonia war schmutzig. Die Ehe als etwas zu sehen, das lediglich aufs miteinander Essen, Einkaufen und Schlafen hinauslief, war geschmacklos. Weshalb war sie überhaupt mit Sonia befreundet? Vermutlich, weil sie in New York nicht viele Leute kannte. Wenn man kaum Freunde hatte, konnte man nicht besonders wählerisch sein.
Sie sah auf die Uhr. Es war eins. Sie beschloß, einen Kaffee trinken zu gehen und etwas fürs Abendessen zu besorgen. Vielleicht würde sie ein Huhn kaufen und Curryhuhn in Joghurt kochen. Das hatte sie schon ewig nicht mehr gemacht.
Ein grauhaariger Mann von ungefähr fünfundsechzig Jahren war im Aufzug. Er trug eine große Plastiktüte. Esther hatte ihn schon einmal gesehen. »Ich fahr’ zu meiner Tochter«, sagte er zu Esther. »Die ist gerade nach New Jersey gezogen. Und jetzt mach’ ich genau das, was sie tut, wenn sie mich besucht – ich nehme meine Wäsche mit.« Esther war sich nicht sicher, ob er einen Scherz gemacht hatte oder nicht. Sie lächelte ihn an.
Draußen schneite es. Esther war aufgeregt wie ein Kind, als sie den Schnee sah. Sie blieb einen Augenblick stehen, um ihn zu betrachten. Große, dicke Flocken flogen in alle Richtungen, die Luft war voller Schneetupfer. Ein weißer Schneemantel hatte sich bereits über die geparkten Autos gelegt. Der Schnee sah weich aus. Und warm. Wie eine schützende, kuschelige Decke.
Die obersten Stockwerke aller Gebäude waren in den Himmel verschwunden. Manhattan sah aus wie ein Dorf. Ein polnisches oder russisches Dorf vor dem Krieg.
Egal, wie Esther ihren Schirm hielt, die Schneeflocken wirbelten um sie herum und klatschten ihr ins Gesicht. Die Leute auf der Straße lächelten. Der Schnee schien jedermanns Stimmung zu heben.
Im Supermarkt entschied sich Esther für das fleischigste koschere Huhn. Sie kaufte gerne koschere Hühner. Bei denen war ihrer Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit geringer, daß sie eine von diesen neuzeitlichen Hühnerkrankheiten hatten, von denen man dauernd hörte.
Das Leben ist wirklich kompliziert geworden, dachte sie. Als sie ein Kind war, hatte man einfach ein Huhn gekauft, und damit basta. Man brauchte keine Gummihandschuhe zu tragen, um ein Huhn zu waschen, und nicht sorgfältig darauf zu achten, daß es auch richtig durch war. Kein Mensch dachte an Salmonellen oder irgendein Virus. Den meisten Leuten waren Viruserkrankungen unbekannt. Heutzutage hatten junge Leute Warzen an den Genitalien, Pilz- und Hefeinfektionen, und auch ihre eigenen Altersgenossen litten an diesem oder jenem. Sie fühlte sich plötzlich alt.
Sie wartete in der Schlange, um zu bezahlen. Es schien Probleme mit der Kasse zu geben. Sie wechselte die Kasse. Dort ging offenbar aber auch nichts weiter. »Da haben Sie jetzt aber den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben«, sagte eine alte schwarze Frau zu ihr.
Esther nickte ihr zu und fragte sich, was die Frau gemeint haben könnte. War der Teufel schlimmer als Beelzebub oder umgekehrt? Oder waren sie beide gleich schlimm? Bedeutete es das gleiche, wie vom Regen in die Traufe zu kommen? Natürlich, das mußte es sein. Sie lächelte der Frau zu.
Schließlich kam Esther an die Reihe. Sie bezahlte das Huhn und verließ das Geschäft. Das Schneetreiben hatte nachgelassen. Ein paar kleine, feine Flocken hingen matt in der Luft. Esther ging ins Büro zurück.
Die Vierzehnte Straße war gesperrt. An einer blauen Absperrung in der Mitte der Straße hing ein Schild mit der Aufschrift LICE LINE Do NOT CROSS [Läuse-Sperre – Durchgang verboten. Anm. d. Ü.] Esther schaute genauer hin und lachte. Es war eine Polizei-Absperrung. Irgend jemand hatte das Po von POLICE überpinselt.
Am Vormittag hatte sie über Läuse gelesen. In Auschwitz waren die Läuse so vollgesogen mit dem Blut der Häftlinge, daß sie bei der kleinsten Berührung zerplatzten.
Ein junges Paar stand neben der Absperrung und küßte sich. Sie waren sehr jung, die beiden. Ungefähr sechzehn. Sie küßten sich sehr heftig. Esther fand, daß sie zu jung für einen so intensiven Zungenkuß waren.
Sie ging weiter. Zwei orthodoxe Juden hasteten die Second Avenue hinauf. Esther staunte immer noch darüber, wie viele Juden es in New York gab. Sie sah die beiden Männer an und nickte ihnen zu. Sie ignorierten sie. Sie begriff, daß sie sie für niemand besonderen hielten, sie gehörte nicht zur Herde, nicht zu ihnen. Für die war sie einfach bloß irgendeine Jüdin.
Als sie ihr Büro betrat, läutete das Telefon. Sie hob den Hörer ab. Es war ihr Chefredakteur, der aus London anrief. »Okay, Esther«, sagte er. »Wir haben einen anonymen Hinweis bekommen, daß Alistair Champion, der amerikanische Zinnbaron, tot ist oder im Sterben liegt. Oder vielleicht ist es auch sein Sohn, Alistair Champion junior, der im Sterben liegt oder schon tot ist. Wir wissen nicht, ob einer von beiden tot ist, und wenn ja, welcher. Kannst du das rausfinden?«
Esther machte sich an die Arbeit. Alistair Champion junior managte die englische Rockgruppe Spin. Sie suchte die Nummer der Agentur heraus, die diese Gruppe in Manhattan betreute.
»Ich würde gerne mit Alistair Champion Kontakt aufnehmen«, sagte sie zu der jungen Frau, die das Telefon beantwortete.
»Sie können ihn über die Plattenfirma in Los Angeles erreichen«, sagte die junge Frau. »Allerdings weiß ich zufällig, daß er gerade außer Landes ist.«
Irgend etwas an der leisen, zögerlichen Art, in der sie dieses »außer Landes« sagte und der konspirative, wissende Ton des Satzes »allerdings weiß ich zufällig« alarmierte Esther. Sie hätte diesen Ton nicht gehabt, wenn Alistair Champion junior mit der Gruppe auf Tour gewesen wäre.
»Eigentlich wollte ich seinen Vater erreichen«, sagte Esther, »Alistair Champion senior.« Am anderen Ende der Leitung war eine lange Pause.
»Ach so«, sagte die junge Frau langsam.
Esther wußte, daß sie auf etwas gestoßen war. Wäre alles in Ordnung gewesen, hätte die junge Frau ihr lediglich gesagt, daß ihre Agentur nichts mit Alistair Champion senior zu tun habe.
»Alistair Champion ist bei seinem Vater, hab’ ich recht?« fragte sie.
»Ja, er ist bei ihm, in England«, sagte die junge Frau.
»Er ist bei ihm im Krankenhaus, richtig?« fragte Esther.
»Ja«, sagte sie.
»In welchem Krankenhaus ist er?« fragte Esther.
Die junge Frau wurde einsilbig. Esther konnte heraushören, daß sie fürchtete, bereits zuviel gesagt zu haben. »Wenn Sie Alistair Champion erreichen möchten, schicken Sie uns ein Fax hierher, wir faxen es dann weiter«, sagte sie.
»Vielen Dank«, sagte Esther.
Sie rief ihren Chefredakteur an: »Ich habe herausgefunden, daß Alistair Champion senior irgendwo in England im Krankenhaus liegt. Sein Sohn ist bei ihm. Ich weiß nicht, in welcher Klinik er ist, und ich weiß auch nicht, wie krank er ist. Aber ich nehme an, ziemlich krank.«
Zwei Stunden später rief der Chefredakteur zurück: »Fang an. Schreib den Nachruf.« Esther krempelte die Ärmel hoch. Sie holte ihr Adreßbuch heraus und machte sich bereit, Alistair Champions Leben zusammenzufügen.
2
DIE ZEREMONIENMEISTERIN TRUG EIN TRÄGERLOSES ROTES Organzakleid. Sie hatte große, runde, füllig pralle Brüste, von denen ein großer Teil aus ihrem Ausschnitt wogte.
Esther Zepler kam es irgendwie blasphemisch vor, in einer Kirche soviel Busen zu zeigen. St. Andrews war im East Village, in der Siebenten Straße. Aber selbst in New Yorks East Village war eine Kirche immer noch eine Kirche. Und diese Brüste hatten in einer Kirche nichts verloren. Sie paßten nicht zu ihrem kargen Inneren, und zu den meisten frommen Vorsätzen paßten sie auch nicht. Sie fragte sich, warum sie sich darüber aufregte. Schließlich war sie doch eigentlich Agnostikerin.
Die Zeremonienmeisterin holte tief Luft, und Esthers Blick verfing sich an einer Brustwarze. Wieso gab es Leute, fragte sie sich, die völlig unerschrocken ihren Körper herzeigten. Sie selbst kam sich manchmal schon nackt vor, wenn ihr Schlüsselbein zu sehen war. Ihre älteste Tochter zog Röcke an, die kaum noch die Scham bedeckten. Die Jüngste war noch sittsam.
Esther schrieb im Auftrag des Downtown Bugle über diese Trauerfeier für Harold Huberman. Sie hatte Harold Hubermans Nachruf für den Bugle und für die Jewish Times geschrieben.
Als der London Weekly Telegraph entschied, die Nachrufe auf Politiker in Zukunft von seinen Auslandskorrespondenten erledigen zu lassen, war es Esther gelungen, den Downtown Bugle, die Jewish Times und den Australian Jewish Herald als neue Kunden zu gewinnen. Sie war erleichtert. Politik war noch nie ihre Stärke gewesen.
Die meisten der Nachrufe, die sie schrieb, waren allerdings immer noch für den London Weekly Telegraph. Manchmal konnte sie diese Nachrufe überarbeiten und für die anderen Zeitungen wiederverwenden.
Harold Huberman war an AIDS gestorben. Mit achtunddreißig Jahren. Nach und nach füllte sich die Kirche. Nervosität lag in der Luft. Man grüßte sich gemessen und dem Anlaß entsprechend. Esther kannte diese Nervosität vor einem Trauergottesdienst, wenn die Trauergäste nicht recht wußten, wie sie sich verhalten sollten oder was passieren würde.
Die Alten und die Frommen konnten mit dem Tod umgehen. Aber wenn ein Nichtgläubiger gestorben war, ein junger Mensch oder einer in den besten Jahren, herrschte Unbehagen bei der Leichenfeier.
Esther schätzte, daß bereits drei- oder vierhundert Leute in der Kirche waren. Viele junge Ehepaare mit kleinen Kindern, ein paar verstreute, stark geschminkte Transvestiten in hochhackigen Pumps, Geschäftsleute im Nadelstreif samt Gattinnen, zwei Clowns im Kostüm in rot und schwarz gepunkteter Seide, einige Schicki-Musiker aus Downtown Manhattan, ein paar bekannte Schauspieler und eine Schauspielerin. Eine Gruppe Hippies der zweiten Generation mit strähnigen Haaren, bunten Halstüchern und Hosen mit Schlag hatte sich in einer Ecke versammelt.
»Ich glaube, bei dem Ausschlag würde eine Hydrocortisonsalbe viel besser helfen als eine Salbe, die nur beruhigt«, sagte die Frau, die vor Esther saß, zu ihrer Nachbarin. Esther war verblüfft. Amerikaner sprachen so selbstsicher und überzeugt über Medikamente. Alle schienen sich genauso gut auszukennen wie jeder Arzt oder Apotheker. Ein Botenjunge hatte ihr einmal vorgeschlagen, für die Dermatitis um ihre Nase herum Diflorason-Diacetat zu nehmen, das sie unter dem Namen Floron-E-Salbe in jedem Drugstore kaufen könne. »Und wenn Sie eine empfindliche Haut haben«, fügte er hinzu, »nehmen Sie Tylenol und kein Aspirin.«
Im letzten Winter hatte der damalige Portier ihr geraten, gegen ihre Bronchitis und zur Vermeidung einer Lungenentzündung Amoxycillin zu nehmen. »Und nächstes Jahr lassen Sie sich unbedingt gegen Lungenentzündung impfen.« So krank war sie gar nicht gewesen, und sie hatte nicht einmal gewußt, daß man sich gegen Lungenentzündung impfen lassen konnte.
Ein Rechtsanwalt, der im obersten Stockwerk ihres Hauses wohnte, hatte sein eigenes pharmazeutisches Nachschlagewerk, die sogenannte Rote Liste. Er wußte, welches Medikament sich mit welchem nicht vertrug. Er wußte, welche Medizin man vor den Mahlzeiten, mit den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten einnehmen mußte. Er wußte, welche Lebensmittel man bei welchen Medikamenten zu meiden hatte.
Esther wußte genau, daß sie die Rote Liste nicht einmal überfliegen durfte. Sie würde bei der Beschreibung der jeweiligen Krankheitssymptome hängenbleiben oder bei der Aufzählung möglicher Nebenwirkungen der Medikamente. Sie würde zweifellos an allen Symptomen und sämtlichen Nebenwirkungen leiden.
Sie fragte sich, ob sie nicht strenggenommen ein Hypochonder war oder wenigstens als ein solcher bezeichnet werden konnte. Und ob es da überhaupt einen Unterschied gab.
Jedesmal, wenn sie einen Drugstore betrat, blieb sie wie angewurzelt stehen. Das Warenangebot machte einen schwindelig. Der letzte Drugstore, in dem sie gewesen war, verfügte über zwei jeweils drei Meter lange Regalfächer mit neunundvierzig verschiedenen Mitteln gegen Fieberblasen. Sie konnte sich für keines entscheiden. »Da, wo ich herkomme«, hatte sie dem indischen Apotheker ihre Verwirrung zu erklären versucht, »ist Selbstbehandlung nicht üblich.« Er hatte sie völlig ausdruckslos angesehen.
Sobald sie einen Drugstore betrat, wollte sie auf dem Absatz kehrtmachen. Sie kam sich völlig umnebelt vor. Sie fand rein gar nichts. Letzte Woche hatte sie statt einer Wärmflasche versehentlich eine Klistierspritze gekauft.
»In ungefähr einer Viertelstunde beginnen wir mit dem Gottesdienst«, verkündete die Zeremonienmeisterin. »Wir sind etwas spät dran, weil Frederick Lobell, der extra von Paris hergeflogen kommt, im Stau steckt. Er hat gerade angerufen. Er ist schon fast am Hollandtunnel, also kann es nicht mehr lange dauern.«
Esther saß neben James White, einem australischen Journalisten, der schon seit Jahren in New York lebte. Sie kannte ihn nicht sehr gut. Sie hatte ihn vor einem Jahr durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Damals, bei ihrer ersten Begegnung, hatte er sie gefragt, ob sie nicht ein Aphrodisiakum wisse, das ihm helfen würde, einen Mann zu erobern, in den er sich total verliebt hatte. Esther, völlig verdattert von dem Ansinnen, mit einem Liebestrank einen Liebhaber ködern zu wollen, hatte sich besorgt gefragt, warum er sie für einen Menschen hielt, der sich bei Liebestränken auskannte.
»Hast du was von David Bloom gehört?« fragte James White.
»Ja«, sagte sie, »er hat mir eine Karte geschickt. Er ist ganz gerne wieder in Melbourne, schreibt er. Die Ruhe gefällt ihm, und daß die Gemeinde St. Kilda jedem Haushalt einen großen, leuchtendgrünen Mülleimer zur Verfügung stellt. Dienstag und Donnerstag abend joggt er und zählt die Mülleimer.«
»Mir hat er ein Aerogramm geschickt«, sagte James White. »Kleine Schrift, einzeilig getippt. Er schreibt, daß er keine Drogen mehr nimmt und jemanden zum Bumsen hat.«
Esther wußte nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte keine Ahnung, daß David Bloom Drogen genommen hatte. Und sie wollte nicht fragen, welche. Auf der High School war sie sehr eng mit David befreundet gewesen. Als sie siebzehn waren, erzählte er ihr, daß er mit dem Nachbarn von gegenüber seit sieben Jahren ein sexuelles Verhältnis hatte. Esther war fassungslos gewesen. Für sie war Homosexualität etwas, das sich in Büchern abspielte, aber nicht bei David Bloom in Melbourne, Australien.
Esther hatte David Blooms Mutter sehr gern gemocht. Die kleine Mrs. Bloom, deren Englisch mit jiddischen genauso wie mit polnischen Brocken durchsetzt war, hatte sich an ihrem sechsundsechzigsten Geburtstag für ein Seminar Literarisch schreiben für Erwachsene angemeldet. »Ich werde über mein Leben schreiben«, erzählte sie Esther. »Den ersten Satz hab’ ich schon: ›Bei mir ist von oben bis unten alles falsch.‹« Für Esther war das einer der besten Anfangssätze, die sie je gehört hatte.
»Hal Hubermans Eltern und seine beiden Schwestern sitzen in der ersten Reihe«, sagte James White zu ihr. Esther sah sich Harold Hubermans Familie an. Sie saßen ganz still da. Kein Laut. Keine Regung. Sie schienen von den anderen Trauergästen ziemlich weit entfernt zu sein. Von hinten betrachtet wirkten sie wie gelähmt.
Zwei Plätze neben Esther hatte ein Mann seinen Arm um einen kleineren Mann gelegt. Von Zeit zu Zeit beugte er sich über ihn und küßte ihn auf den Kopf.
Die Zartheit dieser Berührung zwischen zwei Männern erschien Esther unpassend. Ein solcher Austausch von Zärtlichkeiten schien ihr eher für Mann und Frau vorbehalten. Natürlich war ihr bewußt, daß Männer sich genauso zärtlich lieben konnten wie ein Mann eine Frau. Und eigentlich kannte sie nicht viele Frauen, die von ihren Männern besonders zärtlich geliebt wurden.
Sie erinnerte sich, wie unangenehm es ihr gewesen war, als in einem Fernsehfilm zwei Männer sehr tiefe Zungenküsse austauschten. Sie hätte beinah aufgeschrien, als sie anfingen, sich gegenseitig zu entkleiden, gegenseitig ihre Hemden aufzuknöpfen. Ihr kam es vor, als hätte sie jemandem zugesehen, wie er sich selbst liebt. Um so mehr, als beide Männer Nadelstreifenanzüge und gleiche Hemden trugen. Sie hatte gejohlt, wie es halbwüchsige Burschen bei Sexszenen im Kino tun. Danach hatte sie sich geschämt.
Neben ihr nahm ein älteres Ehepaar Platz. Die beiden wirkten irgendwie merkwürdig. Auf den ersten Blick hatte man den Eindruck eines gut und konservativ gekleideten Paares, aber als sie näher hinsah, stellte sie fest, daß der Mann, Mitte siebzig, peinlichste Sorgfalt auf die farbliche Abstimmung seiner Kleidung verwendet hatte.
Sein grün und blau gemustertes Sakko hatte den Farbton seiner dunkelgrünen Tweedhosen fast getroffen. Es lag nur um ungefähr einen halben Ton daneben, es paßte nicht ganz. An einem Zeigefinger trug er einen riesigen, klobigen goldenen Ring, und die Füße steckten in schwarzen Lederschuhen mit großen Silberschnallen.
Seine Frau, ungefähr gleich alt, trug einen schwarzen Plisseerock, schwarze Strümpfe, eine schwarze Seidenbluse und eine orangefarbene Webpelzjacke. Vielleicht, dachte Esther, bleibt einem die Vorliebe für auffällige Kleidung ein Leben lang.
Bevor sie nach New York kam, hatte Esther geglaubt, daß die Menschen sich im Alter irgendwie aneinander angleichen und einfach alte Leute sein würden. Mit weißen oder grauen Haaren und kaum voneinander zu unterscheiden.
Sie hatte geglaubt, weil man im Alter ruhiger und weniger exzentrisch war, würde man sich auch entsprechend kleiden. Das Alter würde die Unterschiede zwischen den Menschen verringern. Sie würden sich alle ähnlicher werden. Falten würden unregelmäßige Züge ausgleichen, die Körperhaltung die des Alters sein und die Gestalt nicht mehr so ausgeprägt wie in der Jugend oder in mittleren Jahren.
Es war, als würde das Alter die Dinge einander angleichen. Die Schönen waren nicht mehr so schön und die Häßlichen nicht mehr so häßlich. Dralle Busen fielen nicht mehr so auf, und flache Brüste waren unwichtig geworden. Die Leute schienen alle die gleiche Größe zu haben. Vielleicht wurden die Dünnen dicker und die Dicken dünner? Oder vielleicht waren die meisten von den ganz Dicken schon gestorben? Wer wußte das schon?
Selbst der Unterschied zwischen arm und reich verwischte sich. Im Alter sahen die Reichen nicht mehr so reich aus. Manchmal vergaßen sie, sich am Hinterkopf die Haare zu kämmen, bekleckerten sich und bemerkten die Flecken auf ihrer Kleidung nicht mehr.
Aber hier, in New York, gab es ältere Frauen, die große Schönheiten waren, und sehr gutaussehende alte Männer. Sie waren feurig, scharfzüngig, artikuliert, witzig und hochintelligent. Männer und Frauen in ihren Siebzigern und Achtzigern, die auch im Alter die blieben, die sie gewesen waren.
»Hatte Hal Huberman nicht einen Bruder?« fragte James White.
»Nein, nur zwei Schwestern«, sagte sie. »Ich habe zwei Nachrufe auf ihn geschrieben, für den Bugle und die Jewish Times.«
»Hast du die dabei?« fragte er.
»Bloß den für die Jewish Times«, sagte sie. Sie griff in ihre Tasche und zog ihn heraus. Der Nachruf lautete:
Harold Huberman, der am Freitag starb, war 38 Jahre alt. Harold Huberman war Schauspieler, Dichter, Promoter und Manager. Man nannte ihn einmal den Regierenden Zirkusdirektor des New Yorker Nachtlebens. In den 70er und 80er Jahren hatte er in seiner Rolle als Türsteher von Clubs wie dem Isabella oder der Galeria 70 riesigen Einfluß auf das New Yorker Gesellschaftsleben. Harold Huberman hatte die Gabe, ein Talent zu erkennen. Er pflegte und förderte die Karrieren vieler begabter junger Musiker, Künstler, Schriftsteller und Schauspieler. Als Türsteher brachte er Berühmtheiten und Debütanten mit Königen und Künstlern zusammen, wobei man, wie einmal über ihn geschrieben wurde, Harold Huberman genausowenig einen Türsteher nennen konnte, wie man einen Thunderbird Baujahr ’55 einfach als Auto bezeichnet hätte.
Harold Huberman starb an AIDS. Er hinterläßt seine Eltern, Thelma und Maurice Huberman aus Brooklyn, New York, seine Schwester Ruth Goldman aus Atlantic Highlands, New Jersey, seine Schwester Alice Meer, ebenfalls Brooklyn, sowie vier Nichten und Neffen.
Auf derselben Seite wie Harold Hubermans Nachruf fand sich unter der Rubrik »Grabstätten zu verkaufen« folgende Anzeige: »Führende Gemeinde in der Bronx mit abnehmender Mitgliederzahl verkauft 867 Gräber.«
Die Anzeige hätte anders lauten sollen, fand Esther. Eine Kultusgemeinde mit abnehmender Mitgliederzahl würde kaum auf leidenschaftliches Interesse stoßen. Wer würde sich da schon einkaufen wollen? Sie ging davon aus, daß sich die 867 Gräber neben jenen befanden, die die Gemeinde behalten wollte. Vermutlich war es nach dem Tod genauso wichtig wie vorher, daß man die richtige Adresse hatte.
In einer weiteren Anzeige wurden zwei Gräber mit Grabsteinen aus pinkfarbenem Granit angeboten, ohne Inschrift, auf dem Mount Hebron Friedhof in Flushing, New York. Der Preis war Verhandlungssache. Warum verkauften diese Leute ihre Gräber, fragte sie sich. Hatten sie beschlossen, nicht zu sterben? Hatten sie sich mit ihren Kindern überworfen und deshalb entschieden, daß die sich woanders begraben lassen sollten? Waren sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten? Waren sie einmal so wohlhabend gewesen, daß sie die Grabsteine bereits bezahlt hatten und sich jetzt nicht mal mehr die Gräber leisten konnten? Wahrscheinlich hatte das Ganze natürlich einen simplen Grund, etwa den, daß die Leute nach Florida gezogen waren und dort begraben werden wollten. Wenn man zu viele Nachrufe las, konnte einem leicht die Phantasie durchgehen.
An diesem Morgen hatte in der New York Times ein trauriger Nachruf gestanden. Ein katholisches Ehepaar, Mitte vierzig, war bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hinterließ fünf Kinder. Kardinal O’Connor, der die Trauerrede hielt, hatte von dem unübertrefflichen Einsatz gesprochen, den die Familie für die Gemeinde leistete. Aus dem Nachruf ging eindeutig hervor, daß es sich bei dem Ehepaar um beispielhafte Bürger gehandelt hatte. Weshalb mußten sie dann sterben und fünf Kinder zu Waisen werden? Wieso hatte ihre Rechtschaffenheit sie nicht beschützt? Es war rätselhaft, warum der eine früher und der andere später starb.
Ihre Mutter hatte ihr gesagt, in Auschwitz seien die Besten zuerst gestorben. Esther hatte das bezweifelt, ihre Mutter war jedoch eisern geblieben. Ihr eigenes Überleben, hatte sie oft behauptet, sei nur Glück gewesen. Glück. Und das in Auschwitz, dachte Esther.
Die armen Juden in Europa hätten sehr viel mehr nötig gehabt als Glück. Esther hatte über einen Arbeiterstreik des Jahres 1942 gelesen. Im Dezember 1942 war in New York eine halbe Million jüdischer Arbeiter aus Protest gegen den Nazimord an den Juden zehn Minuten lang in Streik getreten. Die jüdischen Arbeiterführer, die die Arbeit zunächst eine Stunde niederlegen wollten, entschieden sich schließlich dagegen, weil sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, die Kriegsproduktion zu behindern. Mit dieser Sorte Glück auf ihrer Seite war es kein Wunder, daß die europäischen Juden keine Chance hatten.
Sie versuchte sich abzulenken. Sie wollte nicht daran denken, was die amerikanischen Juden unternommen hatten, während die europäischen Juden starben. Vermutlich waren sie einkaufen gegangen, hatten Ausflüge gemacht, gearbeitet, Picknicks veranstaltet, Firmen gegründet und Imperien aufgebaut.
Die Führer der amerikanischen Juden hatten Roosevelt im allgemeinen sehr respektiert und ihm vertraut. Sie glaubten daran, daß er helfen würde, und weigerten sich zu erkennen, daß er nichts tat.
Die Führer des Jüdischen Weltkongresses hatten solche Scheuklappen, daß ihre für nach dem Krieg geplanten Rettungsmaßnahmen davon ausgingen, daß in Europa noch Millionen von Juden zu retten seien.
Sie mußte aufhören, darüber nachzudenken. Sie hatte festgestellt, daß sie reichen Juden gegenüber eine gewisse Feindseligkeit empfand. Sie hatte sich mit einer Bekannten unterhalten, einer Frau um die Fünfzig mit sehr reichen Eltern, deren Brüder noch reicher waren als die Eltern und deren Ehemann überhaupt der allerreichste war. Die Frau, Barbara Sandler, hatte gesagt, Geld bedeute ihr absolut gar nichts. Esther hatte einen armen Menschen noch nie so etwas sagen hören. Es war eine ständige Rede der Reichen. Mitten im Gespräch mit Barbara Sandler stellte Esther plötzlich fest, daß sie sich fragte, was deren Eltern getan hatten, während ihre Eltern im Ghetto um Essen bettelten, bevor sie abtransportiert wurden.
Was machten sie gerade an jenem Tag, an dem ihre Mutter das Bewußtsein verloren hatte und nackt auf einem Betonfußboden gelegen war, von Typhus geschüttelt?
Ihr war heiß. Sie schaute sich um. Die Kirche war brechend voll. Kein Platz mehr frei. Viele Leute standen hinten und in den Gängen.
Im Taxi auf dem Weg zu Harold Hubermans Trauergottesdienst hatte sie Queen ihren alten Hit »Bohemian Rhapsody« singen hören. Bohemian Rhapsody war eine Sechsminutenarie über einen armen jungen Burschen, der des Mordes überführt war. Freddie Mercurys herrliche Stimme, verwundbar, mutig, stark und weich, sang:
Too late, my time has come.
Send shivers down my spine.
Body’s aching all the time …
Goodbye everybody, I’ve got to go.
Got to leave you all behind and fade through.
Mama, ooh, ooh, I don’t want to die.
I sometimes wish I’d never been born at all.
Freddie Mercurys Stimme ging ihr durch und durch. Sie dachte an ihn, mit aufgeworfenen Lippen posierend auf den Bühnen der Welt. Er sang herzzerreißend zärtlich, mit wilder Selbstvergessenheit, Stimme und Körper ein Ausdruck jubelnder Freiheit. Mama, sang er, Mama, life had just begun but now I’ve gone and thrown it all away. Mama, didn’t mean to make you cry. Die Gitarre schluchzte ein Echo.
Freddie Mercury hatte »Bohemian Rhapsody« 1975 aufgenommen. 1975 hatte noch kein Mensch etwas von AIDS gehört. Freddie Mercury war vor kurzem an AIDS gestorben.
Die Trauergäste waren nicht mehr ganz so feierlich. Man unterhielt sich leise. Harold Hubermans Nachruf zu schreiben war verhältnismäßig einfach gewesen. Jeder war begierig darauf, über ihn zu reden.
Das Schreiben von Nachrufen konnte sehr knifflig sein. Man kam sich ein bißchen wie in einem Labyrinth vor. Wege und Kurven waren verwirrend und schwierig, und man hatte keine Zeit, nach Wegweisern zu suchen.
Es war eine Frage der Zeit. Binnen vierundzwanzig Stunden mußte sie alles recherchieren, was sie jemals über den Verstorbenen wissen würde. Die Zeit bestimmte, was sie wußte und was sie schrieb.
Ein guter Nachrufschreiber mußte gut lügen können und ein gutes Gespür für die Lügen anderer haben. Außerdem mußte man gut bluffen können. Esther war ihr Leben lang eine gute Lügnerin gewesen. Sie neigte zu Übertreibungen. Die Wahrheit war selten gut genug. Es hatte mehrere Jahre Analyse gebraucht, bis sie versuchte, bei der Wahrheit zu bleiben.
Häufig rief sie Journalisten an und bat sie um Informationen für ihre Nachrufe. Journalisten konnten sehr genau abschätzen, ob man ihnen in Zukunft von Nutzen sein könnte oder nicht. Esther lernte, während der ersten Minute eines Gesprächs die Namen einiger Prominenter fallenzulassen. Journalisten waren nicht leicht zu manipulieren, und sie wußte, daß ihr durch die Erwähnung dieser Namen ein Maximum von fünf Minuten Gesprächszeit zur Verfügung stand.
Starjournalisten oder Wissenschaftler waren eher unwillig, mit ihr zu sprechen. Sie wußten, daß sie lediglich einen einmaligen Beitrag schrieb und ihnen in Zukunft vermutlich auch keinen Gefallen würde tun können.
Manchmal stieß Esther auf einen Wissenschaftler, der begeistert war, erzählen zu können. Meistens handelte es sich dabei um einen Spezialisten, für dessen Fachgebiet sich nur wenige Leute interessierten. Esther hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie diesen Gesprächsfluß stoppte.
Wenn sie Leute anrief, um Informationen zu erhalten, hatte sie häufig keine Ahnung, was diese vom Gegenstand ihres Nachrufs hielten. Hegten sie einen Groll gegen die verstorbene Person, oder mochten sie sie gern? Persönliche Eindrücke, die sie gewonnen hatte, durfte sie nicht äußern und mußte ihre Fragen so stellen, daß sie ihre Informationen erhielt und gleichzeitig die Einstellung des Befragten zum Verstorbenen heraushörte.
Esther dachte oft, daß die Kombination aus Elternhaus und Analytikern sie gut auf diesen Job vorbereitet hatte.
Heute morgen beim Frühstück hatte Sean sie zum Lachen gebracht. »Weißt du, wie ein jüdisches Telegramm lautet?« hatte er sie gefragt. »Mach dir schon mal Sorgen. Stop. Erklärung folgt.«
Obwohl Sean wie ein Jude aussah, war leicht zu erkennen, daß er keiner war. Er sah zu fröhlich aus. Sean liebte Manhattan. Er liebte jeden Weg und jede Straße. Er liebte die Leute. Alle Leute. Er kam mit den Nachbarn gut aus, den Geschäftsleuten in der Nachbarschaft, dem Bäcker und dem Briefträger. »Mr. Dapolito ist der heimliche Bürgermeister von Soho«, hatte er ihr neulich erklärt. Mr. Dapolito gehörte die Bäckerei Vesuvio in der Prince Street. Sie kauften jeden Morgen ihr Brot bei ihm.
Sean wollte in Manhattan bleiben. Esther war sich nicht sicher. Sie wußte nicht recht, was an Australien es war, das ihr fehlte.
»Du würdest dich zu Tode langweilen, wenn wir nach Melbourne zurückgingen«, sagte Sean ihr immer wieder.
»Es gibt Leute, die mir fehlen«, sagte sie zu ihm.
»Wer? Ivana? Marjorie? Anna? Du hattest ständig mit einer von ihnen Streit oder hast dich über sie beschwert«, sagte er.
»Aber ich hatte immer ein oder zwei enge Freundinnen, mit denen ich mich gut verstanden habe«, sagte Esther.
»Das hast du hier auch«, sagte er. »Du hast Sonia.«
Sie erinnerte sich, warum sie erschöpft war. Sonia Kaufman hatte sie heute früh angerufen. Um 6 Uhr. Sie hatte seit fünf oder sechs Wochen nicht mehr mit ihr gesprochen. Sie hatte beschlossen, daß sie Sonia eigentlich nicht mochte. Sonia war zu schrill und zu selbstsicher. Esther wußte, daß sie übertrieben ängstlich und unentschlossen war, aber Sonia, fand sie, war bedrückend selbstherrlich.
Ihre letzte Unterhaltung war abrupt zu Ende gegangen. Sonia hatte Esther in ihrem Büro angerufen. Esther war gerade mit dem Nachruf auf den verstorbenen Rock-Impresario Bill Graham fertig. Graham war ums Leben gekommen, als sein Helikopter in San Francisco in einen siebzig Meter hohen Wasserturm krachte. Er war sechzig Jahre alt gewesen.
1968 hatte Esther, in ein langes, psychedelisches Gewand gehüllt, unter den Neonröhren in Grahams Fillmore Auditorium in San Francisco getanzt. Sie war achtzehn Jahre alt und Reporterin für ein Rockmagazin gewesen. Damals hatte sie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones von den Rolling Stones und Mama Cass interviewt. Sie waren alle gestorben.
Sie hatte auch Rockstars interviewt, die nicht gestorben waren. Sonny and Cher, Mick Jagger, die Beach Boys, die Young Rascals, Herman’s Hermits, Crosby, Stills and Nash, die übrigen Mamas and Papas. Sie hatte Hunderte Rockstars interviewt, die nicht gestorben waren.
Bill Graham war als Wolfgang Grajonca in Berlin auf die Welt gekommen. Sie erinnerte sich an Graham, 1968 im Fillmore. Sie wünschte sich, sie hätte damals schon gewußt, daß er als Kind aus Nazi-Deutschland geflohen war. Er hatte es geschafft. Aber seine dreizehnjährige Schwester war auf der Flucht verhungert. Graham sagte, daß er sich deswegen sein Leben lang schuldig gefühlt habe.
Sie wußte nicht, was es ihr bedeutet hätte, wenn sie schon damals über Grahams Vergangenheit Bescheid gewußt hätte. Wahrscheinlich gar nichts. Sie hatte einen langen Nachruf geschrieben, in dem von den Dollarmillionen die Rede war, die Graham für soziale und politische Zwecke gesammelt hatte, und den Stars in der Musikwelt, deren Konzerte und Karrieren er gefördert hatte.
Sie tippte gerade die letzten Worte des Nachrufs, als Sonia anrief. »Ich hasse diese Scheißkanzlei«, waren ihre ersten Worte. Esther, die immer noch bei Bill Grahams Leben und Sterben weilte, reagierte nicht sofort. Sonia merkte es gar nicht.
»Ich hasse sie«, fuhr sie fort. »Sie können mich nicht loswerden, weil mein lieber Mann, Michael, zuviel Geld für sie verdient, aber sie hätten vermutlich nichts dagegen, wenn ich kündige.«
»Warum glaubst du, daß sie deine Kündigung wollen?« sagte Esther.
»Eigentlich«, sagte Sonia, »habe ich keinen blassen Dunst, was sie überhaupt wollen. Ich hatte gerade eine dieser gräßlichen Beurteilungen, die’s alle halben Jahre gibt. Du sitzt vor einem Komitee, das dir erzählt, was die Leute in der Firma von dir halten. Sie sagen dir, wer gern mit dir arbeitet, wer sich über dich beschwert und warum. Dein Vorgesetzter hat dabei die Aufgabe, dich zu verteidigen. Aber mein schleimiger kleiner Jim Brentstone, der seine Pfoten nicht von den Mädels im Büro lassen kann, war während des ganzen Meetings auffallend schweigsam. Früher habe ich bei diesen Beurteilungen einen Teil der Kritik immer für gerechtfertigt gehalten. Aber diesmal weiß ich, daß ich wirklich gut gearbeitet habe, und trotzdem habe ich heute von jedem nur eine mittelmäßige Beurteilung bekommen. Meistens ist das ein diskreter Hinweis, zu gehen. Ich glaube, die sehen in mir keinen zukünftigen Teilhaber der Firma.«
»Muß jeder ein potentieller zukünftiger Teilhaber sein?« fragte Esther.
»Grundsätzlich ja«, sagte Sonia. »Wenn man nach sieben oder acht Jahren immer noch nur mit allgemeinen Kanzleiaufgaben beschäftigt ist, finden sie Mittel und Wege, einen wissen zu lassen, daß man nicht in die Firma paßt. Ich bin jetzt fast fünf Jahre dabei und hatte geglaubt, zu den zukünftigen Teilhabern zu gehören. Michael war es schon nach sechs Jahren, aber er ist auch einfach brillant. Zumindest auf den Gebieten Vermögensverwaltung und Treuhänderschaft. Entschuldige, daß ich so labere. Aber ich bin ziemlich gereizt. Meine Periode ist seit vierzehn Tagen überfällig, und das macht mir auch zu schaffen. Letzten Monat ist Fred ein Kondom geplatzt. Das ist mir noch nie passiert. Ich war mit Fred immer so vorsichtig, nie ohne Kondom.«
»Du hast mir erzählt, daß er seinen Saft aus dir rausleckt«, sagte Esther.
»Nur, wenn ich kurz vor der Regel bin«, antwortete Sonia. »Außerdem sollst du mir keine Löcher in den Bauch fragen, sondern mir zuhören und mich bedauern.«
»Tut mir leid«, sagte Esther. »Du hast schon genug Sorgen mit den Löchern im Kondom.«
»Sehr witzig«, sagte Sonia. »Die Motilität von Michaels Spermien ist sehr gering, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, daß ich von ihm schwanger werden könnte.«
Esther war es peinlich, dieses intime Detail über Michaels Physiologie zu erfahren. Sperma war so etwas Persönliches. Sie fand, daß Michaels Sperma sie nichts anging. Sie brauchte nicht zu wissen, daß es sich nicht allzu munter bewegte. Niedrige Motilität. Aber es paßte. Michael bewegte sich überhaupt sehr langsam. Er hatte einen lahmen, feuchten Händedruck. Esther konnte sich gut vorstellen, daß seine Spermien nicht genug Interesse aufbrachten, bis zu den Eileitern vordringen zu wollen. Michaels gesamte Energie schien in seinem Kopf konzentriert zu sein.
»Dieses Kondom«, sagte Sonia, »wurde als das dünnste auf der Welt angepriesen. Der Welt dünnstes Kondom endete als dünner Gummiring an Freds Schwanzwurzel.«
»Warum hast du das dünnste Kondom der Welt benutzt, wenn du wußtest, daß dein Eisprung bevorsteht?« fragte Esther. »Ich hätte eine Gummimatte genommen. Sogar ich verwende extra starke Kondome mit einem Spermizid.«
»Was soll das heißen, sogar ich?« sagte Sonia.
»Ich meine ich, die ich mit meinem eigenen Mann schlafe«, sagte Esther. »Das meine ich.«
»Diese Bemerkung habe ich überhört«, sagte Sonia. »Als Fred kam, hat er gebrüllt: ›Dieses Kondom ist großartig.‹«
Esther fragte sich, warum sie Sonias Gerede über Sex so geschmacklos fand. Sie hatte keine Lust, über Fred Soundso nachzudenken, wie er sein Sperma aufleckte oder brüllte, wenn er kam. War sie vielleicht prüde? Oder vielleicht war es geschmacklos. Geschmacklos. Sie grinste über diese Zufallspointe.
Es war ja nicht so, daß sie nicht an Sex dachte. Sie tat es durchaus. Aber sie redete nicht über ihr Sexualleben. Wenn sie und Sean sich liebten, hatte sie oft die Vorstellung, er würde Rahm produzieren. Flüssigkeiten in ihm würden geschleudert und geschleudert wie beim Buttern und einen Strom von Rahm hervorbringen. In diesem Moment begriff sie zum ersten Mal, daß ihre Analogie völlig falsch war. Es war der Rahm, der geschleudert wurde und als Butter herauskam.
»Du bist bestimmt nicht schwanger«, sagte sie. »Deine Periode hat sich einfach verschoben. Mit einundvierzig muß man mit so etwas rechnen. Sie wird unregelmäßiger.«
»Wovon redest du eigentlich?« sagte Sonia.
»Vom Beginn der Wechseljahre«, sagte Esther. »Der Östrogenspiegel kann schon mit Ende dreißig zu sinken beginnen.«
»Ich bin nicht in den Wechseljahren«, schrie Sonia. »Mein Zyklus ist völlig regelmäßig. Alle achtundzwanzig Tage.«
»Ich behaupte ja gar nicht, daß du in den Wechseljahren bist«, sagte Esther. »Ich sagte, es könnte der Beginn des Wechsels sein. Wenn man in die Menopause kommt, kann man immer noch regelmäßige Zyklen von achtundzwanzig Tagen haben.«
»Ich halte das nicht aus«, sagte Sonia. »Ich mache mir Sorgen, ob ich vielleicht schwanger bin, und du rätst mir, mir über mein Klimakterium Sorgen zu machen.«
»Ich will nicht, daß du dich sorgst. Ich wollte deine Sorgen zerstreuen«, sagte Esther.
»Mir zu sagen, ich befände mich in den Wechseljahren, ist wirklich eine neue Art, Freude zu verbreiten«, sagte Sonia.
»Ich sagte Beginn der Menopause«, sagte Esther.
»Ich lege jetzt auf«, sagte Sonia.
Nachdem sie aufgelegt hatte, fühlte Esther sich ziemlich schlecht. Sie wußte nicht, warum sie Sonia gegenüber so unsensibel gewesen war. In letzter Zeit tat und sagte sie so vieles, was ihr unverständlich war. Als sie Australien verließ, war sie überzeugt gewesen, nach sieben Jahren analytischer Psychotherapie und fünf Jahren Analyse ihr Verhalten und ihre Motive einigermaßen zu verstehen.
»Entschuldige, daß ich dich so früh anrufe«, sagte Sonia.
Sie hatte bis zu diesem Morgen nichts mehr von Sonia gehört.
»Macht nichts«, sagte Esther. »Gibt’s Probleme?«
»Nein«, sagte Sonia.
»Puh«, sagte Esther.
»Na ja, keine richtigen Probleme«, sagte Sonia. »Nur ein bißchen.«
»Bleib bitte dran, ich lege das Gespräch ins Nebenzimmer. Sean schläft noch«, sagte Esther.
Sie ging durch das Loft, das sie erst kürzlich bezogen hatten. Es war ihr noch sehr neu. Sie wußte noch nicht automatisch, wo sich alles befand. Sie hob das Telefon in Seans Studio ab.
»Also, was ist los?« sagte sie.
»Ich bin schwanger«, sagte Sonia.
»O Gott«, sagte Esther. »Alles okay? Ich meine, wie fühlst du dich?«
»Mir ist dauernd schlecht«, sagte Sonia.
»Das meine ich nicht«, sagte Esther. »Ich meine, wie geht’s dir damit, ein Kind zu bekommen?«
»Anfangs war ich ziemlich durcheinander«, sagte Sonia. »Ich hielt mich für ambivalent, was das Kinderkriegen betrifft. Und nachdem Michaels Sperma eine so niedrige Motilität hat, stand eine Entscheidung für mich auch nie wirklich im Raum. Ich glaube, ich habe einfach akzeptiert, daß ich wahrscheinlich keine Kinder haben würde. Aber sobald ich wußte, daß ich schwanger bin, wollte ich das Kind. Ich war selbst überrascht, wie sehr ich dieses Kind wollte. Nett von dir, daß du mich nicht fragst, wer der Vater ist.«
»Wer ist der Vater?« fragte Esther.
»Ich weiß es nicht«, sagte Sonia.
Esther hatte sich gefragt, wer wohl der Vater sein mochte. War das Kind von Fred, Sonias Liebhaber, gezeugt worden oder hatten Michaels Spermien sich aufgerappelt und die Vereinigung vollzogen? Sie schämte sich, weil sie in einem solch heiklen Augenblick Michaels Spermien gegenüber so respektlos war.
»Das Kondom ist am zehnten Tag meines Zyklus geplatzt«, sagte Sonia. »Michael und ich haben am neunten und am dreizehnten Tag miteinander geschlafen. Ein sehr ungewöhnlicher Monat für uns. Ich habe alles Verfügbare über den Eisprung gelesen und halte es für mehr als wahrscheinlich, daß ich am dreizehnten und nicht am zehnten Tag ovuliert habe.«
Esther entschloß sich, Sonia recht zu geben. Sie versuchte, amtlich zu klingen. Das meiste, was sie über die Ovulation wußte, hatte sie dem Beipackzettel eines Clearplan Easy One-Step Ovulation Predictor Packet entnommen. Sie hatte das Ovulations-Testpäckchen als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme gegen eine Schwangerschaft gekauft. Seitlich auf der Schachtel stand Zur Verhütung nicht geeignet.
»Bei einem Zyklus von achtundzwanzig Tagen«, sagte Esther, »findet der Eisprung im allgemeinen an den Tagen elf, zwölf oder dreizehn statt.«
»Darauf bin ich auch schon gekommen«, sagte Sonia. »Ich habe Fred gesagt, daß ich ihn nicht mehr treffen wollte, weil ich versuchen würde, ein Kind zu bekommen. Er meinte, das wäre in Ordnung, und vielleicht könnten wir uns nach der Geburt wieder sehen. Seine Reaktion hat mich etwas aus der Fassung gebracht, ich weiß nicht, warum.«
»Weil es sich ziemlich lässig anhört«, sagte Esther. »Du wolltest wahrscheinlich nicht, daß er besonders besitzergreifend ist, aber seine Reaktion war so beiläufig, daß sie an Gleichgültigkeit grenzt. Als dein Liebhaber mochte das noch angehen, aber als möglicher Vater deines Kindes hattest du dir vielleicht mehr von ihm erwartet. Nicht, daß ich ihn für den Vater deines Kindes halte, überhaupt nicht.«
»Ich auch nicht«, sagte Sonia.
»Und wie steht Michael dazu?« sagte Esther.
»Der ist außer sich vor Freude«, sagte Sonia. »Ich habe mir den Kopf zerbrochen, ob er irgendwie rausfinden könnte, daß das Kind nicht von ihm ist, falls es nicht von ihm ist. Ich will Fred nicht nach seiner Blutgruppe fragen, weil ich nicht will, daß er mißtrauisch wird. Außerdem könnte er ja auch dieselbe haben wie Michael, Null positiv. Wie dem auch sei, wie viele Väter kennen die Blutgruppe ihrer Kinder? Falls der Arzt feststellt, daß dieses Kind unmöglich von Michael sein kann, wird er sich kaum darum reißen, ihm das mitzuteilen. Ich meine, heutzutage kriegen die Leute ihre Kinder auf so viele verschiedene Weisen, Ei-Spende, Samenbank, Leihmutter. Die meisten Ärzte werden dieses Thema sicher sehr taktvoll behandeln. Außerdem sind wir in Amerika. Hier tun die Ärzte genau das, wofür du sie bezahlst. Wenn du dich fünfzigmal an derselben Stelle liften lassen willst, um deine Hängebacken zu korrigieren, werden sie dich fünfzigmal operieren. Also wird dieser Gynäkologe den Mund halten.«
»Der dreizehnte Tag war wahrscheinlich der Tag der Empfängnis«, sagte Esther. »Du warst immer regelmäßig. Ich bin sicher, du hast ordentlich und pünktlich ovuliert. Das Baby wird vermutlich genauso aussehen wie Michael. Wie sieht Fred aus?«
»Klein und dunkel, wie Michael«, sagte Sonia.
»Gott sei Dank«, sagte Esther.
»Bei Michael scheint diese Schwangerschaft eine leichte Hirnerweichung hervorzurufen«, sagte Sonia. »Neulich abends meinte er doch tatsächlich, ob wir nicht nach Australien zurückkehren sollten, weil wir doch jetzt ein Kind bekommen. Ich war stocksauer. Ich gehe nicht nach Australien zurück. Ich nehme drei Monate Mutterschaftsurlaub und dann gehe ich wieder arbeiten. Ich weiß nicht, wieso Michael auf die Idee kommt, wir sollten alles aufgeben, was wir uns vorgenommen und wofür wir gearbeitet haben, bloß weil wir Eltern werden. Erzählt mir den ganzen Scheiß von wegen blauem Himmel, Gärten, Stränden und dem sicheren Leben in Australien. Ich will nicht, daß mein Kind in einem Garten aufwächst. Es soll wissen, wie ein Cappuccino im Café Dante in der MacDougal Street schmeckt.«
»Und was hast du zu Michael gesagt?« fragte Esther.
»Ich habe ihm gesagt, ich gehe nirgendwohin. Spar dir die Scheiße mit dem blauen Himmel. Ich habe das idyllische australische Leben auf meiner Tingeltour durchs Land ausreichend genossen. Ich habe in Goulburn, Kiandra, Deniliquin, Wagga gelebt und gearbeitet. Ich kenne die Wahrheit über das gute und einfache Leben in Australien. Ich habe die Verzweiflung, die Brutalität, die betrunkene Aggressivität mitbekommen. Ich habe die verprügelten Frauen und mißhandelten Kinder gesehen. Ich kannte den Päderasten, der in dem Wohnwagen hinter den Sportanlagen wohnte. Ich habe die tödlichen Unfälle auf den Straßen gesehen, die Raufereien in den Pubs, die Intoleranz. Und den armen Teufel von gegenüber, der sich aus schierer Einsamkeit erschießt. Hör mir bloß auf mit deinem blauen Himmel.«
»Ich glaube nicht, daß Michael meint, in Australien wäre das Leben besser«, sagte Esther. »Er möchte bloß, daß sein Kind das bekommt, was auch er hatte. Alle Eltern sind so. Wenn du als Kind nur Prügel bezogen hast, ist es sehr gut möglich, daß auch du dein Kind verprügeln wirst. Das Prinzip ist dasselbe.« Esther holte tief Luft. Sie hatte den Eindruck, daß sie bei dem genannten Beispiel möglicherweise Prinzipien und trübe Metaphern durcheinandergebracht hatte. Es war nicht ihre Absicht gewesen, einen Umzug nach Australien mit Kindesmißhandlung gleichzusetzen.