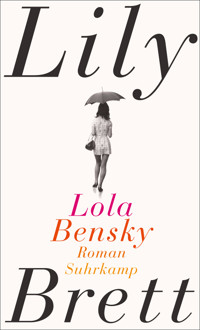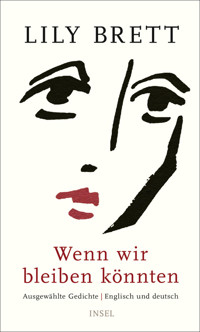7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»›Wenn man zu schnell geht, bekommt man Falten‹, sagte eine Nachbarin zu mir. Um mir das mitzuteilen, hatte sie mich mitten auf dem West Broadway angehalten. ›Tatsächlich‹, sagte ich. ›Davon bin ich felsenfest überzeugt‹, antwortete sie. Ich sah ihr Gesicht an. Sie ist um die Sechzig. Ihr Gesicht war verhältnismäßig faltenlos. ›Ich kenne Sie‹, sagte sie. ›Sie gehen immer sehr schnell.‹ Damit hatte sie recht. Ich gehe gern schnell. Es ist gar nicht so einfach auf den überfüllten Straßen Manhattans schnell zu gehen.«
Ein Jahr lang hat Lily Brett in der Wochenzeitung Die Zeit über ihr Leben in New York berichtet. Die Texte zeichnen ein Bild der Stadt und ihres Lebensgefühls; sie fügen sich aber gleichzeitig auch zu einem Selbstporträt ihrer Autorin, die mit ihrer Offenheit und ihrem Mut die Herzen ihrer Leserinnen und Leser für sich gewonnen hat.
Nach dem überwältigenden Erfolg von Einfach so (st 3033) und Zu sehen (st 3148) ist Lily Brett mit New York ein weiteres zauberhaftes Buch gelungen. Ob Lily Brett einen Schönheitssolon besucht oder mit ihrem Vater telefoniert, ob sie über einen unbeabsichtigten Nebeneffekt von Monica Lewinskys Affäre mit dem Präsidenten oder das Los des »Singles« sinniert: Ein weiteres Mal beweist Lily Brett, wie meisterhaft sie anhand scheinbar alltäglicher Situationen die großen Themen des Lebens erklären kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
»Wenn man zu schnell geht, bekommt man Falten«, sagte eine Nachbarin zu mir. Um mir das mitzuteilen, hatte sie mich auf dem West Broadway angehalten. »Tatsächlich«, sagte ich. »Davon bin ich felsenfest überzeugt«, antwortete sie. Ich sah ihr Gesicht an. Sie ist um die Sechzig. Ihr Gesicht war verhältnismäßig faltenlos. »Ich kenne Sie«, sagte sie. »Sie gehen immer sehr schnell.« Damit hatte sie recht. Ich gehe gern schnell. Es ist gar nicht so einfach, auf den überfüllten Straßen Manhattans schnell zu gehen. Ein Jahr lang hat Lily Brett in der Wochenzeitung Die Zeit über ihr Leben in New York berichtet. Die Texte zeichnen ein Bild der Stadt und ihres Lebensgefühls; sie fügen sich aber gleichzeitig auch zu einem Selbstporträt der Autorin, die mit ihrer Offenheit und ihrem Mut die Herzen ihrer Leserinnen und Leser für sich gewonnen hat. Lily Brett, geboren I.946 in Deutschland, wo ihre Eltern, nachdem sie Auschwitz überlebt hatten, sich in einem Durchgangslager wiedertrafen. I.948 wanderte die Familie nach Australien aus. Mit neunzehn begann Lily Brett als Journalistin für Rockmagazine zu arbeiten. Heute lebt sie in New York. Im Suhrkamp Verlag erschien I.9.9.9 ihr Roman Einfach so (st 3033) und 2.000 Zu sehen (st 3I48). Ihr letzter Roman, Zu viele Männer, erschien 200I im Deuticke Verlag.
Lily Brett
New York
Aus dem Englischen von Melanie Walz
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 6. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 3291.
© Lily Brett 2000
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2008
© der Übersetzung von Melanie Walz Deuticke in der Paul Zsolnay Verlag Ges.m.b.H., Wien 2000
Die deutschsprachige Erstausgabe erschien 2000 in der Franz Deuticke Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien.
Die Erstveröffentlichung im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, erfolgte 2001.
»Toiletten« wurde von Anne Lösch übersetzt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlagfoto: © Die Zeit/Ashkan Sahihi
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-75067-4
www.suhrkamp.de
Inhalt
Auf dem Land
Ausschuß
Das Auto
Bazillen
Botschaften
Chers Mutter
Chinatown
Ehestiften
Erinnerung
Falten
Familie
Fettarm
Frauen
Genossenschaftswohnungen
Gerüche
Geschenke
Großartig
Die Hamptons
Hypochondrie
Instantregeneration
Kinder
Kleidergrößen
Lärm
Lebensmittel
Leopardenhosen
Lügen
Ein Mann
Ein Mobiltelefon
Monica
Muße
New York
Obdachlosenpaar
Orientierungssinn
Probleme
Psychohygiene
Radieschen
Religiosität
Schilder
Sex
Shorts
Silvester
Sport
Streß
Stricken
Tierhaltung
Toiletten
Ungesund
Untersuchungen
Vater
Yankees
Zwischenmahlzeit
Auf dem Land
Ich erwachte mit dem dringenden Wunsch, aus der Stadt herauszukommen. Mehr Himmel zu sehen. Dieser Wunsch war untypisch für mich. Ich bin ein Stadtmensch. Wenn ich nicht in der Stadt bin, fühle ich mich schnell einsam.
Trotzdem war ich unruhig und kam mir eingesperrt vor. »Laß uns übers Wochenende wegfahren«, sagte ich zu meinem Mann. Wir entschieden uns für Bethlehem in Pennsylvanien. Die Vorstellung, nach Bethlehem zu fahren, gefiel mir. Besagtes Bethlehem liegt zwei Fahrstunden von New York entfernt.
Wir mieteten einen Wagen. Einen Ford Explorer. Wie die meisten New Yorker fahren wir selten. Einen Wagen zu mieten hat etwas Aufregendes. Ich steige in den Ford Explorer. Ich empfinde ein Glücksgefühl. Bisher läßt das Wochenende sich gut an.
Zehn Minuten nachdem wir Manhattan verlassen haben, verspüre ich Hunger. Reisen macht mich hungrig. Ich habe etwas zum Essen eingepackt. Ich öffne die Tasche mit dem Essen. Mein Mann sieht herüber und hebt die Augenbrauen. Ich habe Flaschen mit Wasser, Bananen, Karotten, Äpfel, Brot und Käse eingepackt. »Wir fahren nicht bis zum Mars«, sagt er. Er sieht, daß in einer Seitentasche Popcorn steckt. »Warum hast du Popcorn mitgenommen?« fragt er. »Popcorn gibt es überall, wo es irgendwas zu kaufen gibt.«
»Nicht diese Marke«, sage ich.
Wir fahren eine Zeitlang schweigend weiter. Ich esse einen Apfel und ein paar Karotten. Die Gegend sieht bereits ländlich aus. Weniger Häuser, viele Bäume. New York fehlt mir. New York fehlt mir jedesmal, wenn ich wegfahre. Oft fehlt mir New York schon, bevor ich fahre. Bereits beim Packen fehlt mir die Stadt. Ich vergesse den Gestank in manchen Stadtteilen, wenn es warm wird. Ich vergesse das Gedränge und die Angespanntheit.
Wir kommen an noch mehr Bäumen vorbei. »In Pennsylvanien gibt es ziemlich viele Bäume«, sage ich zu meinem Mann.
»Ich habe Birnbäume, Tannenbäume, Magnolienbäume, Fichten und Hartriegel gesehen«, sagt er.
»Sind diese ganzen Bäume notwendig?« sage ich zu ihm.
Wir sind von Grün umzingelt. So viel Grün. Überall Grün. Ich mag Grün nicht. Mir wird vom Fahren übel. Vom Grün. Ich mag Bäume nicht sonderlich. Letztes Jahr haben wir Freunde in San Francisco besucht. Sie haben uns den Redwood Forest gezeigt. Die Bäume waren alt und groß. Sehr groß, und mir war ängstlich und bedrückt zumute. Ich konnte nicht hochsehen, ohne Reizbarkeit zu empfinden. Als wir den Wald verließen und ein Café aufsuchten, kehrten meine Lebensgeister wieder.
Ich fühle mich auf dem Land nicht wohl. Und das Land fühlt sich in meiner Gegenwart nicht wohl. Alles, was Flügel hat, sticht mich. Jede Mücke, jede Wespe, jeder Moskito, jede Fliege und jeder Floh sticht mich. Wenn Schmetterlinge und Motten stechen könnten, würden auch sie mich stechen.
Und ich reagiere auf die Stiche. Ich schwelle zusehends an. Ich entwickle Beulen und Höcker. Sie brennen und jucken tagelang. Ich kann nicht schlafen. Ich liege im Bett, und meine Haut juckt. Ich habe es mit Eispackungen auf den Stichen versucht und dabei Frostbeulen bekommen. Letzten Sommer habe ich auf Shelter Island, einer kleinen Insel zwei Fahrstunden östlich von New York, ein insektenabweisendes Armband getragen. Das Armband sollte für dreißig Stunden alle Insekten der näheren Umgebung fernhalten. Nach zwei Minuten wurde ich gestochen.
Ich legte mehr Armbänder an. Eines um jedes Handgelenk, zwei um jeden Knöchel und eines im Haar. Die Armbänder sahen aus wie Namensschilder im Krankenhaus. Ich sah aus wie einer Irrenanstalt entflohen. Ich trug die Namensschilder den ganzen Sommer lang.
In Bethlehem steigen wir in einem reizenden Gasthaus ab. Wir machen einen Spaziergang. Bethlehem ist sehr hübsch. Es hat einen Fluß und anheimelnde alte Häuser. Ich genieße den Spaziergang. Dennoch ist mir nicht behaglich zumute. Wir gehen früh zu Bett.
Am Morgen fühle ich mich isoliert, entwurzelt. Ich frage den Gastwirt, ob die Rettungswagen in der Gegend mit einem Defibrillator ausgestattet sind.
»Haben Sie ein Herzleiden?« fragt er.
»Nein«, sage ich. »Ich wollte es nur wissen.«
Wir verlassen Bethlehem früher als beabsichtigt. Als wir uns New York nähern, fahren wir an vier Polizeiwagen vorbei, die mit eingeschaltetem Blaulicht im Pulk am Straßenrand stehen. Es geht mir viel besser.
Ausschuß
Manche Leute freuen sich auf neue Dinge. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ganz egal, um was es sich handelt – ein neues Jahr, einen neuen Mantel, ein neues Haus. Es stimmt mich traurig, das Alte aufzugeben. Ich trauere um das alte Jahr, den alten Mantel, das alte Haus.
Dem Neuen mißtraue ich. Veränderungen sagen mir nicht zu. Überraschungen sagen mir nicht zu. Und das Ungewisse sagt mir überhaupt nicht zu. Ich weiß, daß es zur menschlichen Erfahrung gehört. Zur condition humaine. Aber es sagt mir nicht zu. Ich will Gewißheit. Je besser ich meine Freunde kenne, um so wohler fühle ich mich. Manchmal habe ich den Eindruck, daß das Ausmaß meiner Neugier meinen Freunden Unwohlsein bereitet.
In New York ist es nicht schwer, über Leute, die man seit Jahren kennt, so gut wie nichts zu wissen.
Ich weiß gern über die Rituale und Routine anderer Bescheid. Ich weiß gern darüber Bescheid, was sie mittags essen. Ich mag Familiarität. Ich finde sie beruhigend.
Ich mag den Umstand, daß das Käsegeschäft Joe’s Dairy in der Sullivan Street mittags geschlossen ist. Den Laden gibt es seit Jahren in SoHo. Jeden Tag werden dort mehrere hundert Pfund frischer und geräucherter Mozzarella hergestellt. Und jeden Tag ist der Laden zwischen zwölf Uhr und ein Uhr mittags geschlossen.
Joe’s Dairy ist eines der letzten Relikte der ehemaligen Nachbarschaft. Von den einstigen Nachbarn sind auch nicht mehr viele übrig. In SoHo wimmelte es früher von Künstlern und Schriftstellern. Heute scheint es, als wären die einzigen übriggebliebenen Exemplare dieser Spezies mit männlichen und weiblichen Bankern oder Anwälten verheiratet.
Silvester 1999 sah es in SoHo so aus wie immer. Bis auf ein paar Einheimische waren die Straßen so gut wie menschenleer. Es war so ruhig und friedvoll. Ich war glücklich trotz des Umstands, daß das ganze neue Jahr, neue Jahrhundert, neue Millennium ein bißchen zu viel Neues für meinen Geschmack war.
Ich war das alte Millennium, das alte Jahrhundert gewohnt. So viele Neuanfänge schüchterten mich ein. Was galt es zu entrümpeln, um das Neue zu begrüßen? Das Alte? Die Vergangenheit? Die Frage machte mir zu schaffen.
Es fällt mir schwer, Dinge wegzuwerfen. Ich hänge nicht allzusehr an Gegenständen. Ich habe keinen Hamstertrieb. Wenn Gläser oder Teller oder Vasen zerbrochen werden, rege ich mich nicht auf. An diesen Dingen hänge ich nicht.
Meine Eltern wußten um den begrenzten Wert materiellen Besitzes. In Auschwitz war das einzige, was beide besaßen, ihre Seele. Sie war das einzige, was ihnen geblieben war. Und das wichtigste.
Bei uns zu Hause legte niemand großen Wert darauf, Gegenstände anzusammeln. Tische, Stühle oder Spielsachen waren nicht das Wesentliche. Im großen und ganzen habe ich diese Haltung beibehalten. Ich hänge nicht an Gegenständen.
Schwerer fällt es mir, von persönlicheren Besitztümern Abschied zu nehmen. In meinem Kleiderschrank habe ich zwei Paar Schuhe meiner verstorbenen Mutter. Ich bewahre sie auf, als weilten die Füße meiner Mutter noch in ihnen.
Blumen, die mir geschenkt wurden, habe ich aufbewahrt, bis sie nicht nur welk waren, sondern sich zersetzten. Beim Anblick verwelkter Rosensträuße dachte ich an verlassene Ballerinen, an schäbig gewordene Brautjungfern. Ich mußte andere darum bitten, die Blumen wegzuwerfen.
Die Mailbox meines Handys ist fast verstopft, weil ich es nicht über mich bringe, bestimmte Nachrichten zu löschen. Nachrichten von meinem Mann und meinen Kindern. Ich kann es einfach nicht. Ich bewahre sie auf. Es ist ein bißchen lächerlich. Es ist abzusehen, daß man mir bald keine Nachrichten mehr wird hinterlassen können. Ich werde lernen müssen, alle Nachrichten zu löschen.
Manchmal sind wir selbst der Ausschuß, der entsorgt wird. Das kann ich nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen, wenn Leute plötzlich auf die Idee kommen, daß sie mich nicht mögen. Wenn jemand, mit dem ich auf freundschaftlichem Fuß verkehrt habe, plötzlich unfreundlich wird. Ohne Vorwarnung, ohne Erklärung. Das macht mich hilflos.
Ich glaube, Eltern kommen sich oft hilflos und ausgesondert vor. Bis zu einem bestimmten Alter brauchen die Kinder einen, und danach beginnen sie einen zu entsorgen. Sich damit abzufinden ist nicht leicht.
Ich weinte, als meine jüngste Tochter nach Philadelphia zog, wo sie das College besuchte. Ich konnte nicht wissen, daß ich überglücklich sein würde, keine Kinder mehr zu haben. Es gibt neue Erfahrungen, die rundum erfreulich sind.
Das Auto
Im Sommer, als ich nach Monaten zum erstenmal wieder in Shelter Island war, gab mein Auto auf dem Supermarkt-Parkplatz den Geist auf.
Shelter Island ist ein ruhiger Flecken, zwei Stunden Fahrzeit von Manhattan entfernt. Jedes Jahr verbringe ich einen Teil des Sommers dort. Der Puls der Insel spiegelt sich im Polizeibericht, der einmal wöchentlich im Shelter Island Reporter veröffentlicht wird.
Letzte Woche meldete der Polizeibericht drei verschiedene Unfälle, bei denen ein Wildtier von einem Automobil angefahren worden war. Und es wurde berichtet, daß jemand sich über Hundegebell beschwert hatte und daß ein Arbeiter der Telefongesellschaft von einem Truthahn angefallen worden war. »Der Besitzer des Aggressors konnte den Vogel einfangen. Schadenersatz wurde nicht geltend gemacht«, schloß der Bericht.
Daß mein Auto den Geist aufgab, ärgerte mich maßlos. Ich hatte mich auf Ruhe und Einsamkeit gefreut. Immer wieder drehte ich den Zündschlüssel in der Hoffnung, den Wagen doch noch zu starten. Der Motor gab keinen Mucks von sich. Meine Bemühungen waren aussichtslos.
Ich mag mein Auto nur, wenn es funktioniert. Jedes wärmere Gefühl, das ich einmal für diesen Wagen empfunden haben mag, hat sich rapide abgekühlt, seit er begonnen hat auseinanderzufallen.
Es ist ein Lincoln Continental, Baujahr 1986. Er soll viele Dinge können. Er soll einem die Außentemperatur und die Fahrtrichtung mitteilen können.
Aber die Temperatur, die die Elektronik des Wagens meldet, paßt nie zum Wetter. Und der Orientierungssinn dieses Autos ist mehr als fragwürdig.
Ich bin schon im Kreis gefahren, bis mir schwindlig wurde, um zu sehen, ob der Wagen angeben konnte, daß wir nach Süden oder Südwesten fuhren. Er konnte es nicht.
Als er auf dem Supermarkt-Parkplatz den Geist aufgab, war ich erbost. Das war der letzte Tropfen.
Ich starrte das Auto zornig an. Nichts geschah. Ein Auto einzuschüchtern ist ähnlich schwer, wie die eigenen erwachsenen Kinder einzuschüchtern. Ich stieg aus und trat gegen einen der Reifen. Es brachte mir keine Erleichterung.
Ich versuchte mich zu beruhigen. Mich daran zu erinnern, daß ich hergekommen war, um Ruhe zu finden. Um gewöhnliche Dinge zu tun. Zum Beispiel einen Automechaniker anzurufen und auf ihn zu warten.
»Wagen defekt?« fragte ein Mann, der an mir vorbeikam. Ich nickte finster. »Ich glaube, die Batterie ist leer«, sagte ich. Er ging zu seinem Wagen, um ein Starthilfekabel zu holen.
Als er fünf Minuten später wiederkam, hatten mittlerweile drei Leute angeboten, einen Automechaniker für mich zu holen. Aber das Starthilfekabel genügte. Der Wagen sprang an.
Ich fuhr rückwärts aus meiner Parklücke. Ich hatte gerade genug Zeit, ein Gefühl des Triumphs zu empfinden, bevor der Wagen stehenblieb. Ich befand mich noch immer auf dem Parkplatz. Ich stieg aus.
Die allgemeine Meinung auf dem Parkplatz war die, daß ich eine neue Batterie benötigte. Die Stimmung rings um mein streikendes Auto war munter und ausgelassen.
Ich merkte, daß es mir Spaß machte. Alle waren so fröhlich und so hilfsbereit. Auf diesem Supermarkt-Parkplatz herrschte eine bessere Stimmung als bei den meisten Essenseinladungen.
Eine Stunde nachdem mein Auto zum erstenmal den Geist aufgegeben hatte, besaß ich einige neue Freunde.
Schließlich bekamen wir den Wagen wieder in Gang. Ich fuhr in die Werkstatt. Unterwegs blieb er drei weitere Male stehen.
Jedesmal hielten Leute neben mir an und boten ihre Hilfe an. Alle waren hilfsbereit. Männer und Frauen beugten sich über den Motor.
Als die neue Batterie eingebaut war, war es später Nachmittag. Ich war nicht am Strand gewesen, wo ich zu sitzen pflege und wachsamen Auges nach Kriebelmücken und Stechmücken Ausschau halte, weil ich Insektenstiche nicht vertrage.
Ich hatte nicht im Teich geschwommen und dabei versucht, nicht an die bissige Schildkröte zu denken, die dort lebt. Ich hatte den schönsten Tag seit Jahren auf dem Land verbracht.
Bazillen
Statt Geld abzuheben, war der Mann vor mir am Geldautomaten damit beschäftigt, die Maschine zu reinigen. Er rieb den Bildschirm mit mehreren feuchten Hygienetüchern ab.
Er war keine Reinigungskraft. Er sah eher wie ein Anwalt oder ein Buchhalter aus. Ich hatte es eilig. Ich räusperte mich mehrmals ungeduldig. Er ließ sich nicht stören.
Als er mit dem Bildschirm fertig war, begann er die Tastatur abzuwischen. Er packte noch mehr feuchte Tücher aus. Ich sah auf die Packung. Es waren antibakterielle Einwegtücher.
Die Bedürfnisse des Mannes waren mir nicht gänzlich fremd. Ich habe oft genug Knöpfe im Aufzug mit dem Ellbogen betätigt, wenn eine besonders ungepflegte Erscheinung sie vor mir gedrückt hat. Ich habe ungewöhnlich gelenkige Ellbogen entwickelt.
Ich bin kein Zwangsneurotiker, was meine Ellbogen betrifft. Wenn andere dabei sind, benutze ich sie meistens nicht. Ich lege Wert darauf, in Gegenwart anderer entspannt und lässig aufzutreten.
Eine Freundin von mir ist alles andere als lässig, was die möglichen Folgen betrifft, wenn man den falschen Knopf berührt. Im vergangenen Winter erschien sie auf dem Höhepunkt der Grippewelle mit einem Geschenk an meiner Wohnungstür. Es war ein Fläschchen Instantdesinfektionsspray.
Ich versuchte, erfreut auszusehen. »Alles, was du außerhalb deiner Wohnung anfaßt«, sagte sie, »haben Hunderte vor dir angefaßt. Jedes Rolltreppengeländer, jeder Einkaufswagen im Supermarkt, jede Türklinke ist von jemand anderem angefaßt worden. Überall kleben Krankheitskeime.«
Der Instantdesinfektionsspray garantierte, daß er in weniger als fünfzehn Sekunden 99,99 % der verbreitetsten krankheitsverursachenden Keime vernichtete. »Vielleicht sollten wir ein bißchen davon trinken«, sagte ich. »Dann werden wir nie mehr krank.« Sie wirkte etwas verstimmt. Um sie zu besänftigen, steckte ich den Desinfektionsspray sofort in meine Handtasche.
Ein paar Wochen darauf war ich im Cort Theatre. Ich wollte David Hares Stück »The Blue Room« mit Nicole Kidman sehen. Karten waren fast nicht zu bekommen. Die Aufführungen waren schon vor der Premiere so gut wie ausverkauft.
Diese Situation gründete weitgehend in dem Umstand, daß Miß Kidman während der meisten Zeit auf der Bühne spärlich bekleidet und für einen kurzen Augenblick völlig nackt war.
Im Theater fiel mir auf, daß viele Besucher Ferngläser und Operngläser mitgebracht hatten.
Miß Kidman auf der Bühne war ein atemberaubender Anblick. Mit und ohne Kleider. Sie war groß, schlank, blond und makellos. Wie konnte ein Körper so frei von Malen und Unebenheiten sein? Ihre Haut war straff und glatt. Nicht die kleinste Spur von Zellulitis ließ sich ausmachen.
Ich beugte mich vor und fragte die Frau, die vor mir saß, ob ich mir kurz ihr Fernglas ausleihen könne. Sie sah verärgert aus, als hätte ich sie um ihre Unterhosen oder ihren Lippenstift gebeten. »Ich nehm’ es nicht in den Mund«, sagte ich im Versuch, einen humoristischen Ton anzuschlagen. Widerstrebend händigte sie mir das Fernglas aus.
In Nahaufnahme sah Nicole Kidman noch besser aus. Es war fast ein wenig deprimierend. Ich gab das Fernglas umgehend zurück. Die Frau nahm es entgegen und begann es zu putzen. Sie benutzte feuchte Hygienetücher, die sie einem silbernen Täschchen entnahm. Genau wie der Mann am Geldautomaten.
Ich sah ihr im Dunkeln zu, wie sie jeden Quadratmillimeter Fernglas putzte und sich danach die Hände reinigte. Ich verpaßte zehn Minuten der Aufführung, weil ich ihr zusah.
Als Ian Glen, der zweite Star neben Miß Kidman, plötzlich ein Rad schlug, holte das meine Aufmerksamkeit zum Bühnengeschehen zurück. Er war ebenfalls nackt. Ein nackter Mann, der ein Rad schlägt, ist kein uninteressanter Anblick.
Das Rad und Miß Kidmans Körper waren das Beste am Stück. Es war ein liebloses, gleichgültiges, misogynes Bühnenmachwerk. Und ich bin es leid, mir Männerphantasien darüber anzusehen, was Frauen wollen und was Männer mit Frauen anstellen wollen.
»Vielen Dank für Ihr Fernglas«, sagte ich nach Vorstellungsende zu der Frau in der Reihe vor mir.
»Wenn man die Sachen anderer Leute anfaßt, kann man sich Erkältungen, Grippe, Hepatitis und Tuberkulose holen« sagte sie zu mir; ihr Ton klang ziemlich streng.
»Wirklich?« sagte ich.
Plötzlich war mir ängstlich zumute. Und angespannt. Ich langte in meine Handtasche. Der Instantdesinfektionsspray war noch da. Vielleicht sollte ich ihn hin und wieder verwenden, dachte ich mir. Der Gedanke löste meine Spannung.
Botschaften
Was mein Wohlbefinden verstört, sind nicht Cyberspace, das Internet oder irgendwelche intergalaktischen oder interplanetarischen Kommunikationsmethoden.
Die Implikationen moderner Kommunikationssysteme, ihre Auswirkungen auf uns beschäftigen mich nicht im geringsten.
Ich kann mich nicht über Raumstationen und Satelliten ereifern. Mit diesen Kommunikationsformen bin ich nicht vertraut. Aber ihre fernen und weitreichenden Mitteilungen und Sendungen beunruhigen mich nicht.
Weit beunruhigender finde ich die gewohnteren Wege, auf denen wir uns Dinge sagen. Weit verstörter bin ich durch die unauffälligeren Formen der Interaktion, deren wir uns bedienen.
New York ist das Epizentrum codierter Begriffe, mehrdeutiger Mitteilungen und hochkomplizierter und raffinierter Kommunikationsmethoden. Alles hängt von Status und Bedeutung des einzelnen ab.
Jeder New Yorker ist bedeutender als derjenige, mit dem er zu tun hat, und jeder New Yorker kann sekundenschnell die Bedeutung des anderen einschätzen.
Bei einem Anruf kann man in der Warteschleife abgestellt werden oder mit der Mailbox des Angerufenen verbunden werden oder mit der Auskunft abgespeist werden, er werde zurückrufen, oder man wird durchgestellt.
Wenn man keine Antwort auf seinen Anruf erhält, weiß man, wie man eingestuft wird. Und so ist es auch gemeint. Es ist ein lauter und deutlicher Hinweis auf die eigene Bedeutungslosigkeit.
Man muß diese Demütigung ertragen lernen. Zumindest bis das eigene Ansehen steigt.
Neulich rief ich jemanden an, der versprochen hatte, mir einen Gefallen zu tun. Er ist ein Public-Relations-Mann mit guten Beziehungen. Ich rief fünf- oder sechsmal an. Jedesmal sagte seine Sekretärin, er werde zurückrufen. Er tat es nicht. Am Ende haßte ich ihn aus ganzem Herzen. Und wußte, wie unbedeutend ich war.
Zwei Tage verbrachte ich damit, mir auszumalen, wie ich ihm das heimzahlen konnte, bevor ich es bleibenließ und einsah, daß es ein sinnloses Unterfangen war.
Die wirksamste Art, andere zu treffen, ergibt sich aus Aspekten unserer Persönlichkeit, die weit einflußreicher sind als irgendwelche High-Tech-Spielereien.