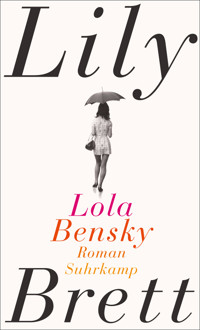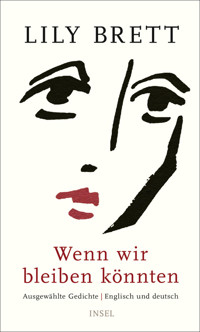9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lily Brett, die australische New Yorkerin mit europäischen Wurzeln, steckt mittendrin, und um die Stadt einzufangen, hält sie sich selbst den Spiegel vor. Hinreißend erzählt sie von ihren Nöten, einen halbwegs anständigen Büstenhalter im Greenwich Village zu erstehen, vom befremdlichen Anblick der Schoßhündchen in Regenmänteln und Sonnenbrillen, vom überbordenden Großstadtverkehr. Und zum Glück gibt es in dieser ziemlich hektischen Stadt auch Winkel der Ruhe und des Friedens, den Geruch von frisch gebackenem Brot und die entwaffnend ehrlichen Gespräche mit ihrer Kosmetikerin. Denn in Manhattan ist nichts unbedeutend und nichts selbstverständlich. Lily Bretts New-York-Erzählungen sind ein großes Lesevergnügen. In der tragikomischen Mischung aus Autobiographie und kleinen Alltagsvignetten schimmern die großen Themen des Lebens durch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Neues aus Lily Bretts New York!
Lily Brett, die australische New Yorkerin mit europäischen Wurzeln, steckt mittendrin, und um die Stadt einzufangen, hält sie sich selbst den Spiegel vor. Hinreißend erzählt sie von ihren Nöten, einen halbwegs anständigen Büstenhalter im Greenwich Village zu erstehen, vom befremdlichen Anblick der Schoßhündchen in Regenmänteln und Sonnenbrillen, vom überbordenden Großstadtverkehr. Und zum Glück gibt es in dieser ziemlich hektischen Stadt auch Winkel der Ruhe und des Friedens, den Geruch von frisch gebackenem Brot und die entwaffnend ehrlichen Gespräche mit ihrer Kosmetikerin. Denn in Manhattan ist nichts unbedeutend und nichts selbstverständlich.
Lily Bretts New York-Texte sind seit ihrem ersten Kolumnenband »New York« (2000) Klassiker. Denn in der tragikomischen Mischung aus Autobiografie und kleinen Alltagsvignetten schimmern die großen Themen des Lebens durch.
Lily Brett, geboren 1946 in Deutschland, wuchs in Australien auf und lebt seit einem Vierteljahrhundert in New York. Die Journalistin und Autorin zahlreicher Romane, u. a. »Chuzpe« und »Lola Bensky« ist mit dem Maler David Rankin verheiratet und hat drei Kinder. Ihr erster Kolumnenband »New York« erschien 2000 (st 3291). www.lilybrett.com
Lily Brett
Immer noch
New York
Aus dem amerikanischen Englisch von Melanie Walz
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Only in New York bei Penguin Books Australia.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2014.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Copyright © 2014 by Lily Brett
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlagfoto: Wayne Fogden/Getty Images
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
eISBN 978-3-518-73944-0
www.suhrkamp.de
Für David, der mich, Bob Dylan und New York liebt.
Inhalt
Ein Ziel
Eine Entdeckung
Ruhe
Caffe Dante
Zu Fuß unterwegs
Ein Fahrrad in der Stadt
Lilitschka
Kichererbsencurry
Yakub
Hellseher
Hunde
Flat White
Gastfreundlichkeit
Krokodilbeine
So jüdisch
Bäume
Wörterbücher
Schultern
Jüdisches Feng Shui
Mein Vater
Schreibwerkzeug
Spandex House
Einsamkeit
Weich
Pferde
Die Brillen meiner Mutter
Wie man sich bettet
Wetter
Anwaltstätigkeit
Psycho-Putz
Sprechen
Suchen
Papiere
Hiroko's Place
Lotterie
Groll und Ressentiments
Orientierungsschwäche
Sunnyside
Schwangerschaft
Tiere
Der Strand
Immer noch New York
Ein Ziel
Wenn ich in New York spazieren gehe, habe ich dabei gern ein Ziel. Egal, wo ich spazieren gehe, ich habe immer gern ein Ziel. Ich bin keine ziellose Spaziergängerin. Keine von denen, die planlos von hier nach da schlendern können.
Ich brauche immer einen Plan. Ohne Plan bin ich hilflos. Ich plane alles. Ich plane meinen Tagesablauf. Ich plane Diäten. Ich mache Pläne für meine Anrufe. Ich mache mir Notizen zu den Dingen, die ich mit verschiedenen Freundinnen besprechen will. Ich mache mir Notizen zu den Dingen, die ich meinen Arzt, meinen Zahnarzt, meine Fußpflegerin fragen oder die ich mit ihnen besprechen will. Und zu den Dingen, die ich mit meinem Mann, meinen Kindern und meinem Vater besprechen will.
Dad fragen, ob er noch mehr Wedel-Schokolade braucht, wäre beispielsweise eine typische Notiz. Wedel ist die polnische Schokolade, die mein Vater schon als Kind aß. Letzte Woche hatte ich mir eine Notiz gemacht, dass ich ihn fragen wollte, ob er außer der Schokolade Lust auf frisches Pastrami von Katz's Deli habe. Er wollte beides, und deshalb musste ich erst zu dem polnischen Feinkostgeschäft an der First Avenue und danach zu Katz's an der East Houston gehen. Das ist ein Spaziergang von mehr oder weniger fünfzig Minuten, der mich durch das East Village und ans Ende der Lower East Side führt.
Ich weiß, dass es viele Dinge gibt, die selbst den besten Plan durchkreuzen können. Aber ich plane mit Umsicht. Vor allem meine Spaziergänge. Ich gehe nicht gern auf Entdeckungsreisen. Es gefällt mir, auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel Entdeckungen zu machen.
Mein neuestes Lieblingsziel ist Grand Central Station. Oder, wie der Bahnhof offiziell heißt, Grand Central Terminal. Der Spaziergang von meinem Zuhause in SoHo dorthin dauert etwa fünfzig Minuten.
Bei schlechtem Wetter kürze ich den Spaziergang manchmal ab und fahre den Rest der Strecke mit der Subway. Ich fahre gern mit der Subway. In der Subway ist man unzweifelhaft in New York. Die New Yorker Subway ist so typisch für New York. Sie ist zuverlässig, schnell und von Menschen aus aller Herren Länder bevölkert.
Fast vierzig Prozent aller New Yorker stammen nicht aus New York. Von den Einwanderern wiederum kommen um die zweiunddreißig Prozent aus Lateinamerika, sechsundzwanzig Prozent aus Asien, zwanzig Prozent aus nichtspanischen karibischen Nationen, siebzehn Prozent aus Europa und vier Prozent aus Afrika. Diese enorme Vielfalt macht New York City zu einer der großartigsten Städte unseres Planeten.
Einer meiner verwegensten Pläne ist es, eines Tages mit jeder Subway-Linie New Yorks von einer Endhaltestelle zur anderen zu fahren.
Es erdet mich, in der Subway zu sein. Ich fühle mich eins mit allen anderen. Eins mit einer großen Menschheit. In der Subway trennen uns keine Alters-, Herkunfts-, Geschlechts- oder Religionsschranken. Wir sind zusammen. Oft genug eng aneinandergequetscht.
Ich habe mich schon auf Sitze zwischen Fremden gequetscht, deren Leben sich ansonsten niemals mit meinem berührt hätten. Und das ist ein wunderbares Gefühl. In der Subway fühle ich mich nie allein. Oder gar einsam. Ich verspüre ein Gefühl der Zugehörigkeit, was für mich ein sehr seltenes Gefühl ist.
Mehrere Jahre lang war ich nicht imstande, die Subway zu nehmen. An der Subway lag es nicht. Vielleicht ging es dort etwas ruppiger zu als heute, aber Millionen Menschen nehmen sie jeden Tag. Nein, es lag an mir.
Ich konnte mich nicht von dem Gefühl befreien, dass ich mich im Untergrund befand, unter dem Erdboden, unterhalb all dessen, was lebendig war. Jedes Mal wenn ich versuchte, die Treppe zur Subway hinunterzugehen, war mir zumute, als würde ich begraben. Außer jeder Reichweite. Ich war so froh, als dieses Gefühl sich irgendwann legte.
Ich bin stolz darauf, dass ich meinen Weg vom Ausgang der Subway an Grand Central bis zur Bahnhofshalle im Griff habe. Es ist nicht besonders schwierig, sich bis zur Halle hindurchzulavieren, aber außer bei Auseinandersetzungen bin ich sehr schlecht darin, mich durch irgendetwas hindurchzulavieren. Ich liebe die Atmosphäre von Bahnhöfen. Ich liebe die Geschäftigkeit und das Gedränge von Abfahrt und Ankunft. Besonders an Grand Central. Es ist ein höfliches Geschiebe und Gedränge. Es gibt keinen Stress, keine Hysterie und meistens keinen Ärger.
Es ist so anders als die angespannte und nervöse Atmosphäre an fast jedem größeren Flughafen der Welt. Niemand schubst, niemand drängelt. Niemand wirft einem sein Gepäck auf die Füße. Vor zwei Jahren hat ein Mann, der in der Warteschlange am Check-in für einen Flug von New York nach Seattle vor mir stand, seinen Koffer auf mein Bein fallen lassen und mir dann beteuert, dass es sicher nicht wehgetan habe. Heute habe ich noch immer einen blauen Fleck am Bein.
Grand Central Station gilt manchen als der größte Bahnhof der Welt, als der schönste Bahnhof der Welt und als der geschäftigste Bahnhof der Welt. Geschäftig mag es dort zugehen, aber man spürt es nicht. Dieser sehr geschäftige Bahnhof wirkt ziemlich friedlich und zivilisiert.
Jeden Tag verkehren mehr als siebenhundertfünfzigtausend Leute an diesem Bahnhof und mehr als siebenhundertfünfzig Züge kommen an und fahren ab. Grand Central hat vierundvierzig Bahnsteige und siebenundsechzig Gleise. Ich liebe es, solche Dinge zu wissen. In nicht allzu ferner Zeit wird die Long Island Rail Road eine neue Station unterhalb der Gleise von Grand Central eröffnen. Dann wird Grand Central fünfundsiebzig Gleise und achtundvierzig Bahnsteige haben.
Der Bahnhof ist sehr groß. Größer als achtundvierzig Morgen Land. Mit den hohen Deckengewölben und seinen gigantischen Ausmaßen ist er auch sehr schön. Er ist elegant und nimmt sich anmutig und zugleich solide aus. Alles an Grand Central ist robust. Nichts macht den Eindruck, provisorisch oder nicht für die Dauer gebaut zu sein. Der Bahnhof wurde 1913 errichtet, und er wirkt, als hätte es ihn schon immer gegeben. Und als würde es ihn immer geben.
Grand Central ist mehr als ein Bahnhof. Es ist eine kleine Stadt in einer größeren Stadt. Es gibt einen Ableger des Verkehrsmuseums, es gibt Bäckereien, Cafés, Zeitungskioske, einen Gemüsemarkt und fast genauso viele Läden wie in SoHo.
Man kann Fastfood oder gesundes Essen in dem Dining Concourse kaufen, der sich in dem Geschoss unterhalb des Erdgeschosses befindet, oder man kann die Oyster Bar besuchen. Die Oyster Bar ist berühmt. Sie ist ein großes Restaurant für Meeresfrüchte und eine New Yorker Institution. Wie den ganzen Bahnhof gibt es sie seit 1913. Das Restaurant ist groß, aber es ist weder unpersönlich noch chaotisch. Man kommt sich dort vor, als speiste man in einer anderen Zeit. Alle sind zu allen höflich. Die Kellner tragen Uniform. Niemand wird laut.
Die Speisekarte ist endlos lang. Als ich zuletzt nachzählte, gab es allein zweiunddreißig verschiedene Sorten Austern. Ich liebe Meeresfrüchte. Ich esse kein rotes Fleisch und nur selten Geflügel. Nicht weil ich ein Tierfreund wäre. Das bin ich nicht. Mir gefällt nur die Vorstellung nicht, etwas zu töten, um es zu essen. Unlogischerweise kommen Fische in meinem Denken nicht vor. Und obwohl ich kein Fleisch esse, koche ich welches.
Ich hätte fast aufgehört, Fisch zu essen, als ich einen Fisch sah, den mein Mann am Strand von Long Island gefangen hatte. Der arme Fisch zappelte mindestens eine Minute lang mit dem Kopf nach unten, bevor er einen kleineren Fisch erbrach und ohnmächtig wurde. Ich hatte nicht gewusst, dass Fische sich übergeben können. Wahrscheinlich hat er sich unter Schock übergeben. Es dauerte einige Monate, bis ich wieder Fisch essen konnte.
Der Ort in Grand Central, den ich unbedingt aufsuchen muss, ist der Markt. Dort gibt es eine Auswahl der Dinge, die ich am liebsten mag. Brot, Käse, Fisch, Nüsse, Schokolade und Kuchen. Mein Vater liebt Kuchen. Ganz besonders liebt er Biskuit. Er spricht das amerikanische Wort für Biskuit, »sponge«, so aus, dass es sich auf »lunch« reimt. Der Biskuitkuchen aus Moishe's Bake Shop an der Second Avenue war sein größter Favorit. Aber letztes Jahr wechselte er plötzlich zu einem chinesischen Biskuitkuchen mit Zitronenaroma aus einer Bäckerei namens Lucky King and Dragon Land über.
Dann kaufte ich ihm eine Schnitte von Eli Zabars Napfkuchen in dem Markt in Grand Central. Er war begeistert und nannte diesen Kuchen den »schweren Biskuitkuchen« im Unterschied zu dem chinesischen Kuchen, den er fortan den »nicht so schweren Biskuitkuchen« nannte.
Zu häufige Besuche bei Eli Zabars Brot- und Gebäckstand stellen eine Gefahr für mich dar. Die Brötchen mit Rosinen und Pekannüssen sind eine schwere Versuchung. Ich versuche, mich auf ein Brötchen zu beschränken. Und das Brot mit Rosinen und Pekannüssen kaufe ich nie, weil ich fürchte, ich könnte es auf dem Nachhauseweg zur Hälfte aufessen.
Man könnte all seine Einkäufe in Grand Central erledigen. Es gibt dort alles. Es gibt einen Apple Store und eine Bank. Man kann seine Sehkraft testen und seine Schuhe reparieren lassen. Und fast alles kaufen, was man braucht. Und es gibt Frankies Dogs on the Go. Als ich die Anzeige zum ersten Mal sah, dachte ich, es handele sich um einen Hundesitter, wo man seinen Hund auf dem Weg zur Arbeit abgeben und abends wieder abholen könnte. Aber Frankies Dogs on the Go ist ein Hot-Dog-Laden.
Man kann in Grand Central seinen Tennis- oder Squashschläger auf dem Weg zur Arbeit abgeben und abends neu bespannt abholen. Grand Central Racquets gibt es seit 1933. Grand Central Racquets ist offenbar für alle Arten von Sport, für die man Schläger benötigt, zuständig, ob Tennis, Squash, Racket, Badminton oder Hallentennis. Was Hallentennis ist, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass es nichts mit der Markthalle von Grand Central zu tun hat.
Trotz des Vorhandenseins und offenbaren Erfolgs von Grand Central Racquets fällt es mir schwer, mir New Yorker Arbeiter vorzustellen, die auf dem Weg zur Arbeit an Tennis oder Squash oder Badminton denken. Die meisten New Yorker sind auf dem Weg zur Arbeit nicht besonders entspannt.
Die Stadt ist offenbar sportlicher, als es den Anschein hat. In Grand Central Station habe ich einen Tennisclub entdeckt. Den Vanderbilt Tennis Club. Das ist kein gewöhnlicher Tennisclub. Die Räume haben eine Deckenhöhe von fast zehn Metern und einen Tennisplatz, der für die US Open qualifiziert wäre. Für zweihundertfünfundzwanzig Dollar kann man ein Feld für drei Stunden mieten. Für dreihundert Dollar kann man drei Stunden Einzelunterricht nehmen.
Als Mitglied des Vanderbilt Tennis Club kann man nicht nur die Spielfelder nutzen, sondern auch Fitnessräume sowie New Yorks einzige Anlage, mit der man seine Schlagtechnik per Video in Zeitlupe analysieren kann.
Ich glaube, ich werde trotzdem widerstehen. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen, selbst wenn mehr New Yorker, als ich für möglich gehalten hätte, ihre Tennisschläger neu bespannen lassen und sich ihre Schlagtechnik auf einem Video in Zeitlupe ansehen.
Eine Entdeckung
Nach meinem Kenntnisstand sind alle Männer verblüffend sachkundig, wenn es darum geht, einer Frau den Büstenhalter auszuziehen. Eine Handbewegung, und die Frau ist von ihrem Büstenhalter befreit. Einer Frau einen Büstenhalter anzuziehen, ist eine andere Sache. Männer können es nicht. Die meisten haben es noch nie versucht.
Zu Beginn des Jahres 2013 musste ich mich an der Schulter operieren lassen. Ich hatte eine Rotatorenmanschettenruptur und Risse im Bizeps und in zwei Sehnen. Das ist sehr schmerzhaft. Ich kann es niemandem empfehlen. Und man kann keinen Büstenhalter anziehen. Monatelang. Mein Mann mochte sich noch so bemühen – und mein Mann ist wirklich geschickt –, dem Büstenhalter war er nicht gewachsen. Ich will damit sagen, dass er ihn mir nicht so anziehen konnte, dass ich mich halbwegs würdevoll in die Öffentlichkeit hätte wagen können.
Da ich mich gezwungen sah, so viel über Büstenhalter nachzudenken, fiel mir auf, dass ich ein paar neue Büstenhalter brauchen könnte. Ich kaufe nicht gern Dinge, die erfordern, dass man sich in einem engen Verschlag mit greller Beleuchtung vor einem hohen Spiegel auszieht. Und es gab ein zweites Problem: Auch nach fünf Monaten konnte ich nur mühsam einen Büstenhalter anziehen. Ich beschloss, La Petite Coquette auszuprobieren, ein Wäschegeschäft am University Place in Greenwich Village, das es seit Jahren gibt. Ich nahm meinen Mann mit. Nicht, weil ich seine Hilfe beim Aussuchen gebraucht hätte. Nur beim Anziehen.
Mein Mann betrat La Petite Coquette, warf einen Blick auf die dünne, spitzenbesetzte Unterwäsche, die von Kleiderbügeln baumelte, in Körben aufgehäuft war, auf Tischen ausgebreitet lag und die Wände bedeckte, und verspürte das dringende Bedürfnis, sich draußen vor dem Laden mit einer Obdachlosen zu unterhalten. Ich konnte ihn verstehen. Ich würde unter Eid versichern, dass ein Quadratmeter Stoff für den gesamten Warenbestand des Ladens an Slips mehr als ausreichend gewesen sein dürfte.
Es roch gut in dem Laden. Die Ausstattung war im Stil der 1920er in Paris gehalten. Erotische Gemälde an den Wänden, handbemalte Lampenschirme auf den Tischen. Ich beglückwünschte mich, dass ich diesen Laden entdeckt hatte. An der Wand neben mir sah ich ein gerahmtes und signiertes Foto von Woody Allen. »Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich sehe immer noch fabelhaft aus«, hatte Woody Allen für Rebecca, die Inhaberin des Geschäfts, geschrieben. An den Wänden hingen unter anderem gerahmte Fotos von Uma Thurman, Julianne Moore, Liza Minnelli, Britney Spears, Anjelica Huston und Sarah Jessica Parker. Ich weiß nicht, wieso ich geglaubt hatte, ich hätte diesen Laden entdeckt.
Ich ging in die Umkleidekabine und probierte sieben oder acht Büstenhalter an. Tania, die Verkäuferin, half mir dabei. Ich gab mir große Mühe, mich nicht im Spiegel anzusehen. Vielleicht sieht sich nicht einmal Scarlett Johansson gerne nackt in einem hohen Spiegel. Und ich fragte mich für einen Augenblick, ob Männer auch das Gesicht verziehen, wenn sie sich nackt im Spiegel sehen.
Als ich mich endlich für zwei Büstenhalter entschieden hatte, war ich zerzaust und verschwitzt. Ich verließ die Umkleidekabine mit meinen zwei Büstenhaltern – und stieß fast mit meiner Literaturagentin zusammen. Das Büro meiner Literaturagentin liegt in der Upper West Side. Die meisten geschäftlichen Dinge wickeln wir telefonisch ab. Ich habe sie mir nie in einem Wäschegeschäft in Downtown vorgestellt.
Im Allgemeinen lege ich Wert darauf, wie eine sensible, nachdenkliche Schriftstellerin auszusehen und nicht wie eine schwitzende, aufgeregte Frau mit rotem Kopf, die vom Shoppen kommt und gerade sieben oder acht Büstenhalter anprobiert hat. Wir plauderten ein wenig. Es stellte sich heraus, dass sie genau wie Uma und Liza und Britney seit Jahren bei La Petite Coquette einkauft.
Ich verließ das Geschäft, die Tüte mit meinen neuen Büstenhaltern fest im Griff. Draußen unterhielt mein Mann sich immer noch mit der Obdachlosen. Offenbar hatte sie ein geradezu enzyklopädisches Wissen über amerikanische Filme. »Das Filmemachen ist ein ganz besonderes Geschäft«, sagte sie gerade. »Da sind so viele Leute beteiligt, aber wenn nur ein Einziger Mist baut, Regisseur, Produzent, Cutter oder Kameramann, ist der ganze Film im Eimer. Jeder gute Film ist entgegen allen Erwartungen gut.«
Sie nickte mir zu. »In interessanten Filmen geht es nicht darum, dass die Bösen interessant sind«, fuhr sie fort, »sondern darum, dass auch die Guten komplex und interessant sind.« Daraus kann ich was lernen, dachte ich.
Ruhe
In dieser ziemlich hektischen Stadt suche ich immer wieder nach Winkeln des Friedens und der Ruhe. Einer meiner Lieblingsorte war die Bank vor der Bäckerei an der Sullivan Street. Dort konnte man sitzen, so lange man wollte, und den Duft frischgebackenen Brotes genießen. Das Paar, das die Bäckerei führte, hat sich getrennt, und die Filiale wurde geschlossen.
Aber Galina, die russische Pediküre auf der Seventh Avenue, die ich alle sechs Wochen aufsuche, gibt es noch. Ich bin eine treue Kundin Galinas und habe in ihrem Gefolge mehrmals den Kosmetiksalon gewechselt. Das liegt nicht nur daran, dass Galina sich mit der rohen Kraft und der Präzision eines orthopädischen Chirurgen über meine Zehennägel hermacht, sondern auch daran, dass Galina nichts unwichtig findet. Sie ist sehr russisch. Nichts ist unbedeutend. Und es gibt nichts, worüber man nicht in Panik geraten könnte. Ich für meinen Teil kann ziemlich angespannt wirken und, um ehrlich zu sein, schnell in Panik geraten. Neben Galina komme ich mir vor wie eine enge Verwandte des Dalai Lama.
»Vera mag Sex wirklich«, sagte Galina bei meinem letzten Besuch zu mir. Vera ist ihre Kollegin und die Inhaberin des Pediküresalons. Beide sind Russinnen und um die sechzig.
»Tatsächlich?«, sagte ich. »Woher wissen Sie das?«
»Sie redet über nichts anderes«, sagte Galina.
»Sie redet über Sex?«, fragte ich in einem Ton, der wesentlich schriller klang, als ich beabsichtigt hatte.
»Selbstverständlich«, sagte Galina. »Sie redet über Sex und darüber, wie sehr sie Sex mag.«
Ich war schrecklich, ja entsetzlich neugierig darauf, was Vera genau sagte. Nur wenige Frauen aus meiner Bekanntschaft sprechen über Sex oder, besser gesagt, darüber, was sie davon halten. Ich holte tief Luft und öffnete den Mund, um Galina zu fragen, was genau Vera gesagt hatte, als sie über Sex redete, als Galina ziemlich laut sagte: »Ich mag keinen Sex.«
Das brachte mich einigermaßen aus dem Konzept. »Oh«, sagte ich. Schweigen trat ein, und ich hoffte, Galina wollte nicht hören, was ich von Sex hielt. Gerade in diesem Moment war ich mir nicht sicher, ob ich meine Gedanken zum Thema Sex erforschen wollte. Außerdem dachte ich, dass dieses Thema mehr Zeit erforderte als meine Zehennägel.
»Ich mag keinen Sex«, sagte Galina noch einmal. Sie sagte es in dem Ton, in dem man sich über eine Spülmittel- oder Möbelpolitur- oder Bohnerwachsmarke äußert, die man nicht mag.
»Oh«, sagte ich noch einmal. Ich wollte nicht, dass mein »Oh« zu mitfühlend klang, als täte Galina mir leid, weil sie Sex nicht mochte, aber es kam heraus wie ein schüchternes Quieken und so, als hätte ich ein Problem und nicht Galina.
Was ich Galina wirklich gerne gefragt hätte, war, warum sie Sex nicht mochte, welcher Teil am Sex es war, den sie nicht mochte, und ob es irgendetwas am Sex gab, was sie mochte. Stattdessen sagte ich nichts. Ich brachte kein Wort heraus. Mein Schweigen ärgerte mich. Ich kam mir wahnsinnig verklemmt vor. Oder schlimmer: prüde.
Galina arbeitete weiter und erzählte mittlerweile von einer Kundin, bei der vor kurzem Lungenkrebs diagnostiziert worden war. Galina erwog die Behandlungsmöglichkeiten der Frau. Galina hat zu so gut wie jeder Krankheit oder Verletzung, die einen Menschen ereilen kann, eine Ansicht und auch gleich ein Rezept parat. Galina hat die Nägel so vieler Frauen poliert, geschnitten, gefeilt und geglättet. Sie hat ihre Bikinizonen gewachst und ihre Augenbrauen und Wimpern gefärbt und verfügt über genügend Kenntnisse für einen Doktortitel in Medizin. Fundierte Informationen über Gesundheitsfürsorge sind in New York eine harte soziale Währung. Viele Kundinnen Galinas lassen ihre Symptome nach ihren Ratschlägen behandeln. In der Regel weiß sie auch, welche Fachärzte etwas taugen und welchen man aus dem Weg gehen sollte.
Galina erzählte von einer chirurgischen Behandlung, die ihre Kundin erwog. Ich versuchte mir nicht einzubilden, ich hätte Schmerzen im linken Lungenflügel. Diese Stadt hat meinem Eindruck nach mehr als ihren gebührenden Anteil an Hypochondern. Ich bin nicht die Einzige. Und ich fragte mich, wie ich das Gespräch darauf zurückbringen könnte, dass Galina keinen Sex mochte. Es kam mir ausgesprochen ungehörig vor, ein Gespräch über Lungenkrebs mit einer Frage nach Sex zu unterbrechen. Und ich ließ es bleiben.
Caffe Dante
Caffe Dante in der MacDougal Street ist für viele fast ein zweites Zuhause. Mein Mann und ich fühlen uns dort so wohl wie in den eigenen vier Wänden. Das heißt, wir fühlten uns dort wohl, bis die Gerüchte aufkamen. Gerüchte, dass das Café, das seit Jahrzehnten besteht und zum Alltag so vieler Menschen gehört, schließen würde.
Leise Panik machte sich unter den Stammgästen breit. Wie bei allen Gerüchten wurden nur ständig Behauptungen und Halbwahrheiten hinter vorgehaltener Hand getuschelt, die sich oft widersprachen und viele Lücken ließen. Doch alle waren sich darin einig, dass es ganz danach aussähe, als würde das Caffe Dante demnächst schließen.
Das waren keine guten Nachrichten. Mehrere Stammgäste befürchteten, dass ihre Welt, die Welt des Greenwich Village der 1960er und 1970er, endgültig verschwinden würde, wenn es das Caffe Dante nicht mehr gab. Das meiste von dieser Welt war bereits verschwunden.
Joe's Dairy in der Sullivan Street existierte nicht mehr. Plötzlich und ohne Vorankündigung hatte der Laden zugemacht.
In Joes Lädchen hatten alle aus der Gegend seit Jahren ihren Käse gekauft. Der frische und der geräucherte Mozzarella fanden in ganz New York nicht ihresgleichen. Der Käse in Joe's Dairy war unübertroffen und kostete einen Bruchteil dessen, was die zahlreichen Gourmetgeschäfte ringsum verlangten.
Wenn man in Joe's Dairy einkaufte, erfuhr man auch immer interessante Dinge. Joe's Dairy lag gegenüber St. Anthony's Church. Wenn es dort einen Beerdigungsgottesdienst gab, konnte man in Joe's Dairy erfahren, wer gestorben war.
In Joe's Dairy bekam ich auch von dem Priester, der für die Priester von St. Anthony's kocht, einige sehr gute Ratschläge für die Zubereitung von Pasta. Sobald die Nudeln abgetropft sind, mischt man ein bisschen Sauce darunter. Danach kann man so viel Sauce zugeben, wie man für erforderlich hält. Das war ein sehr nützlicher Hinweis.
Wenige Wochen nach dem Ende von Joe's Dairy begegnete ich zufällig Rose, die dort jahrelang gearbeitet hatte, bei Raffetto's in der Houston Street, wo sie inzwischen arbeitete. Ich fand es aufregend, sie bei Raffetto's zu sehen. Rose und ich haben über zehn Jahre Kochrezepte und Familiengeschichten ausgetauscht. Raffetto's gibt es seit einhundertacht Jahren an der Houston Street. Dort bekommt man die besten frischen Ravioli. Meine Lieblingssorte sind die Ravioli mit Wildpilzen.
Milady's, ein Restaurant mit Bar an der Ecke Thompson Street und Prince Street, gibt es auch nicht mehr. Das ein wenig heruntergekommene Lokal hatte sich seit fünfzig Jahren an dieser Ecke befunden. Es war nie schick oder angesagt gewesen. Es war ein Lokal, in dem man etwas trinken und essen konnte, ohne dafür ein Vermögen zu bezahlen und ohne von irrsinnig coolen Menschen umgeben zu sein.
Einer der Stammgäste des Caffe Dante leierte eine ganze Litanei von Läden herunter, die es nicht mehr gab. Es war deprimierend. Er schlug vor, wir sollten uns alle ein anderes Café suchen, in das wir künftig gehen wollten, aber die meisten Stammgäste waren zu bedrückt, um Pläne zu schmieden.
Einer, ein Akademiker, der fast jeden Nachmittag im Caffe Dante einen Cappuccino und einen koffeinfreien Kaffee mit einem Glas Wasser bestellt hatte, wagte die Vermutung, dass das Dante sich vielleicht in eine Bar mit Discobeleuchtung und glitzernden Oberflächen verwandeln würde. Ich vermute, dass dieser Mann geistig noch in den 1960ern oder 1970ern lebte. Ich glaube nicht, dass es irgendwo noch Bars mit Discobeleuchtung gibt. Aber seine Bedenken konnte ich teilen. Würde sich unser heiß geliebtes Caffe Dante etwa so zur Unkenntlichkeit verwandeln, dass es eher einem Club ähnelte, wo Go-go-Girls in Käfigen unter blitzendem Stroboskoplicht tanzten?
Als die Gerüchte irgendwann immer haarsträubender wurden, sagte Mario junior, einer der Inhaber des Cafés, das Café würde bald für Renovierungsarbeiten geschlossen. Das also war nun bestätigt. Mario junior sagte, in einigen Wochen würden sie das Café wieder eröffnen.
In einigen Wochen wollten sie das Café wieder eröffnen? Jeder, der jemals etwas renoviert hat, was größer ist als ein Stuhl, weiß, dass Renovierungsarbeiten nie nur einige Wochen in Anspruch nehmen. Die meisten Renovierungsarbeiten dauern in New York wesentlich länger als anderswo. Die Straßen ersticken im Verkehr. Man kann nirgends parken. Die Eingänge sind zu eng für größere Baumaschinen oder Schutt. Und gerade in Downtown New York sind die Treppenhäuser viel zu eng.
Ein verzweifelter Freund, der seine Wohnung in Tribeca renovieren wollte, erklärte mir, dass man in den Vororten sein Haus relativ schnell renovieren lassen kann. Die Baufirma belädt zwei große Laster mit allem, was sie braucht, und kann sie so lange stehen lassen, wie sie will.
In Manhattan gibt es so viele Regeln, die bestimmen, wie und wann man sein Auto parken darf und wie lange man einen Parkplatz benutzen darf, oder besser gesagt, wie kurz man einen Parkplatz benutzen darf, wenn man das Glück hat, einen zu finden.
In den letzten Wochen vor der Renovierung war das Caffe Dante voll bis zum Bersten. Die Neuigkeiten hatten sich schnell herumgesprochen. Leute kamen von überall her, um ihren letzten Kaffee zu trinken, ihre letzten Cannoli zu essen, ihr letztes hausgemachtes Gelato. Viele machten Fotos. Fotos von den Fotos von Dantes Geburtsstadt Florenz an den Wänden. Fotos von den zwei sepiagetönten Wandbildern der Stadt Florenz im 19. Jahrhundert. Es war es so voll, dass die Stammgäste Schwierigkeiten hatten, einen Sitzplatz zu finden. Trotz der vielen Leute herrschte eine Atmosphäre wie bei einem Leichenbegängnis, als wären die Leute gekommen, um einem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Ich hatte das Café jeden Tag besucht, und nun trauerte ich. Was sollte ich tun, wenn Dante für alle Zeiten zumachte?
Im Caffe Dante hatte ich mich so zu Hause gefühlt. Viele der Kellnerinnen kannte ich gut. Wenn man fast jeden Tag dasselbe Café besucht, diskutiert man dort alle großen und kleinen Ereignisse des Tages. Dinge, die nicht zur Sprache kommen, wenn man Leute nur einmal im Monat oder in zwei Monaten sieht. Mehrere Kellnerinnen wussten besser Bescheid über mein Leben als meine Freunde. Und ich wusste über das Leben der Kellnerinnen Bescheid.
Und eine weitere Dimension meines Lebens im Caffe Dante ist weniger augenfällig. Das ist seine Lage. Caffe Dante liegt unmittelbar gegenüber dem früheren Wohnhaus eines Mannes, zu dem mein Mann eine sehr intensive Beziehung unterhält. Ja, den Mann, den ich liebe, teile ich mit einem anderen Mann. Es ist nicht leicht, so zu leben. Der Mann, den ich liebe, liebt einen anderen. Und zwar leidenschaftlich.
Ich bin überraschend tolerant gegenüber diesem anderen Mann. Obwohl ich eigentlich zur Eifersucht neige. Und obwohl der Mann, den ich liebe, mein Ehemann ist. Manchmal wird meine Toleranz auf die Probe gestellt. Wenn mein Mann mir erzählt, wie intelligent und sensibel dieser andere Mann ist, bemühe ich mich, nicht die Beherrschung zu verlieren. Wenn er mir erzählt, was für einen unglaublichen Verstand der andere hat und was für ein fantastischer Autor er ist, ist es um meine Toleranz nicht mehr allzu rosig bestellt. Ich werde dann ein wenig gereizt und fühle mich unterschätzt.
Der andere Mann sieht nicht einmal besonders gut aus. Aber es ist nicht leicht, in Sachen Aussehen zu konkurrieren, wenn der Rivale ein anderes Geschlecht hat. Es ist nicht leicht, mit dem Mann zu konkurrieren, der im Mittelpunkt unserer ehelichen Spannungen steht. Dieser Mann ist berühmt und erfolgreich. Es handelt sich nämlich um Bob Dylan. Mein Mann ist verrückt nach ihm.
Von unserem Lieblingstisch im Caffe Dante aus kann man Bob Dylans früheres Haus sehen. Es ist das einzige Haus der Straße mit Fenstern zu beiden Seiten der Eingangstür. Ich stelle mir gern vor, wie Bob Dylan dort mit seinen Kindern gelebt hat.
Letzte Woche begegneten wir vor dem Caffe Dante zufällig Mario junior. Wochenlang war das Café zugesperrt gewesen und hatte kein Lebenszeichen von sich gegeben. Von der Renovierung war nichts zu sehen oder zu hören. Mein Mann und ich kamen gerade aus dem La Lanterna Caffe, das sich ebenfalls an der MacDougal Street befindet. Mehrere Stammgäste des Dante waren nach seiner Schließung zum La Lanterna übergewechselt. Ich mag das La Lanterna. Es hat etwas vom alten Greenwich Village. Ein Journalist hat geschrieben, es sei der beste Ort in ganz New York, wenn Verliebte sich küssen wollen. Es wäre nett gewesen, dort hinzugehen, um uns dort zu küssen, aber wir gingen hin, um uns mit Ada zu unterhalten, einer ehemaligen Kellnerin des Caffe Dante, die inzwischen im La Lanterna arbeitete. Ada haben wir geküsst.
Mario junior wollte gerade gehen, als wir ihn trafen. Er schloss die Tür des Cafés auf und ließ uns hinein. Sie hatten tatsächlich renoviert. Die zwei Bereiche des Cafés sahen viel größer aus als früher. Alles war frisch gestrichen. Neue Sitzbänke säumten drei Wände. Der wuchtige, laute alte Kühlschrank war verschwunden. Sie hatten viele Möbel umgestellt. Doch trotz des herumliegenden Werkzeugs und des Staubs sah es ganz so aus, als würde das Caffe Dante auch nach der Renovierung das Caffe Dante sein.
Zu Fuß unterwegs
New York ist eine Stadt der Fußgänger. Man kann stundenlang zu Fuß gehen. Die Straßenzüge gleiten an einem vorüber. Es gibt so viel zu sehen, so viel zu bestaunen. Ich gehe viel zu Fuß. Vor allem, wenn ich gerade an keinem Buch arbeite.
Ich habe lange gebraucht, um meinen letzten Roman, Lola Bensky, zu schreiben. Ich will damit nicht sagen, dass ich lange gebraucht hätte, um mich hinzusetzen und das Buch tatsächlich niederzuschreiben. Ich will damit sagen, dass ich lange gebraucht habe, mich dazu zu überwinden, das Buch zu schreiben.
Ich hatte mir wie immer eine Menge Notizen gemacht. Diese Notizen sammelte ich in Aktenmappen aus Karton. Zehn Mappen. Um jede Mappe kam ein Gummiband. Dann kam ein dickeres Gummiband um alle zehn Mappen. Ich nahm eine alte braune Reisetasche, legte den ganzen Packen hinein und zog den Reißverschluss der Tasche sorgfältig zu. Die verschlossene Tasche kam in eine Schublade eines Aktenschranks aus Metall, und die Schublade schloss ich fest. Ich vergewisserte mich, dass sie wirklich zu war.