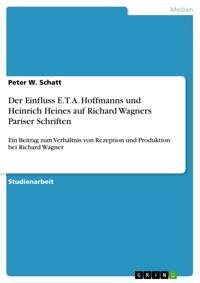17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: wbg Academic
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf welche Aspekte richtet sich musikpädagogische Wissenschaft? Welche Begriffe werden dabei verwendet, was ist mit ihnen gemeint? Woran orientieren sich musikpädagogische Zielvorstellungen und wie sollen sie durch Musikunterricht verwirklicht werden? Auf diese und viele andere Fragen geht Peter W. Schatt in der stark überarbeiteten und erweiterten Neuauflage seines grundlegenden Buches ein. Es ist ein Aufriss der Musikpädagogik, verständlich geschrieben, kritisch-reflexiv und gleichzeitig konstruktiv-zukunftsgerichtet, der mit den wichtigsten musikpädagogischen Strömungen in Theorie und Praxis, mit den zentralen Begriffen sowie mit historischen und aktuellen Konzepten und Konzeptionen vertraut macht. Der Band wendet sich in erster Linie an Studierende der Lehramtsstudiengänge für alle Schulformen, der Instrumental- und Vokalpädagogik sowie der Elementaren Musikerziehung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Peter W. Schatt
Einführung in die Musikpädagogik
2. Auflage
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.deabrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Academic ist ein Imprint der wbg2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2021© 2021 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtI.Auflage 2007Die Herausgabe dieses Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.Umschlagabbildung: Gerhard Ausborn: Farbholzschnitt Rondo (1987)Satz: Lichtsatz Michael Glaese GmbH, HemsbachUmschlaggestaltung: SchreiberVIS, Seeheim-JugenheimGedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem PapierPrinted in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978–3-534–27362-1
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978–3-534–27399-7eBook (epub): 978–3-534–27400-0
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur ersten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
1.Wissenschaftstheoretische Orientierung
1.1Musikpädagogisches Denken als Praxis und ‚Gegenstand'
1.2Musikpädagogik – Musikerziehung – Musikdidaktik – Musikunterricht
1.3Interdisziplinarität der Musikpädagogik – Musikpädagogik als wissenschaftliche Disziplin
2.Intentionale Grundideen musikpädagogischen Handelns
2.1Musik-Lernenermöglichen
2.2Musik-Verstehen anleiten und fördern: Modelle zur Erklärung der Aneignung von Musik
1.Semiotik
2.Hermeneutik
3.Rezeptionsästhetik und Phänomenologie
4.Psychologie
5.Konstruktivistische Kommunikations- bzw. Interaktionstheorie
2.3Durch Musik erziehen – zur Musik erziehen
2.4Musikalische Bildung verwirklichen
2.5Erwerb musikalischer und musikbezogener Kompetenzen ermöglichen
3.Musikpädagogische Prinzipien und Orientierungen
3.1Kunstwerk
3.2Handlung, Performanz und Praxialität
3.3Schüler*innen
3.4Erfahrung
3.5Lebenswelt
3.6Kultur
3.7Bedeutung und Bedeutsamkeit
4.Musikpädagogische Konzepte und Konzeptionen
4.1Vorkonzeptionelle Entwürfe und Ideen: Kretzschmar, Kestenberg, Musische Erziehung und Bildung
4.2Orientierung am Kunstwerk
4.3Didaktische Interpretation und Toposdidaktik
4.4Auditive Wahrnehmungserziehung
4.5Polyästhetische Erziehung und Integrative Musikpädagogik
4.6Kulturerschließung Exkurs: Kultur und Kulturen
4.7Interkulturelle Musikerziehung
4.8Handlungsorientierter Musikunterricht
4.9Erfahrungserschließende Musikerziehung
4.10Schülerorientierter Musikunterricht
4.11Subjektorientierte Musikerziehung
4.12Aufbauender Musikunterricht
4.13Musikklassen und Klassenmusizieren
4.14Musikalisch-ästhetische Bildung, Prozess-Produkt-Didaktik und Musikpraxen erfahren und vergleichen
4.15Überlegungen zu informellen Bildungs- und Lernprozessen: Community music
4.16Kommunikative Musikdidaktik
5. Zur Orientierung in der postmodernen Pluralität von Konzeptionen
Literaturverzeichnis
Register
Vorwort zur ersten Auflage
Musikpädagogik ist kein Ort, in den man hineinführen könnte, sondern das Ergebnis unterschiedlicher Weisen des Nachdenkens vieler Menschen über bestimmte Probleme. Insofern gibt es auch nicht ‚die‘ Musikpädagogik, und eine Arbeit wie diese hat den Zusammenhang der Denkweisen und -ergebnisse ebenso darzustellen wie ihre Differenzen. Diesem Anliegen gilt das vorliegende Buch. Es geht also nicht um eine Einführung in das Studium oder um eine Sammlung und Aufzählung musikpädagogischer Einsichten, sondern um einen Zugang zu Gedanken, die zu eigenem musikpädagogischem Denken anregen sollen. Dazu sind zentrale Fragestellungen und Orientierungspunkte zu erarbeiten – u.a. um bestimmen zu können, was in unterrichtlicher Praxis als gelingend oder sinnvoll bezeichnet werden kann. Das Augenmerk wird dabei auf zwei Kategorien zu richten sein: darauf nämlich, welcher Musikbegriff und welches Menschenbild zur Geltung gebracht werden – Letzteres insbesondere auch hinsichtlich der Weisen und Möglichkeiten des Menschen, mit Musik umzugehen und der Perspektiven Anderer dafür, diese Weisen und Möglichkeiten bei Anderen zu fördern.
Meinem geschätzten Kollegen Prof. Dr. Stefan Orgass bin ich für viele Anregungen sehr dankbar. Wolfram Schwieder von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt danke ich für seine umsichtige und engagierte Betreuung der Veröffentlichung, Katharina Gerwens für ihr kritisches und konstruktives Lektorat. Zu danken habe ich auch Malte Sachsse für sein gewissenhaftes Korrekturlesen. Mein ganz besonderer Dank aber gilt meinem langjährigen Mitarbeiter Andreas Horster: Ohne seinen entscheidenden Impuls und seinen unermüdlichen Einsatz bei allen Stadien der Arbeit wäre das Buch nicht entstanden.
Vorwort zur zweiten Auflage
Die Feststellung, die wie von Geisterstimme gesprochen am Anfang des Films Der Herr der Ringe. Die Gefährten (2001) aus dem Off ertönt: „Die Welt ist im Wandel“, ist weder neu noch zeitlich begrenzt: Schon das auf Ovid zurückgehende Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert konstatierte in vergleichbarer Weise: „Tempora mutantur“, und fügte hinzu „nos et mutamur in illis“. Ob „wir“ uns wandeln, mag dahingestellt sein; in jedem Fall aber änderte und ändert sich im Laufe der Zeit das musikpädagogische Denken, dessen Darstellung dieses Buch gewidmet ist. Es ändert sich, weil sich nicht nur die Verhältnisse der Welt ändern, auf die es sich bezieht – und zwar insbesondere diejenigen Verhältnisse, die mit Kultur und insofern mit Musik zusammenhängen –, sondern auch die Wege, die zu deren Erschließung beschritten werden, sowie die Einsichten, auf denen diese beruhen, und die Positionen, die auf deren Basis vertreten werden.
Das gilt auch für meine eigenen Einsichten und Standpunkte, und so stehe ich heute nicht mehr uneingeschränkt schon zu dem ersten Satz, mit dem das Vorwort zur ersten Auflage begann: Die Behauptung, Musikpädagogik sei kein Ort, würde ich aus heutiger Sicht nur insofern aufrecht halten, als sie natürlich kein topographisch fasslicher Ort ist. Sie kann aber als eine spezifische Verknüpfung von Einsichten und von Strukturen aufgefasst werden, durch die ein Bereich des Denkens als imaginärer Raum des Zusammenhangs vorstellbar wird. Freilich ist dieser Zusammenhang schwer fasslich – darüber täuschen nach wie vor der bestimmte Artikel und der Singular hinweg –, sodass die un-differenzierte Rede von ‚der Musikpädagogik‘ geeignet ist, einen Mythos zu konstituieren (Schatt, 2008a). Nach wie vor gibt es ‚die eine‘ Musikpädagogik im substanziellen Sinne ebenso wenig wie ‚die eine‘ Musik – zu unterschiedlich sind die erkenntnis- bzw. wissenstheoretischen Grundlagen von der Hermeneutik über die Phänomenologie bis zur konstruktivistischen Kommunikations- und Bedeutungstheorie, zu unterschiedlich die Forschungsprinzipien von der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung über die Diskursanalyse bis hin zur ‚Philosophy of musical education‘, zu unterschiedlich die zugrunde gelegten Legitimationsparadigmen von der Anthropologie über die Kulturtheorie bis hin zur Theorie ästhetischer Erfahrung, zu unterschiedlich die Intentionen wie Musikerziehung, Musik-Verstehen, musikalische Bildung und die Ermöglichung des Erwerbs musikalischer Kompetenzen.
All dies bildet allerdings ein Gewebe aus Denkbewegungen, das man mit dem Philosophen Gilles Deleuze und dem Psychoanalytiker Felix Guattari als „Rhizom“ beschreiben könnte (Deleuze & Guattari, 1992); darin bilden sich „in sich selbst vibrierende Intensitätszonen“ (ebd., S. 37), aus denen – wie „Plateaus“ – erkennbare Einsichten und Positionen an die Oberfläche des Wissens hervortreten. Das musikpädagogisch relevante „Rhizom“ selbst weist eine lediglich topologisch beschreibbare – nämlich in sich konsistente, aber in den Umrissen veränderliche – Einheit auf: es bildet einen Raum, in dem – bezogen auf Musikpädagogisches – Gedanken zusammentreten, die der Idee der Förderung des Menschen hinsichtlich seiner Befassung mit Musik gewidmet sind.
Dass diese Einheit in der pluralen Geltung der Vielfalt von einschlägigen Überzeugungen besteht, gehört zu den Einsichten, mit denen bereits die erste Auflage schloss. Seither haben sich zum nicht geringen Teil nicht nur die Einsichten geändert, sondern auch die theoretischen Grundlagen, auf denen sie beruhen. Neue Forschungswege sind erschlossen worden, neue Konzeptionen sind entstanden, es gibt neue Ansätze zur Wissenschaftstheorie, zum Selbstverständnis der Disziplin, neue Positionen bzw. Modifikationen oder Erweiterungen hinsichtlich bestehender Überlegungen, sodass eine gründliche Überarbeitung der Einführung in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht erforderlich schien.
Eigentlich war diese Überarbeitung längst überfällig. Die ersten Überlegungen zur ersten Auflage stammen immerhin von 2003, die Arbeit war Ende 2005 abgeschlossen und konnte gerade noch die neuesten und innovativen Überlegungen meines geschätzten Kollegen Stefan Orgass berücksichtigen. Zugleich erschien mir aber eine Neuauflage als überflüssig: Werner Jank hat die von ihm herausgegebene Musik-Didaktik immer wieder überarbeitet, Michael Dartsch hat Eine Einführung in die Musikpädagogik mit den Schwerpunkten Musik lernen – Musik unterrichten verfasst, Rudolf-Dieter Kraemers Musikpädagogik, die sich als eine Einführung in das Studium versteht, wurde mehrmals neu aufgelegt, Andreas Lehmann-Wermser hat ein Studienbuch über Musikdidaktische Konzeptionen herausgegeben, in dem auch deren theoretische Grundlagen erörtert werden, und unlängst haben sich zahlreiche Mitglieder der musikpädagogischen ‚community‘ zusammengetan, um in einem Handbuch Musikpädagogik deren wesentliche Züge herauszustellen.
Allerdings unterscheiden sich mehrere dieser Arbeiten von der hier vorliegenden, weil Letztere aus einem Guss und kein Sammelband ist; außerdem geht die Schrift einerseits über das weit hinaus, was in ihrem Titel – der allerdings dem Titel der Reihe, in der die erste Auflage erschien, geschuldet ist – verheißen wird, andererseits bleibt sie dahinter zurück: Sie ist nicht bloß eine „Einführung“, sondern darüber hinaus ein Aufriss theoriegeleiteten musikpädagogischen Denkens; sie befasst sich aber nur mit wissenschaftlich ausgerichteter Musikpädagogik – wobei ich ausdrücklich die Musikdidaktik einschließe –, nicht aber – allenfalls bisweilen am Rande – mit der praktisch auszuübenden oder ausgeübten, also mit Musikunterricht. Gleichwohl hat dieser Aufriss einführenden Charakter: Er soll angehenden Musikpädagog*innen Orientierung im Geflecht unterschiedlichster Formen, Arten und Wege musikpädagogischen Denkens, soll ihnen das einschlägige Mit- und Nachdenken ermöglichen.
Die Gliederung der ersten Auflage wurde beibehalten. Im ersten Kapitel wird gezeigt, mit welchen grundsätzlichen Anliegen und disziplinären Verflechtungen ein wissenschaftliches Nachdenken über Musikpädagogik sich zu befassen hat und welcher Strategien es sich dabei bedient. Im zweiten Kapitel werden – mit Lernen, Verstehen, Erziehung und Bildung in musikbezogener Perspektive – fünfzentrale Ideen zu der Frage, was durch eine pädagogisch geleitete Befassung mit Musik erreicht werden soll, entfaltet. Im dritten Kapitel werden in sieben Abschnitten musikpädagogische Leitbegriffe, die als Orientierung für die Konkretisierung dieser Grundideen fungierten, dargestellt; der Entfaltung dieser leitenden Vorstellungen in musikpädagogischen Konzepten und Konzeptionen ist das vierte Kapitel gewidmet. Im fünften, abschließenden Kapitel wird versucht, Anregungen für die Gegenwart und Perspektiven für die Zukunft zu geben.
Die erste Auflage war noch im generischen Maskulinum formuliert. Nun wurde die Sprache weitestgehend gendergerecht modifiziert. Freilich hätte dies an manchen Stellen zu einer unschönen Aufblähung des Satzbaus geführt, in wenigen anderen Fällen habe ich tatsächlich nur an Männer gedacht – zum Beispiel beim „Automechaniker“ und bei den „Lehrern“ A und B. Daher wurde dort aus Gründen der Praktikabilität bzw. der Authentizität die ursprüngliche Sprache beibehalten; es sei jedoch versichert, dass bei allen Aussagen prinzipiell immer alle denkbaren Genderkategorien gemeint sind.
Die Vorgänge, um die es insgesamt geht, sind komplex; um dem gerecht zu werden, bedarfes einer differenzierten Sprache. So entgegnete ich dem Vorwurf, den ein „Rezensent“ auf amazon dem Buch machte (ein Nutzer namens „Northern Warrior“), es sei „selbst ‚Anwaltsdeutsch‘ teilweise noch verständlicher“, dass Anwälte sich um der genauen und differenzierten Sachklärung willen einer Sprache bedienen, „die sich um Sorgfalt, Präzision und Gerechtigkeit der Sache gegenüber bemüht“. Nichts anderes habe ich auch hier versucht. Ich gebe zu, dass die Bemühung um die Sache in der Sprache Spuren hinterlässt -Spuren, die aufzunehmen allerdings auch den Leser*innen bisweilen ein wenig Mühe abverlangt.
Allerdings war ich glücklicherweise mit meinen Anstrengungen nicht allein. Eine aufmerksame kritische redaktionelle Sichtung, zudem zahlreiche wertvolle Anregungen und wichtige, weiterführende Hinweise habe ich Dr. Malte Sachsse zu verdanken, der insbesondere mit den jüngeren einschlägigen Veröffentlichungen in maßstabsetzender Weise vertraut ist. Annemarie Michel hat es auf sich genommen, Korrektur zu lesen; auch sie hat zusätzliche Anregungen beigesteuert – ich bin dafür sehr dankbar. Nicht zuletzt gilt mein Dank Herrn Dr. Jens Seeling von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft für die freundliche und umsichtige redaktionelle Betreuung der Neuauflage.
Es bleibt, der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass all diese Mühe sich gelohnt hat bzw. lohnen wird: dadurch, dass die Wege des musikpädagogischen Diskurses geklärt und für neue Impulse geöffnet wurden und werden, sodass Leser*innen daraus Anregungen und Gewinn für die eigene Positionierung ziehen können.
1. Wissenschaftstheoretische Orientierung
1.1 Musikpädagogisches Denken als Praxis und ‚Gegenstand‘
Drei Beispiele aus drei verschiedenen Lebensbereichen mögen in unser Vorhaben einführen, indem sie aufzeigen, dass, wo und wie über das Verhältnis von Mensch und Musik sowie dessen Veränderung im Sinne einer Optimierung nachgedacht werden kann:
Meine Zahnärztin fragte mich, ob ich ihr empfehlen würde, ihre Tochter zur Musikalischen Früherziehung zu schicken. Sie sei drei Jahre alt, singe ganz allerliebst verschiedene Lieder mit recht reiner Intonation und spiele mit Begeisterung auf ihrem kleinen Glockenspiel, erfinde dabei sogar selbst die eine oder andere Melodie. Die Mutter wollte diese offenbar vorhandene Neigung oder Begabung fördern.
Wenig später dachte ich über ein Konzertprogramm nach. Ich wollte die Komposition Hypotosis von Karl Gottfried Brunotte in der Essener Musikhochschule aufführen in der Absicht, den Studierenden ein Werk zu Gehör zu bringen, in dem sich exemplarisch aktuelles musikalisches Denken zeigt. Um ein Konzertprogramm zusammenzustellen, galt es, andere Werke hinzuzufügen. Meine Wahl fiel auf Karlheinz Stockhausens Spiral und Alban Bergs Vier Stücke für Klarinette und Klavier, da diese Werke – wie das von Brunotte – Ergebnisse eines Denkens sind, das Grenzen zu überwinden sucht. Diese Grenzüberschreitungen hörend wahrzunehmen schien mir interessant und wichtig, da sie zum musikalischen Fortschritt beitrugen, dadurch wichtige Momente der Musikgeschichte markieren und insofern ihre Kenntnis zur musikalischkulturellen Bildung gehört.
Ein halbes Jahrhundert zuvor dachte meine Mutter, es wäre schön, ein musikalisches Kind zu haben, und so sang sie während ihrer Schwangerschaft ein Lied nach dem anderen in der Hoffnung, dies würde Auswirkungen auf die Eigenschaften ihres Nachwuchses haben.
In allen drei Fällen wurde zweifellos darüber nachgedacht, ob, wie und in welchen Hinsichten Menschen mit Blick auf Musik gefördert werden können oder sollen. Aber dürfen wir das Denken in allen drei Fällen als musikpädagogisch bezeichnen?
Musikpädagogisches Denken
Statt schnell eine mehr oder weniger begründbare Antwort zu geben, wenden wir uns den Problemen zu, die mit der Begriffskombination „musikpädagogisches Denken“ aufgeworfen werden. Zumindest zwei Fragen ergeben sich daraus: 1. Begründet oder ermöglicht der Zusammenhang mit Musikpädagogik besondere Weisen des Denkens oder legt er diese nahe? 2. Wenn dies nicht der Fall ist, worin besteht dann das Spezifische des Musikpädagogischen, auf das ein Denken sich richtet?
Die Antwort auf die erste Frage erschließt sich durch einen Blick auf neurobiologische, kognitions- und erkenntnistheoretische Einsichten zur Funktionsweise des Gehirns sowie zu den Vorgängen der Wahrnehmung und des verarbeitenden Bewusstseins: Diese Wissenschaften machen deutlich, dass prinzipiell alle Gehirne gleich funktionieren – in allen Gehirnen ereignen sich bei den genannten Vorgängen dieselben Prozesse, das Denken selbst ist immer dasselbe. Es wäre ein Irrtum, zu glauben, dass Denken anders als in anderen Zusammenhängen funktioniere, wenn es auf Musikpädagogisches gerichtet sei, dass also die Besonderheit, die das Adjektiv rechtfertigt, in den Strukturen subjektiven Denkens liege. Vereinfacht gesagt, bestehen diese in einem Abgleich von Wahrnehmung und gespeicherten Schemata sowie in deren Veränderung mit dem Ziel, Sinn hervorzubringen durch Unterscheidung und Zuordnung in Form u.a. von Urteilen, Positionierung und Handlungsbereitschaft. Allerdings beschreiben die oben genannten Wissenschaften nur die Funktionen, nicht die Inhalte. Und unter Berücksichtigung der inhaltlichen Dimension kommen wir denn doch zu Differenzen: Die Sicht auf die Gegebenheiten des Lebens ist je nach Maßgabe von Interessen, Intentionen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten eine jeweils andere – wenn nicht in den Strukturen des Denkens, so doch in der Weise, wie die Erscheinungen als Wirklichkeit wahrgenommen und zu Aussagen, Erkenntnissen, Einsichten und Urteilen verarbeitet werden.
Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen: Ein Autofahrer denkt anders, wenn er einen Wagen mit Schaltgetriebe fährt als wenn ihm eine Automatik zur Verfügung steht, er reagiert wahrscheinlich auf der Fahrt zur Arbeit in seiner Limousine anders als bei einer Spazierfahrt im offenen Cabriolet – obwohl die fundamentalen Vorgänge, mit denen er der Umwelt Beachtung widmet, gleich sein dürften. Ein Verkehrspolizist, der die Einhaltung von Regeln beachtet, wird ganz anders über diese Autofahrten denken; noch anders ein Mediziner, den der Einfluss des Verkehrs auf die Herzfrequenz interessiert, ein Chemiker, der die Zusammensetzung der Abgase unter dem Einfluss des Verkehrsverhaltens untersucht, ein Politiker, der sich mit deren Auswirkungen auf die Umwelt befasst, oder ein Psychologe, der nach Wechselwirkungen zwischen Autotyp und Wohlbefinden fragt. Das jeweils Andere bei den genannten Personen liegt in den Weisen des Denkens – aber nicht in struktureller, sondern in formaler und inhaltlicher Hinsicht: Alle nehmen Wirklichkeit wahr und stellen das Wahrgenommene in bereits vorhandene Zusammenhänge; dasjenige aber, was sie an der Wirklichkeit wahrnehmen, ist unterschiedlich, und zwar deshalb, weil die Wirklichkeit unter verschiedenen Voraussetzungen erschlossen und in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Interessen und Arbeitsweisen verarbeitet wird. Juristisches Denken beispielsweise bezieht im Streben nach Gerechtigkeit seine Besonderheit – im Unterschied zum Alltagsdenken – aus dem Bemühen um größtmögliche Logik und Strenge in Bezug zu gegebenen Gesetzen und der größtmöglichen Abstraktion von Gefühlen und subjektiven Einschätzungen. Besonderheiten musikpädagogischen Denkens zu entfalten wird indes ein zentrales Anliegen der folgenden Ausführungen sein.
Schon jetzt aber kann festgehalten werden, dass ein Interesse, welches auf eine positive Beeinflussung des Bezugs zwischen Menschen und Musik gerichtet ist, dem Denken eine bestimmte Perspektive verleiht, indem es gerade diesem Bezug eine besondere Aufmerksamkeit widmet: Betrachte ich den Menschen unter dem Aspekt der tatsächlichen und möglichen Weisen seiner Zuwendung zur Musik, erscheint er mir in besonderer Form, und umgekehrt erscheint mir Musik als etwas Spezifisches, wenn ich sie unter dem Aspekt ihrer Zugänglichkeit für den Menschen betrachte.
Dasjenige, was an allen denkenden Gehirnen und bei allen Denkvorgängen gleich ist, hat in sehr einfacher und einleuchtender Weise der Schweizer Psychologe Hans Aebli herausgestellt. Es lässt sich bereits dem Titel seiner Hauptschrift entnehmen: Denken – das Ordnen des Tuns (1994). Einer der zentralen Gedanken dieser Schrift besagt, dass Denken sich auf ein Tun beziehe, welches vorausgegangen sei, und zwar im Modus des Ordnens – so dass umgekehrt Denken sich dadurch artikuliere, dass eine mentale Ordnung hergestellt werde. Eine solche Auffassung korrespondiert mit neueren musikpädagogischen Positionen, die – gestützt auf Arbeiten insbesondere aus der Kultursoziologie – die Praktiken des Menschen akzentuieren und von hier aus den Blick auf Möglichkeiten der Förderung richten. Allerdings geht es bei diesen Theorien weniger – wie bei Aebli – um das Individuelle des Denkens als um Handlungsperspektiven, die aus sozial geteilten Praktiken und deren Routinen erwachsen.
Um Ordnung herzustellen, benötigt man Kriterien – wie z.B. Gelungenheit oder Wohlgefallen –, mit deren Hilfe man die wahrgenommenen Phänomene unterscheiden kann, und man benötigt Kategorien – z.B. Musik, Kultur oder Bildung, soweit es um Musikpädagogik geht –, um die Bereiche des Wahrgenommenen zu beschreiben. Solche Kriterien und Kategorien sind nicht ein für alle Mal gegeben und sie stehen nicht für alle Menschen fest, sondern sie sind abhängig von den Intentionen, die Menschen in bestimmten Situationen verfolgen. Wenn ich also hier von musikpädagogischem Denken schreibe, richtet sich mein Denken auf ein bestimmbares, nämlich das musikpädagogische Tun, und zwar in der Absicht es zu ordnen sowie zugleich aufden Vollzug dieses Ordnens.
Zwischen eigener und fremder Wirklichkeit reflektieren
Dabei ereignet sich etwas, das nur dem Menschen gegeben ist: Es gehört zu den Eigenarten menschlichen Denkens, dass es sich selbst beobachten und kann – Helmuth Plessner nannte dies „exzentrische Positionalität“ unterscheiden ([1928]1981). Eine solche exzentrische Position können wir durchaus im Alltag einnehmen – die Tatsache, dass meine Zahnärztin mich um Rat hinsichtlich des Musikunterrichts ihrer Tochter fragte, macht deutlich, dass sie ihrem eigenen Nachdenken skeptisch gegenüberstand. Im wissenschaftlichen Denken nehmen solche Selbstbeobachtungen in Form des Vergleichs des Eigenen mit dem Anderen sowie die abwägende Differenzierung als Grundlage für den Anschluss an andere Forschungsergebnisse und andere Positionen eine zentrale Rolle ein.
Im Rahmen ordnenden Denkens gilt es dabei zu unterscheiden: zwischen eigenen und fremden Absichten, eigenen und fremden Mitteln und damit generell zwischen eigener und fremder Wirklichkeit. Nicht nur, wenn ich über mögliche Förderung oder Unterrichtung in Musik nachdenke, sondern auch, wenn ich das diesbezügliche Nachdenken Anderer in den Blick nehme, denke ich über Musikpädagogik nach – und damit denke ich selbst bereits musikpädagogisch. Das in diesem Buch verfolgte Anliegen, Aussagen über musikpädagogisches Denken zu machen, würde demnach implizieren, auch das eigene Denken in eine Distanz zu rücken, als sei es ein anderes.
Damit leistet mein musikpädagogisches Denken einen Beitrag zu dem, was als musikpädagogisch-wissenschaftlicher Diskurs bezeichnet wird. Da die Darstellung und Erörterung u.a. von Positionen, Einsichten, Erkenntnissen, Erfahrungen und Urteilen, aus denen solche Diskurse bestehen, durch ihre Bezugsfelder – in unserem Falle der Mensch hinsichtlich seiner Kommunikation und Interaktion in Bezug auf Musik in bestimmten Situationen – gesellschaftlich verankert sind, werden in ihnen unweigerlich Sozialität, Kultur und Politik reproduziert, kritisiert oder auch revolutioniert. Die Analyse solcher Diskurse gehört zu den Aufgaben wissenschaftlicher Musikpädagogik – insbesondere, wenn diese sich als „kritische Kulturwissenschaft“ versteht (Vogt, 2014): Ein solches Selbstverständnis spiegelt sich im Namen einer wichtigen musikpädagogischen Online-Veröffentlichungsreihe, der Zeitschrift für Kritische Musikpädagogik (ZfKM).
Eigenarten wissenschaftlichen Denkens
Mein Denken, das ich an dieser Stelle entfalte, ist einer bestimmten Ordnung im Modus eines bestimmten Systems unterworfen: eines Systems, das wir Wissenschaft nennen. Wie auch das Alltagsdenken richtet es sich auf bestimmte Inhalte und Probleme mit dem Ziel, Orientierung zu gewinnen und eine Positionierung zu ermöglichen – dies wird aus den eingangs angeführten Beispielen deutlich. Ein wesentlicher Unterschied aber zu anderen (alltäglichen) Systemen des Denkens – solchen, die beispielsweise auf die Durchführung von Unterricht oder die überzeugende Darbietung eines Werks gerichtet sind – besteht darin, dass seine Vollzüge jederzeit nachvollziehbar und überprüfbar sein müssen. Dazu müssen die Kriterien, Aspekte, Kategorien und sachlichen Inhalte nachvollziehbar benannt und vor allem begründet werden. Dies gilt sowohl für die Auseinandersetzung mit dem Denken Anderer als auch – quasi in eins damit – für den Vollzug des eigenen Denkens. Insofern habe ich an die Praxis meines eigenen Denkens dieselben Kriterien anzulegen wie an das Denken Anderer – eingedenk des unlösbaren Problems, dadurch keine absolute Objektivität gewinnen zu können, da ich auch meine eigenen Aspekte, Kriterien, Kategorien in der Auseinandersetzung mit Anderen gewonnen habe: Sie stellen quasi die Kehrseite des Anderen im Eigenen (oder des Eigenen im Anderen) dar. Ziel indessen nicht nur der Forschung, sondern wissenschaftlichen Denkens im Allgemeinen ist es u.a., Meinungen, Erfahrungen und Gewohnheiten durch Wissen zu ersetzen (Gruhn, 2006, S. 34–35).
Dass dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, leuchtet spontan ein, wenn man zum einen die einschlägigen Veröffentlichungen der Vergangenheit und der Gegenwart in den Blick nimmt: Sie zeichnen sich nicht nur durch Fülle, sondern auch durch Verschiedenheit aus. Und zum anderen dürfte Musikunterricht – in dem sich immerhin auch musikpädagogisches Denken artikuliert –, zumindest durch Vielgestaltigkeit, wenn nicht durch komplette Heterogenität gekennzeichnet sein.
Gleichwohl widmen sich all diese Facetten musikpädagogischen Denkens dem gleichen Lebenszusammenhang. Ihn herauszustellen wird die nächste Aufgabe sein. Ferner ist darüber nachzudenken, warum es überhaupt eine bearbeitenswerte Aufgabe ist, den Inhalten musikpädagogischen Denkens und seinen Eigenarten nachzugehen. Dazu befassen wir uns zunächst mit dem Gehalt des Begriffs ‚musikpädagogisch‘.
Wer pädagogisch denkt, widmet seine Aufmerksamkeit dem Menschen unter einem bestimmten Aspekt: dem Aspekt der Förderung im Sinne von Lernen, Bildung oder Erziehung. Die Hinsichten dieser Förderung aber sind nicht gegeben und stehen ein für allemal fest, sondern müssen immer wieder neu hervorgebracht werden, da sie in engem Zusammenhang mit der bestehenden und sich stets wandelnden Kultur stehen. Die Grundlagen jeder Förderung nämlich sind einerseits die Diagnose eines Ist-Zustands, der als so beschaffen erkannt wird, dass Lernen, Bildung oder Erziehung notwendig oder zumindest sinnvoll erscheinen, und andererseits die Vorstellung davon, welcher Zustand durch Lernen, Bildung oder Erziehung erreicht werden soll. Insofern sind „Lernen oder Erziehung ohne Vorstellungen vom Menschen" ebenso wenig plan- und realisierbar, wie sich der Mensch „ohne Lernen und Erziehung“ nicht verstehen lässt. Pädagogisches Handeln ist insofern an den Menschen sowie seine Vorstellungen davon gebunden, wie bzw. was der Mensch sein solle, und daher wiederum konstitutiv für den Menschen. Da indessen „Menschen […] immer mehr als nur pädagogische Wesen“ sind, kann man grundsätzlich festhalten: „Der Mensch ist auch ein genuin pädagogisches Wesen“ (Wulf & Zirfas, 2014, S. 9).
Wesen des Pädagogischen
Zur Annäherung an die für die genannten Bereiche pädagogischer Aufmerksamkeit relevanten Handlungsformen lohnt es sich, der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs ‚pädagogisch‘ nachzugehen. Der Begriffist zusammen-gesetzt aus den griechischen Wörtern nötig oder ncaSög, was ‚Kind‘ oder ‚Knabe‘ bedeutet, sowie äyeiv: ‚führen‘. Der Pädagoge ist also ursprünglich ein Leiter oder Führer von jüngeren Menschen gewesen, Leitung – auch Anleitung –, Führung oder zumindest Begleitung erscheinen als das Wesen des Pädagogischen. Interessant und weiterführend ist die Räumlichkeit dieser Begriffe: sie handeln von einer Bewegung, durch deren Vollzug sich Veränderung ereignet, und zwar unter dem Einfluss eines Menschen auf einen anderen. Nimmt man den Vorgang einmal beim Wort, so könnte man fragen: Wohin geht die Führung? Von wo beginnt sie? Mit welchem Recht nimmt einer die Rolle des Führers, einer die des Geführten ein? Anders gesagt: Woher nimmt jemand die Gewissheit, dass seine Diagnose des Ist-Zustands ein pädagogisches Handeln berechtigt, sinnvoll oder notwendig erscheinen lässt und woher weiß dieser Jemand, dass dasjenige, was sein soll, besser ist als das, was ist?
Menschenbild und Musikbegriff
In der jüngeren Forschung (Sachsse, 2014) wurde herausgestellt, dass die einschlägigen pädagogischen Entscheidungen darüber, was zur Förderung vorgeschlagen wird, auf Urteilen beruhen, die sich der Differenz zwischen Beobachtungen und bestimmten Ideen verdanken. Diese Ideen beziehen sich auf den Menschen im Allgemeinen und verdichten sich zu bildhaften Vorstellungen: zu Menschenbildern. Bezogen auf Musik verdichten sich in ihnen Vorstellungen davon, wie einerseits der Mensch Musik konkret in sein Leben einbezieht und wie er es andererseits tun sollte, um glücklicher, erfüllter, gerechter oder vielseitiger zu werden. Im Rahmen dieser ‚Bilder‘ kann der Mensch z.B. als Musik-Denker, als Musik Empfindender, als Erfahrungen Machender, als Schöpfer oder als Handwerker erscheinen. Eine solches ‚Bild‘ kann aber nicht gewonnen werden, ohne dass man eine Vorstellung davon entwickelt, was Musik leisten und was durch sie bewirkt werden kann – und dies wiederum hängt von der Vorstellung davon ab, wie sie beschaffen ist und worin ihre Eigenschaften und Eigenarten bestehen – vom Musikbegriff also. Musikbegriffe und Menschenbilder entstehen, wie oben bereits angedeutet, in einem bestimmten historisch-sozialen Rahmen und sie bestehen in Übereinkünften, deren Geltung im Gebrauch Anerkennung findet (Niegot, 2016), aber jederzeit wieder verworfen werden kann.
Musik: sein und sollen
Auf der Basis geltender Vorstellungen der optimalen Wechselwirkung zwischen Musik und Mensch erst wird es möglich, das Pädagogische hinsichtlich des Musikalischen mit konkretem Inhalt zu füllen. Damit wäre zumindest die Richtung der oben umrissenen ‚Führung‘ bestimmt: Sie soll zur Musik führen. Wo aber ist die Musik? Im Erklingen während eines Konzerts? Im Kopf des Komponisten? In der Partitur? Im eigenen Kopf? In den Analysen der Musiktheorie oder in den Beschreibungen der Musikwissenschaft? Ferner: Wodurch zeichnet sie sich aus? Aufgrund welcher Eigenarten lohnt es sich, sich mit ihr zu befassen? Und: Zu welcher Musik soll geführt werden? Zur Kunstmusik? Zur Musik fremder Kulturen? Zur Musik der Gegenwart? Warum soll überhaupt ‚zur Musik geführt‘ werden, gehört doch, folgt man den einschlägigen Befragungen wie beispielsweise den Shell-Studien, Beschäftigung mit Musik zu den absoluten Lieblingstätigkeiten junger Menschen.
Musikpädagogisches Denken und Handeln fasst ein Sollen in den Blick, das sich vom Sein unterscheidet. Freilich sind dabei die Zustände bzw. die Eigenarten des ‚Seins‘ zu klären, und die Sollens-Forderungen sind zu begründen; ferner sind Aussagen über die Möglichkeiten zu treffen, das Seiende zu verändern. Musikpädagogik gerät damit in ein ambivalentes Verhältnis zum öffentlichen Musikleben: Einerseits können die Intentionen auf Vertiefung, Intensivierung und Erweiterung gerichtet sein, andererseits auf Alternativen und Veränderungen. Wie soll der junge Mensch an Jugendkulturen teilhaben? Intensiver – engagierter – weniger – gar nicht? Soll Musikunterricht eine Zulieferfunktion für den Konzertbetrieb und die Opernhäuser haben? Soll und kann Musikunterricht zum Partner oder zum Widerpart des bestehenden Musiklebens werden? Und ist er im schulischen Bereich vielleicht überflüssig? Zur Musik geführt wird doch bereits in vielfachen Lebenszusammenhängen: Die Mutter tut es, wenn sie ihrem Kind ein Lied vorsingt, der Influencer tut es, wenn er seine neueste Playlist vorstellt, der Konzertpianist tut es, wenn er ein Werk darbietet – und diejenigen tun es, die bereits Unterricht in Musik erteilen. Es scheint demnach so, als sei eine pädagogische Bemühung um den Menschen hinsichtlich seiner auf Musik bezogenen Praktiken in mehrfacher Hinsicht begründungsbedürftig: zum einen in Bezug auf Defizite bei vorhandenen und geübten Praktiken, zum anderen mit Blick auf die Ermöglichung anderer, alternativer oder ganz neuer Praktiken und vor allem hinsichtlich der Frage, warum er sich überhaupt mit Musik befassen soll.
Musik als Pra
Worauf richtet sich das Denken und Handeln des Menschen, wenn er sichxis hörend, musizierend, komponierend, improvisierend, nachdenkend oder interpretierend mit Musik befasst? Bei allen Unterschieden zwischen den maßgeblichen phänomenologischen und konstruktivistischen Erklärungen kann festgehalten werden, dass er kein gegenständliches Objekt vor sich hat oder ein solches produziert, sondern etwas, das sich in der Zeit klingend entfaltet – auch wenn es durch Pausen unterbrochen wird oder überhaupt aus Stille besteht.
Notwendige Bedingung dafür, dass sich etwas klingend entfalten kann – sei es real, sei es auch nur mental, z.B. in der Vorstellung oder Erinnerung –, ist eine einschlägige Praxis des Menschen. Daher hat Hermann J. Kaiser die These vertreten, Musik(en) existierten „einzig und allein als Formen […] gesellschaftlicher Praxen, [und zwar] nur dadurch, dass Musiken gemacht, gespielt, gehört oder nachvollzogen, rezipiert, angeeignet werden [.]“ (Kaiser, 1998, S. 107). Spitzt man diese praxeologische Position konstruktivistisch dahingehend zu, dass man behauptet, alles dem Menschen als existierend Erscheinende sei ein Produkt seines Denkens, so kann man zu der Einsicht kommen, Umgang mit Musik sei gar nicht möglich, vielmehr gelte: „Musik ist Umgang“ (Blanchard, 2019, S. 86).
Bedeutung und Bedeutsamkeit
Freilich lassen diese Bestimmungen offen, worauf die verschiedenen Praktiken sich richten bzw. worin der „Umgang“ besteht. Einig ist man sich darüber, dass dabei ein tönendes Etwas durch die Weise, wie es erklingt, dem Menschen ermöglicht, es als Träger von Bedeutungen wahrzunehmen, die zum einen das Tönende als sinnhaft erscheinen lassen, zum anderen zugleich über sich hinaus die Aufmerksamkeit auf Anderes, Nicht-Musikalisches lenken kann – ein Anderes, das man als musikbezogene Bedeutsamkeit bezeichnet. Zugleich konstituiert der wahrnehmende Mensch einen Bezug zu dem als bedeutungsvoll und bedeutsam Wahrgenommenen. Es kann dem Einzelnen sinnvoll erscheinen, diesen Vorgang zu vollziehen – Musik kann für ihn Relevanz besitzen oder überflüssig sein. Freilich werden die Begriffe Bedeutung, Bedeutsamkeit und Relevanz nicht einheitlich gebraucht. Darauf wird zurück zukommen sein, wenn es darum gehen wird, ‚Bedeutung‘ als musikpädagogische Orientierung auszuweisen (Näheres dazu im Kapitel 3.7). Beides ist anschließbar an eine kommunikations- und bedeutungstheoretische Bestimmung von Musik, die ich vorgeschlagen habe: Demnach kann „Musik als unterschiedlichste Inszenierungen eines Prozesses gelten, bei dem im Medium des Klanges – oder dessen Auslassung – Geltungsansprüche hinsichtlich möglicher Bedeutungen und Bedeutsamkeit in Kraft gesetzt und im Felde musikalisch-ästhetischer Wahrnehmung sowie des entsprechenden Verstehens erwogen werden“ (Schatt, 2017, S. 191).
Legitimations paradigmen für Musikpädagogik
Pädagogisch ist diese Bestimmung relevant, weil mit ihr zugleich mit ‚Musik‘ der Mensch in den Blick gerät. Dieser Beziehung gelten auch alle Bemühungen um eine Begründung dafür, dass der Mensch hinsichtlich seiner Befassung mit Musik gefördert werden solle. Hermann J. Kaiser hat vier derartige Legitimationsparadigmen ausgewiesen (Kaiser, 1998, S. 101–102):
1das Erziehungs- und Therapieparadigma: Es beruht auf der Vorstellung, dass musikalische Praxis den Menschen von sich aus im positiven Sinne verändert, indem sie ihm zu einem harmonischen Verhältnis zu anderen Menschen wie auch zu sich selbst verhilft;
2das anthropologische Paradigma: Es basiert auf der Beobachtung, dass musikalische Praxis überall auf der Welt gepflegt wird und der Überzeugung, dass sie prinzipiell jedem Menschen möglich und für seine individuelle Entwicklung unabdingbar sei;
3das kulturtheoretische Paradigma: Ausgehend von der Tatsache, dass Musik ein wesentlicher Teilbereich unserer und auch fast aller anderer Kulturen ist, auf den schwer verzichtet werden kann, ferner Kultur von Menschen gestaltet und umgekehrt der Mensch von Kultur beeinflusst wird, soll jedem Menschen die Teilhabe an Musikkultur ermöglicht werden – dafür sorgen u.a. auch, so hat Kaiser später ausgeführt, Institutionen oder institutionelle Instanzen (Kaiser, 2018, S. 40–42);
4das ästhetische Paradigma: Es wird durch die Einsicht begründet, dass „durch Musik Erfahrungen für uns Menschen ermöglicht werden, die formal und inhaltlich in keinem anderen und durch kein anderes Medium sonst zu gewinnen sind“. Solche Erfahrungen aber seien notwendig für eine möglichst umfassende Welterfahrung und „ein differenziertes Weltverhältnis“ (Kaiser, 1998, S. 102).
In systematischer Absicht hat Kaiser dazu als Bezugsfeld eine „jeweils [.] letzte Instanz“ herausgestellt, welche seiner Auffassung nach „die Rechtmäßigkeit des musikpädagogischen Handelns bzw. Sprechens sichert“. Dies sei der Rekurs
„(a) auf einen leitenden Begriff, einen fraglos anerkannten Sachverhalt, eine Theorie oder
(b) auf ein Subjekt bzw. eine Gruppe von Subjekten oder
(c) auf eine institutionelle Verknüpfung von Person(en) und Sachverhalten" (Kaiser, 2018, S. 40).
Dabei ist allerdings im Blick zu behalten, dass zwischen diesen „Instanzen“ eine wechselseitig konstitutive Dialektik besteht (Sachsse, 2014): So verdankt sich im musikpädagogischen Denken nachweislich z.B. einer der „leitenden Begriffe“, der Musikbegriff, einem jeweils bestimmten Menschenbild, und umgekehrt orientiert sich z.B. institutionelles Handeln, welches sich auf die Verwirklichung eines bestimmten Menschenbildes richtet, an einer bestimmten Vorstellung von Musik.
Ziele und Aufgaben musikpädagogisches Denken
Aneignung: Formale, informelle und non-formale Prozesse
Musikpädagogisches Denken hat diese Paradigmen nicht nur hervorgebracht; es orientiert sich auch daran und setzt sich kritisch mit ihnen auseinander. Immer aber richtet es sich auf die Frage nach der Aneignung von Musik und die Ermöglichung sowie Förderung dieser Aneignung im Kontext von Erziehungs-, Bildungs-, Lern-, Lehr- und Unterrichtsperspektiven. Zwar weist Bernhard Weber mit Recht darauf hin, dass Aneignungsprozesse bildungstheoretisch einem Lernen zugeordnet werden, das „in aller Regel im alltäglichen Kontext außerhalb von Bildungs- und Ausbildungsstätten stattfindet und weder didaktisch strukturiert noch zertifiziert wird“ (Weber, 2017, S. 14): dem informellen Lernen. Dieses sei, so Weber, vom formalen Lernen ebenso zu unterscheiden wie vom ‚non formalen‘ Lernen, das sich durch die zielgerichtete Sicht der Lernenden vom ‚informellen Lernen‘ abgrenze (ebd.). Damit erscheint ‚Aneignung‘ aber als eine Form der Weltzuwendung, die mit Lernen zwar zusammenhängt, jedoch nicht damit identisch ist, sondern weiter zu fassen ist und darüber hinausgeht. Fraglich bleibt dabei, ob nicht alle Prozesse der Verarbeitung von Welt zu etwas, was das Subjekt auf sich beziehen und mit dem es künftig handeln kann – Prozesse, unter die auch die drei genannten Lernbegriffe fallen –, als Vorgänge der ‚Aneignung‘ aufzufassen und ohne „die Intentionalität des einzelnen Akteurs“ (Orgass, 2017, S. 265) kaum zu denken sind.
Unter diesen Perspektiven werden im Rahmen musikpädagogischen Denkens Voraussetzungen, Bedingungen, Intentionen, Inhalte, Vollzugsweisen, Ergebnisse und Legitimationen von ‚Aneignung‘ im Rahmen jedweden Lernens mit unterschiedlicher Akzentuierung in den Blick genommen, und zwar in dem Bemühen „um Unterstützung und Verbesserung“ (ebd.).
Offensichtlich gibt es zwei Weisen, dies zu tun: eine, die auf konkretes musikalisches Handeln von Menschen gerichtet ist und eine, die die Legitimationen, Strukturen, Ursachen, Bedingungen, Voraussetzungen und Ergebnisse dieses Handelns untersucht, um Wissen zu erwerben und dieses Wissen mit anderen zu teilen.
Theorie und Praxis
Wir haben es uns angewöhnt, die eine Weise als ‚Praxis‘ zu bezeichnen, die andere als ‚Theorie‘. Die bisherigen Ausführungen dürften bereits auf eine Schieflage in dieser Unterscheidung, zumindest aber auf eine Interdependenz zwischen den beiden Bereichen aufmerksam gemacht haben: Auch die Hervorbringung von ‚Theorie‘ ist eine Praxis, und es ist umgekehrt keine ‚Praxis‘ vorstellbar, in der nicht ein wie auch immer geartetes ‚theoretisches‘ Denken verwirklicht würde. Festzuhalten bleibt immerhin, dass die Modi sich unterscheiden: Der eine ist konkret auf Realisierung musikalischer Praktiken gerichtet, wie es z.B. im schulischen Musikunterricht oder im Instrumentalunterricht der Fall ist, der andere verbleibt im Status des Wissens.
Auch die Alltagspraxen entbehren nicht einer Grundlegung durch ‚Theorie‘ – allerdings keiner wissenschaftlichen, sondern einer alltäglichen. Dies zeigen die drei Fälle, die eingangs geschildert wurden. Ihnen ist gemeinsam, dass in ihnen – mit unterschiedlichen Akzenten – nach Bedingungen der Möglichkeit von Förderung Anderer gefragt oder deren Klärung unterstellt wird. Dabei geht es um physische Bedingungen wie Alter und Kraft, um psychische Bedingungen wie Motivation, Interesse und Begabung sowie um musikkulturelle Bedingungen. Meine Zahnärztin bringt anthropologische und psychologische Beobachtungen – Alter und Begabung – in einen sozial-kulturellen Zusammenhang, aus dem sie eine Sollensaussage ableitet: Weil ihre Tochter jung und begabt ist und Musikausübung ihr kulturell und für das Kind selbst als wünschenswert erscheint, erkundigt sie sich nach optimalen institutionellen Bedingungen für musikalisches Lernen. Freilich denkt sie nicht in diesen Begriffen und den dazugehörigen Kategorien – sie denkt nur darüber nach, wie sie etwas Gutes für ihr Kind tun könne. Offen bleibt, worin für sie das Gute besteht: in der Förderung der Anlagen ihres Kindes und deren Vervollkommnung willen, in der Harmonisierung der seelischen Befindlichkeit, in der Ermöglichung einer spezifischen Teilhabe an Musikkultur oder an der Vermittlung spezifischer Erfahrungen. Insofern ist dies zwar ein Denken, das auf Lernen und Lehren von Musik zum Zwecke der Förderung des Kindes gerichtet ist – also ein musikpädagogisches Denken –, aber es verbleibt als Praxis im Status alltäglichen Handelns.
Auch im Fall der Konzertplanung werden Voraussetzungen Anderer reflektiert, ins Verhältnis zu wünschenswert erscheinenden Kompetenzen gesetzt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, die jedoch auf spezifische Inhalte und nicht auf allgemeine Fähigkeiten bezogen sind. Indem Aktualität, Exemplarizität und kulturelle Relevanz bedacht werden, geht es primär darum, Anderen einen speziellen Bereich der Musikkultur zugänglich zu machen und dadurch zu ihrer musikalisch-kulturellen Bildung beizutragen.
Und das einstige Tun meiner Mutter erscheint fast wie eine Umsetzung neuerer neurobiologischer Erkenntnisse: Da wird Er,ziehung‘ – quasi im Sinne von ‚Aufzucht‘ – bereits in einem Stadium realisiert, in dem es noch um die Voraussetzungen von Wachstum geht: keineswegs unreflektiert, sondern im Horizont eines empirischen Wissens und mit Blick auf ein für erwünscht gehaltenes Menschenbild, damit unbewusst das anthropologische Paradigma verwirklichend.
Es zeigt sich, dass auch hier ein musikpädagogisches „Denken als Ordnen des Tuns“ stattfand; die handlungsbestimmenden ‚Theorien‘ bestehen jedoch weitgehend in umgangsmäßig gewonnenen Erfahrungen, Meinungen und Überzeugungen. Eine auf wissenschaftliche Weise gewonnene Theorie unterscheidet sich dadurch von ihnen, dass sie nach Maßgabe bestimmter Modalitäten, nämlich zumindest Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit, Komplexität- und damit im Streben nach Wahrheit – reflektiert, was in der alltäglichen Weise vollzogen wird.
Die Ziele und die Aufgaben wissenschaftlichen musikpädagogischen Denkens werden keineswegs einheitlich umschrieben. Hermann J. Kaiser umriss beides folgendermaßen:
„Überblickt man die gegenwärtige Diskussion, so will wissenschaftliche Musikpädagogik Wissen schaffen um das, was im musikalischen Aneignungsvorgang vor sich geht, besser, d.h. vollständiger und gesicherter verstehen zu können; um sagen zu können, wie zukünftige musikalische Aneignungsprozesse vor sich gehen können; um diese Aneignungsprozesse besser fördern, kurz: sie pädagogisch verantwortungsvoller und sachlich adäquater realisieren zu können“ (Kaiser, 1983, S. 218).
Beim Wort genommen, geraten damit Musik und Mensch nicht nur in ihren Eigenschaften und in ihrer Wechselbeziehung, sondern auch in ihren jeweiligen Kontexten in den Blick. Sigrid Abel-Struth betonte dagegen, wissenschaftliche Musikpädagogik diene ausschließlich dem Erkenntnisgewinn im Felde pädagogischen Umgangs mit Musik (Abel-Struth, 1983, S. 204). Sie abstrahiert damit von einer auf künftige Unterrichtspraxis gerichteten Perspektive und befürwortet eine Wissenschaft, deren Funktion darin besteht, der Wissenschaft zu dienen. Genau entgegengesetzt postulierte Christoph Richter, Musikpädagogik habe „Menschen die Teilhabe an Musik zu ermöglichen“, sie zur Musik als einem Medium für Lebensvollzug, Erziehung und Lebensgestaltung anzuregen (Richter, 1997, Sp. 1442).
Vergegenwärtigen wir uns hier die Eigenart von Musikpädagogik im Status von Wissenschaft, ohne über deren Funktion für außerwissenschaftliche Praxis zu urteilen.
Empirie – Interpretation – Kritik
Das musikpädagogisch relevante Wissen bezieht sich auf die Theorie und Praxis der Aneignung und Vermittlung zwischen Musik(en) und Menschen. Es kann durch unterschiedliche Tätigkeiten bzw. Zuwendungsweisen erworben werben. Die zentralen Weisen, sich mit den genannten Bereichen zu befassen, sind Empirie, Interpretation und Kritik. Während eine empirisch-analytische Zuwendungsweise, wie sie für die Natur- und Sozialwissenschaften charakteristisch ist, primär beschreibend der Gegenwart gilt, richtet sich die Interpretation – das zentrale Verfahren der Geisteswissenschaften – im Modus des Auslegens, Verstehens und Deutens auf sie. Derartig geisteswissenschaftlich ausgerichtete Modi widmen sich nicht nur dem Präsenten, sondern dem fundamental Aktuellen wie auch dem Historischen. Ohne dies freilich kann auch eine kritische Zuwendung, die zudem auf eine mögliche Wirklichkeit gerichtet und primär dem Ziel der Veränderung gewidmet ist, nicht auskommen. Und keineswegs kann oder soll mit diesen ganz groben Unterscheidungen gesagt sein, dass etwa empirisch gewonnene Befunde nicht der Interpretation bedürften bzw. dass die Fragestellungen, zu deren Klärung sie angewendet werden, nicht das Ergebnis von Positionen sein können, die durch Deutung oder Interpretation gewonnen wären.
Die interne Verwobenheit verschiedener fundamentaltheoretischer Einsichten und die daraus resultierenden Methoden, Ergebnisse und Konsequenzen sind insbesondere für die Fragestellungen und Aufgaben der wissenschaftlichen Musikpädagogik von Bedeutung. Als gemeinsames Ziel lässt sich der Gewinn von Theorien musikbezogener Aneignungs- und Vermittlungsprozesse benennen. Und dies alles dient dem Zweck, Erkenntnis, Orientierung, Erklärung und Entscheidungshilfe hinsichtlich des Problems hervorzubringen und zu begründen, wie die Beziehungen zwischen Menschen und Musik erklärt, optimiert, angeregt und gefördert werden können.
Rudolf Dieter Kraemer hat die Aufgaben der Musikpädagogik und die erkenntnistheoretischen Positionen zusammenfassend dargestellt (Kraemer, 2004, S. 45). Demnach sind Vorgänge musikbezogener Aneignung und Vermittlung in einer geschichtlich gewachsenen, kulturell-gesellschaftlichen Gesamtsituation von Individuen im Rahmen deren jeweiligen Lebensumfeldes möglichst unvoreingenommen zu beschreiben und hinsichtlich ihrer Ursachen und Zusammenhänge zu erklären. Sie müssen bewusst gemacht und gedeutet werden, um sie ggf. verändern zu können.
Bei diesen Bemühungen geraten nicht nur der Musikbegriff und die Ver-fasstheit der beteiligten Menschen, sondern auch die Prozesse ihrer Beteiligung wie Produzieren und Reproduzieren, Reflektieren und Interpretieren sowie Distribuieren, ferner das gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche und politische Umfeld mit seinen Kommunikations- und Interaktionsprozessen, zudem natürlich auch die Ergebnisse dieser Beteiligung, z.B. Kompositionen, Musikproduktionen sowie Musikbücher und -schriften in den Blick.
Sein und Sollen
Bei all diesen wissenschaftlichen Zuwendungsweisen spielt die Annahme einer Differenz zwischen Sein und Sollen eine entscheidende Rolle. Im wissenschaftlichen Schrifttum und in der unterrichtlichen Praxis kommt dies in Form von unterschiedlichen Diagnosen hinsichtlich der Differenz zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit, Sein und Sollen, hinsichtlich unterschiedlicher Verfahren, diese Diagnose zu stellen, und hinsichtlich unterschiedlicher Vorstellungen darüber, welche Konsequenzen daraus gezogen werden sollen – ob also z.B. musikalisch-ästhetische Erfahrung, kulturelle Bildung oder musikpraktische Fertigkeiten, ob Instruktion oder Selbsttätigkeit für das Lehren und Lernen maßgeblich seien –, zum Tragen.
Allen genannten Fällen, Prozessen, Denkstrategien, Inhalten, Wissenschaftsbereichen usw. liegt eine Frage zugrunde. Sie lautet:
„Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (auch: Kompetenzen), Einstellungen und Haltungen braucht der Mensch heutzutage und künftig, um mit Musik sein Leben sinnvoll zu gestalten, und was kann und soll man tun, um ihm den Erwerb dieser Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen im Rahmen von Schule und Gesellschaft zu ermöglichen?“
Wir haben gesehen, dass diese Frage im Alltag und in der Forschung gestellt wird. Eine entsprechende Forschung gibt es, weil die Frage im Alltag von verschiedenen Menschen unterschiedlich beantwortet wird: Lehrer werden sie anders beantworten als Diskjockeys, Zahnärztinnen anders als Bardamen, Wissenschaftler anders als Politiker. Deutlich wird die Differenz zwischen Sein und Sollen, deutlich wird auch der Zusammenhang zwischen Empirie und Deutung: Erst wenn ich den konkreten Fall kenne, kann ich Aussagen über notwendige und wünschenswerte Förderung machen. Erst wenn ich weiß, worin musikbezogene Fähigkeiten bestehen, wodurch sie entstehen und wie sie sich zeigen, kann ich die Frage beantworten. Deutlich wird auch die Notwendigkeit historischer Forschung: Was ist im Schrifttum über Handlungsvorschläge nachzulesen? Und letztlich wird bereits hier die Differenz zwischeneiner wissenschaftlichen und einer nichtwissenschaftlichen musikpädagogischen Fragehaltung deutlich – ein*e Musiklehrer*in nämlich würde die Frage ganz anders formulieren:
„Was kann ich in meinem Unterricht tun, damit meine Schüler*innen im Unterricht so handeln, dass sie daraus einen Gewinn ziehen, der ihnen hilft, ihr künftiges Leben sinnvoller: genussreicher, erkenntnisreicher, aufgeschlossener, vielfältiger, den Möglichkeiten der Welt angemessener, menschenwürdiger gestalten zu können?“
1.2 Musikpädagogik – Musikerziehung – Musikdidaktik – Musikunterricht
Wir bemühen uns um die Begriffe, mit denen die Bereiche der pädagogisch orientierten Auseinandersetzung mit der Aneignung von Musik durch Menschen bezeichnet werden – sei sie auf den Gewinn von Wissen im Sinne von Wissenschaft, sei sie auf den Vollzug von Lehrhandlungen gerichtet –, weil sie auf die Unterschiedlichkeit und auf die Gemeinsamkeiten hinsichtlich der einschlägigen Aufgaben, Zielsetzungen und Fragestellungen verweisen.
Bereits bei deren näherer Bestimmung werden unterschiedliche Vorstellungen von der Bedeutung des Begriffs ‚Musik‘ sowie unterschiedliche Vorstellungen von der Eigenart der Aktivitäten des Menschen, der diese praktiziert, deutlich – und damit auch unterschiedliche Vorstellungen von der Art und Weise, wie das Moment des Pädagogischen zu vollziehen sei.
Musikpädagogik als Fach, Studiengang und Bereich
Diese Begriffe spielen auch in der unmittelbaren Arbeits- bzw. Studienwelt derer, die einen musikbezogenen Lehrberuf ergreifen wollen, eine Rolle. Wer Musikpädagogik mit dem Ziel studiert, Diplom-Musikpädagoge*in zu werden, hat ein Fach zu belegen, das „Musikpädagogik“ heißt – und andere Fächer, die nicht damit identisch sind, wohl aber zum Studiengang Musikpädagogik gehören: Musikdidaktik, Allgemeine Didaktik, Unterrichtsplanung und -durchführung. Studierende im Lehramtsstudiengang indessen hatten beispielsweise in Nordrhein-Westfalen1 seit den 1980er-Jahren bis ins 21. Jahrhundert hinein Musikpädagogik als einen Bereich zu studieren, der sich in „Geschichte der Musikpädagogik“, „Didaktik und Methodik einzelner Lernfelder“, „Musikdidaktische Konzeptionen der Gegenwart“ sowie „Musikpädagogik unter soziologischen und psychologischen Aspekten“ gliederte.
Musikerziehung – Schulmusik
Der Begriff Musikpädagogik kann demnach einerseits einen umfassenden Bereich von Ausbildung, Lehren und Lernen bezeichnen, zugleich aber innerhalb dieses Bereiches ein ‚Fach‘. Allerdings ist das im Vergleich zu dem Fach Umfassendere, Allgemeinere des Bereichs nicht identisch mit ‚Allgemeiner Musikerziehung‘, ist mit dieser Begriffskombination doch ein eigener Studiengang gemeint. Der Begriff der Musikerziehung wiederum war bis vor nicht allzu langer Zeit als Berufs- und Studiengangsbezeichnung üblich – Musiker-zieher*in bzw. Musikerziehung – und begegnet uns in Titeln wie Handbuch der Musikerziehung (Bücken, 1931; Fischer, 1954), Geschichte der Musikerziehung (Gruhn, 1993) oder Anfänge institutioneller Musikerziehung (Sowa, 1973). Diese Titel sind Ergebnisse einer eingehenden Reflexion über das musikpädagogische Selbstverständnis, und so ist der Differenz zwischen ihnen und Titeln wie Handbuch der Musikpädagogik (Schmidt & Richter, 1986) bzw. Handbuch Musikpädagogik. Grundlagen – Forschung – Diskurse (Dartsch, J. Knigge, A. Niessen, F. Platz & C. Stöger, 2018) und Geschichte der deutschen Schulmusik (Schünemann, 1928) durchaus Bedeutung beizumessen. Den letztgenannten Begriffführten die beiden zentralen Berufsverbände VDS (Verband deutscher Schulmusiker) und AfS (Arbeitskreis für Schulmusik) in ihren Namen. 2015 schlossen sich diese Verbände zum Bundesverband Musikunterricht (BMU) zusammen, und es ist zu fragen, ob bzw. welche Traditionen des Selbstverständnisses unter dem neuen Namen erhalten blieben.
Widmen wir uns im Folgenden also den Begriffen Musikpädagogik, Musikdidaktik, Musikunterricht, Musikerziehung und Schulmusik mit der Frage nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten.
Bezugsebenen und Methoden der Musikpädagogik
Der Begriff Musikpädagogik begegnet uns in vier verschiedenen Zusammenhängen, die sich als vier Ebenen musikpädagogischen Denkens und Handelns umreißen lassen (vgl. Kaiser & Nolte, 1989, S. 18). In ihnen kommen sehr unterschiedliche Methoden zur Anwendung. Diese orientieren sich weitgehend am jeweiligen Erkenntnisinteresse. Folgende Ebenen bzw. Felder von „Musikpädagogik“ lassen sich unterscheiden:
1.steht der Begriff für ein Nachdenken und Forschen, das sich primär analytisch – dabei auch komparativ – auf zwei Bereiche der Wirklichkeit richtet: zum einen auf tatsächlich vorfindliche musikpädagogische Praxis, zum anderen aufdie historisch und systematisch beschreibbaren Bedingungen für die Möglichkeit musikpädagogischen Handelns und für das Nachdenken über dessen Grundlagen, nämlich musikpädagogische Theoriebildung. Insoweit es um die Analyse musikpädagogischer Praxis geht – vorzugsweise also um Musikunterricht in seinen verschiedenen Ausprägungen (z.B. schulischer Musikunterricht, Instrumentalunterricht im privaten oder im Bereich der Musikschule, Unterweisung im Internet) – werden primär Methoden der empirischen Forschung angewandt. Vor allem, wenn neue Ideen auftreten, möchte man wissen, mit welchem Erfolg sie verwirklicht wurden, um sie bestätigen, optimieren oder verwerfen zu können. Aufdie-se Weise gerieten in der jüngeren Vergangenheit u.a. Ideen zur Inklusion, das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ („JeKi“), Klassenmusizieren, Musikklassen und Komponieren bzw. Musik-Erfinden mit Schüler*innen in den Blick der Forschung. Wenn es dabei primär um individuell relevante Unterrichtsergebnisse wie Einschätzungen oder Befindlichkeiten der am Unterricht Beteiligten geht, kommen primär Methoden der qualitativen Forschung wie z.B. narrative oder leitfragengestützte Interviews zum Tragen. Sie können mit quantitativen, z.B. für Statistiken relevanten Methoden verknüpft werden, die u.a. angewendet werden, wenn es um Fragen der Teilhabe an Musik infolge von Unterrichtserfahrungen geht – z.B. wer ohne und mit Unterricht wann wie oft musiziert, hört oder tanzt – oder um die Auswirkungen sozialer Bedingungen auf die Einstellungen der Lernenden – z.B. die Frage, wie sich ein Migrationshintergrund auf die musikalischen Präferenzen oder die musikbezogene Lernbereitschaft auswirkt. Wer aus historischer Sicht Musikunterricht beschreiben will, hat u.a. schriftliche Dokumente auszulegen: alte Erlasse, Lehrpläne, konzeptionelle Schriften zur Musikpädagogik, Unterrichtsmaterialien usw. Zur Interpretation, Einschätzung, Ein- bzw. Zuordnung solcher Quellen finden Methoden der Hermeneutik Anwendung. Wo es um das Anliegen geht, Musikpädagogik systematisch zu erfassen, wo also über ein System bzw. eine systematische Fundierung des Denkens über den Zusammenhang der musikpädagogisch relevanten Teilbereiche nachgedacht wird, wird eine Methodik in Anschlag gebracht, die man als philosophisch insoweit bezeichnen kann, als sie sich der Verfasstheit von Erkenntnis im weitesten und grundlegenden Sinne widmet. Im angelsächsischen Sprachgebrauch wird dieser Teilbereich auch als ‚philosophyofmusical education‘ bezeichnet. Zu ihr gehört wesentlich jener Bereich der Musikpädagogik, der als ‚Systematische Musikpädagogik‘ oder ‚Allgemeine Musikpädagogik‘ bezeichnet werden kann. Er befasst sich mit grundsätzlichen Fragen: mit Voraussetzungen, Bedingungen und Folgen musikpädagogischen Denkens und Handelns und mit den bereits gewonnenen Antworten aufdiese Fragen. Durch Systematische Musikpädagogik wird versucht, auf der Grundlage u.a. erkenntnistheoretischer, ästhetischer und soziologischer Einsichten musikpädagogischem Denken eine geordnete Orientierung zu verleihen. Zu ihren Intentionen gehört auch die Ausarbeitung einer einschlägigen Wissenschaftstheorie. Da in verschiedenen Ländern unterschiedliche Vorstellungen von musikalischer Erziehung und Bildung bestehen, gibt es auch einen als ‚vergleichende Musikpädagogik‘ bezeichneten Bereich, der sich der Aufarbeitung dieser nationalen Positionen widmet. Dabei geraten unterschiedliche Musiken, differierende Musikbegriffe, unterschiedliche Einschätzungen musikalischer ‚Sachverhalte‘ und unterschiedliche musikpädagogische Positionen in den Blick, weil Menschen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich denken. Diese Kontexte können unter bestimmten Umständen ‚Kultur‘ genannt werden, und unterschiedliche Kulturen sind es denn letztlich auch, auf die Differenzen zwischen musikpädagogischen Vorstellungen in verschiedenen Ländern zurückzuführen sind.
2.steht der Begriff für ein Nachdenken und Forschen, das sich primär konstruktiv auf eine künftige musikpädagogische Praxis richtet, und zwar primär im Modus des Nachdenkens – weniger des empirischen Forschens – über diese Praxis. Oft ist ein solches Nachdenken auf die Struktur und den Gehalt von Konzepten für Unterricht oder musikpädagogische Konzeptionen gerichtet und kann in neue konzeptionelle Vorschläge einmünden. Dabei geht es fundamental darum, wie den verschiedensten Ansprüchen, die an Lehren, Lernen und Bildung im Zusammenhang mit Musik vor allem im institutionellen Zusammenhang gestellt werden, möglichst ausgewogen gerecht werden kann. Erwartungen, Wünsche und Forderungen der Lernenden, der Lehrenden, der Elternschaft, der kulturellen Institutionen, der Politik und der Wissenschaften – insbesondere der Musik- und Kulturwissenschaften, aber auch der aktuellen Musikpädagogik – sind dabei zu berücksichtigen. Insoweit dabei bereits vorliegende Positionen ausgewertet werden, um sie zu kritisieren, zu optimieren oder um Alternativen zu gewinnen, können z.B. Prinzipien des Verfahrens der Diskursanalyse angewendet werden, um herauszustellen, was Andere aus welchen Gründen gedacht haben (zusammenfassend Wirmer, 2020). Bei einer solchen Analyse wird nicht nur nach Interdependenzen zwischen einzelnen Positionen und den Strukturen dieser Beziehungen gefragt, sondern auch nach deren Abhängigkeit z.B. von Machtverhältnissen oder hegemonialem Denken.
3.wird der Begriff für jenen Bereich praktischer Tätigkeiten gebraucht, mit denen es anderen ermöglicht wird, im Umgang mit Musik ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern, also Musik zu lernen und sich musikalisch bzw. musikbezogen zu bilden: Dazu gehört primär der schulische und außerschulische Musikunterricht.
4.findet der Begriff auch Anwendung im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die zwar mit Musik und Pädagogik verbunden werden können, jedoch nicht spezifisch auf Bildung oder Ausbildung ausgerichtet sind (z.B. Prozesse informeller musikalischer und musikbezogener Bildung durch den einschlägigen Gebrauch digitaler Medien, Bemühungen um gemeinsames Musizieren im Rahmen von ‚Community music‘, Komponist*innen als Pädagog*innen bzw. Werke als klingende Musikpädagogik; vgl. dazu z.B. Schatt, 1991; Kloppenburg, 2002; Mertens, 2013).
Überlegungen zur Unterscheidung zwischen den genannten Bereichen haben insbesondere in den 1970er-Jahren im musikpädagogischen Denken eine große Rolle gespielt. Sie dienten der Selbstfindung einer noch jungen Disziplin und entsprangen dem Ringen um die Fundierung von Musikpädagogik als einer selbständigen Wissenschaft. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Musikpädagogik und Musikdidaktik war dabei von erheblichem Belang, gab es doch Stimmen, die beides als Unterabteilungen anderer Wissenschaften sahen, insbesondere der (historischen und systematischen) Musikwissenschaft.2
Unterscheidung Musikpädagogik – Musikdidaktik
Bei der Unterscheidung zwischen Musikpädagogik und Musikdidaktik geht es um die Zuweisung von Aufgaben und die Bestimmung bzw. Abgrenzung von Inhalten. Eine etymologische Bestimmung des Wortes ‚Didaktik‘ hilft nur wenig weiter. Der Begriff stammt vom gr. διδάσκειν, was so viel wie unterrichten, lehren, aber auch belehrt, unterrichtet werden, sich aneignen heißt. Das dazu gehörige Nomen δίδαξις bedeutet dementsprechend Lehre, Unterweisung, Unterricht. Im Vergleich zu den Bestimmungen, die von dem Wort Pädagogik ausgingen, können wir an dieser Stelle festhalten, dass es in beiden Fällen um eine absichtliche Veränderung von Menschen geht, und zwar dahingehend, dass sie sich Erscheinungen der Welt in neuer Weise oder neuen Erscheinungen der Welt zuwenden. Im Unterschied zum Pädagogischen richtet sich aber das Didaktische mehr auf bestimmte Formen und bestimmte Modi dieser Zuwendung: und zwar auf solche, die mit mehr oder weniger institutionalisierten Weisen der Interaktion und Kommunikation, also Lehren im Sinne von Unterricht, verbunden sind.
Zurückzuweisen ist insofern z.B. die Auffassung Wolfgang Rüdigers,
„die Vorstellungen, die wir uns von einem Stücke machen und die in dem Maße wachsen, in dem wir uns möglichst eindringlich um das Stück bemühen, es vielfältig erschließen, mit ihm ‚sprechen‘, seine Wesensart ergründen, wie es gemacht ist und warum“
seien didaktisch (Rüdiger, o. J., S. 2). Wir haben es hier mit einem Vorgang zu tun, bei dem Aspekte von ‚Lehre‘ und ‚Unterricht‘ keine Rolle spielen und den wir im Allgemeinen als Interpretation bezeichnen. Interpretation findet zwar in didaktischen Zusammenhängen statt: Etwa dann, wenn man einen Inhalt daraufhin untersucht, welche seiner Aspekte für Lehren und Lernen geeignet und sinnvoll sind; Interpretation aber mit Didaktik gleichzusetzen, führt zu einer Erweiterung des Begriffs, der ihn für musikpädagogische Zusammenhänge unbrauchbar macht.
Die Schwierigkeiten der Abgrenzung zwischen Musikpädagogik und Musikdidaktik zeigen sich in zwei Äußerungen des Musikpädagogen Karl Heinrich Ehrenforth. Er beschrieb 1977 die Aufgabe der Musikpädagogik – um sie von derjenigen der Musikdidaktik zu unterscheiden – folgendermaßen:
„So ist eine kooperative Arbeitsteilung zwischen Musikpädagogik und Musikdidaktik anzustreben, die dem gemeinsamen Ziel einer ‚Theorie der Musikerziehung‘ gewidmet ist. Der Musikpädagogik wären dann folgende Aufgaben zuzuordnen: a) die empirisch-sozialwissenschaftlich-psychologische Ermittlung der musikkulturellen Bedingungen und Voraussetzungen des Musiklernens (dies in enger Zusammenarbeit mit Musikpsychologie und Musiksoziologie) und b) die Aufarbeitung und Verarbeitung der von den anthropologischen und soziologischen Nachbarwissenschaften erzielten Erkenntnisse und Theorien, soweit sie für eine ‚Theorie der Musikerziehung‘ förderlich und von Nutzen sind. Der Musikdidaktik wäre aufgetragen a) alle Aspekte der unterrichtlichen Vermittlung von Musik zu bedenken und aufeinander zu beziehen und b) Zielvorstellungen musikalischer Bildung zu entwickeln, die ihre entscheidenden Maßstäbe aus der Antwort auf die Frage gewinnen muss, was die Musik als geschichtliches und gegenwärtiges Phänomen unaustauschbar und über die Offenheit allgemeiner Lernzielvorstellungen hinaus zur Personwerdung des Menschen beitragen kann“ (Ehrenforth, 1977, S. 98).