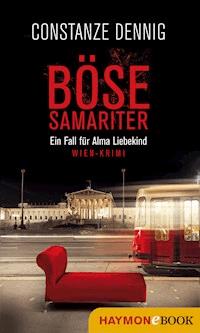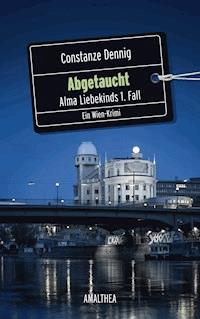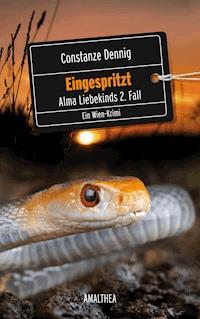
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Giftschlangen und verschwundene Leichen - Ein neuer Fall für Alma Liebekind Eine junge Turnusärztin stirbt im Wiener Allgemeinen Krankenhaus ohne ersichtlichen Grund - und das auch noch im Nachtdienst. Alma Liebekind, Psychiaterin mit einem Faible für mysteriöse Todesfälle, kann es nicht lassen - sie muss das Geheimnis klären, auch wenn die Polizei eine natürliche Todesursache vermutet. Ihre neugierige Mutter steht ihr bei diesem Unterfangen wieder tatkräftig zur Seite - mit wie immer ungewöhnlichen Strategien. Bald gibt es heiße Spuren: Hat das Verschwinden der Leichen zweier junger Frauen aus der Pathologie etwas damit zu tun? Die Suche nach Indizien und einer entflohenen Giftschlange treibt Mutter und Tochter bis nach New York. Auch in ihrem zweiten Fall muss Alma alle Register ziehen. Vieles ist anders, als es scheint. Denn die Lüge ist nur die Rückseite der Wahrheit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Constanze Dennig
Eingespritzt
Constanze Dennig
Eingespritzt
Alma Liebekinds 2. Fall
Ein Wien-Krimi
AMALTHEA
Ich danke Friederike Lenart für ihre wertvolle Mitarbeit und Franz Xaver Zach für seine Unterstützung.
Alle Namensnennungen und damit einhergehende Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig.
© 2015 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Elisabeth Pirker /OFFBEATümschlagfotos: © istock.com und Shutterstock.comLektorat: Martin BrunySatz: Gabi Adébisi-SchusterGesetzt aus der Sina Nova 10,1/13ISBN 978-3-99050-015-6eISBN 978-3-903083-03-5
1. Kapitel
Der Tote ist tot! Was kümmert es den Toten, ob er überhaupt, wie er, wann er und wo er verstorben ist? Oder gar, ob er von selber oder durch die Hand eines anderen gestorben ist. Nur uns Lebendige plagt die Wissbegier, das Rätsel eines Fremdverschuldens aufzuklären.
Diese Gedanken kreisen in meinem Kopf, während ich auf dem Weg in die Sensengasse zu Manfred Marchel, dem liebenswertesten Gerichtsmediziner von Wien, bin. Der ist nämlich so einer, der der Ansicht ist: »Die Lüge ist die Rückseite der Wahrheit.« Drum dreht er jede Wahrheit zumindest ein Mal um, bevor er sie glaubt. Denn wenn man der Wahrheit nicht glauben kann, soll man sich die Lüge anschauen. Die Wahrheit ist sowieso ein Konstrukt des menschlichen Gehirns und damit abhängig von der Stoffwechselsituation dieses Organs.
Mein Konflikt* mit Manfred, meinem – allerdings nur seelisch – intimsten Freund, liegt mir im Magen. Es ist ja so, dass auch die düsteren Ereignisse einer Hierarchie der Wichtigkeit unterliegen. Mit dem Fall Katz hatte ich andere Sorgen als Manfreds Liebesentzug, und dann waren Ferien, und dann war dies und dann war das; jedenfalls jetzt, wo der de la Menta sitzt und die Sommersonne die Wogen der emotionalen Sturmflut geglättet hat, möchte ich Manfred wieder versöhnen.
Wenn allerdings inzwischen wirklich ein Gspusi mit seiner Sekretärin läuft, dann wird es schwer werden, ihn herumzukriegen, denn Männer reden im ersten Liebeswahn immer der Geliebten nach dem Mund. Und die wird sich hüten, mich als ihre Gefühlsrivalin in Schutz zu nehmen. Na, schauen wir mal! Immerhin besuche ich ihn heute ausnahmsweise ganz ohne Hintergedanken. Ich will ja gar nichts von ihm, außer wieder seine, allerdings platonische, Freundin sein!
Je näher ich dem gerichtsmedizinischen Institut komme, desto nervöser werde ich. Ich krame in meiner Handtasche, um einen Kaugummi zur Stressabfuhr zu suchen, aber da findet sich zwar die Plastikverpackung meiner Marke, allerdings nur gefüllt mit den ausgelutschten Kaugummis, die ich aus Müllentsorgungsdisziplin da wieder verstaue. Ich werfe die Plastikverpackung mitsamt Inhalt in den nächstbesten Mistkübel und widerstehe der Versuchung, einen der ausgelutschten Spearmints zwischen meinen Kiefern zu recyceln. Es bleibt mir nichts anderes über, als den Anblick und den Geruch der Leichen ohne Minzgeschmack zu ertragen. Aber vielleicht ist der Professor ja auch in seinem Büro und nicht gerade beim Leichenzerschnipseln?
Er ist leider nicht in seinem Office. Hinter der zerkratzten Bürotür (der Lack scheint noch aus der Zeit der k.u.k. Monarchie zu stammen), die ich vergebens versuche, möglichst lautlos zu öffnen (das Institut kann sich scheinbar auch kein Schmieröl leisten), erblicke ich Manfreds Schreibtisch, auf dem sich die Akten türmen, hinter denen aber sein Kopf nicht – wie sonst üblich – aufblickt. Da er auch nicht rauchend vor dem Eingang zum Institut gestanden ist, kann er nur in der Prosektur bei den Toten sein.
Ich steige also die Stiegen in den Keller hinunter und öffne möglichst unauffällig die Tür zum Sektionsraum. Die quietscht übrigens nicht. Manfred steht mit dem Rücken zu mir, ein Skalpell in der rechten, in seiner anderen Hand den linken Arm einer Toten.
Als seine Sekretärin meiner ansichtig wird und mich zweideutig mit »Ah, die Frau Dr. Spanneck!« begrüßt (Spanneck sagt sie zu mir, da sie glaubt, dass das der Nachname meines Ehemannes ist), lässt Manfred vor lauter Schreck den Arm der Leiche fallen. Der baumelt nun seitlich neben der Metallbahre wie ein gräuliches Pendel hin und her, bis die Sekretärin ihn wieder pietätvoll auf die Bahre neben den nackten Körper der Frau legt.
Manfred dreht sich um. Er schluckt, ist betreten.
Ich auch. »Guten Morgen …«, sage ich, obwohl es sicher schon auf zwölf zugeht.
»Hm, Mahlzeit …«, meint er.
Die Sekretärin merkt, dass sie fehl am Platz ist und verzieht sich: »Ich geh jetzt, bin nebenan.«
»Was willst du?« Manfred tut ganz kalt.
»Ich, ich wollte, ich will nichts …«
»Und was sonst willst du, außer nichts? Hm?«
»Ehrlich, ich bin nur hier … wegen dir.«
»Das zahlt sich nicht aus. Weder werde ich mich umbringen, damit du noch einen Fall für deine psychiatrische Pseudowissenschaft hast, noch lasse ich mich von jemandem umbringen, damit du dich als Aufdeckerin im Pfusch profilieren kannst. Also?«
Als er das mit der »Aufdeckerin im Pfusch« sagt, muss ich mich kurzfristig zusammenreißen, dass ich nicht wieder kehrum durch die Tür mit allen meinen Entschuldigungsvorsätzen verschwinde. Habe ich nicht vor Kurzem einen Kriminalfall aufgeklärt, an dem die Polizei gescheitert wäre? Habe ich nicht dadurch einem armen Waisenkind erspart, für ein Almosen bei »Licht ins Dunkel« vorgeführt zu werden? Habe ich nicht gezeigt, dass das Bauchgefühl einer erfahrenen Psychiaterin mehr weiß als alle sogenannten Ermittlerprofis zusammen? Und habe ich nicht einfach wieder recht gehabt?
Ein Kaugummi wäre jetzt was Feines zum Draufbeißen und dann zum Frust runterschlucken. So schlucke ich nur meinen Speichel hinunter und sage mir: »Lass ihn mich runtermachen, dann hat er mir gegenüber das Gefühl der Überlegenheit und kann den Mann rauslassen. Das hilft ihm, seine testeronale Ehre wiederherzustellen.«
Ich nähere mich ihm einen Schritt, er weicht zurück. Ich mache noch einen Schritt auf ihn zu, um ihn mit meinem Zeigefinger an seinem linken Arm – dem ohne Skalpell – anzustupsen. Manchmal bewirkt nämlich ein winziger Körperkontakt mehr als tausend Worte.
Manfred hebt wie panisch abwehrend beide Hände. Wir umkreisen die Metallbahre mit der nackten Frauenleiche: Dr. Marchel mit hoch erhobenen Händen, ich mit ausgestreckten Armen. Manfred rückwärts, ich vorwärts auf ihn zu.
Als ich nach einer dreiviertel Umrundung direkt vor den Füßen der Toten zu stehen komme, lese ich auf dem Schild, das am rechten großen Zeh befestigt ist: »Dr. Lea Sibjesky.« Sibjesky …, Sibjesky …, Sibjesky …? Den Namen kenne ich. Ich starre auf den großen Zeh der Leiche und stoppe meinen Freundschaftsangriff auf Manfred.
Jetzt bleibt auch er stehen. Hat wohl bemerkt, dass meine Aufmerksamkeit von ihm abgelenkt wurde und nun auf den weißen Fuß der Dame gerichtet ist. Das scheint ihm auch nicht zu gefallen. »Die ist tot …«, meint er aufschlussreich. »Das ist meine Leiche!«
Ich wende mich ihm wieder zu. Nicht, ohne den Namen Sibjesky in meinem Hirn zu speichern, um später nachgrübeln zu können, woher ich ihn kenne. Ich lege ihn unter »Sibirski«, nur »je« statt »ir«, ab. Sibirski ist leicht zu merken, denn Leiche und … kalt. »Ich, ich … Ach Manfred, sei wieder gut!« So, jetzt ist es heraus. So eine Entschuldigung fällt einem gleich viel leichter, wenn man zwar in bester Absicht, aber dann doch auch durch ein Begehr motiviert, seinen Stolz überwindet. Ich möchte mehr über die tote Dame erfahren. Tja, meine Neugierde!
Manfred ist irgendwie gerührt. Jetzt macht er einen Schritt auf mich zu, und ich muss mich beherrschen, nicht einen Schritt zurückzuweichen. Das wäre keine passende Botschaft bei einer Versöhnung. Gott sei Dank verkneift er es sich, mir unanständig übers Gesäß zu streifen, sondern nimmt mich einfach nur freundschaftlich in den Arm und drückt mich an sich – ganz brüderlich. »Siehst du ein, dass du mich ausgetrickst hast?«
Ich nicke und schaue recht schuldbewusst drein.
»So, aber heute kannst du mir ein Mittagessen nicht verweigern.«
Da die Leiche ja ganz appetitlich ist (ein jugendlicher Frauenkörper) und noch nicht stinkt, ekelt mich nicht und ich werde wohl auch eine Mahlzeit ohne Grausen überstehen. Außerdem kann ich dann ja vielleicht und überhaupt und so nebenbei was über die Sibirski, nein, – je –, Sibjesky erfahren.
Manfred führt mich zum Essen ins »Rebhuhn« in der Berggasse. Das ist sein Lieblingslokal, zumindest zu Mittag. Wo er abends am liebsten hingeht, weiß ich nicht. Und ich frage auch nicht, denn sonst muss ich abends auch noch mit ihm essen gehen. Am Weg in die Berggasse queren wir das Areal des alten AKH, in dem sich der Narrenturm befindet. Ich liebe den Narrenturm! Kein auswärtiger Besucher sollte sich diese Sensation entgehen lassen, vor allem dann nicht, wenn er ein Faible fürs Makabre hat.
Manfred und ich haben schon beruflich bedingt eine Vorliebe fürs Makabre! Wir steigen die Stiegen von der Sensengasse zum Narrenturm hinauf, passieren das kleine Eingangsportal, das noch immer durch eine verwitterte grobhölzerne Türe verschlossen wird, die wahrscheinlich schon Joseph II. hat einbauen lassen. Wir bleiben beide gleichzeitig stehen, schauen uns an, drehen uns um, fixieren das Schild mit den Öffnungszeiten und deklamieren gleichzeitig: »Da müssen wir aber auch bald wieder einmal hin …«
»Am Samstag zu Mittag, da können wir dann auch gleich anschließend essen gehen«, meint Manfred.
Wie kann ein Mensch immer nur ans Essen denken? »Missgeburten, ja. Essen, nein!«, meine ich.
In diesem pathologischen Museum sind meine Favoriten – nämlich fehlgebildete Föten in Formaldehyd, und da wiederum eingelegte Lithokelyphopädien, das sind im Mutterleib versteinerte Embryos – ausgestellt. Ein Psychoanalytiker würde daraus sofort Schlüsse auf einen unerfüllten Kinderwunsch ableiten. Ich schließe daraus, dass ich Leibesfrüchte hinter Glas einer Leibesfrucht in meiner Gebärmutter vorziehe.
Manfred steht auf Moulagen, denn wie sein großes Vorbild Rudolf Maresch, ein Pathologe, der sich dadurch auszeichnete, dass er »das Schöne im Krankhaften« sah, schätzt er die künstlerische Qualität hinter diesen Wachsmodellen.
Jedenfalls verbindet uns die Liebe zum Narrenturm und zu seinem Inhalt. Wenn heute Mittwoch wäre, hätte ich Manfred überredet, statt ins »Rebhuhn« in den Narrenturm zu gehen. So aber marschieren wir über die Währinger Straße die Berggasse hinunter zum »Rebhuhn«.
Da im Gastgarten kein Platz mehr frei ist, setzen wir uns hinein. Im Sommer bekommt man in den Restaurants drinnen ja immer einen Platz, umso mehr im Altweibersommer, wo jeder noch ein bisschen Sonne tanken will. Gähnende Leere, das ganze Lokal für uns beide allein. Herrlich! Nur an einem Tisch sitzt ein Mann, Shorts und T-Shirt bedruckt mit »Visit Rockaway« – das lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es sich um einen Amerikaner handelt.
Wir Europäer unterscheiden uns von den Amerikanern vor allem durch unsere Vorliebe, selbst unter widrigsten Wetterbedingungen unsere Mahlzeiten unter freiem Himmel zu verspeisen. Das kommt Amerikanern anscheinend völlig abwegig vor, da sie es selbst bei strahlendem Sonnenschein vorziehen, in einem zugigen, unterkühlten, finsteren Raum zu essen. Immerhin hat unser Nachbar im »Rebhuhn« wenigstens ein Dach über dem Kopf, wenn auch keine Klimaanlage. Das wird seine Meinung über »Good old Europe« bestärken, wo die Menschen noch so rückständig sind, dass sie die Jahreszeiten ohne künstliche Temperaturregelung aushalten müssen.
»Hättest du gern eine Klimaanlage?«, frage ich Manfred, während wir uns setzen.
»Wieso? Ich habe es sowieso immer kalt.«
Er versteht nichts.
Ich nicke in Richtung Ami: »Weil der sicher hier leidet.«
Ich setze mich absichtlich mit dem Rücken zum Amerikaner, da ich vermute, dass ich ihn sonst immer anstarren würde. Dabei ist gar nichts Interessantes an dem, außer, dass er der einzige Gast inside und vermutlich kein Wiener ist. Der Mann ist auch gar nicht attraktiv: zu dicklich von zu vielen Burgern, beginnende Glatze, im Gesicht Narben, vermutlich von einer abgeheilten, aber schlecht behandelten Akne. Ich schätze circa in meinem Alter. Trotzdem, irgendwas hat er an sich, dass ich mich mit ihm beschäftige.
Manfred bemerkt das: »Gefällt dir der?«
»Wie kommst du darauf?«
»Na, weil du dich immer umdrehst.«
»Ich suche die Kellnerin. Bin durstig.«
Manfred steht auf, um die Kellnerin zu suchen.
»Was willst trinken?«
»Ein Mineral-Zitron.«
Da Manfred Richtung Theke marschiert, kann ich unauffällig so tun, als ob ich ihm nachschauen würde, dabei interessiert mich nur, was der Ami isst und trinkt. Auf seinem Teller glaube ich – zumindest aus der Entfernung – Eiernockerl zu erkennen, dazu trinkt er ein Glas Bier. Eiernockerl? Das ist komisch. Ein echter Amerikaner kennt keine Eiernockerl, der würde ein Schnitzel bestellen, oder Gulasch oder eben Tafelspitz – vom Kellner empfohlen.
Während der vermeintliche Amerikaner die Nockerl mit der Gabel in den Mund schiebt, blättert er mit der linken Hand in einem Buch. Wird ein Reiseführer sein, oder ein Comic? Jemand, der ein T-Shirt mit »Visit Rockaway« trägt, ist sicher ein Comicfan.
Als Manfred zurückkommt, stehe ich auf und tue so, als ob ich aufs Klo müsste.
»Magst nicht vorher bestellen, sie kommt gleich.« Man sieht ihm an, dass er schon sehr hungrig ist.
»Ich nehme die Eiernockerl und einen Salat.«
»Woher weißt du, dass es Eiernockerl gibt?«
Ich deute mit meinem Daumen in Richtung Ami: »Der hat welche …« Dann spaziere ich langsam Richtung Klo.
Vor dem Tisch des Amerikaners bleibe ich stehen und deute auf die Speisekarte, die da liegt: »May I?«
Er nickt mit vollem Mund. Das gibt mir die Gelegenheit, einen Blick auf das geöffnete Buch zu werfen. Ich registriere, dass es sich um medizinische Literatur handeln muss, denn als Headline steht: »Pulmonary hypertension …«
Also ein Arzt. Vermutlich Internist oder Lungenfacharzt, wahrscheinlich auf einem Pulmologenkongress in Wien. Ich nehme die Speisekarte und bewege mich wieder Richtung unseres Tisches. Dort lege ich die Karte Manfred vor die Nase. Der schaut erfreut auf: »Sehr aufmerksam, meine Liebe!«
Ich erinnere mich, dass ich ja aufs Klo wollte und drehe mich wieder um, um noch einmal am Tisch des Fremden vorbeizugehen. Der steht gerade auf, um zu gehen. Langer, gedrungener Oberkörper, kurze O-Beine, behaart, registriere ich, während er sein Buch in eine Herrenhandtasche packt, zwanzig Euro aus einer seiner Hosentaschen herausholt und auf den Tisch legt.
Ich lächle ihn verlegen an: »Bye!« Und öffne die Klotüre.
Er nickt, ohne sein Gesicht zu verziehen.
Als ich vom Klo zurückkomme, ist der Manfred gerade dabei zu bestellen: »Ein Mal Eiernockerl mit Salat, ein Mal den Schweinsbraten mit Kraut.«
»Entschuldigung«, meine ich zur Kellnerin, »kann ich statt dem grünen Salat einen Tomatensalat haben?«
»Kein Problem«, meint sie.
Manfred schiebt mir das Soda-Zitron hin und prostet mir mit seinem Bier zu: »Auf uns!«
»Auf uns!?« Was soll das heißen? Ich touchiere sein Krügel mit meinem Glas: »Prost!« Dann nehme ich einen großen Schluck vom Soda. Als ich hinuntergeschluckt habe, verkrampft sich meine Gesichtsmuskulatur, da der Zitronensaft darin so sauer ist.
Manfred lacht spöttisch und setzt sein Bier an die Lippen, um kräftig anzusaugen. Als er das Krügel absetzt, seufzt er zufrieden: »Was gibt es Besseres als ein kaltes Zipfer an einem letzten Sommertag in Gesellschaft einer schönen Frau.«
Nachdem die Kellnerin unser Essen gebracht hat, ist erst einmal Funkstille. Manfred isst. Ich möchte ihn nicht stören, drum hebe ich mir die Frage nach der Sibjesky für später auf: »Ist dein Schweinsbraten gut?«
Manfred wiegt seinen Kopf: »Könnte ein bisschen fetter sein.« Er schluckt hinunter und legt Gabel und Messer an den Rand seines Tellers. »Ich verstehe nicht, wieso die jetzt alle Sauen mager züchten!« Dabei tunkt er seine Gabel vorwurfsvoll in die Bratensauce, die tatsächlich kaum Fettaugen hat.
»Lass mich kosten …«, sage ich und ziehe seinen Teller ein kleines Stück zu mir. Dann schneide ich mir ein Stück vom Fleisch ab. »Schmeckt herrlich. Saftig, zart, die Haut knusprig. Ich weiß gar nicht, was du hast?«
Manfred schiebt mir seinen Teller ganz hin: »Kannst haben.«
Ich schiebe das Essen wieder zurück: »Danke, ich habe schon meine Nockerl.«
Er seufzt und langt wieder zu: »Mir geht dieser Cholesterinwahn so was auf die Nerven. Als wenn wir nicht alle sowieso sterben müssten.«
Ich begreife: Manfred hat schlechte Fettwerte, darum das Protestverhalten beim Essen. »Reden wir über was anderes. Die junge Frau da, ich meine die Leiche, was hat denn die?«
Manfred wirft sein Besteck unmutig in den Teller, sodass die magere Sauce auf sein Hemd spritzt. Er nimmt die Serviette und versucht, die Patzer abzuwischen. »Jetzt hast mir aber wirklich endgültig den Appetit auf den eh schon zu mageren Schweinsbraten verdorben.«
Ich hebe abwehrend meine Hände vor meine Brust: »Oje, hab ich wieder was Falsches gesagt? Ich wollte dich doch nur von deinem Cholesterin ablenken. Mit was Beruflichem.«
Manfred verdreht die Augen: »Das ist dir gelungen. Du hast ein Feingefühl wie ein Stein. Ehrlich. Zuerst kommst du, um dich mit mir zu versöhnen. Ich freue mich. Dann stierlst du in meinen Laborwerten herum und verdirbst mir den Appetit, und jetzt legst noch eins drauf und erinnerst mich an dieses arme Mädel.«
Ich streichle ihm zur Beruhigung über die rechte Hand, die gerade wieder das Messer fassen will. Leider ist der Messergriff voller Sauce und bekleckert seine Finger.
Manfred lässt pikiert das Messer wieder in den Teller plumpsen, und diesmal spritzt die Sauce auf meine Hand. Da alle Servietten angebraucht sind (wieso sind die Gasthäuser mit den Servietten auch immer so knausrig?), muss ich mir die Flüssigkeit von den Fingern lecken.
Das lenkt ihn ab und stimmt ihn friedlich, ja es stimuliert offenbar seine Begehrlichkeit etwas anderem gegenüber als dem Essen. »Ein schönes Zünglein hast du …«, meint er zweideutig und hält mir zum Spaß auch seine Finger hin. Die wische ich ihm dann aber nur mit einem Eck meiner angepatzten Serviette ab. Daraufhin zieht er seine Hand sofort wieder zurück.
»Wieso ist das ein armes Mädel?«, bemerke ich beiläufig, obwohl ich vor Neugierde beinahe platze.
»Erzähl ich dir gleich. Aber vorher bestell ich mir Palatschinken. Zum Trost.« Während wir auf die Nachspeise warten – ich schon unruhig, da meine Ordination in einer Dreiviertelstunde beginnt –, fängt Manfred an zu erzählen: »Das Mädel ist eine Turnusärztin, die haben sie mir von der Patho angeliefert. Die konnten sich über die Todesursache nicht klarwerden. Jetzt soll ich schauen, ob ein Fremdverschulden vorliegt.«
»Aber die ist doch noch gar nicht aufgemacht worden?«
»Nein, der Staatsanwalt hat gleich ein gerichtsmedizinisches Gutachten haben wollen.«
»Wieso?«
»Blöde Geschichte. Man hat sie tot im Dienstzimmer beim Nachtdienst aufgefunden. War vorher nicht krank.«
Und jetzt, als Manfred das Dienstzimmer und den Nachtdienst erwähnt, funkt es in meinem Gehirn. Sibjesky! Ilse Sibjesky! Das ist schon lange her. Ilse und ich auf der Chirurgie, in meinem ersten Turnusjahr, in Schärding. Die schöne Ilse, die fleißige Ilse, die Streber-Ilse. Was nur aus der geworden ist? Die habe ich ganz aus den Augen verloren, nachdem ich aus Schärding weggegangen bin, um meine Facharztausbildung zu machen. Und so gut war ich auch wieder nicht mit ihr, um mit ihr weiter Kontakt zu pflegen. Die war nicht in unserer Jungärzte-»Happy Pepi Fortgeh- und Feierclique« drin. War eher eine von den »braven« Kollegen, das heißt, eine von jenen, die nach einem Nachtdienst geschlafen und sich nicht wie wir, trotz Müdigkeit, gleich wieder die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Grauslich, wenn das ihre Tochter wäre. »Ist ihre Mutter eine Kollegin? Mir kommt der Name bekannt vor …«
Ach Gott, jetzt habe ich mich verraten. Ich soll ja gar nicht wissen, wie das Mädel heißt. Doch Manfred fällt das mit dem ausspionierten Namen gar nicht auf, da die Palatschinken im Anmarsch sind. Er zuckt die Achsel: »Das weiß ich nicht. Reicht schon, dass die arme Kleine das schreckliche Medizinstudium umsonst absolviert hat.«
Die Kellnerin stellt uns umsichtig einen zweiten Teller und ein zweites Besteck hin: »Für die Gattin …«, meint sie.
Manfred schaut bedauernd zu ihr auf: »Leider nein.«
»Was meinen die von der Internen?«
Manfred mampft unverständlich über seinem Teller, das Schlagobers bedeckt seine Mundwinkel, aber er schaut glücklich aus. »Könnte eine Tako-Tsubo-Kardiomyopathie sein.«
»Was?«
»Eine Tako-Tsubo-Kardiomyopathie.«
»Hm?«
»Tschapperl, ungebildetes! Das ist ein sogenanntes Broken Heart Syndrom. Hat aber nur bedingt mit der Psyche zu tun. Ist eine Stress-Kardiomyopathie.«
Ich schüttle den Kopf: »Noch nie gehört.«
»Tja, da würde ich der Frau Doktor empfehlen, sich besser fortzubilden.«
»Hör auf, sonst fange ich an, über unsere Fortbildungsveranstaltungen zu schimpfen, und dann sitzen wir morgen noch da. Aber wieso ist die Leiche nicht auf der Patho?«
»Weil der Staatsanwalt einen Verdacht hat. Ich soll schauen, ob sie vergiftet wurde.«
Ich lege meine Hand auf meinen Bauch: »Pff, ich bin voll.«
»Aber geh, hast eh alles stehen lassen. Drum bist so dünn.«
»Ich weiß, dass du mir das nicht erzählen wirst, aber ich frage dich trotzdem. Warum soll sie vergiftet worden sein?«
»Richtig vermutet! Das erzähle ich dir sicher nicht.«
Ich schaue auf die Uhr und tue panisch. Ich stehe auf, zücke meine Geldbörse, lege zwanzig Euro auf den Tisch und küsse Manfred auf die Wange: »Mutter wartet in einem vollen Wartezimmer. Jetzt werde ich sowieso schon Schläge von ihr bekommen.«
Dann drehe ich mich um und renne Richtung Ausgang des Lokals. Ich höre noch: »Samstag, Narrenturm?«
Ich drehe mich kurz um, werfe ihm eine Kusshand zu und schreie zurück: »Ja! Wir telefonieren.«
Am Weg Richtung Ordination durch meine geliebte Servitengasse – die erinnert mich immer an Paris – google ich schnell mal die Ilse Sibjesky. Da mein Blick auf das Display meines Smartphones gerichtet ist, übersehe ich den Blumenstock, der vorm Floristen auf dem Gehsteig steht, und stolpere drüber. Und da liegt er nun, der Rosenstock, inmitten der am Gehsteig verteilten Erde. Ich selber fange mich im letzten Moment noch, um nicht auch draufzufallen. Bis auf Dornen in meinem Schienbein und einer blutenden Wade ist nichts passiert.
Der Blumenhändler schießt aus seinem Geschäft: »Oh, haben Sie sich verletzt?«
Ich begutachte gerade meinen Unterschenkel. »Nichts passiert … Ich habe nicht geschaut. Tut mir leid!«
Er kniet vor mir nieder, um die Wunden zu begutachten, und ruft nach seiner Mitarbeiterin: »Manuela, hol den Verbandskasten!«
Da sich rund um uns schon eine kleine Traube an Passanten gebildet hat, trachte ich danach, den Ort meines Waterloos so schnell wie möglich zu verlassen. »Keine Ursache, ich … ich bin gleich zu Hause.«
Der Blumenhändler will mich festhalten, um mich in sein Geschäft zu drängen, aber ich schüttle ihn ab: »Es ist nichts passiert. Meine Schuld … Sie wissen, das Handy … Ich muss weg. Ich zahle den Blumenstock. Danke …« Ich ziehe meine Geldbörse aus der Handtasche, um ihm die Rose zu erstatten.
Doch er lenkt zum Glück meine Hand mit dem Portemonnaie (keine Geldscheine drin, nur Münzen) wieder in die Tasche zurück. »Kommt nicht infrage. Ich müsste zahlen! Schmerzensgeld.«
Er schenkt mir den Rosenstock, der neben dem Umgeworfenen stand – dieser allerdings mit rosa Blüten: »Als kleinen Trost …«
Mit blutender Wade, unter dem linken Arm den schweren Blumenstock, über der rechten Schulter meine Tasche und in der rechten Hand das Handy humple ich Richtung Ordination. Und was hat sich in der Zwischenzeit auf das Display meines Smartphones geladen? Ilses Website mit ihrem Foto. Ilse leicht gealtert, aber immer noch schön, lächelt mich patientenfreundlich an. Dr. Sibjesky hat eine augenärztliche Ordination und ein Kontaktlinseninstitut in Groß-Enzersdorf.
In meiner Praxis das gewohnte Bild: Mutter in der Rezeption sitzend, umringt von einer Schar ungeduldig wartender Menschen, die sie durch unterhaltsame Geschichten in Schach hält: »Blödsinn, die Mondphasen haben gar nichts mit den Schlafstörungen zu tun. Der Mond ist ein Trabant der Erde und kein Wecker. Dann müsste es auch die Saturnmondeschlafstörung und die Jupitermondeschlafstörung und die … Egal, es gibt Milliarden Monde, dann dürfte keiner mehr schlafen!«
Mutter unterbricht, als sie meiner ansichtig wird, mustert mich von oben bis unten. Ihr Blick bleibt an meiner blutverschmierten Wade hängen, dann fixiert sie den Blumenstock, steht auf, umarmt und küsst mich. Wie peinlich – vor all den Leuten! Schließlich wendet sie sich ihrem Publikum zu und verkündet: »So ist es, mein Kind! Vergisst nicht einmal auf meinen Namenstag!«
Sie entreißt mir die Rose und stellt sie auf ihren Schreibtisch, nicht ohne vorher ein Blatt unterzulegen, damit der Tisch nicht schmutzig wird. Ich verstehe gar nichts mehr. Wir feiern doch gar keinen Namenstag, und ich weiß auch gar nicht, wann Martha gefeiert wird.
Mutter hat jedenfalls ihren Auftritt, das Publikum ist begeistert. Bei so einer Tochter ist man als Patient bestens aufgehoben! Bei dieser töchterlichen Fürsorge wird man als Leidender wohl auch über alle Maße befürsorgt werden. Eine exorbitante Vorgabe, der ich sicher nicht entsprechen kann.
Mutter schiebt mich in meinen Behandlungsraum. Drinnen packt sie eine Pinzette und einen Tupfer mit Desinfektionsmittel, deutet mir, mich zu setzen, und drückt mir den Alkoholtupfer auf meine Wunden am Schienbein.
»Hast du dir den Rosenkranz da reingestochen?«
Ich seufze laut auf: »Bitte Mama, wir müssen anfangen.«
Sie versucht, mit der Pinzette die Dornen zu entfernen, scheitert aber, da sie zu schlecht sieht.
»Ich mache das schon selber! Danke.«
»Wo hast du die Rose her? Und wozu?«
»Hast du doch gerade erst verkündet. Dein Namenstag.«
»Ich habe am 29. Juli Namenstag, und das ist mir auch wurst. Musste doch was erzählen, wenn du blutüberströmt reinkommst.«
»Na, so blutüberströmt auch wieder nicht. Wäre gar niemandem aufgefallen, wenn du nicht so ein Bahö daraus gemacht hättest.«
»Was ist passiert?«
»Ich bin über einen Blumenkübel gestolpert, der vor der Auslage des Blumenhändlers stand. Dann hat er mir zum Trost den anderen geschenkt.«
»Oh Gott, so alt und immer noch ›Hans guck in die Luft‹.«
Ich lache: »Nein, nicht ›Hans guck in die Luft‹, sondern ›Hans guck ins Handy‹!«
»Google? Recherche? Mord?«
»Nein, keine Sorge, nur das Wetter.«
Mutter nickt ungläubig: »Das Wetter. Aha, das Wetter …«
Ich drücke sie von meinem Schienbein weg: »So, jetzt fangen wir endlich an!«
Als sie draußen ist, schreibe ich auf einen Notizzettel, den ich mir neben meine Tastatur klebe: »Stachel entfernen.« Ich weiß, dass ich auf so was immer vergesse und das Zeug dann rauseitert.
Ein Ordinationsnachmittag ohne Zwischenfälle, weder besonders ärgerlich noch besonders erfreulich. Routine! Fachfremde Personen stellen sich den Arbeitstag eines Psychiaters immer sehr aufregend vor. Sie glauben, dass sich der Einblick in Menschenschicksale und -seelen wie ein Krimi in den Kopf des Behandlers schreibt. Ist aber nicht so! Die meisten Lebensgeschichten liefern nicht einmal den Spannungsbogen eines üblichen Wetterberichts. Hurrikans sind eben selten. Und ein Tränenhochwasser überflutet meinen Schreibtisch auch nicht ständig. Ich ziehe sowieso den Schnürlregen vor.
Nachdem der letzte Patient draußen ist, kommt Mutter herein. Sie schaltet die starke Vergrößerungslampe, die neben meiner Therapieliege steht, an, nimmt aus der Lade meines Instrumententischs eine Lupe und deutet mir mit strenger Miene, mich auf meine Behandlungsliege zu legen: »Jetzt!«
Ich schließe die Augen und schüttle den Kopf: »Nein, ich mach das selber.«
»Na, dann mach! Aber jetzt. Sonst entzündet sich das.«
»Wenn du draußen bist!«
»Ich assistiere dir.«
Sie nimmt die Pinzette, besprüht sie mit Desinfektionsmittel und drückt sie mir bedeutungsvoll in die Hand.
Ich gebe nach, setze mich im Langsitz auf meine Liege und beginne, an meiner Wade herumzustochern.
Da es nicht eine dieser Rosen ist, die so wie Teerosen große Dornen hat, sondern es sich um ein Exemplar mit gemeinen kleinen, kaum sichtbaren Stacheln handelt, schaffe ich nicht alle Einstiche. Ich begnüge mich mit den leicht herausoperierbaren Nadeln, merke aber, wenn ich mit dem Zeigefinger darüberstreiche, dass sich da noch einige in meiner Haut verhakt haben. Vor Mutter tue ich so, als ob ich alle erwischt hätte. »Fertig!« Ich drücke ihr die Pinzette in die Hand.
Sie hält die Lupe vor ihr rechtes Auge und kontrolliert, dann deutet sie auf einen Einstich. »Da ist noch was …«
Ich streiche drüber und verneine, obwohl ich spüre, dass da noch was ist. Aber ich habe keine Zeit mehr. Ich möchte Ilse noch telefonisch in ihrer Ordination erreichen. »Du irrst dich, ich spür nix mehr.«
»Wirst sehen, das fängt zu eitern an.«
»Und wenn schon, die kommen von selber wieder raus. Mach dir keine Sorgen.« Ich hüpfe von der Liege, küsse sie auf die Wange, packe mein Handy und die Handtasche und flüchte aus meinem Sprechzimmer. »Baba!«
Sie schaut mich vorwurfsvoll fragend an.
»Verabredung … Michael.« Wunderbar, wenn man seinen Liebhaber immer als Ausrede gebrauchen kann. Was tät ich ohne Michael?
Kaum stehe ich vor dem Haus, wähle ich Ilses Ordinationsnummer.
Anrufbeantworter: »Guten Tag. Die Ordination ist wegen eines Todesfalls geschlossen. Nächste reguläre Sprechstunde am dreißigsten September. Danke und auf Wiedersehen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Augenklinik.«
Das hätte ich mir denken können. Wer würde schon arbeiten, wenn gerade das Kind verstorben ist? Immerhin bin ich mir jetzt sicher, dass die Tote ihre Tochter ist. Aber wie komme ich zu Ilses Privatnummer? Mail! Ich schreibe eine Mail, vielleicht habe ich Glück.
»Liebe Ilse! Erinnerst du dich noch an mich?«, das klingt zwar blöd, aber was soll ich sonst schreiben? »Wir waren zusammen in Schärding, Turnus. Ich habe zufällig vom Tod deiner Tochter erfahren. Das hat mich sehr erschüttert. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir meine Schulter zum Ausweinen anbieten möchte. Alma.« Entweder sie reagiert oder eben nicht.
Dann spaziere ich in Richtung sechsten Bezirk, zu Michael. Es ist ein strahlender, schon ein wenig an den Herbst gemahnender Sommertag, die Gastgärten sind voll, die Menschen wirken zufriedenaufgekratzt. Die Innenstadt ist voller Touristen, denen der Wettergott Glauben macht, dass Wien nur aus Walzer- und paradiesischer Weinseligkeit besteht. Jedenfalls freut das die Wirte, denn heute wird der Wein in Strömen fließen, und das vom Alkohol vernebelte Hirn wird glauben, dass es den Himmel auf Erden gibt. Diesen Zustand strebe ich heute Abend gemeinsam mit Michael auch an.
Ich bin gerade am Graben, als mein Handy vibriert. Eine Mail! Eine Mail von Ilse.
»Liebe Alma, das ist sehr freundlich, dass du dich meldest. Ich wollte dich schon kontaktieren, da ich weiß, dass du auch Gerichtsgutachterin bist. Leas Todesursache ist unklar, und ich wollte dich um deine Meinung fragen. Hast du Zeit? Ilse.«
Augenblicklich Konflikt in meinem Kopf. Glückseliger Abend mit Michael oder armseliger Abend mit Ilse?
»Du musst dich entscheiden«, befiehlt mein Über-Ich, das sich im Kampf mit meinem Es befindet.
Der Kampf dauert nur kurz, dann ich tippe in mein Handy: »Café Korb in zehn Minuten?«
»Zwanzig Minuten. Ilse«
Ich biege links zum Petersplatz Richtung Brandstätte ein. Und es geschieht ein Wunder. Justament als ich beim Café Korb ankomme, wird ein Tisch frei, und ich gewinne den Fight um einen Platz gegen ein japanisches Touristenpaar, weil ich denen ein »Reserved« entgegenschleudere.
* Siehe »Abgetaucht. Almas Liebekinds 1. Fall«. Amalthea Verlag, 2014
2. Kapitel
Was es heißt, einen Tisch im Gastgarten eines beliebten Wiener Innenstadtkaffeehauses an einem Abend, an dem jeder anscheinend glaubt, dass er den letzten Sonnenuntergang seines Lebens erlebt, verteidigen zu müssen, spüre ich hautnah. Rund um mich sitzen die Leute beinahe aufeinander, nur ich residiere privilegiert mit drei Sesseln – noch dazu zwei davon unbesetzt – in bester Kaffeehauslage. Das weckt Aggressionen. Berechtigt! Trotzdem verweigere ich anderen Gästen, sich zu mir zu setzen oder auch nur einen Sessel abzuzweigen. Als ich Ilse, von der Peterskirche Richtung Café hetzend, wahrnehme, springe ich auf und winke, um auf mich aufmerksam zu machen.
Ich hätte sie sofort erkannt, auch ohne das Foto auf ihrer Website. Noch immer die gleiche Frisur, halblang, brünett (jetzt wohl gefärbt), die Welle auf der Schulter korrekt nach außen geföhnt. Das beige Businesskostüm ähnelt der Privatkleidung, die sie schon in Schärding getragen hat – wohl jetzt sehr viel teurer. Mit der zu den roten Schuhen passenden roten Handtasche als Blickfang sieht Ilse wie eine richtig erfolgreiche Ärztin aus. Ist sie wohl auch! Eine würdige Vertreterin ihres Berufsstandes! Im Gegensatz zu mir, die ich beschämt auf meine blutverschmierte Wade hinunterblicke, über der ein schlecht gebügelter Rock zipfelt. Vielleicht sollte ich doch mehr auf meine Freundin Erika hören?
Ilse scheint sich über unser Treffen zu freuen: »Servus! Gut schaust aus …«, begrüßt sie mich.
Ich nehme ihre Hand und schließe sie zwischen meine beiden Handflächen ein: »Es tut mir so leid. Ich, ich, ich wusste nicht … Wir haben uns aus den Augen verloren … Tja, die Zeit … Das Schicksal …«
Ilse rettet mich davor, noch mehr belangloses Blabla auszuspucken. Auch ein Psychiater ist nur dann ein Profi im Trösten, wenn es nicht um persönliche Beziehungen geht. Das Bild der nackten, jungen Frauenleiche, jetzt dieser Mutter, mit der ich einige Zeit meines Lebens verbrachte, zugeordnet – das löst in mir plötzlich so was wie einen persönlichen Schmerz aus. Ich spüre, dass meine Augen nass werden. Ehrlich, die Geschichte geht mir nahe.
Ilse spürt das, denn sie umarmt mich spontan.
Um zu verhindern, dass alle Leute im Gastgarten auf uns starren, ziehe ich Ilse Richtung Eingang des Cafés: »Setzen wir uns rein, da sind wir allein.«
Ilse geht vor, ich packe meine Handtasche von einem Sessel und schiebe den anderen Stuhl zum Nachbartisch, vor dessen Gästen ich ihn eben noch verteidigt habe: »Bitte schön …«
Der Mann schaut mich erstaunt an und schüttelt den Kopf: »Jetzt haben wir schon einen …«
»Na, dann eben nicht …« Ich schiebe den Sessel wieder zurück und folge Ilse hinein. Verdammt noch mal, bin ich eines dieser Lebewesen in Wien, das den letzten gefühlten Sonnenuntergang seines Lebens aus Pietät innen drinnen im Café verbringen muss?
Im »Korb« gibt es immerhin keine Klimaanlage. Wir setzen uns an einen Tisch ganz im Eck gegenüber dem Eingang. Da hätte man keine Zuhörer, selbst wenn es Leute drinnen gäbe. Ilse trinkt einen Tee, ich bestelle noch einen Spritzer; den ersten habe ich draußen vergessen. Wir schweigen.
Ilse rührt in ihrer Tasse, und ich versuche eine professionelle Haltung einzunehmen, sprich zu warten, bis mein Gegenüber reden möchte. Da Geduld nicht so meine Stärke ist, unterbreche ich unprofessionell als Erste die Stille: »Wie hältst du das aus?«
Ilse schluckt, drückt ihre Verzweiflung durch den Kehlkopf in Richtung Speiseröhre, blickt mich an, schließt die Augen und schlägt mit der Hand auf den Tisch, dass der Teelöffel auf den Boden springt.
Ich bücke mich und lege ihn wieder auf die Untertasse.
»Gar nicht …«
»Nimmst du was?«, frage ich, denn Tranquilizer sind in so einer Situation ein Segen.
Sie nickt: »Drei Mal ein Lexotanil …«
»Passt! Solltest aber auch einen SSRI dazu nehmen. Weißt eh, die Abhängigkeit.«
Sie schaut mich entgeistert an: »Weißt du, wie egal mir das ist?«
Klar, mir wäre das an ihrer Stelle auch egal. Kind tot, und eine so blöde Kuh wie ich redet über Abhängigkeiten.
»Die Lea war perfekt! Nie ein Problem mit ihr. Ich habe immer gesagt: Mit Lea hab ich so ein Glück, das habe ich nicht verdient. Jetzt muss ich für dieses Glück bitter bezahlen.«
»Hast du noch mehr Kinder?«
Ilse schüttelt den Kopf: »Ich habe nichts mehr außer der Ordination.«
»Schrecklich!«
»Ich möchte nur noch wissen, an was sie gestorben ist, und dann bring ich mich um.«
»Sie war doch nicht krank, oder?«
»Topfit …«
»Was vermutest du?«
»Keine Ahnung, sie sagen Tako-Tsubo-Kardiomyopathie. Das glaube ich nicht, eine Ausrede. Sie vermuten was anderes, sonst wäre sie nicht sofort auf die Gerichtsmedizin gekommen. Ich bekomme keine Auskunft, nur Herumgerede. Drum bin ich froh, dass du dich gemeldet hast.«
»Der Chef der Gerichtsmedizin ist mein Freund, drum weiß ich von deiner Lea.«
»Ich würde mir wünschen, dass du für mich spionierst. Ich muss wissen, woran sie verstorben ist.«
»Ich meine, hm … Ich meine, na ja, hm … Wenn sie keines natürlichen Todes … Also wenn ihr jemand …«
Ilses Gesicht versteinert: »Du brauchst nicht herumreden. Ich sagte schon, ich muss wissen, was da geschah, und dann werde ich mich umbringen. Du brauchst mit mir nicht wie mit einer Patientin reden. Ich lebe nur mehr, um Gewissheit zu haben.«
»Gut. Was weißt du von irgendwelchen Feinden? Konflikte, privat, beruflich?«
»Feinde nein. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ihr ein Oberarzt immer anzügliche SMS und Mails geschrieben hat. Ihr unmittelbarer Vorgesetzter auf der Internen.«
»Das Handy hat die Polizei – nehme ich an.«
Ilse schüttelt den Kopf: »Nein, das Handy habe ich. Als ich ihre Sachen aus dem Krankenhaus abgeholt habe, gab es noch keinen Verdacht auf Fremdverschulden, drum hat mir die Schwester alle ihre Sachen mitgegeben.« Ilse zieht ein Handy aus der Tasche. »Die Polizei hat von mir dann Leas Sachen wieder eingefordert, aber das Handy habe ich verschwiegen. Irgendwie wollte ich nicht, dass Fremde ihre persönlichen Botschaften lesen.«
»Pff, und das ist denen nicht komisch vorgekommen? Ein Mensch ohne Handy?«
»Schon! Ich denke, sie vermuten, dass es wer anderer genommen hat.«
Ich greife nach dem Handy, das am Tisch in einer bunten gehäkelten Hülle liegt. Ich streiche über das wollene Telefongewand. »Damit es nicht friert?«
»Lea hat im Nachtdienst immer gestrickt. Das ist jetzt wieder in – Handarbeiten.«
Ich lächle Ilse an: »Kannst dich erinnern, das haben wir auch gemacht. Du mit dünnen Nadeln, ich mit den ganz dicken.«
Sie lächelt verkniffen zurück: »Du Schal, ich Weste mit kompliziertem Zopfmuster.«
»Genau! Drum du Augenarzt und ich nur Psychiater.« Ich ziehe das Handy aus seiner Hülle und versuche es anzumachen. Akku leer, klar, nach drei Tagen. »Hast du gelesen, was der geschrieben hat?«
»Nein, es war ausgeschaltet, und ich habe keinen PIN.«
»Oje, was machen wir da?«
»Ich schaue, dass ich den PUK in ihrem Schreibtisch finde. Mit dem geht es auch. Den wollte ich schon suchen, aber es war so viel los.«
»Wohnt ihr zusammen?«
»Ja, sie ist nicht ausgezogen. Eine eigene Wohnung hätte sich nicht ausgezahlt, da sie im Turnus ja sowieso noch in die Schweiz gehen wollte.«
»Alle wollen in die Schweiz, drum haben wir keine Jungärzte mehr. Wie heißt der Oberarzt?«
»Babovsky. Ist erst seit einem halben Jahr wieder in Österreich, war vorher angeblich in Amerika. Deshalb hat er auch immer so gescheit getan.«
»Das kennen wir doch auch, oder? Wie hieß unserer aus Amerika?«
»Sie…, Sie…, Sie…?«
»Siegbert, genau. Siegbert. Siegbert, der Sieger!«
Ilse muss lächeln – fast unverkrampft. Die Erinnerung an das Leben vor Lea scheint sie aufzumuntern.
»Rufst du mich an, wenn du den PUK gefunden hast?«
Ilse nickt, trinkt den letzten Schluck Tee aus, schiebt mir das Handy hin und steht auf.
»Nimm’s du, ich schaffe das nicht.«
Ich gebe ihr das Telefon wieder zurück: »Nein, da sind vielleicht noch andere Mitteilungen drauf, die mich nichts angehen.« Dann erhebe ich mich ebenfalls, wir umarmen uns über den Tisch hinweg, der Teelöffel fällt wieder auf den Boden, aber jetzt hebt ihn keine mehr auf.
»Immerhin haben wir uns so wiedergetroffen. Finde ich schön!«
Das finde ich auch. Wahrscheinlich war ich zu jung, um zu erkennen, was für eine feine Person Ilse ist.
Nachdem Ilse verschwunden ist, rufe ich Michael an, um ihm vorzuschlagen, den Rest des Abends mit mir im Gastgarten des »Korb« zu verbringen.
Oh Wunder, er hebt ab. Und er wird kommen.
Selbstverständlich ist jetzt aber draußen kein Tisch mehr frei. Egal, in Amerika hätte ich auch drinnen sitzen müssen – und das mit Klimaanlage.
Gestern war dann doch noch ein wunderschöner Abend, denn Michael hatte sofort einen Tisch im Freien ergattert. Künstlerglück! Wir haben nicht einmal, wie sonst üblich, gestritten, denn die Geschichte mit Lea hat mich friedlich gestimmt. Wie geht es uns gut! Wieso sich sein Leben dann mit irgendwelchen blöden Kleinigkeiten, wie der, dass Michael, ohne mir was zu sagen, beschlossen hat, ab Samstag für drei Tage auf ein Schreibseminar an den Irrsee zu fahren, verpatzen? Blasphemische Exerzitien nenne ich so was.
Am Irrsee dürfte es besonders kreativ ablaufen, denn wenn er von da zurückkehrt, schwebt er in schöpferischen Sphären. Von einem künstlerischen Ertrag habe ich allerdings noch nie was bemerkt. Bis auf ein paar dann in der Wohnung wohl platzierten Notizzetteln schaut nichts dabei heraus. Ich habe es aufgegeben, nachzufragen, wann denn der Roman endlich fertig sein wird. Das Opus magnum braucht eben seine Zeit, meint er. Die Inspiration muss ersessen werden. Dieser Meinung bin ich gar nicht, denn ich denke, dass künstlerische Arbeit einfach auch nur Arbeit ist.
Egal, gestern Abend ließ ich ihn einfach Dichter sein, ohne spöttische Bemerkung über die Last der Kreativität.
Ausgeschlafen und voller Elan – zumindest ich – frühstücken wir noch bei mir, bevor ich in die Arbeit muss. Während ich das Frühstück wegräume, blättert Michael in der Gratiszeitung, die er noch vom Sonntag voriger Woche zerknüllt in seinem Rucksack mitgebracht hat. Er meint, dass es interessanter sei, die News nach einer Woche zu lesen, denn dann wisse man schon, wie sich manche Neuigkeiten überlebt haben, und hält mir eine Überschrift vor die Nase: »Rätselhaftes Verschwinden von Leichen aus der Pathologie im AKH!«
»Von wegen, dass ich schlampert bin! Die müssen schlampert sein! Leichen verloren! Wie gehen Leichen verloren? Erklär mir das!«
Ich nehme die Zeitung, um den Artikel zu lesen. Leider ist genau das Eck unterhalb der Überschrift abgerissen. Ich winke mit der Seite in die Luft über Michaels Kopf.
»Hast du den Rest im Rucksack?«
Michael bewegt sich nicht von der Stelle, sondern deutet nur auf den Boden, wo irgendwo sein Rucksack sein müsste. Ich schaue mich um und entdecke sein Heiligtum (immer dabei!) unter dem Sofa. Ich krame darin und finde außer ein paar gebrauchten Papiertaschentüchern keine weiteren Fetzen.
Also kombiniere ich: Leas Leichnam wurde sofort von der Pathologie auf die Gerichtsmedizin überstellt. Das bedeutet, dass irgendwas auf der Patho nicht stimmt. Vermutlich laufen schon Ermittlungen und man vertraut dem Institut keine Obduktionen mehr an.
Gestohlene Leichen? Da bleib ich dran! Manfred weiß sicher Genaueres, aber unterliegt der Verschwiegenheit. Das bedeutet, dass die tote Lea nicht nur wegen des Verdachts auf Fremdeinwirkung auf die Gerichtsmedizin überstellt wurde, sondern dass man das Verschwinden ihres Korpus verhindern wollte. Sehr spannend! »Kann ich die Zeitung haben?«
Michael wirft das Blatt durch die Luft: »Geschenkt! Das Kasblatt ist für dich, und alles, was da drinsteht, garantiert schon lange vorbei.« Er steht auf und haucht mir einen Kuss auf meinen Nacken, als ich mich gerade nach der Zeitung bücke. »Dein Schwanenhals …«, meint er bewundernd.
Das soll eine Aufforderung für mehr sein. Aber mit der Leichenbotschaft in der Hand ist mir so gar nicht nach Erotik. Ich entwinde mich abrupt, Michael versteht die Botschaft.
Er fasst eine Ecke der Seite, die ich gerade zusammenfalte: »Keine Ermittlungen, versprich mir!«
»Ich schwöre!« Wer redet da von Ermittlungen? Ich werde nur den Ameling, der zufällig Obduktionsgehilfe auf der Patho ist, anrufen, ob ich ihn auf ein Bier einladen darf.
Auf meinem Weg zur Ordination über den Augartensteg spende ich der Zigeunerin, die da am Boden sitzt und mit einem Packbecher bettelt, fünf Euro. Ich bin mir zwar sicher, dass diese bemitleidenswerte, frierende Person das Geld an ihren Kapo abgeben muss, aber auch ich gehorche dem innerlichen Reflex des Ablass-Kaufens.
Ich weiß, dass man Zigeuner nicht mehr sagen darf. Aber es ist doch so: Hat eine Menschengruppe gegenüber einer anderen Menschengruppe ein schlechtes Gewissen, ändert sie erst einmal die Bezeichnung für diese Gruppe, um sie angeblich nicht zu diskriminieren, also zum Beispiel »Zigeuner« auf »Roma« und »Sinti«. Dann geht es denen zwar genauso schlecht wie vorher, aber man kann sich vormachen, dass sie nicht mehr diskriminiert werden. Und dann spendet man, um den lieben Gott zu korrumpieren: Er möge doch dafür sorgen, dass der eigenen Gruppe so ein Elend erspart bleibe. Auch ich bin nicht frei von diesem Aberglauben, ganz im Gegenteil, je agnostischer ich werde, desto mehr muss ich dem Gott, an den ich nicht glaube, bezahlen.
Mutter erwartet mich schon mit einem zweiten Frühstück. Sie ist übrigens frei von jeglichem Aberglauben und braucht sich deshalb beim lieben Gott auch nicht freizukaufen.
»Heute habe ich dir einen Zwetschkenkuchen mitgebracht.«
Ich antworte gar nicht, da ich mich auf keine Diskussion einlassen möchte. Ich tue geschäftig und raffe Befunde, die auf ihrem Schreibtisch liegen, zusammen.
Aber sie lässt nicht locker: »Ist gar nicht einfach, österreichische Zwetschken zu bekommen, die Cilli meint, heuer wäre ein schlechtes Zwetschkenjahr.«
Die Cilli ist ihre Favoritin unter den Standlern am Karmelitermarkt. Den Naschmarkt boykottiert sie wegen der überwiegend ausländischen Geschäfte und der überhöhten Preise.
Ich tue noch immer so, als ob mich das nichts anginge. Sie hält mir den Teller mit dem Kuchen hin. Ich winke ab.
»Das waren übrigens die letzten, die sie hatte.«
Immer diese Erpressung! Soll ich mir den nächsten Kilo hinaufessen, nur weil die Cilli meiner Mutter gnadenhalber ihre letzten Zwetschken verkauft hat? Die letzten Zwetschken, die unwiderruflich letzten Zwetschken, die einzigen Zwetschken in ganz Wien, nein, in Österreich, nein, auf der ganzen Welt?
»Mama, ich habe schon gefrühstückt … mit Michael.«
»Na, das kann ich mir vorstellen, was du da gefrühstückt hast. Kaffee, und sonst nichts.«
»Wir haben ausreichend gefrühstückt …«
»Erzähl mir nicht, dass er Semmeln geholt hat? Nie im Leben.«
Jetzt ist es aber genug. Ich lasse mir meinen Liebhaber nicht immer schlechtmachen. Auch wenn was dran ist, dass er von selber nie auf die Idee käme, für mich Semmeln zu holen. »Michael ist auch nicht zum Semmelholen da«, kontere ich gehässig.
»Na, na, na … Bist mit dem falschen Fuß aufgestanden?«
Ich packe den Papierstoß, schenke ihr noch einen bösen Blick, den sie mit einem gekünstelten Lächeln beantwortet, und verziehe mich in mein Sprechzimmer, nicht ohne die Tür lautstark zu schließen.
Da lasse ich mich in meinen Chefsessel fallen, würge meinen glücksbringenden Plüschelefanten und blase die Mutterluft aus meinen Lungen. Huh! Wieso lasse ich mich immer noch so von ihr reizen? Ist doch nur gut gemeint, der Zwetschkenkuchen? Nein! Der Zwetschkenkuchen ist nicht gut gemeint, der dient nur dazu, auch noch die Kontrolle über so existenzielle Bedürfnisse wie meine Nahrungsaufnahme zu haben.
Kaum ist die ganze Mutterluft draußen, drückt mich das schlechte Gewissen und ich stehe auf, öffne sanft die Tür zum Empfang, tänzle leise an Mutters Schreibtisch vorbei in unsere Teeküche – denn der Kuchen steht nicht mehr vor ihr – und will ihn mir von da holen, als sie hinter mir her säuselt: »Den habe ich der Frau Skodal versprochen, für die Kinder. Die kriegen niiiie so was Gutes. Sie lässt sich sehr bei dir bedanken, dass du drauf verzichtest.«
Frau Skodal ist unsere Putzfrau. Ob sie wirklich Kinder hat, das weiß ich nicht.
»Da hättest du mich aber schon fragen können, ob ich den hergebe!«
»Ich dachte, du ziehst Michaels Semmeln vor …«
»Gerade jetzt möchte ich ihn aber!«
Zum Glück erlaubt unsere wartende Kundschaft keinen weiteren Diskurs, wir müssen losstarten. Bevor ich den ersten Patienten drannehme, bitte ich Mutter, noch einen Befund von Dr. Lea Sibjesky im AKH anzufordern. Sie wirft einen Blick in unsere Kartei, findet Lea da aber klarerweise nicht.
»Die ist nicht von uns.«
»Nein. Bitte trotzdem.«
Mutter schaut mich wissend an: »Tot?«
»Wieso …?«
»Weil dich doch nur die Befunde von deinen Leuten oder die von deinen Selbstmördern interessieren.«
»Weder noch. Bitte ruf an. Wir müssen.«
»Also tot, wie auch immer …«