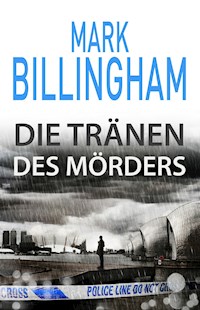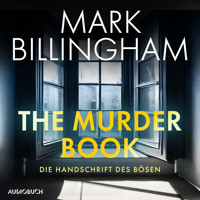Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Alice Frances Armitage, bis vor Kurzem Detective Constable bei der Mordkommission der Metropolitan Police im Norden Londons, weiß, wie man für Recht und Ordnung sorgt. Aber da, wo sie ist, nützt ihr das gar nichts. Nicht, weil es in Psychiatrien eben grundsätzlich chaotisch zugeht, sondern weil sie selbst Patientin ist. Seit ihr Kollege bei einem Routineeinsatz erstochen wurde, leidet sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Alkohol und die Drogen haben sicher auch nicht geholfen, und nachdem Alice ihrem Freund eine Weinflasche über den Kopf gezogen hat, war es mit dem Verständnis ihres Arbeitgebers endgültig vorbei. Wenn sie die psychiatrische Akutstation wieder verlassen darf, will Alice ihre Wiedereinstellung durchboxen. Aber auch ohne Dienstmarke beginnt sie sofort Nachforschungen anzustellen, als einer ihrer Mitpatienten ermordet wird. Die Polizei will sie nicht einbeziehen, und so muss sie heimlich Beweise sammeln und sich auf die wenigen Kontakte verlassen, die sie noch hat. Alices Leben gerät endgültig aus den Fugen, als sie merkt, dass sie niemandem auf der Station trauen kann – am wenigsten sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Billingham
Eingewiesen
Roman
Aus dem Englischen von Andrea Fischer
Kampa
Voller Dankbarkeit und Respekt dem Gedenken an die große Zahl von Ärzten, Pflegefachkräften in der Psychiatrie und Pflegeassistenten gewidmet, die ihr Leben an Covid-19 verloren haben.
Man sagt nur die Wahrheit, wenn man eine Maske trägt.
BOB DYLAN
Ich wollte gerade Tabak schnorren bei Lucy, manchmal vonmir L wie Learner genannt und wahrscheinlich das vornehmste Wesen der Welt – sie mag nicht angefasst werden und glaubt, die Erde sei eine Scheibe –, als der Radau in dem kleinen Zimmer neben der Kantine losbrach. Das Zimmer mit der gelben Tapete und dem Sofa. Heißt auch »Musikzimmer«, weil da ein paar verstaubte Bongos im Regal liegen und eine Gitarre mit vier Saiten.
In der Luft hing noch der Geruch des wässrigen Currys, das Eileen zu Mittag gekocht hatte.
Dass mich keiner falsch versteht: Ich hatte alles aufgegessen. Zwei große Teller, weil ich immer schon einen guten Appetit hatte und weil man isst, was einem vorgesetzt wird, aber als es noch eine gute Stunde später danach stank, wurde mir leicht übel. Genau, das weiß ich noch. Allerdings wird mir inzwischen bei einigen Sachen etwas flau im Magen, und offen gestanden ist es nicht so, als würde es in diesem Laden mal wirklich gut riechen.
Ich eierte also durch den Gang, versuchte, den Geruch zu ignorieren, und wollte dringend eine rauchen, da hörte ich das Palaver.
Geschrei und Geschimpfe, rumgeworfene Gegenstände, so was.
Das war Mittwochnachmittag, zwei Tage, bevor die Leiche gefunden wurde.
Hier hallt es sehr, deshalb dachte ich mir am Anfang nicht viel dabei. Ist ja nicht so, als wäre hier noch nie jemand ausgerastet, deshalb ging ich davon aus, es sei vielleicht nur ein Streit, der sich viel schlimmer anhörte, als er war, und erst als ich direkt vor der Tür stand und sah, was in dem Raum abging, wusste ich, dass ich irgendwas unternehmen musste. Dass ich einschreiten musste.
Ach, bin ich blöd! Das war drei Tage, bevor die Leiche gefunden wurde. Drei Tage …
Im Musikzimmer ging es drunter und drüber. Ein paar Leute standen abseits und sahen bloß zu – ein Typ, den ich nicht besonders gut kannte, klatschte sogar in die Hände, als sei das Durcheinander Teil eines offiziellen Unterhaltungsprogramms –, die anderen schnaubten und schnappten, taumelten umher und kippten Möbel um. Von der Tür aus konnte ich nicht wirklich sagen, wer kämpfte und wer versuchte, andere vom Kämpfen abzuhalten. Es war zu spät, um herauszufinden, wie das Ganze angefangen hatte, aber zu dem Zeitpunkt war das auch egal, wahrscheinlich war der Auslöser eh nicht besonders wichtig gewesen.
Hier braucht es meistens nicht viel.
Ein halbes Dutzend von denen hatte sich ineinander verkeilt, riss sich gegenseitig an den Haaren, kratzte und beschimpfte einander aufs Übelste. Bambule, so nennt man das doch, oder? Wenn sich mehrere schlecht gelaunte Menschen zu Idioten machen.
Ringen, fluchen, Drohungen ausstoßen.
Der Warter war dabei, die Somalierin auch, die gerne fremde Füße anfasst. Die war richtig verbissen, schon erstaunlich, denn sie ist höchstens eins fünfzig groß und rappeldürr. Ilias markierte den starken Mann, Lauren stand ihm in nichts nach, während Donna und Big Gay Bob sich kreischend wehrten. Das Ding war natürlich auch da, mittendrin, trat einen Stuhl um und versuchte, Kevin zu schlagen, der mit dem Rücken zur Wand stand. Ein anderer, dessen Gesicht ich unter der Kapuze nicht erkennen konnte, klammerte sich an den Arm von Dem Ding, als gäb’s kein Morgen.
Echt, Mann, Herr Jesus im Kettenhemd.
Es wunderte mich nicht im Geringsten, dass keiner von denen, die dafür bezahlt werden, sich um so was zu kümmern, es besonders eilig hatte. Für die war der Streit, ehrlich gesagt, nichts Neues. Damit will ich sagen, dass ich nicht dumm rumstehen und darauf warten konnte, dass einer von den Spezis seinen Arsch in Bewegung setzte und dem Ganzen ein Ende machte. Außerdem hatte ich zu meiner Zeit schon zig Schlägereien aufgelöst, war also kein Ding für mich. Schließlich bin ich dafür ausgebildet, oder?
Bloody hell, Al … Reiß dich zusammen! Die Fakten müssen richtig dargestellt werden, das ist wichtig, ja? Auch das habe ich in der Ausbildung gelernt.
Das war drei Tage, bevor die erste Leiche gefunden wurde. Die erste der Leichen.
Nachdem ich in das Zimmer gerauscht war, stellte ich ziemlich schnell fest, dass ich nichts groß ausrichten konnte; körperlich schon gar nicht. Ehrlicherweise muss man sagen, dass ich meine Ausrüstung nicht dabeihatte – Schlagstock, Pfefferspray, Taser und so weiter –, weshalb ich mir keine großen Vorwürfe machte. Letzten Endes blieb mir nur die Möglichkeit, auf einen der wenigen Stühle zu steigen, die noch nicht umgekippt waren, tief durchzuatmen und lauter als alle anderen zu schreien, bis ich beachtet wurde.
Also, zumindest von den meisten, ein paar kabbelten sich trotzdem weiter.
»Ihr habt jetzt noch eine Chance, mit dem Scheiß aufzuhören, dann wird es ernst, verstanden?« Ich machte eine Kunstpause, damit auch ankam, was ich gesagt hatte, weil das immer ganz hilfreich ist. Bringt die Leute zum Nachdenken. »Also, tut euch einen Gefallen und hört auf, euch so aufzuführen.« Ein strenger Blick in die Runde. »Habt ihr mich verstanden? Das ist mein voller Ernst. Dies ist eine Störung der öffentlichen Ordnung, und ich bin Polizeibeamtin …«
Ich muss sagen, der Satz machte den Unterschied, obwohl ich nicht behaupten kann, dass ich besonders stolz auf mich war, als einige die Möbel wieder dahin stellten, wo sie hingehörten, und die anderen nach draußen in den Korridor schlurften. Ich meine, das machte mich jetzt nicht gerade glücklich. Schon in dem Moment wusste ich, dass ich später, wenn ich mich in den Schlaf heulte, unaufhörlich daran denken müsste, aus welchem Grund sie auf mich gehört hatten.
Denn es lag nicht daran, dass ich sie zur Vernunft gebracht oder ihnen Angst gemacht hätte.
Auch nicht daran, dass ich irgendeine Autorität besaß.
Tatsächlich hatten sie keine Lust mehr zu kämpfen, weil sie zu sehr lachen mussten.
Erster TeilPlötzlich oder verdächtig
1
Um die wichtigsten Informationen so effizient wie möglich zu vermitteln und die ganze Geschichte ein Stück weit aufzupeppen, habe ich mir gedacht, ich tue so, als sei ich bei einem Bewerbungsgespräch. Ich weiß noch ungefähr, wie so was abläuft. Man stelle sich also vor, dass ich mich total rausgeputzt habe, um mich bestmöglich in Szene zu setzen und mir irgendeine einmalige Aufstiegsmöglichkeit zu angeln (nicht dass ich hier in Jogginghose und Schlappen in einer Klapsmühle herumhänge wie ein armseliger Depp). Genau: in einer Klapse. Wahrscheinlich nicht der politisch korrekteste Ausdruck, das sehe ich ein, aber die Leute hier drin nennen es so.
Na gut …
Eine psychiatrische Akutstation.
Besser so? Können wir jetzt weitermachen? Nicht dass ich noch einem zart Besaiteten auf die Füße trete.
Ich heiße Alice Frances Armitage. Oder auch Al. Ich bin einunddreißig Jahre alt. Mittelgroß, mittelschwer – im Moment etwas dünner als sonst –, im Übrigen in jeder Hinsicht: Durchschnitt. Ich habe straßenköterblonde Locken und komme aus dem Norden – aus Huddersfield, wen’s interessiert –, und wenn man meiner Mutter glauben will, habe ich eine große Fresse. Bis vor wenigen Monaten war ich Detective Constable bei einer Mordkommission der Metropolitan Police in Nordlondon.
Faktisch bin ich das immer noch.
Womit ich sagen will, es ist umstritten.
Womit ich sagen will, es ist … kompliziert.
Die Met war sehr verständnisvoll, was die PTBS betraf. Ich meine, muss sie auch sein, schließlich gehört das mehr oder weniger zu den Berufsrisiken. Nicht mehr ganz so verständnisvoll war die Polizeibehörde, als Alkohol und Drogen ins Spiel kamen, obwohl das oben erwähnte Trauma daran schuld war. Schon eine verzwickte Angelegenheit, nicht? Die sogenannte Psychose ist vom chronologischen Ablauf her etwas schwerer zu fassen. Das ist ein bisschen wie mit der Henne und dem Ei. Nein, ich bin nicht so bescheuert, dass ich mir einbilde, der Wein und das Gras hätten irgendwie geholfen, aber ich glaube schon, dass der komische Kram in meinem Kopf in erster Linie mit dem Trauma zu tun hat beziehungsweise hatte und dass es viel zu einfach ist, das Geschehene lediglich auf äußere und selbstverschuldete Einflüsse zurückzuführen.
Merlot und Marihuana sind nicht an allem schuld.
Für die Met war das natürlich sehr praktisch, denn plötzlich lösten sich Mitgefühl und Verständnis in Luft auf, und mit dem gut gemeinten bezahlten Urlaub war es auch vorbei. Das lasse ich mir natürlich nicht gefallen, und mein Gewerkschaftsvertreter meint auch, ich hätte beste Chancen, wieder in den Dienst aufgenommen zu werden, sobald ich hier raus bin. Außerdem gäbe es starke Argumente dafür, dass ich ungerechtfertigt aus dem Dienst entlassen wurde und ein Anrecht auf Verdienstausfall hätte. Den will er für mich durchboxen.
Von daher können Das Ding und die anderen sich ruhig über mich lustig machen. Momentan habe ich vielleicht keinen Dienstausweis, den ich zücken kann, aber soweit es mich betrifft, bin ich immer noch Polizeibeamtin.
Ich glaube, das mit dem Bewerbungsgespräch lasse ich lieber. Ist mir zu anstrengend, die Nummer durchzuziehen, außerdem glaube ich nicht, dass die Sache mit dem Alkohol und den Drogen in so einem Gespräch besonders gut kommt, und das mit der Berufserfahrung war ja mehr oder weniger abrupt vorbei.
So, Miss Armitage, was ist denn im Januar passiert? Danach scheinen Sie gar nicht mehr gearbeitet zu haben …
Tja, es gibt ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall verschweigen würde, zum Beispiel das mit der Körperverletzung, und man muss auch sagen, dass eine Zwangseinweisung nach Absatz 2 und 3 des Gesetzes zur psychischen Gesundheit von 1983 sich in einem Lebenslauf nicht besonders gut macht.
Von den begrenzten beruflichen Perspektiven mal abgesehen, gibt es echt ziemlich viel, was komplizierter wird, sobald man mal zwangseingewiesen wurde, vor allem nach Absatz 3. Im Grunde genommen ändert sich alles. Man kann sich entschließen, die Lebensphase unter Verschluss zu halten, was die meisten aus naheliegenden Gründen auch tun, aber es steht natürlich alles in irgendwelchen Datenbanken. Die Zeit in der Klapse, jede hässliche Kleinigkeit – alles mit einem Mausklick da. Zum Beispiel bei Versicherungen: Das ist anschließend echt der Horror; auch Reisen werden wirklich aufwendiger. Es gibt ein paar Länder, die nicht mehr wollen, dass man ihnen einen Besuch abstattet, zum Beispiel Amerika, was total der Witz ist, wenn man bedenkt, wer den Laden da mal geführt hat.
Klar, ich verstehe das, so läuft es nun mal, aber trotzdem.
Hat man Probleme mit irgendwelchem Scheiß, bekommt man Hilfe – ob man will oder nicht –, man erholt sich, mehr oder weniger, und wenn man zurück in der wahren Welt ist, muss man sich mit noch mehr Scheiß rumschlagen. Kein Wunder, dass so viele Leute immer wieder in einem Laden wie diesem landen.
Wenn alle im selben Boot sitzen, gibt es kein Stigma.
Okay, mehr muss wohl erst mal nicht bekannt sein. Das ist der – wie sagt man? –, der Kontext. Kommt natürlich noch eine Menge hinzu, und auch wenn ich schon ein paar Figuren erwähnt habe, gibt es noch viel über jeden einzelnen zu wissen und über alles, was passiert ist. Ich werde mich bemühen, nichts Wichtiges zu unterschlagen, aber das hängt stark davon ab, wie es mir gerade geht und ob die zuletzt eingenommenen Medikamente gerade wirken oder ihre Wirkung allmählich nachlässt.
Damit will ich sagen: Ich hoffe auf ein bisschen Nachsicht.
Einiges ist schwer zu glauben, das kann ich versprechen, aber nicht mehr, wenn man weiß, wie es hier drin abgeht. Schon gar nicht, wenn man ständig damit zu tun hat. Wenn man die Leute kennt und weiß, wozu sie an einem schlechten Tag in der Lage sind, erstaunt einen wirklich nichts mehr. Ehrlich gesagt, ist es ein Wunder, dass solche Sachen nicht öfter passieren.
Ich kann mich erinnern, dass ich an einem Morgen mit Dem Ding an der Medikamentenausgabe darüber gesprochen habe und wir im Großen und Ganzen zum selben Schluss kamen. Wenn man einen Haufen Leute nimmt, die gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen, die kaum vorstellbar heftige Stimmungsschwankungen haben und im Nu von null auf hundert sind, Leute, die Dinge sehen und hören, die nicht da sind, die paranoid sind, Wahnvorstellungen haben, oft auch beides; absolut unberechenbare Menschen, obwohl sie bis zur Oberkante Unterlippe mit Medikamenten vollgepumpt sind. Leute, die im Übermaß wütend oder schreckhaft oder nervös sind oder was die sieben Zwerge des Wahnsinns, die hier vierundzwanzig Stunden täglich am Start sind, sonst noch an Verhaltensauffälligkeiten zu bieten haben. Wenn man also diese Leute nimmt und sie alle zusammen einschließt, bettelt man doch geradezu um Ärger, oder?
Es ist schon ein guter Tag, wenn nichts Furchtbares passiert.
In so einem Laden ist ein Mord eigentlich nichts Besonderes, nicht wenn man mal drüber nachdenkt. Er ist fast unvermeidlich, würde ich sagen, genau wie der Radau und der Gestank. So wie ich das sehe, ist ein Mord hier quasi zu erwarten.
Sogar zwei Morde.
2
Ich weiß, dass Kevins Leiche am Samstag gefunden wurde,weil es der Tag nach meiner Anhörung war, und die fand auf jeden Fall am Freitag statt. Solche offiziellen Termine sind nie am Wochenende, weil dann keine Ärzte und Therapeuten da sind, Anwälte schon gar nicht. Die arbeiten nur montags bis freitags, von neun bis fünf, was schon etwas seltsam ist, wenn man bedenkt, dass die Wochenenden hier wahrscheinlich am schwierigsten sind und ein bisschen mehr Personal keine schlechte Idee wäre. An Samstagen und Sonntagen kommt es gerne mal vor, dass die Realität – beziehungsweise das, was einige Leute hier drin dafür halten – so richtig durchschlägt. Tage, an denen den Insassen klar wird, was ihnen fehlt, an denen sie sich noch mehr langweilen als sonst. Oft bedeutet das Ärger.
»Wochenendblues« sagt Marcus dazu.
Der Genauigkeit halber sollte ich sagen, dass es meine zweite Anhörung war. Die erste hatte ich, als ich erstmals mit einer Zwangseinweisung nach Absatz 2 in die Geschlossene kam. Damit kann man bis zu achtundzwanzig Tage weggesperrt werden, um in der Zeit theoretisch beurteilt zu werden, und natürlich war ich alles andere als glücklich über die Situation, deshalb beantragte ich die Anhörung so schnell wie möglich. Warum auch nicht? Allerdings ging der Schuss nach hinten los, und nach nur vierzehn Tagen – nach ein paar unappetitlichen Zwischenfällen, die eigentlich nicht wichtig sind – wurde aus dem 2er ein 3er.
Ein 3er bedeutet, dass man bis zu sechs Monate bleiben muss, beziehungsweise solange die Ärzte meinen, dass man eine Gefahr für sich selbst oder andere darstellt, von daher ist es keine große Überraschung, dass ich die nächste Anhörung beantragte, bevor jemand »anti-psychotisch« sagen konnte. Ehrlich, ich stand schon vor der Tür zum Dienstzimmer und klopfte, bevor die Aufnahmepapiere unterschrieben waren.
Egal, was hier drin passiert – man darf auch nicht vergessen, dass man Rechte hat.
Meine Mutter und mein Vater wollten bei dieser Anhörung dabei sein, angeblich um mich zu unterstützen, aber das habe ich gleich abgewürgt, weil meine Eltern kein Geheimnis daraus machten, dass ich ihrer Meinung nach zu Recht in diesem Laden war. Es sei alles zu meinem Besten. Ehrlich gesagt gab es, abgesehen von meinem Anwalt – mit dem ich höchstens zehn Minuten gesprochen hatte –, niemanden, der auf meiner Seite stand, und es ist echt nicht schön, wenn die eigenen Liebsten die Leute unterstützen, die einen wegsperren wollen.
Mir geht es vielleicht nicht gut, das gebe ich gerne zu, aber ich bin nicht verrückt.
Also die übliche Konstellation: ein Tisch und zwei Reihen Plastikstühle im IR (Interdisziplinärer Raum) am Ende des Hauptgangs.
Der Stationsleiter, Marcus, und eine von den Krankenschwestern.
Dr. Bakshi, die Fachärztin für Psychiatrie, und einer ihrer Assistenten, dessen Namen ich sofort wieder vergessen habe.
Ein sogenannter Laie – ein Typ mittleren Alters, der ständig grinste, aber wahrscheinlich nur ein Wichtigtuer war und nichts Besseres zu tun hatte –, außerdem eine Richterin, die aussah, als hätte sie in eine Zitrone gebissen oder das krautige Ende einer Ananas im Hintern. Oder beides.
Mein Anwalt Simon und ich.
Am Anfang dachte ich, es liefe nicht schlecht. Als ich meine Erklärung abgab, wurde jedenfalls viel genickt. Ich sagte, ich sei schon seit sechs Wochen da, das sei länger als alle anderen, außer Lauren. Wenn ich genau überlege, könnte es sein, dass Ilias eventuell auch etwas länger da ist als ich … Ich habe so eine vage Erinnerung, dass er vor Ort war an dem Abend, als ich aufgenommen wurde, aber die ersten Tage sind ein bisschen verschwommen.
Ist auch egal …
Ich sagte, dass ich mich meiner Meinung nach gut machte, dass die Medikamente anschlügen und ich nicht mehr die albernen Sachen denken würde, die ich bei meiner Einlieferung dachte. Ich sagte, ich hätte das Gefühl, wieder ich zu sein. Marcus und die Krankenschwester meinten, das sei sehr schön zu hören, und versicherten der Richterin, ich würde gut auf die Behandlung ansprechen. Das klang positiv, doch im Rückblick hieß das natürlich nichts anderes als: Deshalb sollte Alice auf jeden Fall weiter behandelt werden.
Man lernt nie aus, nicht?
Selbst da hatte ich noch das Gefühl, es könne gut ausgehen, doch dann wurde eine E-Mail von Andy vorgelesen. Über den muss ich später noch einiges erzählen, jetzt ist erst mal nur wichtig, dass er der Typ ist, mit dem ich bis vor sechs Wochen zusammen war und dem ich eine Weinflasche über den Schädel gezogen habe.
Er mache sich Sorgen um mich, darauf lief seine E-Mail hinaus. Ärzte und Richterin sollten wissen, wie betroffen ihn ein Telefongespräch mit mir vor ein paar Tagen gemacht habe, als ich angeblich zu ihm sagte, ich glaube immer noch, dass er nicht der sei, der er vorgebe zu sein. Als ich hysterisch wurde und warnte, ich würde ihn ohne zu zögern verletzen, wenn ich mich gegen ihn oder die anderen wehren müsste.
Sie glaubt den ganzen Quatsch immer noch, schrieb Andy, diesen Verschwörungskram.
Sie hat mich bedroht.
Nachdem das vorgelesen wurde, gab es ein bisschen Geschrei, das ist klar. Geschrei und Geheul, vielleicht habe ich auch den Stuhl umgestoßen. Als die Richterin sagte, ich solle mich beruhigen, erklärte ich ihr, Andy habe keine Ahnung, so was hätte ich nie gesagt, er würde mich gaslighten, so wie immer. Dass er sich das ausdenken würde wegen dem, was bei unserer letzten Begegnung passiert war.
Das mit der Flasche und so.
Egal, lange Anhörung kurzer Sinn: Mit den Worten verabschiedete ich mich, und Simon kam erst ungefähr zwanzig Minuten später raus und teilte mir die Entscheidung mit. In ein paar Tagen würde sie mir auch schriftlich zugehen, sagte er, zusammen mit der Information, wann ich eine erneute Anhörung beantragen könne, obwohl ich schon beschlossen hatte, dass es mir egal war. Niemand hat Spaß daran, immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, oder? Okay, Graham schon, der macht das so gern, dass er eine bleibende Delle in der Stirn hat und seine Lieblingsstelle an der Wand ständig neu gestrichen werden muss, damit man das Blut nicht sieht.
Als ich mich am Nachmittag nach der Anhörung ein bisschen beruhigt und was gegessen hatte, saß ich mit Ilias im Musikzimmer. Ich hatte meine Kopfhörer auf, auch wenn ich gar keine Musik hörte. Manchmal höre ich schon welche, aber wenn ich ehrlich bin, steckt das Ende des Kabels meistens nur lose in meiner Tasche. Eine gute Methode, um nicht mit anderen reden zu müssen.
Ilias winkte, weil er was sagen wollte, also nahm ich die Kopfhörer mit einem Seufzen ab. Wartete.
»Ich freu mich, dass du hierbleibst«, sagte er.
»Ich ganz bestimmt nicht«, entgegnete ich.
Ein paar Zimmer weiter fing jemand an zu schreien, es ging um gestohlenes Geld. Ilias und ich hörten eine Zeit lang zu, dann verloren wir das Interesse.
»Hast du Lust auf Schach?«
Ich sagte Nein, wie immer. Ich habe Ilias noch nie Schach spielen sehen, ich glaube nicht mal, dass er es überhaupt kann. Ich habe hier auch noch nie ein Schachbrett gesehen, nur verschiedene Puzzles im Schrank.
»Welcher Tag ist heute?«, fragte Ilias.
»Freitag«, sagte ich.
»Morgen ist Samstag.« Ilias macht so schnell keiner was vor. »Samstag, dann Sonntag.« Er hatte einen hässlichen roten Fleck am Hals. »Samstage sind blöd, oder?«
Da konnte ich ihm nicht widersprechen, auch wenn ich, ehrlich gesagt, noch nie ein großer Fan von Wochenenden war. Immer diese Erwartungshaltung, sich zu entspannen und Spaß zu haben. Das heißt, wenn man überhaupt ein Wochenende hat. Verbrecher nehmen sich am Wochenende normalerweise nicht frei, eher im Gegenteil, deshalb hatte ich als Bulle eh nie viel Zeit, um zum Flohmarkt zu gehen oder mal schnell im Gartencenter vorbeizufahren. Was mir an dem Job aber gut gefiel.
»Langweilig. Samstage sind so langweilig.«
Wie gesagt …
»Sie sind viel länger als andere Tage, und es passiert nie was Interessantes.« Ilias wirkte traurig. »Ich meine keine Streitereien oder so, die sind auch langweilig. Ich meine, was wirklich Interessantes.«
Ich habe doch eben vom Gedächtnis gesprochen, oder? Was ich vielleicht getan habe und was nicht? Ich kann es nicht beschwören, aber ich hoffe, dass ich, kurz bevor Ilias wieder laut furzte und loslief, um zu sehen, ob jemand anders mit ihm Schach spielen wollte, dass ich wirklich zu ihm sagte: »Pass auf, was du dir wünschst!«
3
In diesem Laden geht mehrmals die Woche der Alarm los,bei Vollmond noch öfter, das ist nichts Besonderes. Klar, die Schwestern springen direkt drauf an, aber die Patienten laufen nicht panisch herum oder so. Meistens redet man einfach weiter Schwachsinn – höchstens ein bisschen lauter –, isst seine Mahlzeit oder macht was auch immer, bis das Schrillen aufhört. Diesmal gab es jedoch zuerst einen Schrei, weshalb auf der Hand lag, dass etwas Schlimmes passiert war.
Debbie, die Schwester, die die Leiche fand, hat eine ziemlich große Schnauze.
Es war Samstagabend, kurz vor elf, und die meisten lagen schon im Bett. Ich saß mit Shaun und Dem Ding in der Kantine – offiziell der Speisesaal, ein sinnloser Versuch, den Raum aufzuwerten. Wir ließen die letzte Mahlzeit des Tages sacken und unterhielten uns über dies und das.
Wahrscheinlich über Musik oder übers Fernsehen. Lästerten darüber, dass Lauren die Fernbedienung nie aus der Hand gibt.
Als wir in den Flur gingen, kam Debbie aus dem Männertrakt gelaufen, deshalb wusste ich, dass sie es war, die geschrien und wahrscheinlich auch auf den Alarm gedrückt hatte. Das gesamte Pflegepersonal hat ein Gerät am Gürtel. Wenn man das betätigt, geht im ganzen Gebäude der große Alarm los. Ich weiß noch, dass mal ein Patient so ein Gerät in die Finger bekam und es versteckte. Wenn er Langeweile hatte, drückte er einfach drauf. Tagelang verursachte das Chaos.
Debbie wirkte auf jeden Fall sehr schockiert.
Wir drei standen da und sahen zu, wie George und Femi aus dem Dienstzimmer gerannt kamen, und obwohl Debbie versuchte, sich professionell zu verhalten und beim Sprechen die Stimme zu senken, konnten wir, als der Alarm nicht mehr klingelte, deutlich hören, wie sie Kevins Namen sagte, und der Blick in den Gesichtern der anderen Pflegkräfte verriet uns, was wir wissen mussten.
»Scheiße«, sagte Shaun. »O fuck, o Scheiße.« Er kratzte sich heftig an Hals und Oberkörper, sodass ich seine Arme festhielt und sagte, alles würde gut werden.
»Vielleicht hat das Ding ihn geholt«, sagte Das Ding.
Ich entfernte mich unauffällig von den zweien und rückte so nah wie möglich an den Kreis von Pflegekräften heran, um ein bisschen mehr mitzukriegen, doch George entdeckte mich und schickte mich weg. Dann eilten alle zum Männertrakt hinüber, wahrscheinlich in Kevins Zimmer, um sich anzusehen, was Debbie gefunden hatte. Ein paar Minuten später kamen Debbie und Femi mit düsteren Mienen zurück, und kurz darauf holte George alle, die auf ihren Zimmern geblieben waren, heraus und scheuchte sie in Richtung Eingangsbereich. Die meisten schlurften friedlich mit müdem Blick mit, der eine oder andere in seine Bettdecke gewickelt. Ein paar beschwerten sich lautstark, dass sie geweckt worden waren, und wollten wissen, was los sei.
»Ihr könnt mich nicht zwingen, mein Zimmer zu verlassen.«
»Tut mir leid, aber …«
»Das ist mein Zimmer.«
»Es ist etwas vorgefallen …«
»Ist mir egal.«
Als die Zimmer leer waren – also, bis auf das von Kevin, denn der arme Kerl würde nirgends mehr hingehen –, stand George am Anfang des Gangs Wache, um sicherzustellen, dass niemand zurückschlich. Er guckte einfach nur ernst und hob seine große Hand, wann immer es aussah, als würde es jemand versuchen. Unter normalen Umständen wäre das wohl Marcus’ Aufgabe als Stationsleiter gewesen, aber der machte keine Nachtschicht. Ich fragte mich, ob ihm jemand Bescheid gesagt hatte und er auf dem Weg hierher war, kann mich aber nicht erinnern, ihn vor dem nächsten Tag gesehen zu haben.
»Wo sollen wir denn dann schlafen?«, fragte Ilias. »Ich bin müde.«
»Das klären wir noch«, antwortete Femi.
Das war natürlich leichter gesagt als getan. Wenn für acht oder neun Männer ein Zimmer gefunden werden musste und im Frauentrakt nichts frei war, dauerte es schon eine Weile. So vollgepumpt mit Tabletten und müde, wie die meisten waren, war keiner besonders begeistert von der Störung. Ilias und Das Ding meldeten sich sofort freiwillig für die Unterbringung in den beiden »Absonderungsräumen« und stellten sich vor die jeweilige Tür, damit sie sie auch bekamen. Zufälligerweise waren auf der Station direkt gegenüber ein paar Zimmer frei, außerdem einige im Stockwerk unter uns, auch wenn auf die niemand besonders heiß war, weil dort nach allem, was man so hörte, ein paar echte Hardcore-Fälle waren. Letztendlich hatten die Männer aber keine große Wahl, und als schließlich die Polizei eintraf, lagen sämtliche männlichen Bewohner in irgendeinem Bett, mit Ausnahme von zwei Freiwilligen, die mit einem Krankenwagen in die nächste Klinik gebracht wurden.
Das war das Schlimmste für mich, der wahre Schlag in die Magengrube.
Dass ich abgeschoben war, als sei ich nutzlos.
Als sei ich so wie der Rest.
Auch wenn sich der »Vorfall« im Männertrakt ereignet hatte, stellte das Personal von vorneherein klar, dass alle Patientinnen, die nicht schon im Bett lagen, auf ihre Zimmer gehen mussten.
Ich war hellwach, es kribbelte mir am ganzen Körper, aber dass ich nicht ansatzweise die nötige Bettschwere hatte, war nicht das Schlimmste. Ich marschierte direkt zu Femi, als müsste sie sich nicht an die Vorschriften halten. »Vor zwölf Uhr müssen wir nicht im Bett liegen.«
»Ich weiß«, sagte sie. »Aber heute ist das anders … Alle müssen in ihren Zimmern sein, damit die Polizei ihre Arbeit machen kann, wenn sie eintrifft.«
»Darum geht’s doch gerade«, sagte ich. »Ich kann helfen.« Es juckte mir in den Fingern, meinen nicht vorhandenen Dienstausweis zu zücken. »Ich weiß, wie das läuft.«
Femi nickte nur, lächelte schwach, legte mir eine Hand auf den Rücken und schob mich weg. Ich wehrte mich, aber nur weil ich genervt war. Ich wusste, dass es Zeitverschwendung war, weil ich schon sah, wie Lauren, Donna und ein paar andere Frauen, die von dem ganzen Tumult wach geworden waren, zurück zu ihren Zimmern gingen.
»Das ist ungerecht«, maulte ich.
»Wir haben unsere Vorschriften«, sagte Femi.
»Wenn jemand stirbt?«
Femi schwieg und achtete darauf, dass ich mich in die richtige Richtung bewegte.
»Kevin ist tot, oder?«
Aus offensichtlichen Gründen dürfen Frauen nicht in den Männertrakt und umgekehrt. Aus teilweise denselben Gründen hält man hier auch nicht besonders viel davon, wenn jemand das Zimmer eines anderen betritt. Ich meine, Privatsphäre ist für jeden wichtig, das verstehe ich. Das heißt aber nicht, dass zwischen Patienten nicht gewisse Dinge vorkommen, denn eins steht fest: So was läuft auf jeden Fall. Für alle sichtbar, ziemlich oft, ich hab’s mit eigenen Augen gesehen.
Da wird schnell mal einem in der Ecke des Musikzimmers einer runtergeholt.
Da wird in den Büschen gefummelt, wenn die Patienten Ausgang haben.
Andererseits: Ist es nicht gut, dass es Vorschriften gibt, die solche furchtbaren Auswüchse verhindern sollen?
Angesichts dessen, was an dem Abend auf der Station los war, und der Bullen, die überall Chaos veranstalteten, ging ich allerdings davon aus, dass die Pflegekräfte gerade viel zu beschäftigt waren, um sich um ein paar harmlose Besuche in anderen Zimmern zu kümmern. Deshalb klopfte ich eine halbe Stunde, nachdem ich ins Bett gesteckt worden war, leise an ein paar Türen und holte L wie Learner und Donna in mein Zimmer, um zu hören, was sie von all dem hielten.
»Er hat sich ja wohl selbst umgebracht, oder.« Das war keine Frage von Donna.
»Naheliegendste Erklärung«, sagte L. In einem teuren Pyjama mit aufgestickten Sternen, den ihr die Eltern von zu Hause mitgebracht hatten, saß sie am Fußende meines Bettes und bürstete sich die Haare. »Ich glaube, in letzter Zeit war er nicht besonders glücklich.«
L wie Learner ist reizend, aber selbst wenn man das Heroin und den Blödsinn mit der Scheibenerde abzieht, ist sie nicht das schärfste Messer in der Schublade. »Wie viele Menschen hier drin sind denn glücklich?«, fragte ich.
»Hm, tja … Noch weniger glücklich als sonst, meinte ich.«
»Der hat sich umgebracht«, sagte Donna. »Logisch.«
»Und wie hat er das bitte gemacht?« Ich sah mich im Zimmer um, das identisch mit den anderen neunzehn auf der Station war. Ein Einzelbett, ein schmutziges Fenster hinter einem reißfesten Vorhang. Ein wohlweislich so schwerer Stuhl, dass niemand ihn umkippen konnte. Ein Schrank mit drei Fächern und nichts, woran man irgendwas aufhängen konnte.
Schon gar nicht sich selbst.
»Wenn man es unbedingt will, schafft man es auch«, sagte Donna.
Ausgerechnet Donna, die Geherin, die hier war, weil sie unzählige Male gedroht hatte, es zu tun. Die seit mehreren Jahren die langsamste und grausamste Methode anwandte. Ich sah sie an, wie sie auf einem Stuhl hockte, der wahrscheinlich dreimal so schwer war wie sie. Handgelenke, die ein Baby umfassen könnte, ein stricknadeldünnes Schlüsselbein unter ihrem schäbigen rosa Nachthemd. »Weiß nicht, ob das stimmt«, sagte ich.
Sich hier drin umzubringen, ist tatsächlich unglaublich schwierig, und es wird wohl niemanden wundern, dass das mit Absicht so ist. Wer als gefährdet eingestuft wird, wird nicht aus den Augen gelassen, nicht eine Minute. Außerdem wird einem dauerhaft alles verwehrt, mit dem man sich verletzen könnte; auch wenn man zum ersten Mal hier ist, wenn man den Laden erst mal kennenlernt und das Personal einen noch nicht einschätzen kann, nehmen sie einem alles weg, was als gefährlich erachtet wird.
Als ich in der ersten Nacht endlich aufhörte zu heulen und jede Schwester zu treten, die so dumm war, sich mir zu nähern, nahmen sie mir alles Mögliche ab.
Meine Turnschuhe (Schnürsenkel, logisch).
Meinen Gürtel (okay).
Nagelschere (leuchtet ein).
Pinzette (nervig).
Einen BH mit Drahtbügeln (war’n Witz).
Sie kassieren auch das Handy ein, dabei habe ich keine Ahnung, wie man sich mit einem Samsung umbringen soll. Vielleicht haben sie Angst, dass man sich damit erstickt oder einen Auftragsmörder anruft, der den Job erledigt, aber fairerweise muss gesagt werden, dass man das Handy nach ein paar Tagen zurückbekommt, falls nichts dagegenspricht.
Dem Himmel sei Dank, oder?
Wenn ich kein Handy haben dürfte, würde ich mich vielleicht wirklich umbringen wollen.
»Was glaubst du denn, was passiert ist, Al?«, fragte L wie Learner.
Ich sagte ihr nicht, was ich dachte, weil ich, ehrlich gesagt, mehr Angst hatte als alles andere. Ich war aufgeregt, nicht falsch verstehen, meine professionellen Instinkte meldeten sich, aber ich war … misstrauisch. In dem Moment, wo nur wenige Meter entfernt eine Leiche lag, war es erst mal nur ein Gefühl, und vor Gefühlen nahm ich mich aus gutem Grund in Acht. Vor achtzehn Monaten hatte ich das Gefühl gehabt, der Cracksüchtige, der uns in seine Wohnung auf der Mile End Road ließ, sei harmlos. Wäre ich damals vorsichtiger gewesen, hätte ich jetzt keine PTBS und hätte kein Bedürfnis nach all den Dingen gehabt, die ich geschnupft, eingeworfen und in meinen Körper geschüttet hatte, um den Schmerz zu betäuben. Dann hätte ich nicht irgendwann geglaubt, dass die Menschen, die ich am meisten liebe, mich umbringen wollen oder dass Fremde meine Gedanken lesen können. Dann hätte ich niemandem wehgetan.
Während ich L ansah, begann ich leicht zu zittern. Ich versuchte zu lächeln und schob die Hände unter die Oberschenkel, damit sie das Zittern nicht bemerkte.
Ich sagte: »Ich weiß es wirklich nicht.«
Es war ein Gefühl gewesen, das mich hergebracht hatte.
4
Die Fleet-Station (momentan das Zuhause meiner We-nigkeit) liegt direkt gegenüber der Effra-Station, eine von vier psychiatrischen Akutstationen im bemerkenswert kaputten und unansehnlichen Shackleton-Block – der engagierten Einrichtung für psychisch Kranke am Städtischen Krankenhaus von Hendon. Fleet – keine Ahnung, was es mit dem Namen auf sich hat; soll was mit unterirdischen Flüssen in London zu tun haben – ist eine gemischte Station, die bis zu einundzwanzig Patientinnen und Patienten aufnehmen kann, durchschnittlich aber zwischen fünfzehn und achtzehn beherbergt. Normalerweise beträgt das Verhältnis von Frauen zu Männern mehr oder weniger fünfzig zu fünfzig. Das gilt für die freiwilligen Patienten, auch Informelle genannt, ebenso wie für jene, die bei der Einweisung kein Mitspracherecht hatten.
Die tretend und schreiend hergeschleppt wurden.
Oder die man unter einem Vorwand herbrachte.
Oder die sich nicht mal mehr an ihre Einlieferung erinnern.
Ich hänge eigentlich nicht viel mit denen rum, die freiwillig hier sind, weil ich es irgendwie sinnlos finde, sie kennenzulernen. Meistens sind sie eh nur ein paar Tage da, und manche kommen nur, weil sie obdachlos sind, mal ein paar Nächte in einem Bett schlafen und viermal täglich was zu essen bekommen wollen. »Drehtürpatienten« sagen die Pfleger dazu. Rein, raus, dann wieder rein, wenn sie die Nase voll haben von Matratzen aus Pappkarton und von Arschlöchern, die sie mitten in der Nacht anpinkeln. Wenn ihnen alles zu viel wird oder wenn es einen Kälteeinbruch gibt.
Um den Leuten nicht Unrecht zu tun: Sie sind wahrscheinlich genauso fertig wie wir alle, aber für die Sache mit Kevin und all das, was danach passierte, sind sie nicht so wichtig.
Deshalb halte ich mich fürs Erste an diejenigen, die zu der Zeit da waren und es in den meisten Fällen auch jetzt noch sind. Die Abgedrehtesten der Abgedrehten, die mich ironischerweise davor bewahren, verrückt zu werden. Meine kaputten Kollegas von der Fleet-Station. Meine besten Freunde und immer mal wieder auch meine ärgsten Feinde. Meine Sippe … meine Familie.
Die wilde Ballaballa-Bande von durchgeknallten Typen, mit denen ich abhänge.
Die Zwangseingewiesenen …
Und so habe ich nun die Ehre – um mich ein wenig gewählter auszudrücken –, die Damen und Herren des Chors vorzustellen.
Zuerst die Männer, denke ich, weil das relativ viele sind.
KEVIN. Ist … nun ja, tot, so viel steht fest, aber ich finde es irgendwie nicht richtig und auch gemein, dass er nur das Opfer sein soll und man nichts weiter über ihn erfährt. Er war zehn Jahre jünger als ich und ein großer West-Ham-Fan, tja, was soll man machen … Er hatte »Probleme«, logisch, und man kann mal gepflegt davon ausgehen, dass jeder, den ich hier beschreibe, eine Menge Probleme hat, deshalb werde ich das blöde Wort nicht wieder in den Mund nehmen. Kevins Thema waren seine Eltern, meine ich, auch wenn er nie Genaueres erzählt hat. Er war einer der Nettesten hier. Manchmal zu nett, wenn ich ehrlich bin, womit ich sagen will, dass er auch ausgenutzt wurde und nicht genug für sich eingetreten ist, was man hier einfach tun muss. Ich glaube, bevor er herkam, war er Skinhead, und ich weiß noch, wie breit er grinste, als er mir seine Tattoos zeigte. Er hatte ein schönes Lächeln. Ich habe nie erfahren, warum er auf der Fleet-Station landete, was passiert ist, bevor er zwangseingewiesen wurde, ich weiß nur, dass er mit Drogen zu tun hatte, wahrscheinlich auch hier drin … tja, dazu kommen wir noch.
Außerdem war er körperlich fit, das habe ich vergessen zu erwähnen.
GRAHAM, auch der Warter genannt. Ich muss wohl kurz darauf hinweisen, dass ich mir sämtliche Spitznamen selbst ausgedacht habe und die meisten Betroffenen nichts davon wissen. Ich konnte mir noch nie gut Namen zu Gesichtern merken, und die Spitznamen haben mir am Anfang geholfen zu behalten, wer wer ist, und jetzt nehme ich manchmal die richtigen Namen und manchmal meine erfundenen, das hängt von meiner Stimmung und meinem Erinnerungsvermögen ab oder davon, wie zugedröhnt ich bin – was sich nämlich gerne auf beides auswirkt. Der Warter ist nicht gerade der genialste Spitzname, das ist mir klar, aber er passt. Graham ist der Warter, weil er wartet, ganz einfach. Er macht die ganze Zeit nichts anderes. Man weiß immer, wo Graham gerade ist, weil er, wenn er gefrühstückt hat, an der Medikamentenausgabe steht und darauf wartet, dass sie öffnet. Sobald er seine Tabletten genommen hat, steht er vor dem Speisesaal und wartet darauf, dass das Mittagessen serviert wird. Dann geht es zurück zur Medikamentenausgabe, dann wieder zum Speisesaal, Medikamentenausgabe, jeden Tag dieselbe beknackte Reihenfolge. Man gewöhnt sich daran, dass er einfach dasteht und vor sich hin starrt, immer der erste in der Schlange, selbst wenn er eine halbe Stunde zu früh ist. Als mir das allmählich auf den Sender ging, bin ich mal zur Medikamentenausgabe marschiert (die erst in ungefähr einer Stunde aufmachen sollte) und habe ihn gefragt, was zum Teufel er da zu suchen hätte, was das werden sollte. Er sah mich an, als sei ich bescheuert und meinte: »Ich stehe nicht gerne in der Schlange.«
Graham muss auf die fünfzig zugehen und trägt nie etwas anderes als den schicken blassblauen Pyjama in der limitierten Sonderauflage der Fleet-Station. Er ist sehr groß und dünn; ein bisschen … spinnenhaft. Sein Gesichtsausdruck ist immer gleich, er ist nicht sehr gesprächig. Die Unterhaltung an der Medikamentenausgabe könnte tatsächlich eine der längsten sein, die ich je mit ihm geführt habe.
ILIAS, auch der Großmeister genannt. Wegen des Schachs, schon klar, oder? Grieche, glaube ich, vielleicht auch Türke. Ilias ist Mitte dreißig, schätze ich mal … dunkelhäutig, vierschrötig und stark behaart. Das weiß ich, weil er gern ohne Oberteil herumläuft, manchmal auch ohne Hose, egal wie oft das Personal ihm sagt, das sei nicht schicklich. Beim kleinsten Anlass kann er die Beherrschung verlieren, und dann glaubt man, er würde einen abgrundtief hassen, doch zehn Minuten später weint er und nimmt einen in den Arm. Das ist ehrlich gesagt reichlich verwirrend. Ich spreche von heftigsten Stimmungsschwankungen, wenn man nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist. Ich bin keine Expertin, würde aber schätzen, dass er ein astreiner Schizo ist; also hochgradig bipolar. Auf jeden Fall kann er von allen Leuten hier den seltsamsten Scheiß veranstalten, und zwar total aus dem Nichts. Sachen, über die man sich totlacht, dann wieder Dinge, nach denen man sich am liebsten länger unter eine heiße Dusche stellen würde. Trotzdem ist er meistens ein großes dummes Hündchen, und wenn jemand fragte, würde ich sagen, dass Ilias mein Kumpel ist und ich ihn für mehr oder weniger harmlos halte. Sicher, keiner hier drin ist absolut harmlos, ich meine, fragt mal Kevin, aber ist klar, was ich damit sagen will, oder?
Er ist so gut wie harmlos.
ROBERT, auch Big Gay Bob genannt. Robert ist ungefähr – keine Ahnung – um die vierzig und nicht besonders groß. Eigentlich ist er sogar eher klein und ziemlich kahl auf dem Kopf, und ich habe keinerlei Beweise, dass er auch nur im Entferntesten schwul wäre, aber manchmal heißt man trotzdem so. Es gehört hier nämlich zum Allgemeinwissen, dass Bob unablässig von den Frauen erzählt, mit denen er geschlafen hat. Ich schwöre, er hat nichts als Sex im Kopf, und wenn man aus Versehen mal länger mit ihm spricht – er unterhält sich ganz gern –, kann man selbst an nichts anderes mehr denken. Ich schwöre, man könnte ihn auf alles Mögliche ansprechen – Fußball, Dampfmotoren, auf den Scheißholocaust –, er würde immer eine Möglichkeit finden, dem Gegenüber auf die Nase zu binden, dass er in einem Hotelzimmer in Brighton mal was mit einer Blondine mit »ordentlich Holz vor der Hütte« hatte oder mal eine »sexy Rothaarige« auf dem Parkplatz eines Pubs in Leeds vernascht hat. Das soll nicht heißen, dass Bob schmierig ist, ist er nämlich nicht. In erster Linie ist es komisch, ein bisschen wie in der Filmreihe Ist ja irre. Bloß machte irgendwann eine der Frauen – könnte Lauren gewesen sein – die Bemerkung, wenn man ständig über seinen Erfolg beim anderen Geschlecht prahle, sei das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass man sich in Wirklichkeit für das eigene interessiere. Ein Fall von verhindertem Outing oder so. Da kam der Spitzname das erste Mal aus Spaß auf den Tisch und blieb hängen. Ist nicht so ernst gemeint, und tatsächlich scheint er Bob sogar zu gefallen, er spielt manchmal selbst darauf an, als sei er insgeheim froh, so was wie eine … Identität zu haben.
Und tatsächlich finde ich, dass er wirklich ziemlich tuntig rüberkommt.
SHAUN, auch das Schaf genannt. Ja, er kommt aus Wales, also sorry, wenn das etwas vorhersagbar ist, aber der Spitzname passt wie die Faust aufs Auge, weil Shaun ein … nun ja, ein Mitläufer ist, ja? Er gehört zu den Jüngeren hier, und ich glaube, er ist ein klein bisschen verloren, aber er tut so gut wie alles, was man ihm sagt, und er glaubt auch alles. Buchstäblich alles. Zum Beispiel, dass ich in Wirklichkeit Multimillionärin bin. Und bei Love Island mitgemacht habe. Egal, was. Wer weiß, ob er auch so leichtgläubig war, bevor das passierte, was er erlebt hat, aber irgendwas muss das mit seiner Birne angestellt haben. Jetzt ist es so, als sei dort ein leeres Blatt oder eine Masse, die andere so drehen und formen können, wie es ihnen passt.
Außerdem muss man wissen, dass Shaun ein bisschen dünnhäutig sein kann. Fast jeden Tag kommt er an und präsentiert irgendeine winzige Stelle an seinem Kinn – einen Pickel oder so – und fragt: »Muss ich sterben? Muss ich sterben? Muss ich sterben?« Wenn man ihm versichert, dass er in nächster Zeit nicht abnippeln wird, ist er wieder obenauf, aber eine halbe Stunde später bekommt er erneut Panik und fragt wieder nach. Ich meine, meine Mutter ist eine kleine Hypochonderin, aber das ist echt nichts im Vergleich zu Shaun.
Damit will ich nicht sagen, dass er dumm ist, wirklich nicht, wahrscheinlich ist er sogar der Mensch, mit dem ich die nettesten Gespräche hier führe … die normalsten Gespräche. Genau genommen ist er verdammt süß, auch wenn er eine Zeit lang ganz schön fertig war wegen der Sache mit Kevin. Die beiden standen sich nah, das kann ich ruhig sagen. Ich hatte gedacht, sie wären einfach Kumpel, bis ich irgendwann mittags mal sah, wie Shaun unter dem Tisch im Speisesaal die Hand an Kevins Schwanz hatte, weshalb man wohl verstehen kann, dass er nach Kevins Tod ein bisschen neben der Spur war. Ist er eigentlich immer noch. Er weint auch immer noch. Viel.
TONY, auch Das Ding genannt. Also, was man sich über Das Ding auf jeden Fall merken muss, ist, dass Tony nicht wirklich das Ding ist. Er wird nur Das Ding genannt, weil er von dem Ding besessen ist. Das Ding macht ihm vierundzwanzig Stunden am Tag Todesangst. Das Ding ist … sein Ding. Man darf auch nicht vergessen, dass Tony einer ist, den viele Menschen ziemlich angsteinflößend finden würden. Er ist ein riesengroßer Kerl aus Croydon, der wie der Boxer Anthony Joshua aussieht, wenn der sich ein bisschen gehen lassen würde. Ehrlich, Tony ist ein Schrank von einem Mann, aber sobald man von dem Ding spricht … ernsthaft, sobald man das Wort auch nur flüstert … wird er zu einem zitternden Wrack. Fängt an zu schreien, will aus dem nächsten Fenster springen, das volle Programm. Also … dieses Ding ist – in Tonys Augen – ein nicht näher definiertes böses Wesen, das ihm aus Gründen, die keiner von uns verstehen kann, geschweige denn will, nach dem Leben trachtet und – jetzt kommt der entscheidende Kniff – die besondere Macht hat, jedwede Form anzunehmen. Sich in alles und jeden zu verwandeln. Ich könnte das Ding sein, am nächsten Tag vielleicht jemand vom Personal. Oder ein Hund, ein Weberknecht, ein Paar Schuhe. Das Ding ist ein enorm mächtiger und unglaublich gerissener Gestaltwandler.
Meine ehemalige Mitbewohnerin Sophie hat mich hier mal besucht und saß zufällig ein paar Minuten allein mit Tony im Musikzimmer. Bis heute weiß ich nicht, was er zu ihr sagte, das sie so auf die Palme brachte, aber ein paar Tage später schickte sie ihm eine Postkarte, auf der stand: Lieber Tony, es war sehr schön, dich kennenzulernen. Ach, übrigens habe ich mich in diese Postkarte verwandelt. Einen schönen Tag noch. Alles Liebe, das Ding x
Danach kam Tony fast eine Woche lang nicht aus seinem Zimmer.
5
Ich kann nicht behaupten, dass es die erholsamste Nachtwar, die ich je hatte. Ich war viel zu aufgeregt wegen dem, was höchstwahrscheinlich am anderen Ende der Station vor sich ging, aber ehrlich gesagt schlief ich wohl auch deshalb so schlecht, weil ich auf meinem Handy alle halbe Stunde den Wecker gestellt hatte. Ich wollte unbedingt wissen, was los war.
Kann man doch verstehen.
Ich wollte nichts verpassen.
Als ich das erste Mal aus meinem Zimmer schlich, schickte mich Femi zurück ins Bett, kaum dass sie mich gesehen hatte. Ich machte keinen Aufstand, sondern sagte nur, ich müsse zur Toilette, und nachdem ich so lange auf dem Klo herumgehockt hatte, bis es ihr meiner Meinung nach zu langweilig geworden war, konnte ich ein paar Minuten lang entwischen. Dann hatte sie mich wieder am Wickel.
Augen wie ein Adler und Ohren wie ein Luchs hat die Frau.
Der Gang, auf dem Kevins Zimmer lag, war mit Flatterband abgesperrt. Allein beim Anblick des vertrauten blau-weißen Musters bekam ich ein Kribbeln im Bauch. Da flogen die Schmetterlinge direkt los, könnte man sagen. Kevins Zimmer lag am hinteren Ende, deshalb konnte ich nicht hören, was gesprochen wurde, und ich sah nur die eine oder andere Person, die in den betreffenden Raum ging oder ihn verließ, aber das war uninteressant. Mir war natürlich klar, was los war. Ich wusste, welche Phase gerade ablief.
Das Erstzugriffsteam war dran. Zwei Beamte wahrscheinlich, die den Tatort untersuchten, um festzustellen, ob der plötzliche Tod in irgendeiner Weise verdächtig war. Die entscheiden mussten, ob die Kriminalpolizei, die Spusi et cetera geholt werden mussten.
Direkt vor der Absperrung stand ein uniformierter Kollege, und ich nutzte die Gelegenheit, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Femi war wieder ins Dienstzimmer gegangen, und von der Stelle aus, wo ich stand, konnte ich sehen, wie sie mit George und Debbie Tee trank und sich unterhielt. Femi legte Debbie, die wegen des Leichenfunds noch erkennbar durcheinander war, die Hand auf die Schulter. Als ich sicher sein konnte, dass mich niemand bemerken würde, flitzte ich hinüber, um auszutesten, was ich aus dem Kollegen in Uniform herausbekommen konnte. Ich war im Guerrillamodus.
»Oh«, sagte er. Offenbar hatte man dem armen Kerl gesagt, alle Patienten lägen auf ihren Zimmern im Bett, denn er hatte nicht den geringsten Schimmer, was er mit mir anfangen sollte. Er zuckte sogar leicht zusammen und sah sich hilfesuchend um.
»Und, was meinen Sie?«, fragte ich. »Wie wird das Erstzugriffsteam entscheiden?«
»Wie bitte?«
»Schon gut«, sagte ich. »Bin ’ne Kollegin.«
Er registrierte, dass ich ihm in schäbigem Bademantel und Schlappen geschäftig zunickte. »Ja, natürlich«, sagte er und winkte, um jemanden im Dienstzimmer hinter mir auf mich aufmerksam zu machen.
Am liebsten hätte ich ihm eine geknallt, aber ich wusste, dass ich mir damit keinen Gefallen tun würde, außerdem hatte ich nicht viel Zeit. Aus Kevins Zimmer kam ein Polizist.
Ich hob die Hand und rief an dem Uniformierten vorbei: »Richten Sie Brian Holloway viele Grüße von Al aus!«
Mein Chief Inspector. Einer der Anständigen. Und ein guter Kumpel.
Der Polizist am hinteren Ende des Gangs schaute kurz herüber, ignorierte mich und verschwand wieder in Kevins Zimmer. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte. Hendon liegt nicht im Zuständigkeitsbereich meiner Dienstgruppe, weshalb ich wahrscheinlich eh keinen von den Leuten hier kannte, so wie es quasi ausgeschlossen war, dass sie einen von meinen direkten Kollegen kannten. Trotzdem war es ärgerlich.
Ich wandte mich wieder an den Uniformierten. »Holloway ist mein Leiter«, sagte ich. »Wir haben gemeinsam an vielen Fällen gearbeitet.«
Der Typ streckte die Arme aus und stellte sich in seinen Quadratlatschen breitbeinig hin, als rechnete er damit, dass ich jeden Moment an ihm vorbeizischte. Er wusste immer noch nicht, wie er mit mir umgehen sollte, das lag auf der Hand, doch bevor ich es ihm noch schwerer machen konnte, kamen Femi und George und retteten ihm den Arsch. »Kommen Sie, Alice!«, und »Zurück ins Bett, so ist es brav …«
Ungewollt musste ich über die Erleichterung in seinem marionettenhaften Gesicht grinsen, als ich wie ein sehr braves Mädchen zurück zu meinem Zimmer trottete. Es störte mich nicht allzu sehr, weil ich eh wusste, wie es weiterging. Die nächsten Schritte auf dem kritischen Pfad der Ermittlung.
Die Schritte war ich viele Male selbst durchgegangen.
Die hohen Tiere kämen schon früh genug, und wenn es so weit war, würde ich da sein.
Hier drin festzusitzen hat mein Zeitgefühl möglicherweise ein bisschen beeinträchtigt, weil sich die ganze Geschichte deutlich schneller entwickelte als gedacht. Das wurde mir klar, als ich ungefähr eine Stunde später – ich hatte beschlossen, etwas länger zu warten, falls Femi und die anderen den Gang im Auge behielten – noch mal aus meinem Zimmer schlich. Das Nervigste war, dass ich verpasst hatte, wie Kevins Leiche weggebracht wurde, und zwar nicht, weil ich irgendwie pervers drauf wäre, sondern weil dieser Moment für einen Cop von Bedeutung ist. Sollte er jedenfalls sein. Hat was mit Respekt zu tun, außerdem hatte ich als Mensch, dem das Opfer etwas bedeutet hatte – ich war bereits zu dem Schluss gekommen, dass Kevin ermordet worden war –, keine Ahnung, wann oder ob überhaupt jemand von uns die Möglichkeit bekommen würde, sich richtig von ihm zu verabschieden.
Ich hatte dabei sein wollen, wenn der Leichensack rausgetragen wurde.
Inzwischen waren die Forensik-Fuzzis an der Arbeit. Sie kamen und gingen wie die von der Mordkommission in Plastikoveralls und Stiefeln, hatten ihre Ausrüstung und ihre Spurensicherungsbeutel dabei. Es war aber leicht, sie auseinanderzuhalten, weil die Detectives wie immer hauptsächlich rumstanden und quatschten, während sie genervt darauf warteten, dass die Spusi fertig wurde. Ich hatte eine Stelle gefunden, direkt hinter der Tür zum Speisesaal, wo mich keiner aus dem Dienstzimmer sehen konnte. Von dort beobachtete ich, wie einer von der Spurensicherung nach draußen ging. Ich nahm an, dass die Einsatzwagen vor dem Haupteingang standen. Der Mann – für eine Frau war er zu breit gebaut – gab dem Dienstzimmer ein Zeichen und wartete dann vor der Schleuse, bis ihm jemand vom Personal aufmachte. Eine Minute später kam Malaika – eine der Pflegekräfte – schlüsselschwenkend auf ihn zugelaufen.
»Entschuldigung«, sagte sie.
»Eilt nicht«, sagte der Typ von der Spusi.
Jedenfalls nicht beim armen Kevin.
Die gute halbe Minute, als der Techniker in der Schleuse stand und darauf wartete, auf der anderen Seite rauszukönnen, war wie in einem Science-Fiction-Film. Ich stellte mir vor, dass er ein Astronaut war, der in die Schwärze des Alls oder auf die Plattform einer Raumstation treten würde, nicht einfach in den düsteren braunen Eingangsbereich des Krankenhauses oder in den miesen Fahrstuhl, der ihn runter auf den Parkplatz brachte. Ich weiß noch, wie ich dachte, es wäre doch lustig, das den anderen zu erzählen. Wie ich mir überlegte, wer das am coolsten fände. Shaun könnte ich wahrscheinlich sogar wirklich weismachen, ich hätte einen Astronauten gesehen.
Ich überlegte auch, was genau der Spusi-Techniker in der Styropor-Kiste aus Kevins Zimmer getragen und weggebracht hatte. Vielleicht eine Waffe? War viel Blut im Zimmer? Debbie jedenfalls hatte geschrien, als hätte sie was Furchtbares gesehen, und eins stand fest: Man muss schon einiges auffahren, damit eine Krankenschwester aus der Psychiatrie Schiss bekommt.
Ein Messer leuchtete ein, fand ich. War nicht allzu schwer, eins aus der Küche zu stibitzen oder von draußen reinzuschmuggeln. Klar, wenn man Ausgang hat, sollte man anschließend durchsucht werden, aber wenn sie einen wirklich mal abtasten, machen sie das immer eher … nun ja, oberflächlich.
An jedem normalen Flughafen wird härter kontrolliert.
Als ich den Blick von der Schleuse abwandte, merkte ich, dass neben der Herrentoilette ein Detective stand, der zu mir rüberguckte, deshalb schlenderte ich für alle sichtbar zu ihm, die Hände in den Taschen meines Bademantels vergraben, und sprach ihn in dem Bewusstsein an, dass mir nicht viel Zeit blieb.
»Wer ist der leitende Ermittler?«, fragte ich.
»Wie bitte?« Er hatte die Kapuze runtergenommen, ich sah seine Verwirrung. Er war Mitte vierzig, hatte einen rasierten Kopf und trug eine Brille. Wie ein Hooligan, der einen auf intelligent macht.
»Ist nur, weil … Sie können Ihrem Vortänzer ausrichten, dass ich mich zur Verfügung halte, falls was sein sollte.«
»Gebe ich weiter«, sagte er.
Es war schwer zu sagen, ob er sich über mich lustig machte, aber ich beschloss, im Zweifelsfall für ihn zu entscheiden. »Ich habe Infos, richten Sie das bitte aus.«
»Gut zu wissen.«
»Insider-Informationen.«
»Okay.«
Ich nickte, er nickte zurück. Ich sagte: »Sie wissen, wo Sie mich finden, oder?«
Leider zeigte sich kurz darauf, dass auch Femi und George wussten, wo ich zu finden war. Sie tauchten hinter dem Detective auf, der sofort zur Seite trat, als ihm klar wurde, was ablief.
»Alice«, sagte Femi. »Was machen Sie hier?«
Kopfschüttelnd streckte ich ihr meine Handgelenke hin, als wartete ich darauf, Handschellen angelegt zu bekommen. Ich schielte zu dem Cop hinüber, um zu sehen, ob er es witzig fand, doch er fand es kein bisschen lustiger als Femi und George.
George führte mich zu meinem Zimmer zurück. Er sagte: »Langsam wird das albern, meine Liebe. Sie wissen schon, dass wir es hier mit einer sehr ernsten Angelegenheit zu tun haben, oder?«
»Natürlich weiß ich das. Was glauben Sie, warum ich hier bin?« Ich drehte mich noch mal zu dem Detective um, der verfolgte, wie ich weggebracht wurde. Ich schüttelte den Kopf, als wollte ich sagen: Ist das nicht lächerlich? Die raffen es einfach nicht.
Als wir vor meinem Zimmer standen, sagte George: »Wenn wir Sie noch einmal außerhalb Ihres Zimmers finden, haben Sie ein Problem. Verstanden?«
Ich wusste, dass er von einer Änderung meines Beobachtungsstatus sprach. Damals war ich auf stündliche Beobachtung gesetzt, wie die meisten hier, aber das konnte sich schnell zu viertelstündlichen Intervallen ändern, wenn George glaubte, dass ich den Pflegern auf der Nase herumtanzte, auch zu durchgängiger Beobachtung und sogar zu der gefürchteten 1:1-Betreuung, was bedeutete, dass die ganze Zeit jemand bei mir im Zimmer war. Niemand, der ganz richtig im Kopf war, wollte 1:1.
Ich sagte ihm, ich hätte es voll und ganz verstanden, und beugte mich vor, um Femi in den Arm zu nehmen.
»Sie wird sich schon zusammenreißen«, sagte Femi. »Stimmt’s?«
Als ich meine Zimmertür eine halbe Stunde später vorsichtig öffnete, saß Femi davor und lächelte mich an. Eine weitere halbe Stunde später war sie immer noch da und machte sich nicht mal die Mühe, von ihrer Zeitschrift hochzuschauen. Ich sagte ihr, sie sei eine blöde Kuh, knallte die Tür zu und schrie ein bisschen herum, aber ich wusste, dass sie nicht verschwinden würde.
Den Rest der Nacht schlief ich nicht viel, aber ich versuchte nicht noch mal, mein Zimmer zu verlassen.
Das war nicht tragisch, denn ich hatte gesehen, was ich sehen musste. Ich hatte an der richtigen Stelle ein Wort eingelegt, ich hatte auf mich aufmerksam gemacht. Ich strampelte die Decke von mir, lag wach und dachte an Kevin, an meinen ehemaligen Kollegen Johnno und an Messer, die sich in Bäuchen drehten. Ich schloss die Augen und versuchte mir vorzustellen, wie es sich wohl anfühlte, dieses Messer zu sein. Reinzugleiten und sich zu drehen, hart, scharf und glitschig.
Ich wusste, dass Kevins Zimmer am nächsten Morgen versiegelt sein würde und das Personal sein Bestes tun würde, um wieder Normalität einkehren zu lassen. Ilias, Lauren und der Rest der Bande würden herumlungern, neugierig, aber kein Stückchen schlauer. Ich wusste, dass das Absperrband bis dahin abgenommen sein würde und alle wichtigen Beweismittel asserviert und weggesperrt wären. Ich wusste, dass der Erstzugriff gelaufen war.
Aber das war in Ordnung. Alles gut.
Denn ich wusste, sie würden wiederkommen.
6
Man kann über die Fleet-Station sagen, was man will –und ich habe mit Sicherheit eine Menge zu dem Thema beizutragen –, aber wenn es um die Vielfalt des Frühstücksbüffets geht, stellt sie die meisten anderen Einrichtungen in den Schatten. Eine lediglich fünfzehnsekündige pittoreske Strecke vom Speisesaal zur Medikamentenausgabe bietet allen Gästen die Möglichkeit, ihren Tag mit einem flotten Benzodiazepin zu beginnen, nachdem sie sich ihre Frosties reingeschaufelt haben. Jemand anders mag vielleicht einen ausgeklügelten Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bevorzugen – die perfekte Ergänzung zu leichterer Kost wie Obst oder Gebäck (momentan nicht im Angebot); und für diejenigen, die eine eher ungewöhnliche Sicht auf die Dinge haben, gibt es passgenaue Antipsychotika, die maßgeschneiderte Ergänzung zu einem full English breakfast, das einem zehn Jahre der Lebenserwartung nimmt und einen Wachstumsschub bei der Brustbehaarung auslöst.