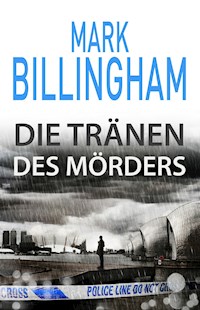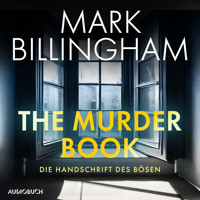Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tom Thorne
- Sprache: Deutsch
Einen Toten erkennt Detective Inspector Tom Thorne sofort, und das Foto auf seinem Handy ist eindeutig das einer Leiche. Nur wer ist dieser Mann, und warum hat man Thorne dieses Bild zugeschickt? Weitere Todesnachrichten folgen, und die Spur führt zu einem erst kürzlich entlassenen Häftling. Dessen Familie wurde durch einen angeblichen Autounfall getötet. Doch daran glaubt er nicht – er will Rache. Und Thorne weiß, dass es keinen gefährlicheren Killer gibt, als einen, der nichts zu verlieren hat …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Das Blut der Opfer
Das Blut der Opfer
© Mark Billingham 2007
© Deutsch: Jentas A/S 2021
Serie: Tom Thorne
Titel: Das Blut der Opfer
Teil: 7
Originaltitel: Death Message
Übersetzer: Isabella Bruckmaier
© Übersetzung : Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-2030-8
Tom Thorne
#1 – Der Kuss des Sandmanns
#2 – Die Tränen des Mörders
#3 – Die Blumen des Todes
#4 – Blutzeichen
#5 – In der Stunde des Todes
#6 – Die Geliebte des Mörders
#7 – Das Blut der Opfer
#8 – Die Schuld des Blutes
–––
Für Claire —
wie alle anderen auch
Die Rache triumphiert über den Tod;
die Liebe verachtet ihn.
Francis Bacon
Prolog
Als er sie sah, wusste er sofort, das waren Bullen. Aber irgendwie wirkten sie so förmlich und steif, so merkwürdig verkrampft, dass es ihn tief in die Magengrube traf, ihm den Atem raubte, als er sich in den angebotenen Sessel fallen ließ.
Er sammelte den Speichel in seinem trockenen Mund und schluckte ihn hinunter, sah den beiden zu, wie sie vergeblich versuchten, locker zu wirken. Wie sie sich räusperten und ihre Stühle etwas näher rückten.
Bei dem Geräusch zuckten sie alle drei zusammen. Dieses furchtbare Kratzen und der Hall.
Sie schauten, als wären sie gegen ihren Willen in diesem Raum gelandet. Wie Schauspieler im falschen Stück. Die beiden taten ihm beinahe leid, als sie Blicke wechselten und er spürte, wie der Schrei sich tief in ihm aufzubauen begann.
Die Polizisten stellten sich vor. Der Mann — der Kleinere von den beiden — machte den Anfang, gefolgt von seiner Kollegin. Die beiden legten Wert darauf, ihm ihre Vornamen zu nennen, als wäre das eine Hilfe.
»Es tut mir leid, Marcus, wir haben schlechte Nachrichten.«
Er achtete nicht auf die Namen, nicht wirklich, starrte nur auf die Köpfe, registrierte Details, an die er sich bestimmt noch lange erinnern würde: einen schmuddeligen Kragen, das feine Adernetz auf einer Säufernase, gefärbte Haare und die schwarz nachwachsenden Haarwurzeln.
»Angie«, sagte er. »Es geht um Angie, stimmt‘s?«
»Es tut mir leid.«
»Sagen Sie es mir.«
»Es gab einen Unfall.«
»Einen schlimmen ...«
»Das Auto bremste nicht.«
Und während er zusah, wie ihre Lippen die Worte formten, erhob sich über den Lärm in seinem Kopf ein einziger banaler Gedanke, wie eine ferne Stimme, die trotz des Rauschens des schlecht eingestellten Radiosenders gerade noch hörbar war.
Deshalb haben sie die Frau geschickt. Weil Frauen angeblich einfühlsamer sind. Oder weil sie glauben, ich breche dann vielleicht nicht zusammen oder werde hysterisch ...
»Was war mit dem Auto?«, fragte er.
Der Polizist nickte, als hätte er diese Frage erwartet und fühlte sich bei der Beantwortung technischer Fragen wohler. »Wir glauben, der Fahrer fuhr über die Ampel und konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem Zebrastreifen bremsen. Wahrscheinlich zu viel Alkohol. Wir haben keine besonders gute Beschreibung, aber wir haben Lackspuren.«
»An Angies Leiche?«
Der Bulle nickte langsam und holte noch einmal ordentlich Luft. »Wir fanden den Wagen am nächsten Morgen ausgebrannt, ein paar Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Wahrscheinlich Hooligans, die sich den Wagen für eine Fahrt gestohlen hatten ...«
Die Luft im Raum war stickig, es roch nach Farbe. War wohl erst frisch gestrichen worden. Schlaf fiel ihm ein und wie es wohl wäre, nassgeschwitzt aus einem Alptraum aufzuwachen.
»Wer kümmert sich um Robbie?« Er sah zu dem Mann, als er die Frage stellte. Peter Irgendwas. Der wich seinem Blick aus, und er spürte, wie es ihm die Brust zerriss.
»Es tut mir leid«, sagte die Frau. »Ihr Sohn war zur Zeit des Unfalls mit Miss Georgiou zusammen. Der Wagen erfasste beide.«
»Sie wurden noch am Unfallort für tot erklärt.« Der Mann hatte die ganze Zeit die Hände verkrampft, nun spielte er mit seinem Ehering. »Sie mussten nicht lange leiden, verstehen Sie?«
Er starrte auf den Daumen und den Zeigefinger des Polizisten, die den Ring drehten und drehten. Ihn fröstelte, das Blut gefror ihm in den Adern, die daraufhin unter seiner Haut aufsprangen. Er spürte das Blut zu schwarzem Pulver werden, unter seinen Tattoos und dem gelblichen Fleisch rieseln, als wäre er schon sehr, sehr lange tot.
»Okay dann«, sagte die Frau und meinte damit: Gott sei Dank, das wär‘s. Können wir jetzt endlich verschwinden?
Er nickte und meinte: Ja und danke, und verschwindet bitte sofort, bevor ich euch meinen Kopf in das Gesicht ramme — oder gegen die Wand oder den Boden.
Auf dem Weg zur Tür, wo der Aufseher bereits wartete, schienen sämtliche Sinne kurze Zeit auf Hochtouren zu arbeiten, bevor sie heruntergefahren wurden.
Die Risse im Anstrich der Ziegelwand taten sich Abgründen gleich auf, und er musste der Versuchung widerstehen, die Finger hineinzustecken. Der Stoff seiner Jeans rieb bei jedem Schritt grob an seinen Beinen. Und das Flüstern der beiden Polizisten auf der anderen Seite des Raums war klar und verständlich — übertönte geradezu ohrenbetäubend den Lärm seiner Schritte und des gurgelnden Wassers in den Heizkörpern.
»Wann kommt er raus?«
»In ein paar Wochen, glaub ich.«
»Dann muss er bei den Beerdigungen wenigstens keine Handschellen tragen ...«
Erster Teil
»Senden«
Erstes Kapitel
Er glaubte der alten Frau nicht, dass sie das Ass hatte. Tom Thorne ließ sich keine Sekunde lang hinters Licht führen von ihrem Nette-Omi-Lächeln und ihrer Brille, ihrer Zuckerwattefrisur und der adretten Handtasche im Schottenkaro. Auch dem Typen im Smoking mit dem kantigen Kinn, den er vor ein paar Runden mit seinem Bluff hatte auflaufen lassen, glaubte er kein Wort. Ein Zehnerpärchen, mehr hatte der nicht.
Thorne setzte fünfzehn Dollar. Mit dem Ass, das er auf der Hand hatte, hätte er ein Pärchen. Andererseits lagen drei Herzen auf, und da wollte er denen einen Schuss vor den Bug geben, die auf einen Flush spekulierten.
Zuerst stieg der Typ im Smoking aus, dann der Kerl mit der Glatze, der die ganze Zeit auf einer dicken Zigarre herumkaute.
Nur noch Thorne und die alte Lady waren übrig. Sie ließ sich Zeit, legte dann aber doch ihr Blatt weg und überließ ihm die fünfundzwanzig Dollar im Pot.
Das war die Crux beim Online-Poker. So echt die Spieler wirkten und so gut die Graphik war, es saßen immer dieselben Typen am Tisch. Soweit Thorne informiert war, war die alte Lady mit dem ungemein witzigen Namen Top Bluffa in Wahrheit ein pubertierendes Pickelgesicht aus dem Mittleren Westen Amerikas.
Thorne, der bei seinem Zocken im Internet als The Kard Kop firmierte, loggte sich seit ein paar Monaten bei Pokerpro.com ein. Es war ein harmloses Vergnügen, nicht mehr. Er hatte genug Opfer der Spielsucht gesehen, um zu wissen, dass einen Zocken ebenso teuer zu stehen kommen konnte wie Heroin und dass die leichte Verfügbarkeit online für Tausende im Lande fatal war. Er konnte damit nach einem langen Tag einfach wunderbar abschalten, nicht mehr. Oder, wie heute Abend, die Zeit totschlagen, während er auf Louise‘ Anruf wartete.
Er sah auf die Uhr und war überrascht, dass er bereits zweieinhalb Stunden spielte.
Ein Blick auf die untere Bildschirmleiste sagte ihm, dass er für heute Abend bereits vierzig Dollar im Plus war. Insgesamt bereits zweihundertfünfundsiebzig Dollar. Das war nicht übel, und vermutlich kam ihn das Zocken am Bildschirm, selbst wenn er ab und an verlor, noch immer billiger, als wenn er die Zeit im Royal Oak verbrachte.
Thorne stand auf und ging zur Stereoanlage. Er nahm die Laura-Cantrell-CD raus, die er gehört hatte, und suchte nach einem passenden Ersatz. Eine halbe oder eine Dreiviertelstunde wollte er noch spielen, bis zwei Uhr. Dann reichte es für heute Nacht.
Mit DI Louise Porter war er seit Ende Mai zusammen, seit einem Fall, an dem sie gemeinsam gearbeitet hatten. Thorne war ihrem Team bei der Kidnap Investigation Unit zugewiesen worden. Der Mullen-Fall hatte viele das Leben gekostet — und manche vielleicht sogar mehr als das Leben. Da waren Dinge geschehen, die nicht mehr wiedergutzumachen waren. Thorne und Louise waren mindestens so überrascht wie alle anderen, dass dieses Gemetzel für sie etwas Positives gebracht hatte und dass nach fünf Monaten noch immer keine Ermüdungserscheinungen zu erkennen waren.
Thorne zog eine Waylon-Jennings-Compilation heraus. Er legte die CD ein und nickte im Rhythmus der Gitarre zum Intro von »Only Daddy That‘ll Walk the Line«.
Es war schon nicht einfach für zwei Polizeibeamte aus verschiedenen Einheiten, überhaupt einigermaßen Zeit füreinander zu finden, aber Louise war überzeugt, dass die Sache eher frisch blieb, wenn man nicht ständig aneinanderklebte. Ihre kleine Wohnung war in Pimlico — ein ordentliches Stück entfernt von Thornes noch kleinerer Wohnung in Kentish Town. Und obwohl sie in der Regel eine oder zwei Nächte in der Woche miteinander in der einen oder anderen Wohnung verbrachten, meinte Louise, es sei gut, dass die beiden Wohnungen so weit voneinander entfernt seien. Gut gegen die Angst, die Unabhängigkeit zu verlieren oder sich in- und auswendig zu kennen. Oder auch nur davor, sich zu langweilen.
Thorne waren diese Ängste zwar nicht fremd, aber er hatte Louise trotzdem gefragt, ob sie sich nicht vielleicht etwas zu viele Gedanken mache. Nach ein paar Monaten hatten sie im Bengal Lancer einen Kaffee getrunken und sich über die Wohnungssituation unterhalten. Und das hatte bedrohlich nach einer Einsatzbesprechung geklungen. Thorne hatte sich über den Tisch gebeugt, ihr die Hand auf die Finger gelegt und gesagt, sie sollten das etwas lockerer nehmen und ihre Zeit miteinander genießen. Und sich einfach Zeit lassen.
»Typisch Mann«, hatte Louise gemeint.
»Wie bitte?«
»Diese Scheiße von wegen ›locker nehmen‹.«
Thorne hatte gegrinst und getan, als würde er nicht verstehen, was sie meinte.
»Es haut mich einfach um, wie Männer keine fünf Minuten für ein Gespräch über ihre Beziehung erübrigen können, aber einen ganzen Tag Zeit finden, ihre CD-Sammlung alphabetisch zu ordnen ...«
Thorne wusste natürlich, dass Krauss vor Kristofferson kam. Aber ihm war ebenso klar, dass es ihm schon lange nicht mehr so gut gegangen war. So glücklich war er nicht mehr gewesen, seit sein Vater vor zweieinhalb Jahren gestorben war.
Als Waylon Jennings — der zwischen The Jayhawks und George Jones eingeordnet war — »The Taker« zu singen begann, setzte sich Thorne für ein paar weitere Spiele wieder an den Computer. Er spürte Elvis unter dem Tisch herumstreichen, mit seiner Schnauze an sein Schienbein stupsen, in der Hoffnung auf einen späten Happen — oder ein lachhaft frühes Frühstück.
Thorne kramte nach dem Katzenfutter und dachte über den König und die Zehn in seiner Hand nach, als sein Handy klingelte.
»Es tut mir leid«, sagte Louise. »Ich komm jetzt erst weg.«
Die Kidnap Investigation Unit war zusammen mit anderen Spezialeinheiten bei Scotland Yard untergebracht, das ebenfalls beruhigend weit entfernt von Thornes Morddezernat war, das sich im Peel Centre in Hendon befand. Doch um diese späte Stunde brauchte man wahrscheinlich nur zwanzig Minuten nach Kentish Town.
»Ich stell schon mal das Wasser auf«, sagte Thorne. In der anschließenden Pause konnte Thorne hören, wie Louise mit den anderen Beamten im Raum scherzte, während sie sich auf den Weg nach unten in die Parkgarage machte.
»Ich denk, ich fahr heute gleich nach Hause«, sagte sie schließlich.
»Oh, okay.«
»Ich bin kaputt.«
»Ist in Ordnung.«
»»Verschieben wir‘s auf morgen.«
»Ich verschieb‘s nicht«, sagte Thorne. »Sieht nur so aus, als wär ich dabei allein.«
Sie lachte auf, kurz und schmutzig. Ihr Atem ging heftig, und Thorne sah sie vor sich, wie sie schnell ausschritt, um zu ihrem Auto und nach Hause zu kommen. »Ich hätte früher anrufen sollen«, sagte sie. »Aber du weißt ja, wie es ist. Wartest du schon lange?«
»Kein Problem.« War es auch nicht. Sie hatten beide in letzter Zeit irrsinnig viel gearbeitet, und es hatte jede Menge dieser späten oder frühen Telefonate gegeben.
»Wie war dein Tag?«
»So lala.« Wie üblich arbeitete Thorne an einer Handvoll verschiedener Fälle, jeder davon in einem anderen Stadium — von der Leiche, die noch nicht kalt war, bis hin zum Gerichtsfall, der gerade in die heiße Phase kam. Von der Frau, deren Ehemann durchgedreht war und sie und ihre Mutter mit einer leeren Wodkaflasche zu Brei geschlagen hatte, bis hin zu einem pakistanischen Mädchen, das von einem Onkel erwürgt worden war, was verdächtig nach einem Ehrenmord aussah. Und einem jungen Türken, der auf dem Parkplatz vor einem Pub erstochen worden war. »Und du?«, fragte Thorne.
»Bei uns gab‘s jede Menge zu lachen«, sagte Louise. »Echt super heute, ich hatte eine längere Debatte mit einem der Hauptcrackdealer hier, der keine Anzeige gegen einen anderen Hauptcrackdealer erstatten will. Ich wollte ihm nicht abnehmen, dass er sich selbst eine Woche lang als Geisel gehalten und sich auch die drei Finger selbst abgehackt hatte.«
»Und wie hat er das erklärt?«
»Wie‘s aussieht, hat er sich selbst in einem Schuppen eingesperrt und sich gedacht, dann könne er die Zeit nutzen und ein bisschen rumwerkeln. Dabei gab‘s Probleme mit der elektrischen Kettensäge.«
»Bitte keine voreiligen Schlüsse«, sagte Thorne. »Hat er ein ehrliches Gesicht?« Wieder lautes, dreckiges Lachen. Er hörte ein leichtes Echo, also war sie in der Garage.
»Du klingst müde«, sagte Louise.
»Mir geht‘s gut.«
»Was hast du so getrieben?«
»Nicht viel. Ich hab mir so einen blöden Film angesehen ... etwas gearbeitet.«
»Okay.« Die Verbindung war jeden Augenblick weg. Thorne hörte das Klicken, als sie den Wagen mit der Fernbedienung aufsperrte. »Also bis morgen Abend, sicher?«
»Außer ich wasch mir die Haare«, sagte Thorne.
»Ich ruf dich zwischendurch an.«
Thorne sah auf den Bildschirm, als die Fourth Street ausgeteilt wurde. Sah, dass sein König und sein Zehner sich in eine nach oben und unten offene Straße verwandelt hatten. Und eine Karte stand noch aus. »Fahr vorsichtig ...«
Er ging in die Küche, um sich Tee zu machen, entschuldigte sich bei Elvis, dass er sein Futter vergessen hatte, und schaltete auf dem Weg zum Kühlschrank das Wasser ein. Er griff nach einer Tasse, als das Handy piepte.
Sicher eine SMS von Louise. Lächelnd drückte er LESEN, und als er den Text las, wurde sein Grinsen noch breiter.
Ich weiß, dass du Poker spielst.
Er dachte noch über eine witzige Antwort nach, als es erneut piepte.
Diesmal stammte die Nachricht nicht von Louise Porter.
Es war eine Multimedia-Message mit einem Foto. Das Bild war schlecht zu erkennen. Eine Nahaufnahme, von unten nach oben fotografiert. Thorne musste es einen halben Meter weg- und im richtigen Winkel halten. Doch dann wurde ihm klar, was er vor sich hatte.
Das Gesicht des Mannes füllte den kleinen Bildschirm aus, es war blass und verzerrt.
Eine dunkle Strähne verdeckte die Wange. Der Mund stand offen, die Lippen waren weiß gesprenkelt, und in der Mundhöhle war die Zunge zu erkennen. Ein Kinn wölbte sich über das andere, beide voll schwarzer und silbriger Bartstoppel, dazwischen eine rote Linie. Das sichtbare Auge war geschlossen. Thorne konnte nicht sagen, ob die Linien über der Braue und der Stirn von der Kameralinse stammten oder nicht.
Er drückte auf die Tasten, um mehr über die Nachricht zu erfahren. Sah sich Uhrzeit und Datum an, suchte nach Hinweisen über den Sender. Ein Name war nirgends zu entdecken, aber er drückte zweimal die Rückruftaste, um die angegebene Nummer zu wählen.
Das Telefon am anderen Ende war tot.
Er sah sich noch einmal das Foto an und spürte seine Halsschlagader pochen. Spürte dieses vertraute, schreckliche Prickeln im Nacken. Es kam häufig vor, dass Thorne das Offensichtliche nicht sah. Aber das hier war, wie immer man es sehen mochte, sein Fachgebiet. Buchhalter kannten sich mit Zahlen aus, und Tom Thorne erkannte eine Leiche, wenn er eine vor sich hatte.
Er neigte das Display noch einmal leicht, hielt es näher an die Schreibtischlampe. Das Pokerspiel hatte er vergessen. Er starrte auf den dunklen Fleck unter dem Ohr des Mannes. Das war mit Sicherheit keine Haarsträhne. Starrte auf die rote Linie, die in die Falte zwischen dem Doppelkinn lief.
Das Blut war nicht ausschlaggebend, aber Thorne wusste, wie hoch die Chancen waren, dass jemand einen Freund oder Verwandten fotografierte, dem ein Balken auf den Kopf gefallen oder der die Treppe hinuntergestürzt war.
Ihm war klar, er blickte auf das Foto eines Mordopfers.
Zweites Kapitel
»Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Formulare dafür ausgefüllt werden müssten?«
»Okay. Dann rücken Sie mir was aus der Portokasse raus. Wir haben doch so was wie eine Portokasse?«
»Ja, und das hieße noch mehr von diesen verdammten Formularen.« Russell Brigstocke nahm die Brille ab und massierte sich mit Zeigefinger und Daumen den Nasenrücken.
Thorne hob die Hände als Zeichen der Kapitulation. Er wollte nicht noch mehr Unglück auf die Schultern seines DCI laden. »Was soll‘s. Ich zahl es selbst. So ein Zweithandy schadet ja nicht.«
War ja nur eine Frage gewesen ...
Es war von Anfang an klar, dass Thorne sein Handy rausrücken musste, um es genau untersuchen zu lassen. Und wie alle anderen war er viel zu abhängig von dem verdammten Ding. Der Gedanke, auch nur kurze Zeit ohne Handy auskommen zu müssen, hatte ihn mit blankem Horror erfüllt. Er hatte auf das Handy auf Brigstockes Schreibtisch gestarrt, als hieße es, sich für immer von einem geliebten Haustier zu verabschieden.
»Sie könnten das Handy ja behalten und ihnen nur die SIM-Karte geben«, meinte Brigstocke.
»Und was bringt mir das? Meine ganzen Nummern sind so oder so auf der Karte gespeichert.«
»Sie wissen nicht, wie man die überspielt?«
»Was glauben Sie denn?«
Natürlich hatten sie keine Zeit zum Blödeln. »Besorgen Sie sich doch einfach eins von diesen Prepaid-Dingern«, sagte Brigstocke. »Stellen Sie es auf Rufumleitung ein, und Ihnen entgeht kein Anruf.«
»Was kosten die?«
»Keine Ahnung, nicht viel.«
»Und übernimmt die Abteilung die Kosten?«
Brigstocke setzte die Brille wieder auf und fuhr sich mit den Fingern durch die dichten schwarzen Haare. Er griff nach Thornes Handy. »Wenn wir dann Ihre Telefonprobleme endgültig geklärt haben ...«
»Ich würde Sie gern sehen, wie Sie ohne zurechtkommen«, unterbrach ihn Thorne.
Brigstocke ging nicht weiter auf Thornes spitze Bemerkung ein, sondern betrachtete das Bild auf dem kleinen Display des Nokia-Handys.
Thorne zog die schwere Lederjacke aus und hängte sie über den Stuhl. Es war kalt gewesen, als er vor eineinhalb Stunden seine Wohnung verlassen hatte, aber nach zehn Minuten im Becke House, in dem kein Fenster zu öffnen und sämtliche Heizungsthermostaten permanent auf »Sahara« gestellt waren, schwitzte er. Draußen blies der Wind gegen die Scheiben. Der November, frisch und aufbrausend, nahm gerade Fahrt auf. Auf den Flachdächern gegenüber wirbelte das Laub wütend durch die Luft.
»Wahrscheinlich nur ein schlechter Scherz«, meinte Brigstocke.
Thorne hatte sich dasselbe gesagt, als er das Foto erhielt. Vergebens. Und es nun aus dem Mund eines anderen zu hören, das überzeugte ihn genauso wenig. »Das ist keine Wachspuppe«, sagte er.
»Vielleicht ein Foto von einer dieser durchgeknallten Webseiten? Da draußen gibt es die seltsamsten Sachen.«
»Vielleicht. Aber irgendetwas steckt hier dahinter.«
»Womöglich war es nur die falsche Nummer?«
»Ziemlicher Zufall wär das. Ungefähr so, als ob ein Klempner aus Versehen das Foto von einem kaputten Absperrhahn zugeschickt bekommt.«
Brigstocke hielt das Handy dicht an sein Gesicht, neigte es ein bisschen, um das Licht besser einzufangen. Er sprach mehr zu sich selbst als zu Thorne, als er sagte: »Das Blut ist noch nicht trocken. Wir müssen davon ausgehen, dass er noch nicht lange tot ist.«
Thorne dachte noch immer über Zufälle nach. Sie hatten in einigen Fällen der letzten Jahre eine Rolle gespielt, und er hatte sie nie leichtfertig von der Hand gewiesen. Aber hier, das spürte er, steckte mehr Organisation dahinter.
»Das ist kein Zufall, Russell. Das ist eine Botschaft.«
Brigstocke legte das Handy sachte beiseite, beinahe so, als müsste er dem noch nicht identifizierten Toten Respekt erweisen. Er wusste, dass Thorne mit seinem Bauchgefühl mindestens so oft dramatisch danebenlag, wie er damit recht hatte. Aber er wusste auch, dass eine Auseinandersetzung mit diesen Eingebungen Kopfschmerzen geradezu provozierte und die Wahrscheinlichkeit eines Magengeschwürs beträchtlich erhöhte. Es sprach wirklich nichts dafür, Thorne in diesem Punkt zu widersprechen. »Wir geben das hier an die Jungs von der Technik. Mal sehen, wie weit die mit dem Foto kommen. Und jemand soll sich mit der Telefongesellschaft in Verbindung setzen.«
»Kann das nicht Dave Holland erledigen?«
»Ich bin sicher, der reißt sich nur zu gern los von dem Imlach-Papierkram.«
Darren Anthony Imlach. Der Mann, der sich vor Gericht dafür verantworten musste, seine Frau und seine Schwiegermutter mit einer Wodkaflasche umgebracht zu haben. Das hatte ihm den Namen »Smirnoff-Mörder« eingebracht. So nannten ihn diese Revolverblätter, deren Nippelquote sich noch immer im zweistelligen Bereich bewegte.
»Dave versteht sich darauf, die Leute zum Reden zu bringen, wenn‘s schnell gehen muss. Spart uns vielleicht ein paar Stunden Formulareausfüllen.«
»Hört sich gut an«, meinte Brigstocke. Er klopfte mit dem Zeigefinger auf das Handy. »Warum kümmern Sie sich nicht darum, ob wir irgendwo eine Leiche haben, zu der dieses Gesicht passt?«
Thorne war bereits auf den Beinen und griff nach seiner Jacke. »Ich logg mich gleich ein.«
»Hat Kitson mit Ihnen über den Sedat-Fall gesprochen?«
Thorne, bereits an der Tür, drehte sich noch einmal um. »Ich hab sie noch nicht gesehen.«
»Wie auch immer. Sie wird Sie aufs Laufende bringen. Wir haben ein Messer gefunden. Lag in einem Abfalleimer gegenüber vom Queen‘s Arms.«
»Fingerabdrücke?«
»Hab ich nicht gehört. Würde mich aber wundern. Das Messer lag zwischen Zigarettenkippen, Bierresten und Dreck. Kebabreste ...«
»Vielleicht der richtige Moment, die Jungs von S&O hinzuzuziehen.«
»Die sollen sich verpissen«, sagte Brigstocke.
Die Serious and Organised Crime Unit, die sich, wie ihr Name sagte, um das organisierte Verbrechen kümmerte, war der Ansicht, dass der drei Tage zurückliegende Mord an Deniz Sedat mit der Tatsache zusammenhing, dass das Opfer Mitglied einer türkischen Gang war. Sedat, der von seiner Freundin vor einem Pub in Finsbury Park gefunden wurde, als er verblutete, war keine große Nummer. Aber sein Name war bei Ermittlungen im aufstrebenden Heroinhandel des Londoner Nordens immer wieder mal aufgetaucht. Und das Team von S&O hatte sofort die Ellbogen ausgefahren.
»Richtig organisiert, wie die sich hier breitmachen«, hatte sich Brigstocke gestern beschwert. »Aber wenn sie das Spiel so spielen wollen ...«
Thorne hatte in dieser Hinsicht bereits seine Erfahrungen gesammelt, sowohl mit S&O als auch mit einigen türkischen Banden, mit denen sie es hier zu tun hatten. Er hatte seine Gründe — persönliche Gründe —, ihnen lieber nicht schon wieder zu sehr auf den Pelz zu rücken. Und in Anbetracht dieser Sachlage sprach es durchaus für den DCI, dass er sich nicht rumschubsen lassen wollte. Außerdem kannte Thorne seinen Chef gut genug, um zu wissen, dass es ihm hier nicht darum ging, wer weiter pinkeln konnte. Wie Thorne gehörte er zu den Bullen, die einen Mord nicht als Bedrohung für ihre Aufklärungsrate sahen, sondern als Fall, den sie lösen wollten. Wenn ein Fall nach drei Wochen Ermittlung eiskalt war, war Brigstocke so übel drauf wie alle anderen, aber wenn ein neuer Fall hereinkam, dann wusste er, dass er es den Betroffenen, ob tot oder lebendig, schuldig war, sich mit seinem Team ins Zeug zu legen.
Allmählich begann sich bei Thorne der Gedanke festzusetzen, dass er sein eigenes Mordopfer bekommen hatte, auf das man — mit voller Absicht — seine Aufmerksamkeit gelenkt hatte und für das er nun alles geben musste.
Für den Moment wollte er nicht zu viel über den Mörder nachdenken. Über den Mann oder die Frau, von dem oder der diese Nachricht vermutlich stammte.
Im Augenblick wusste er nur, dass der Mann auf dem Foto tot war.
Thorne musste ihn nur noch finden.
Die Berichte der Beamten aus den diversen Homicide Assessment Teams, die stets die Ersten vor Ort waren, waren inzwischen sicher bereits in der Zentrale von Scotland Yard eingegangen. Zumindest für die Schicht von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens. Und die Zentrale veröffentlichte täglich eine Übersicht, auf die jeder Kriminalbeamte Zugriff hatte. Der Bericht enthielt sämtliche ungeklärten Todesfälle — oder lebensgefährlichen Verletzungen — inklusive Schussverletzungen, Vergewaltigungen, Vermisster oder sonstiger Vorkommnisse aus dem Großraum London.
Name und Adresse des Opfers, falls vorhanden, und die Details in Kürze. Todesursache, falls diese offensichtlich war. Name des zuständigen Beamten, falls der Fall einem Team zugewiesen wurde.
Thorne suchte sich einen freien Schreibtisch in dem Großraumbüro der Einsatzteams und loggte sich ein. Er las die E-Mail, durchforstete die Morde der letzten Nacht nach passenden Details. Der Rekord für eine Nacht — ausgenommen Terroranschläge — lag bei elf Morden. Das war eine Nacht vor ein paar Jahren gewesen, als neben zwei Familienstreitigkeiten und einem Handgemenge in einem Pub, die tödlich ausgegangen waren, auch noch Schüsse auf Partybesucher in Ealing abgefeuert wurden, eine Wohnung in Harlesden abgefackelt wurde und eine Gang auf der Suche nach Geld für Crack sämtliche Mitarbeiter in einem Minicab-Büro in Stockwell niedergemetzelt hatte.
Wie vorherzusehen war, forderten viele, die Polizisten der Met müssten sich schon etwas stärker ins Zeug legen, wenn sie gemäß ihrem Motto »Working for a safer London« wirklich für ein sicheres London arbeiteten. Und das, obwohl eine Menge Leute, Tom Thorne eingeschlossen, sich in den Wochen danach den Arsch aufrissen.
Er überflog den Bericht.
Drei Tote waren viel für Dienstagnacht.
Er suchte nach »dunklen Haaren«, »Kopfverletzung« — Details, die zu dem Foto auf seinem Handy passten. Der einzige Eintrag, der annähernd in Frage kam, war ein ermordeter Barkeeper aus dem West End: ein Weißer, der auf dem Weg nach Hause in einer Gasse hinter dem Holborn-Bahnhof mit einem halben Ziegelstein erschlagen wurde.
Allerdings nur annähernd. Das Opfer war laut Bericht Mitte zwanzig, und obwohl der Tod oft sogar mit den frischesten Gesichtern merkwürdige Dinge anstellt, war der Mann auf dem Foto sicher älter.
Thorne hörte am Schreibtisch in seinem Rücken DS Samir Karim und DC Andy Stone arbeiten. Auch wenn »arbeiten« in diesem Fall bedeutete, dass die beiden sich über eine Kollegin von der Polizeiwache in Colindale unterhielten, die Stone bequatscht hatte, sich mit ihm auf einen Drink zu treffen. Thorne loggte sich aus dem Bericht aus und sagte, ohne sich umzudrehen: »Offensichtlich handelt es sich hier um einen Fall von positiver Diskriminierung. «
»Wie bitte?«, fragte Stone.
»Dass die in Colindale jetzt bevorzugt blinde Polizistinnen einstellen.«
Karim lachte noch immer, als er und Stone hinter Thorne traten.
»Hab von Ihrem heimlichen Verehrer gehört«, sagte Stone. »Normalerweise schickt man ja Blumen.«
Karim ordnete die Unterlagen auf seinem Schreibtisch. »Wahrscheinlich verläuft die Sache im Sande.«
»Genau. Inzwischen bekommt man so viel Scheiße aufs Handy. Ich krieg jede Woche unaufgefordert Unmengen an Upgrades, Klingeltönen und was es da noch gibt. Spiele ...«
Thorne sah auf zu Stone, als wäre der DC so unendlich beschränkt wie diese Bemerkung. »Und sind viele Nachrichten dabei mit Leichenfotos im Anhang?«
»Ich mein ja nur.«
Karim und Stone wippten auf den Fersen wie drittklassige Kabarettisten, die vergessen hatten, wer mit dem Text dran war. Sie waren ein kurioses Paar: Stone, groß, dunkel und gut angezogen; Karim, grauhaarig und untersetzt, in einem schlecht sitzenden Sakko, wie ein Sportlehrer, der sich für den Elternabend in Schale geworfen hat. Thorne mochte sie beide, obwohl Karim in seiner Funktion als Büroleiter nerven konnte, wenn er wollte, und Stone nicht gerade der gewissenhafteste Bulle war. Vor etwa einem Jahr war ein junger Polizist, der sich noch in der Ausbildung befand und der ihm als Partner zugewiesen worden war, erstochen worden. Stone war deshalb zwar nicht offiziell getadelt worden, aber nicht wenige fanden, Schuldgefühle wären das Mindeste, womit Andy Stone dafür hätte büßen müssen.
»Könnt ihr nicht jemand anders finden, den ihr nerven könnt?«, fragte Thorne.
Nachdem die beiden verschwunden waren, ging er durch den schmalen Gang, der um die Einsatzzentrale führte, in den kleinen, als Büro ungeeigneten Raum, den er sich mit DI Yvonne Kitson teilte. Er verbrachte zehn Minuten damit, diverse Memos und Newsletter unter »P« für »Papierkorb« abzulegen, und blätterte die neueste Ausgabe der Polizeizeitung, The Job, nach Fotos von Leuten durch, die er kannte.
Er schaute gerade gebannt auf ein Foto von Detective Sergeant Dave Holland, wie er bei irgendeinem Polizeisportereignis eine Trophäe überreicht bekam, als dieser leibhaftig in der Tür erschien. Ungläubig las Thorne schnell die paar Absätze zu Ende, bevor Holland sich auf den Stuhl hinter Kitsons Schreibtisch setzte.
»Tischtennis!«, fragte Thorne und schwenkte das Blatt.
Holland zuckte mit den Schultern und konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Auch Thorne grinste breit. »Das schnellste Ballspiel der Welt«, meinte Holland.
»Stimmt nicht«, widersprach Thorne.
Holland wartete.
»Jai Alai«, sagte Thorne.
»Jai was?«
»Auch unter dem Namen Pelota bekannt. Der Ball erreicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu dreihundert Kilometer in der Stunde. Auch ein Golfball ist schneller. Zweihundertsiebzig Kilometer ab dem Tee.«
»Die Tatsache, dass Sie diesen Scheiß wissen, jagt mir regelrecht Angst ein«, antwortete Holland.
»Der alte Herr.«
Holland nickte, er verstand.
Thornes Vater war in den Monaten vor seinem Tod besessen gewesen von trivialen Fakten — von Listen und Quizfragen über Listen. Diese Listen wurden immer bizarrer, und seine Besessenheit, darüber zu sprechen, wurde immer größer, je mehr Schaden die Alzheimer-Erkrankung in seinem Hirn anrichtete und je mehr sie ihn beherrschte.
Die schnellsten Ballspiele der Welt. Die berühmtesten fünf Promiselbstmorde. Die schwersten Organe. Und was es noch an belanglosen Fragen gab ...
Jim Thorne. Der im Schlaf starb, als sein Haus ausbrannte. Ein normaler Wohnungsbrand, den ein liebevoller Sohn — der sich die nötige Zeit genommen und die Mühe gemacht hätte — hätte vermeiden können, so voraussehbar war er.
Oder vielleicht war es auch ganz anders gewesen.
Ein Mord, eine an Thorne gerichtete Botschaft, etwas direkter allerdings als die, die ihn momentan beschäftigte.
So oder so, eine offene Frage. Und wenn er nachts wach lag, konnte Thorne sich nie entscheiden, welche der beiden Möglichkeiten ihm das Leben schwerer machte.
»Jai Alai«, sagte Holland. »Ich weiß es noch.«
»Wie läuft‘s mit den Telefongesellschaften?« Thornes optimistischer Ton war nur aufgesetzt, er wusste, jede Hoffnung würde verdammt schnell platzen, wenn sie es nicht mit einem außerordentlich dämlichen Typen zu tun hatten.
»Es ist eine T-Mobile-Nummer«, sagte Holland.
»Prepaid, richtig?«
»Richtig. Die Nummer ließ sich zu einem Pay-as-you-go-Handy zurückverfolgen, das wohl sofort im Abfall landete, nachdem das Foto an Sie rausgeschickt worden war. Oder vielleicht hat er auch das Handy behalten und nur die SIM-Karte weggeworfen.«
Wie auch immer, da war wohl nicht viel zu holen. Seit der Explosion und der Diversifizierung des Handymarkts war jede Ermittlungsarbeit zum sinnlosen Unterfangen geworden. Prepaid-SIMs bekam man praktisch überall. Man konnte sich ein Handy mit allem Zubehör am Automaten kaufen, und sogar Handys, die bei einem bestimmten Betreiber registriert waren, konnte man für zehn Pfund in jedem Straßenmarkt freischalten lassen. Wer Handys für kriminelle Zwecke einsetzte, brauchte nur die grundlegendsten Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich abzusichern. Das Handy brachte die wenigsten in den Knast.
Die einzige Gefahr war das Aufspüren der Sendemasten, von denen das Signal ursprünglich gesendet wurde. Sobald man einen Sendemast geortet hatte, ließ sich der Bereich, von dem aus der Anruf getätigt wurde, auf eine Handvoll Straßen einengen. Und wenn es immer dieselben Masten waren, dann wusste man schnell, welche Verdächtigen man ins Visier nehmen musste und bei welchen man sich weitere Nachforschungen sparen konnte. Allerdings ein zeitaufwendiges und teures Unterfangen.
Als Thorne die Frage stellte, erklärte ihm Holland, der DCI habe in diesem Fall die Anfrage an die Telefongesellschaft nicht genehmigt. Thornes Reaktion fiel entsprechend grob aus, andererseits war die Argumentation hinter dieser Entscheidung durchaus nachvollziehbar. Die Telefongesellschaften verlangten für eine solche Anfrage bis zu tausend Pfund, und das war zu viel für das Foto eines Mordopfers.
»Und wo hat er es gekauft?«, fragte Thorne. Wenn sie zurückverfolgen konnten, wo er das Handy gekauft hatte — in welcher Gegend oder in welchem Laden —, fanden sie vielleicht in den Aufnahmen der Videoüberwachung ein Bild des Gesuchten. Sosehr Handys der Polizei das Leben schwer machten, so war die allgegenwärtige Videoüberwachung zum besten Freund des Bullen avanciert. Als Bürger der am besten überwachten Nation Europas — in der auf vierzehn Leute eine Kamera kam — wurde der durchschnittliche Londoner dreihundertmal täglich auf Video erfasst.
»Es handelt sich um ein Handy von Carphone Warehouse«, sagte Holland.
»Ist das gut?«
»Raten Sie mal. Dieser dämliche DC bei der Telephone Unit behauptet, deren Handys kann man nur bis zu dem Lagerhaus verfolgen, aus dem sie kommen. Bei einem anderen Handy hätten wir unseren Mann kriegen können, aber mit den Aufzeichnungen der Einzelhändler kommt man nicht weiter.«
»Fuck ...«
»Ich glaube, bei dem Handy brennt für ihn nichts an. Keine Ahnung, woher er das alles weiß. Es sei denn, er arbeitet für eine Telefongesellschaft. Oder er ist einer dieser Irren, mit denen ich mich heute Vormittag herumgeschlagen habe.«
»Danke, Dave.«
»Ich bleib dran«, sagte Holland. »Vielleicht haben wir Glück.«
Thorne nickte, aber er war in Gedanken bereits weiter. Bei dem Kern der Nachricht, die er erhalten hatte. Was bedeutete sie?
Ging es um eine Warnung? Eine Einladung? Eine Herausforderung?
Sollten die Bonzen oben je das Motto ändern wollen, er hätte das perfekte Nachfolgemotto. Eines, das den Job genauer auf den Punkt brachte. Thorne betrachtete das Papier mit dem matten blauen Briefkopf auf seinem Schreibtisch und stellte sich eine Zukunft vor, in der sämtliches Promomaterial der Metropolitan Police einen neuen Slogan trug.
Vielleicht haben wir Glück.
Drittes Kapitel
»Das hat jeder.« Der Verkäufer drückte Thorne das silberglitzernde Stück in die Hand. »Die Promis in GQ und den ganzen Zeitungen, die haben alle so eines. Wir haben die auch in Schwarz, aber Silber ist echt geil ...«
Das Handy war nicht größer als eine Kreditkarte. Thorne starrte auf die winzigen Tasten. Mit seinen knubbligen Fingern drückte er da jedes Mal drei gleichzeitig. »Ich fürchte, ich brauch etwas nicht ganz so Zierliches«, sagte er. »Eines, das scheppert, wenn es aus der Tasche fällt.«
Der Verkäufer, der laut Schild auf den Namen Parv hörte, war ein mondgesichtiger Pakistani mit nach oben gegeltem Haar. Er rieb sich den Kugelbauch durch das Polohemd hindurch, das ihm ein paar Nummern zu klein war und auf dem das Logo des Ladens eingestickt war. »Okay, wie wär‘s mit einem 3G? Die haben größere Tasten. Man kann damit seine E-Mail erledigen, im Internet surfen, alles Mögliche.« Der Junge nickte verständnisvoll, als er etwas wie Interesse in den Augen seines Kunden aufblitzen sah. »Und natürlich mit einem schnellen Zugang. Plus Live-Videostreaming, Videotelefonie, was immer Sie wollen.«
»Ich kenn niemanden, der so eines hat«, sagte Thorne.
»Ach?«
»Also mit wem soll ich videotelefonieren?«
Parv dachte darüber nach. »Okay, das Handy hier ist ziemlich einfach«, erklärte er und griff nach einem anderen Handy. »Nichts Aufregendes. Sie können ins Internet, haben Bluetooth und einen Stimmenrekorder, eine 1,3-Megapixel-Kamera oder bei dem zum Auf klappen eine Kamera mit 1,5 Megapixeln und einem besseren Zoom — und einen eingebauten MP3-Player.«
»Klingt gut«, sagte Thorne. »Kann man damit auch telefonieren?«
Parv strich sich wieder über den Bauch und zwang sich zu einem Lächeln. Seine Augen sprachen eine andere Sprache. Offensichtlich fürchtete er, dieser Kunde könne jeden Augenblick eine automatische Waffe ziehen oder seinen Schwanz auspacken.
»Ich brauche das Handy nur als Zweithandy, mehr nicht.« Thorne sah sich hilflos um. »Ich brauch diese ganze Scheiße nicht.«
»Tut mir leid.« Der Junge griff nach dem Handy und sah sich nach einem anderen Kunden um. »Ganz ohne Scheiße geht es nicht.«
Das war bereits das zweite phantastische Motto, das Thorne heute zu Ohren kam. Vielleicht sollte er bei der Polizei aufhören und eine Firma gründen, die Postkarten mit Slogans für jeden Tag verkaufte.
»Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen«, sagte Parv. Klang beinah so, als ob er es auch meinte.
Thorne hatte Schuldgefühle, weil der Junge sein beträchtliches Wissen und seinen Enthusiasmus an ihn vergeudet hatte. Er versicherte ihm rasch, dass er sehr wohl was kaufen wolle und nur noch ein paar Fragen habe. Mit einem Blick auf die 3G-Handys fragte er, ob man damit auch Online-Poker spielen könne.
Es war Viertel nach vier, mehr als eine Stunde nach Dienstschluss, und es wurde bereits dunkel. Letzte Woche waren die Uhren zurückgestellt worden, was zu dem üblichen Gejammer von wegen jahreszeitlich bedingter Depression führte. Thorne sah das anders. Er fand, die Aussicht von seinem Schreibtisch aus profitierte merklich von der Dunkelheit draußen. Und wer brauchte schon eine jahreszeitlich bedingte Depression, wenn ein Zehn-Minuten-Telefonat mit einem winzpimmeligen Wichtigmacher selbst den glücklichsten Menschen auf Erden in eine tiefe Depression stürzte?
Thorne hatte etwas länger als eine Stunde gebraucht, um sein neues Handy einzurichten und registrieren zu lassen. Nun musste er nur noch die Anrufe auf seine neue Prepaid-Nummer umleiten lassen. Bedauerlicherweise befand sich das Handy, das er brauchte, um die Umleitung zu aktivieren, bereits in einem entsprechend ausgestatteten Labor, um das Foto genauer zu untersuchen. Thorne hatte in Newlands Park angerufen, dem Technikzentrum in Sidcup, das sich mit Fotomanipulationen, audiovisueller Bearbeitung und anderem technischen Schnickschnack beschäftigte, der den geistigen Horizont Normalsterblicher überstieg, die es kaum schafften, ihren Videorekorder zu programmieren.
»Ist ganz einfach«, hatte Thorne gesagt. »Ich hab die Anleitung vor mir liegen und kann Ihnen vorlesen, was zu tun ist. In zehn Sekunden sind wir damit durch. Ich will nur keine Anrufe verpassen, verstehen Sie ...«
»Also Sie müssen mir wirklich nicht die Anleitung vorlesen.« Der Techniker konnte oder wollte seinen sarkastischen Unterton nicht verbergen. Er hieß Dawson. Darunter stellte Thorne sich sofort einen aknegesichtigen Typen mit großen Ohren, Eierflecken auf der Krawatte und einer riesigen Pornosammlung vor. »Ich kann die Einstellung nicht verändern, verstehen Sie?«
»Leider nein.«
»Das Handy wurde uns als Beweismittel übergeben.«
»Das Handy ist nicht das Beweismittel«, hatte Thorne widersprochen. »Das Foto ist das Beweismittel.«
»Und das Foto ist auf dem Handy. Ich kann unmöglich an dem Handy herummachen.«
»Es geht um eine simple Ruf Umleitung. Was ist daran Herummachen?«
»Ich darf nur das Foto herunterladen und vergrößern, darum wurden wir gebeten. Das hab ich schriftlich.«
»Daran zweifle ich ja nicht. Aber der gesunde Menschenverstand muss Ihnen doch sagen, dass, wenn ich eine Videokassette mit der Aufnahme eines Mords zugeschickt bekomme und mir diese anschaue, dies doch nicht heißt, dass ich die Einstellungen meines Videorekorders nicht mehr ändern darf, richtig?«
»Es geht hier nicht darum, was Sie tun«, hatte Dawson gesagt. »Hier gibt es Routinen.«
Thornes Lieblingsausdruck. Ab jetzt konnte es nur noch schlimmer werden.
»Es gilt die Unversehrtheit des Beweismittels.« Das hatte sich angehört, als würde Dawson vom Blatt ablesen. »Die forensischen Belange stehen im Vordergrund.«
»Es gibt keine forensischen Belange«, hatte Thorne eingeworfen und sich dabei größte Mühe gegeben, es witzig rüberkommen zu lassen. Zugegeben, zu viel verlangt. »Das ist mein Handy. Es ist nicht so, dass Sie die Fingerabdrücke des Mörders verschmieren, oder?«
Nach einer kurzen Pause: »Aber ich darf nur ...«
»Das ist ein Witz, verdammt noch mal.«
»Diese Ausdrücke sind keine Hilfe.«
Für Thorne waren sie das durchaus. »An wen kann ich mich sonst wenden?« Während er auf eine Antwort wartete, stellte er sich Dawson gegen eine Werkbank gelehnt vor, wie er, eine Erektion in der Hose, mit einem Rubik-würfel spielte.
»Vermutlich muss Ihr Vorgesetzter offiziell bei meinem Vorgesetzten anfragen.«
»Das ist eine sehr feine Linie«, hatte Thorne gesagt.
»Wie bitte?«
»Dazwischen, ob man seinen Job liebt oder ob man sich vornüberbeugt, während er einen in den Arsch fickt ...«
Thorne hatte Brigstocke, als er mit ihm darüber sprach, nur die überarbeiteten Höhepunkte des Gesprächs erzählt. Sein neues Handy hatte zwar noch nicht geklingelt, aber er ging davon aus, dass der DCI sich umgehend an Dawsons Chef gewandt und die Rufumleitung hatte genehmigen lassen. Und Thorne versuchte sich, während er wartete, für einen von mehreren Dutzend ähnlich nervigen Klingeltönen zu entscheiden.
»Nehmen Sie bloß keins von diesen Hip-Hop-Dingern«, sagte Kitson. »Sonst glauben die Leute noch, Sie leiden unter einer Midlife-Krise.«
Thorne sah auf. Er hatte sie nicht kommen hören.
»Klingeltöne kann man inzwischen herunterladen, wissen Sie«, fuhr sie fort. »Sie könnten sich was von Hank Williams oder Johnny Cash holen.«
»Ringtone of Fire«, schlug Thorne vor. Er sah seiner Kollegin dabei zu, wie sie ihren Schreibtisch aufräumte und etwas auf ein Blatt kritzelte. Als sie eine Bemerkung über sein neues Handy machte, reichte er es ihr und erzählte ihr den ganzen Wahnsinn, den er deshalb erlebt hatte, während sie ein wenig damit herumspielte. Kitson hatte zwar bereits über die Buschtrommeln die Foto-auf-dem-Handy-Story vernommen, aber nun bekam sie die wahre Geschichte zu hören: die Nachricht spätnachts, das Foto von dem Toten.
»Ist dasselbe wie mit Urlaubsfotos«, sagte Kitson.
»Also ein Souvenir, meinen Sie?«
»Bis zu einem gewissen Grad. Was sie eigentlich damit ausdrücken wollen: »Schaut nur, was wir uns leisten können und wie toll wir sind.‹ «
»Sie glauben, er will angeben?«, fragte Thorne nach. Er kniff die Augen zusammen, sah das schwarze Mundinnere, die Feuchtigkeit hinter dem Ohr. Sprach mehr zu sich als zu Kitson: »Schaut, was ich getan habe ...«
Sie nickte und gab ihm das Handy zurück. »Ich kapier noch immer nicht ganz, warum sie das brauchten. Warum haben die nicht einfach die SIM-Karte ins Labor geschickt?«
»Das dürfen Sie nicht mich fragen.« Thorne wollte nicht zugeben, dass er nicht gewusst hatte, wie man seine Kontakte überspielt. Oder dass er sich über sein schickes neues Handy freute.
»Sie hätten sich eine Prepaid-SIM-Karte kaufen und sie in Ihr altes Handy stecken können.«
Thorne betrachtete schulterzuckend das Handy. »Ja, nächstes Mal weiß ich dann Bescheid.«
»Schon was vom Labor gehört?«
»Nichts, was uns weiterbrächte«, sagte Thorne. »Erzählen Sie mir doch von diesem Messer.«
Es handelte sich dabei laut Kitson um ein stinknormales, knapp zwanzig Zentimeter langes Küchenmesser, das in einem Park gegenüber dem Pub, in dem Deniz Sedat erstochen wurde, im Abfalleimer entdeckt worden war. Der Straßenkehrer, der es fand, hatte genug Folgen von CSI gesehen, um Bescheid zu wissen. Das heißt, er hatte sich eine Plastiktüte über die Hand gestreift, bevor er das Messer aufhob und vorsichtig in die Polizeiwache am Finsbury Park trug.
Thorne erzählte Kitson, er sähe sich nicht häufig Krimis an. Sie meinte daraufhin, da verpasse er nichts, aber sie seien zumindest zu etwas nütze. Er fragte sie, ob sie glaube, dass es sich bei dem Messer um die Mordwaffe handle.
»Sah aus, als wäre die Klinge blutverschmiert.«
»Brigstocke hat mir erzählt, das Messer wär total versifft«, sagte Thorne. »Sind Sie sicher, dass es keine Chilisoße war?«
»Die Größe der Klinge passt laut Hendricks zu der tödlichen Stichwunde.«
»Was weiß der schon. Diese leere Hose aus Manchester ...«
Kitson grinste.
Phil Hendricks war der Pathologe des Teams 3 der Area West Murder Squad. Außerdem war er Thornes engster Freund — oder was dem am nächsten kam.
»Würde mich sehr wundern, wenn die Leute von S&O sich darüber genauso freuen«, meinte Thorne. »Oder entsorgt der normale osteuropäische Auftragskiller oder wen immer sie dafür als Täter im Visier haben die Tatwaffe im nächsten Abfalleimer?«
Kitson hielt noch immer den Stift in der Hand, aber von Thornes Platz aus sah es aus, als kritzelte sie nur. »Normalerweise verwenden sie keine Messer, also, weiß der Geier.«
»Messer, Knarren — tot ist tot.«
»Richtig. Und es ging mit Sicherheit schnell«, sagte Kitson. »Profiarbeit. Wie lange war Sedat aus dem Blickfeld seiner Freundin verschwunden? Ein, zwei Minuten?«
Harika Kemal hatte gesagt, sie müsse noch schnell auf die Toilette, als sie das Queen‘s Arms verließen. Sedat hatte nach seinen Zigaretten gegriffen und gemeint, er warte auf dem Parkplatz. Harika hatte ausgesagt, sie sei ein paar Minuten später nachgekommen und habe Sedat sterbend auf dem Boden vorgefunden. Kitson hatte das Entsetzen in den Augen des Mädchens gesehen, als sie ihre Aussage machte. Sie konnte sich vorstellen, was sie bei dem Anblick ihres Freundes gefühlt haben musste, als er, zusammengesunken gegen den Vorderreifen eines Autos gelehnt, nach Luft schnappte, wie ein Fisch in der Faust eines Anglers.
»Ja, es ging schnell«, sagte Thorne. »Eiskalt.«
Kitson stach mit ihrem Kugelschreiber in die Luft. »Schnell und sauber. Direkt ins Herz.« Sie lehnte sich zurück, legte den Stift auf den Tisch und atmete tief aus. »Fuck, ich könnte einen Mord begehen für eine Zigarette.«
»Seit wann?« Thorne hatte bereits vor Jahren aufgehört, aber er kannte dieses plötzliche Verlangen nach einer Zigarette noch immer. Holland hatte vor kurzem mit dem Rauchen angefangen, sehr zum Entsetzen seiner Freundin. Langsam brauchte man Gesetze gegen die Diskriminierung der Raucher.
»Nur ein paar am Abend, verstehen Sie? Zu einem Glas Wein oder eine Tasse Kaffee.«
Klang gut. Thorne sah auf die Uhr. »»Verschwinden wir?«
Sie unterhielten sich weiter, während sie zusammenpackten. Kitson kramte in ihrer Handtasche nach dem Autoschlüssel. Thorne schob Unterlagen in eine abgewetzte braune Aktentasche, die er hinten im Schrank seines Vaters gefunden hatte.
Kitson schaltete das Licht aus. »Ob Profikiller Messer benutzen und sie nach getaner Arbeit in einem Abfalleimer versenken, sei dahingestellt. Aber sie hinterlassen in der Regel nicht allzu viele Fingerabdrücke. Wir werden es also bald wissen ...«
Die Büros des Morddezernats befanden sich im dritten Stock des Becke House. Thorne und Kitson warteten eine Minute auf den Lift, um dann doch lieber zu Fuß zu laufen. Der öffentliche Teil des Hauses war vor kurzem renoviert worden, unter anderem hatte das Treppenhaus einen Teppichbelag erhalten. Bei dem Geruch, der sich drei Wochen hielt, musste Thorne immer an einen Umzug in seiner Kindheit denken, an die Pappkartons und die Take-aways, die sein Dad nach Hause brachte.
Und zugleich machte ihn dieser Geruch etwas nervös.
»Was haben Sie heute Abend vor?«
Er fragte sich, ob das unter dem Kopf des Toten auf dem Foto ein Teppich war. Ließ sich schwer sagen. Vielleicht wenn sie das Foto vergrößerten ...
»Tom?«
Thorne wandte sich um und starrte Kitson an, bis diese ihre Frage wiederholte. »Ein ruhiger Abend zu Hause«, sagte er, um hinzuzufügen: »Und Sie?«
»Der übliche Wahnsinn.« Kitson schien Thorne um seinen leeren Terminplan zu beneiden. »Sogar noch etwas wahnsinniger als üblich. Mein Ältester schreibt bald seine Abschlussprüfung, entsprechend dicke Luft herrscht zu Hause.«
»Kann ich mir vorstellen.« Sie hatten die letzte Treppe erreicht. Kitson erzählte selten von zu Hause, und Thorne fühlte sich beinahe geehrt.
»Es ist nicht einfach für ihn«, sagte Kitson. »Verstehen Sie? Er muss mit einer Menge fertig werden in seinem Alter. Sie wissen nicht, wie sie mit dem Druck umgehen sollen.«
»Wie alt ist er?«
»Fünfzehn.«
Thorne verzog das Gesicht. »Ich bin beinah dreimal so alt.« Er lehnte sich mit der Schulter an die Tür. Die Kälte schlug ihm ins Gesicht, als er hinaus auf den Parkplatz trat. »Wird Zeit, dass mir mal jemand sagt, wie man damit umgeht.«
In der Wohnung hatte Thorne vor einem Teller Tomatensuppe gesessen, in die er Käse gerieben hatte, auf sein neues Handy gestarrt und darauf gewartet, dass es endlich klingelte. Was es schließlich getan hatte, zweimal hintereinander. Nun saß Thorne in seinem Wohnzimmer und sah den beiden Anrufern dabei zu, wie sie sein Lager tranken und sich genüsslich über ihn lustig machten.
Es handelte sich um eine Diskussion, die seit einer Woche lief, seit Halloween, als Thorne mit seiner — allerdings beträchtlichen — Abneigung gegenüber dem Süßes-oder-Saures-Gedöns nicht hinter dem Berg gehalten hatte.
»Das ist ein wahr gewordener Pädophilentraum«, sagte er. »Eine endlose Parade von Kindern, die an die Tür klopfen.«
Phil Hendricks trank einen Schluck von seinem Sainsbury‘s Lager. »Quatsch. Du bist einfach geizig und willst keine Süßigkeiten rausrücken.«
»Das ist so ein neuer amerikanischer Scheiß. Wir haben das nie getan ...«
»Du bist so ein bescheuerter Blödmann«, sagte Louise.
»Die meisten geben sich nicht einmal Mühe. Von wegen Verkleidung.«
»Das sind Kinder ...«
»Das ist nur eine Entschuldigung des Asozialennachwuchses, alten Leuten Knaller und Hundescheiße durch den Briefschlitz zu stecken.«
»Ich seh das wie Louise«, sagte Hendricks. »Du bist geizig und bescheuert.«
Thorne stand auf, um Bier aus der Küche zu holen. Hendricks saß neben Louise auf dem Sofa, und Thorne beugte sich zu ihm, als er vorbeiging. Der Pathologe war wie immer in Schwarz gekleidet und trug sein übliches Sortiment an Metall in Augenbrauen, Nase, Lippe, Wange und Zunge. »Du findest es nur deshalb toll, weil du dich nicht maskieren musst.«
Hendricks zeigte ihm den Stinkefinger. »Du bist ja homophob!«
Louise lachte und stieß ihre Bierdose um. Sie hob sie hastig auf, aber es war ohnehin nicht mehr viel drin.
Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer war Thorne wie immer überrascht, wie ähnlich sich Hendricks und Louise sahen. Sie waren beide vierunddreißig und damit — ein Anlass für endloses Gefeixe — zehn Jahre jünger als er. Beide waren dunkelhaarig und drahtig, auch wenn Hendricks seine Haare ziemlich kurz geschnitten trug und Louise wesentlich weniger Piercings hatte. Wäre nicht ihr unterschiedlicher Akzent gewesen, hätte man sie für Geschwister halten können.
Thorne gab ihnen beiden eine neue Dose Bier.
Die zwei waren schnell Freunde geworden, gingen gemeinsam aus, in Schwulen-Bars und -Clubs, und manchmal, wenn er sie zusammen sah, empfand Thorne fast so etwas wie Eifersucht, worüber er aber nicht gerne nachdachte. Zu Beginn ihrer Beziehung hatte es ihn ein wenig geärgert, dass Hendricks sich kaum bedroht fühlte, vor allem, weil Thorne gelegentlich schon eifersüchtig auf Hendricks‘ Freunde gewesen war. Es ergab sich, dass sie einen Großteil der letzten Monate zu dritt miteinander verbracht hatten, da Hendricks mit seinem letzten langjährigen Freund um die Zeit Schluss gemacht hatte, in der Thorne und Louise einander nähergekommen waren. Die beiden Männer hatten sich getrennt, weil Hendricks unbedingt ein Kind wollte und nun nach einem Partner suchte, der seine Begeisterung teilte. Mehrmals hatten er und Louise darüber gewitzelt, wie sie ihm helfen könne und dass sie Thorne dazu nicht bräuchten.
»Komm schon, Lou«, hatte Hendricks gesagt. »Mit mir bist du doch besser daran. Ich zieh mich besser an, hör die bessere Musik, ich hab einfach den besseren Geschmack.«
»Ja, okay. Warum nicht?«
»Ich meine, wir würden natürlich nicht direkt was machen. Es gibt da Mittel und Wege. Außerdem glaub ich nicht, dass du sextechnisch was vermissen würdest.«
»Da lässt sich nicht viel dagegen sagen.«
Hendricks hatte Louise umarmt und Thorne angegrinst. »Das wär also geklärt. Ich und deine Freundin spielen jetzt ein bisschen mit der Soßenspritze ...«
Heute tranken sie um einiges mehr als sonst und räumten die Küchenschränke leer. Sie sahen fern und redeten über Fußball, Facelifting und den Tumor, den Hendricks im Magen einer Frau um die fünfzig entdeckt und der sich als ungeborener Zwilling entpuppt hatte.
Die üblichen Themen.
Gegen halb zwölf bestellte Hendricks telefonisch ein Taxi in seine Wohnung nach Deptford, und während sie auf das Taxi warteten, redeten sie noch über das Foto. Sie hatten schon früher darüber gesprochen beziehungsweise telefoniert. Drei Mal. Thorne und Louise, Louise und Hendricks, Hendricks und Thorne. Sie hatten beim Eintreffen in der Wohnung darüber gesprochen und schließlich, als sie alle zusammen waren. Es war nur eine Frage der Zeit, wann sie auf das Thema zurückkämen.
»Solange man keine Leiche findet, ist es nur ein Foto«, sagte Hendricks.
»Du hast es nicht gesehen.«
»Na und?«
»Hör doch zu«, sagte Louise. Sie legte Thorne die Hand auf den Arm und nickte in Hendricks‘ Richtung. »Er bringt‘s auf den Punkt. Es ist nur ein Foto. Die Leiche wird vielleicht nie gefunden.«
»Und was heißt das für mich?«
»Vergiss es.«
»Wie ich schon zu Phil gesagt hab ...«
»Nein, ich hab das Foto nicht gesehen, aber ich weiß, wie der Tod aussieht. Hör doch damit auf, Tom, wir alle wissen das.«
Natürlich hatte sie recht, aber trotzdem, Thorne wurde dieses merkwürdige Gefühl nicht los. Als hätte er ständig Gegenwind. »Es kommt mir einfach so vor, als wär es mein Foto. ... Es ist mein Foto.« Er zog die Schultern hoch, wieder dieses Frösteln, und wappnete sich, als Louise sich gegen ihn lehnte. »Es wurde an mich geschickt.«
Hendricks nickte langsam. Er sah zu Louise und dann auf seine Uhr, bevor er ans Fenster trat und hinaus auf die Straße blickte.
»Die Taxifirma sagte, das Taxi brauche zehn Minuten«, sagte Thorne.
Sie gingen in die Diele und standen ein bisschen verlegen herum. Obwohl Thorne den größten Teil der letzten vierundzwanzig Stunden die Frage vermieden hatte, die zwischen ihnen stand, spürte er, wie sie auf ihm lastete. So sehr, dass ihm schwindlig wurde.
Hendricks sprach sie schließlich laut aus.
»Warum an dich?«
Nachdem Hendricks weg war, verschwanden Thorne und Louise schnell im Bett. Doch was dann passierte, war eher halbherzig. Ob es an der Müdigkeit lag, an dem Bier oder etwas anderem, ihre Lust war verschwunden, und die Wärme und Nähe war ihnen beiden genug.
»Das mit dem bescheuerten Blödmann war nicht so gemeint«, sagte Louise, bevor sie sich umdrehte.
Später lag er wach im Dunkeln und bemühte sich, das hartnäckige laute »Warum?« auszublenden. Am Schluss war es nur ein Autoalarm, an den er sich gewöhnt hatte. Und er wusste, die Chance war groß, dass er sich nicht lange mit dieser Frage herumschlagen musste, sondern die Antwort bald erfahren würde. Auch wenn das kaum ein Trost war.
Während Louise neben ihm leise vor sich hin schnarchte, fiel ihm etwas ein, was er heute gesagt hatte. Als Kitson ihn fragte, warum er nicht einfach die SIM-Karte abgegeben und das Handy behalten hatte.
Er hatte sich nicht viel dabei gedacht und es einfach so vor sich hin gesagt.
»Ja, nächstes Mal weiß ich dann Bescheid.«
Er sdsdwar viel herumgelaufen, nachts, zumindest in den ersten paar Monaten.
Hauptsächlich natürlich, weil es möglich war und weil es noch immer neu für ihn war. Die Wohnung war nicht klein, wirklich nicht, aber nach ein, zwei Wochen begann einem einfach die Decke auf den Kopf zu fallen, und man wollte nur noch raus. Der Regen oder der Wind war ihm egal. Das war nur Wetter, und das Wetter war immer gut.
Heute war es kalt und trocken, als er die Hauptstraße entlangmarschierte, an den vergitterten Läden und den Tankstellen vorbei, die die ganze Nacht offen hatten. Er bog in eine Seitenstraße ein und legte die Hand um den Schraubenschlüssel in seiner Jackentasche, als er auf eine Gruppe Teenager an der Ecke traf.
Anfangs war er nur gelaufen, um die Zeit totzuschlagen, um die endlosen Stunden zu überstehen, in denen er kein Auge zutun konnte. Er brachte noch immer nicht mehr als ein paar Stunden Schlaf pro Nacht zusammen, im Höchstfall drei, und das in Fünfzehn-, Zwanzig-Minuten-Happen. Er konnte sich nicht erinnern, länger geschlafen zu haben seit dem Besuch damals.
Das zweite Mal, dass sein Leben auf den Kopf gestellt worden war.
Schon komisch, wie sich beide Male alles total verändert und in Scheiße verwandelt hatte. Er hatte dagesessen mit Leuten, die mit ihren Polizeiausweisen gewunken hatten ...
In den letzten Wochen hatte er den Großteil von Westlondon abgelaufen. Er hatte ganze Nächte auf der Straße nach Shepherd‘s Bush und dann weiter auf der Uxbridge Road durch Acton und Ealing verbracht. Er war nach Süden gegangen, um den Gunnersbury Park herum und dann weiter nach Chiswick, hatte zugesehen, wie die Autos in beiden Richtungen über ihm auf der M4 fuhren. Er war im Zickzack durch die kleineren Straßen zurück nach Hammersmith gegangen und kurz vor der Brücke herausgekommen, wo die Themse einen Bogen beschrieb, zwei, drei Kilometer vor der Überführung, in deren Schatten die Wohnung zwischen einem Krankenhaus auf der einen und einem Friedhof auf der anderen Seite lag.
Die Teenager am Ende der Straße beachteten ihn nicht wirklich. Vielleicht sah man es ihm an.
Früher war es so gewesen.
Er gewöhnte sich daran herumzulaufen, statt zu schlafen. Er ging gern. Das Gehen half ihm, Dinge durchzudenken. Und auch wenn er sich tagsüber oft genug absolut kaputt fühlte, schien sich sein Körper daran zu gewöhnen, das Schlafdefizit zu kompensieren oder wie man das nannte. Er glaubte sich daran zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass Napoleon und Churchill und Margaret Thatcher nur mit ein paar Stunden Schlaf pro Nacht ausgekommen waren. Offensichtlich kam es nur darauf an, wie man die Dinge anpackte, wenn man wach war. Vielleicht kam man damit durch, solange man ein Ziel hatte.
Er machte sich auf den Heimweg. Lief die Goldhawk Road hinunter zur Stamford-Brook-U-Bahn-Station.
Er würde ihr schreiben, sobald er daheim war.
Er würde sich einen Kaffee machen und das Radio einschalten, sich an sein mistiges winziges Tischchen in der Ecke setzen und noch einen Brief raushauen. Ihr erzählen, wie es lief, zwei, vielleicht drei Seiten schaffte er, wenn es ihm locker von der Hand ging, und den Brief dann zu den anderen stecken, die in Gummibänder gewickelt in der Schublade mit den Handys und den SIM-Karten lagen.
Dann würde er sich ein neues Handy schnappen und hier sitzen und darauf warten, dass die Sonne aufging.
Viertes Kapitel
Dawson war vielleicht ein kleiner Arschkriecher, aber was schnelles Arbeiten anging, konnte man ihm und seinen Kollegen nichts vorwerfen. Noch bevor die erste Tasse Kaffee am Morgen kalt geworden war, saß Thorne bereits an einem Computer in der Einsatzzentrale und betrachtete ein hochaufgelöstes JPEG des Fotos, das er auf seinem Handy erhalten hatte.
Das unter dem Kopf des Toten war ein Teppich.
»Die Sauerei kriegt er nie mehr aus dem Flokati raus«, hatte Stone gemeint und seinen Ausdruck geschwenkt. »Für Blut gibt es doch keinen Fleckenteufel, oder?«
Kitson nahm ihm das Foto aus der Hand und sah es sich kurz an, bevor sie es weglegte. »Fleckenteufel Nummer vier. Aber wenn der Teppich dem armen Teufel gehört, spielt das wohl keine Rolle mehr ...«
Thorne bewegte mit einer Hand den Cursor über das Bild, zeichnete den unregelmäßigen Umriss eines roten Flecks nach, während er sich mit der anderen Hand den Hörer ans Ohr hielt. Er hatte das Foto sofort hinüber an das St. George‘s Hospital gemailt, an dem sich Phil Hendricks etwas zu dem Hungerlohn dazuverdiente, den ihm die Met bezahlte, indem er an drei Tagen die Woche unterrichtete.
Hendricks hatte ihn sofort zurückgerufen. »Ist immer noch nur ein Foto.«
Thorne wartete ein paar Sekunden. »Und?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher, was du willst.«
»Vielleicht eine Meinung hören. Eine Fachmeinung. Wahrscheinlich verschwende ich nur meine Zeit ...«
»Auch wenn das eine hohe Auflösung ist, hat das Foto selbst nicht die beste Qualität. Zu wenig Pixel, mein Freund.«
»Du klingst wie der Kerl im Handyladen.«
Aber Hendricks hatte recht. Das Bild war unscharf, und sogar die Cracks in Newlands Park hatten wenig herausgefunden, was sie wirklich weiterbrachte: Der Tote lag auf einem Teppich; die Haare waren womöglich grauer, als es zunächst den Anschein hatte; was auf dem winzigen Display des Handys wie ein Schatten am Nacken ausgesehen hatte, war wahrscheinlich der Rand eines Tattoos, das unter dem Kragen des Toten herauslugte.
»Also nichts, was mir weiterhilft?«, fragte Thorne und ließ den Cursor auf dem einen sichtbaren Auge liegen. »Verrät dir das Blut was? Handelt es sich um eine Schusswunde, oder war das eine stumpfe Waffe?«
»Ich bin doch kein Hellseher«, sagte Hendricks. »Arterielles Blut ist heller, und dafür ist es auch zu wenig. Aber von dem Foto her kann man das nicht sagen. Ich wiederhole mich ...«
»Megapixel, schon gut.«
»Ich sag dir, mit wie viel Zucker er seinen Tee getrunken hat, wenn ich ihn sehe. Oder was von ihm übrig ist.«
Was danach kam, war mehr oder weniger Small Talk. Dass Arsenal in letzter Zeit formschwach war; dass man sich später auf einen Drink treffen könnte. Auf das Foto und die Fragen dazu kamen sie nur noch einmal zurück. Hendricks klang so ernst wie in Thornes Diele am Abend zuvor und stellte noch einmal fest, dass, Megapixel hin oder her, nur eine Sache bei diesem Foto klar war. »Wenn es dir hilft, ich verstehe vollkommen, warum du alles darüber wissen willst«, sagte er.
Nach dem Telefongespräch saß Thorne eine Weile nur herum und sah der Uhr beim Ticken zu. Und Karim, der am weißen Brett schrieb und radierte, das beinah eine ganze Wand der Einsatzzentrale einnahm, und die Landkarte der Morde auf den neuesten Stand brachte. Er hörte zu, wie Andy Stone vergeblich versuchte, mit seiner »Blut-und-Teppich-Nummer« noch mehr Lacher herauszuholen, und Yvonne Kitson das Labor damit nervte, ob es endlich was zu dem Messer gäbe, mit dem Deniz Sedat umgebracht worden sein könnte.
Er bekam nicht jede Einzelheit des Gesprächs mit. Der Schlafmangel machte sich seit halb sieben bemerkbar — als er sich ins Bad geschleppt und das verschwitzte T-Shirt ausgezogen hatte, während Louise noch immer wie tot schlief. Und vier Stunden später hatte er das Gefühl, schon einen ganzen Arbeitstag auf dem Buckel zu haben. Sogar als er den Kopf hob und Brigstocke die Antwort auf seine Frage zuraunzte, war er sich nicht sicher, ob er nicht ein paar Sekunden weggenickt war.
»Wann haben Sie zum letzten Mal das Bulletin gecheckt?«, hatte ihn der DCI gefragt.
»Vor eineinhalb Stunden ...«