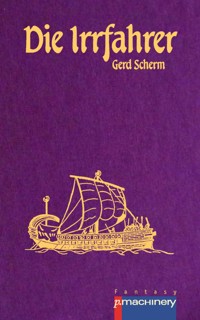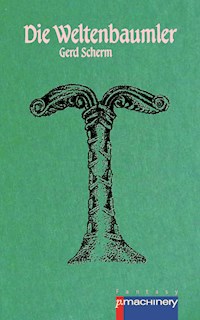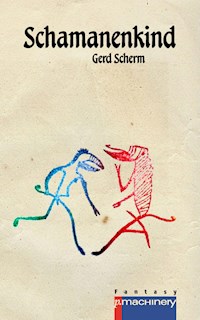9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Über dieses Buch: »Lieber Gerd, heute während meiner schlaflosen Nacht war ich bei Dir, mit Dir, in Deinen Texten, die auch in mir einiges nach oben geschwemmt haben. Was für ein reiches, aber auch verwundetes Leben Du hast. Was Du alles ins Leben gebracht hast, durchgestanden und bewältigt hast. Ich liebe die Tiefe, die Differenziertheit Deiner Sprache. Ich assoziiere sie mit der Musik von Henry Purcell, warum auch immer. Ich könnte stundenlang über Deine Texte sprechen, aber ich belasse es beim Fazit: Du hast mir heute meine Nacht mit Deinen Worten gerettet.« Irmtraud Tarr Konzertorganistin, Autorin und Psychotherapeutin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Einmal Leben und zurück Die Autobiografie des Gerd Scherm
Außer der Reihe 63
Einmal Leben und zurück
Die Autobiografie des Gerd Scherm
Außer der Reihe 63
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Oktober 2021
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Gerd Scherm
Illustrationen im Innenteil: siehe dort
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 263 8
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 834 0
Vorwort
Ende März 2020 brach die Corona-Krise über uns herein und zerstörte die eingeschliffenen Verhaltensweisen, die lieb gewonnenen Gewohnheiten ebenso wie die tägliche Routine. Ausgerechnet in meinem siebzigsten Lebensjahr! Schlagartig waren alle Planungen nichtig, Termine hinfällig, Treffen mit anderen gefährlich und verboten. Die eigenen vier Wände verwandelten sich über Nacht in einen Käfig. Nun kam etwas über uns, das wir noch nie erlebt hatten: Wir wurden physisch und teils auch mental auf uns selbst zurückgeworfen. Doch es war nicht meine manchmal auftretende Sehnsucht nach Ruhe, nach Ungestörtsein, die sich überraschend erfüllte, nein, es war ein Zwang, es war die absolute Einschränkung der Freiheit hinzugehen, wohin man will und wann man will. Ich sagte mir, wenn man derart auf das Innen fixiert ist, öffnet sich vielleicht und im besten Fall dadurch eine Tür zum wirklichen Inneren. Und so geschah es.
Die Stille im Außen schaffte auch im Innen Ruhe. Das Vakuum des isolierten Alltags füllte sich mit Erinnerungen. Der Blick nach vorn war versperrt, vernebelt von seelenlosen Statistiken und Schreckensnachrichten. Alle Vorstellungen von Zukunft wandelten sich in wertlose Optionsscheine. Was blieb mir in dieser Situation?
Für mich fand ich zwei Wege: zum einen das Durchstöbern alter Zettelkästen und feinelektrischer Notizen, zu schauen, was sich vielleicht auszuarbeiten lohnt. Zum anderen der Blick zurück, nachzuspüren, was war und was davon wert sein könnte, festzuhalten.
Meine Literatur ist für mich stets auch die Verortung meiner selbst.
Geografische Koordinaten verschmelzen mit meinem Denkfühlen.
Auch wenn mich meine Geschichten ins alte Ägypten oder ins Troja des Homer führen, wenn ich dem Golem in Prag begegne oder den Reitern der Wilden Jagd in Rothenburg ob der Tauber, es sind immer überzeitliche, besser vielleicht unzeitliche Schauplätze. Sie werden durch das Festhalten in Buchstaben zu Fixpunkten meiner Biografie, zu persönlichen Lebensstationen. Jede Geschichte, jedes Gedicht verbindet sich innig mit mir und wird Teil meines Selbst.
Das Leben ist kein solitärer massiver Block, es besteht aus Fragmenten. Große und kleine, spektakuläre und unscheinbare. Und das Leben verläuft nicht einfach linear chronologisch. Ereignisse verschränken sich mit anderen Ereignissen, manche Phasen legen Pausen ein, Situationen aus unterschiedlichen Bereichen finden gleichzeitig statt, Menschen verlieren sich und finden sich wieder, die Lebensfäden sind lose, manche verschwinden für immer, andere werden wieder aufgenommen.
Die Lebenslinie scheint pfeilförmig zu sein, doch das ist nur die Zeitlinie, um die sich das Leben spiralförmig weiter und weiter entwickelt. Ereignisse tauchen auf, verschwinden, nur um in neuer Form erneut die Zeitlinie zu kreuzen. Menschen verschwinden aus dem Fokus, manche verblassen langsam, andere sind von einen Tag auf den anderen nicht mehr da. So machte ich mich auf, die Splitter und Flicken meiner Erinnerungen in mir zu suchen. Nicht als Forscher meiner selbst wollte ich unterwegs sein, sondern als Flaneur, als einer, der auf dem Boulevard seines Lebens spaziert und in die Schaufenster blickt. Einer, der den Blick schweifen lässt, der kein festes Ziel verfolgt, der sich von Details faszinieren lässt und die Abschweifung liebt.
Die erste Version von »Einmal Leben und zurück« schrieb ich im Juli und August 2020 als Literaturspaziergang für die Webseite des Literaturportals Bayern. Nicht ahnend, dass die Corona-Krise immer länger und länger dauern würde, viel länger als gedacht oder befürchtet oder erhofft und so flanierte ich weiter und weiter und weiter in den Straßen meines Lebens von Fenster zu Fenster …
Fürth 1950–1968
Meine Großmutter Babette Eberlein vor meinem Geburtshaus in der Fürther Altstadt im Kannengießerhof (Gustavstraße). Foto privat.
Jede Großstadt bringt im Lauf ihrer Geschichte einige lesenswerte Schriftsteller hervor. Das ist mehr der statistischen Wahrscheinlichkeit geschuldet als dem Umfeld, da macht auch meine Heimatstadt keine Ausnahme. Doch muss ich gestehen, dass der einzige Fürther Autor, der mir bereits in jüngeren Jahren begegnete, Jakob Wassermann war. Dabei sollte ein anderer für mich später viel interessanter werden: Fritz Oerter. Gerade mal fünfundsiebzig Meter von meinem Geburtshaus entfernt hat er gelebt, fünfzehn Jahre, bevor meine Mutter in einer winzigen Wohnung im Kannengießerhof niederkam.
Oerter war Lithograf, Schriftsteller und Buchhändler und ein Anhänger des Anarchosyndikalismus, d. h. er träumte von einer herrschaftsfreien, gerechten Welt, in der jeder satt werden kann. Nach der gescheiterten Räterepublik von München versteckte er 1919 den Schriftsteller und führenden Revolutionär Ernst Toller bei sich. Nicht zuletzt wegen dieser »anrüchig-linken« Vorgeschichte bietet Oerter auch heute noch viele Gründe für die Gesellschaft, ihn zu vergessen. Legenden ranken sich um ihn und ich vermute, man nennt sie deshalb Legenden, weil die Leute durch diesen Begriff den Wahrheitsgehalt infrage stellen können. Sie als Historie zu akzeptieren, beinhaltet das Risiko, ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
Das Haus, in dem Oerter wirkte, ist sehr markant. Es erinnert mich an das Flatiron Building, den berühmten Wolkenkratzer am New Yorker Times Square, natürlich viel, viel kleiner. Es ist an der Stirnseite nur ein Zimmer breit und ragt einem auf der abschüssigen Oberen Fischerstraße, die jeder Einheimische Fischerberg nennt, entgegen wie ein Schiff. Als würde das Haus aufsteigen vom Fluss her, der Pegnitz, die dort unten fließt. Ganz oben, unterm Dach wohnte er, von dort hatte er den Blick nach unten auf die Ärmsten, aber auch zu den Sternen, die von seiner Sehnsucht kündeten. Sein anfänglicher Feuereifer, sein Brennen für eine gerechte Zukunft wich nach und nach einer zunehmenden Resignation und Wehmut. Als Friedensaktivist hatte man ihn während des Ersten Weltkriegs zu fünfzehn Monaten Festungshaft verurteilt und nach der Machtergreifung der Nazis zunehmend schikaniert. 1935 verhaftete die SA Oerter und verhörte ihn »massiv«. Kurz nach seiner Entlassung aus der U-Haft ist er an den Folgen gestorben.
Eine der exotischsten Geschichten über Oerter ist sein Treffen mit dem indischen Literaturnobelpreisträger (1913) Rabindranath Tagore. Der wollte eigentlich Thomas Mann treffen, doch der lehnte die Begegnung ab, weil Tagore ihn bei einem Empfang nicht sogleich erkannt hatte. Später mokiert sich Thomas Mann in seinem Tagebuch maliziös, der Inder habe den Eindruck einer »feinen alten englischen Dame« hinterlassen. Also besuchte der weltberühmte Dichter statt Mann in München einen Freund seines Übersetzers Gustav Landauer, den engagierten Dichter Fritz Oerter in der Fürther Altstadt. Die beiden korrespondierten schon seit längerer Zeit und tauschten Lyrik aus. So gingen die beiden im Fürther Stadtpark spazieren. Ich sehe sie vor meinem inneren Auge, die beiden weißhaarigen Dichter, mit langem Haupthaar beide, mit prächtigem Schnauzer der eine, mit langem, wallenden Vollbart der andere. Ich denke, die Bürger haben ihnen ziemlich irritiert und höchstwahrscheinlich auch pikiert nachgesehen.
Links Wohnhaus von Fritz Oerter; rechts ein Liebesgedicht an seine Frau
In jenem Stadtpark, in dem ich auf der Freilichtbühne 1971 das erste Mal mit einer Lesung in meiner Heimatstadt auftrat. In bester Zensurtradition wurde ein Jahr später eine erneute Lesung der Fürther Kulturkollektivs »kukoll« vom zuständigen Verwaltungsrat Ammon abgelehnt. Begründung: »Bitte bedenken Sie, dass die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne von jedermann gesehen und gehört werden, auch von Andersdenkenden. […] Die ältere Generation könne in ihren religiösen und sittlichen Empfindungen nur allzu leicht verletzt werden.«
Gerd Scherm bei Stadtpark-Lesung 1971 in Fürth. Foto Meyer.
Die dunkelgrauen Jahre
Fürth stand in meiner Jugend immer noch mit einem Bein in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Traumatisch wirkten die Ereignisse und Verluste nach, kein Mantel des Vergessens war groß und schwer genug, sich darüber zu legen.
Meine ersten Geografiestunden bekam ich schon vor meiner Einschulung bei Verwandtenbesuchen. Dort lernte ich die weite Welt kennen, zumindest dem Namen nach. Geografie hieß damals noch Erdkunde und die Erde kündete vor allem vom Blut, mit dem sie getränkt war.
Der Vater meiner Mutter eroberte für Führer, Volk und Vaterland den Eiffelturm in Paris und die Akropolis in Athen und sorgte dafür, dass alle zu Hause per Feldpost von diesen Triumphen erfuhren. Er diente in einem mobilen Militärpostamt und sorgte für den Kontakt der Soldaten mit der Heimat. Seine Landkarten, mit denen ich später exzessiv spielte, trugen viele verschiedenfarbige Buntstiftlinien mit immer neuen, sich ständig verändernden Grenzen. Ein Tieffliegerangriff mit anschließender Explosion war Anlass für die lapidare Meldung in die Gustavstraße, dass Opa nun ein Held sei. War er aber dann glücklicherweise doch nicht, zumindest kein toter Held. Nach Monaten der Trauer kam das Lebenszeichen aus französischer Gefangenschaft.
Norwegen lernte ich durch Onkel Leikauf kennen, der hoch im Norden in Narvik bei Eis und Schnee als Gebirgsjäger kämpfte. Seine Liebe zu den Bergen ist ihm geblieben, nicht aber sein ältester Sohn Willi, der im Alter von einundzwanzig Jahren bei der russischen Stadt Moltopol fiel.
Noch mehr Kenntnisse der Weiten Russlands konnte der älteste Bruder meines Vaters, der Karl, beitragen. Er stand mit seinem Panzer irgendwo bei Moskau, sehnte sich zurück in die Hitze des Afrikafeldzugs, als ihm die Rote Armee sagte, er könne jetzt gleich bis Sibirien weitermarschieren.
Der Schellers Opa, mein Stiefgroßvater, war auch durch den Triumphbogen in Paris marschiert und hatte auf dem Montmartre flaniert. In Russland haben sie ihm dann das Bein zerschossen und er hat es sich nicht abnehmen lassen, von den Lazarettmetzgern im Erzgebirge. Als der Kanonendonner näher kam, schnappte er sich einen Schrubber und einen Besen als Krücken und machte sich auf den Weg nach Fürth. Dort erst, zu Hause, beim Arzt, den er kannte, ließ er sein Bein und bekam die Prothese, die immer in der Wohnzimmerecke lehnte und mir Albträume bereitete.
Den anderen Bruder meines Vaters, Arthur, haben sie in Montecassino in Italien so zusammengeschossen, dass er mehr tot als lebendig war. Aber doch noch so viel Leben in sich hatte, dass die Wehrmacht ihn für die Rückzugsgefechte in Ostpreußen brauchen konnte.
Mein Vater Adolf schließlich stemmte sich als Siebzehnjähriger in der Normandie mit dem Flakgeschütz gegen die Invasion am D-Day, bis ihn die Amerikaner aus all den Toten in der Stellung herauszogen. Danach durfte er auf den Baumwollfeldern Amerikas in sengender Hitze seine Kriegsschuld abarbeiten.
Dokument der Gefangennahme meines Vaters nach der Invasion in der Normandie.
Heutzutage ist das Fürther Viertel rund um die Michaeliskirche und die Gustavstraße das romantische Zentrum der Stadt. Kleinkunst, Handwerker und Künstler finden in den Altbauten immer noch bezahlbare Wohn- und Arbeitsräume. Dazu reiht sich Kneipe an Restaurant an Café, man feiert hier mannigfaltige Straßenfeste, Floh- und Weihnachtsmärkte. Man zelebriert die Keimzelle der Stadt als Eventkulisse. Es ist chic, den Abend in diesem Viertel zu verbringen.
Man hat sich rund um die Gustavstraße auch schon früher amüsiert, allerdings ein wenig anders. Bevor er ein Star wurde, spielte hier Freddy Quinn für wenig Geld, Kost und Logis für die amerikanischen Soldaten im Gelben Löwen.
Freddy Quinn (links) im »Gelben Löwen« in der Fürther Gustavstraße 1950. Quelle FürthWiki
Er war wirklich hier bei uns in der Gustavstraße, damals. Der Vorzeigematrose aus Wien, immer Gitarre und Meer im Seesack, der Freddy.
Abends trat er mit Hillbilly-Songs im Gelben Löwen auf, der verruchtesten Kneipe der Fürther Altstadt, damals, als ihn außer den Anwohnern und den Amis im Löwen noch keiner kannte. Wenn wir alle damals schon gewusst hätten, was aus dem einmal werden wird – vergangen, vergessen, vorüber. Nach kurzer Zeit wurde Freddy von einem höheren US-Offizier im Wirtshaus »entdeckt«. Dieser vermittelte ihn an den AFN-Radiosender der US-Streitkräfte in Deutschland. In Nürnberg gab es ein eigenes AFN-Studio, sodass der Hillbilly-Sänger meist nachmittags gegen fünfzehn Uhr Songs für den Sender einspielte und dabei mehr verdiente als in einer Woche im Gelben Löwen. Frei nach dem Lied »La Paloma«, das er auch im Gelben Löwen gesungen hat – »Schwarze Gedanken, sie wanken und flieh'n geschwind wie Sturm und Wind!« – war er eine schwarze Gestalt, die dann auch geflohen ist aus der Enge unserer Straße.
Der Stadtmusikant sagte sich wohl: »Was Besseres als den Tod finden wir allemal«, zog von dannen und wurde an der Waterkant berühmt.
Die Amis haben ihn vielleicht vermisst, aber uns ist eigentlich erst aufgefallen, dass er weg war, als seine Filme im Kino kamen. Da saßen dann alle aus der Gustavstraße, Alt und Jung, Klein und Groß, im Alhambra und staunten, was aus dem Wiener Jungen für ein strammer Seemann geworden ist. »Die Gitarre und das Meer« wurde zum ersten Kultfilm einer ganzen Straße. Der Straße, über die man sagte: »In der Gustavstraße darf man nicht stehen bleiben, weil einem sonst durch die Kellerfenster die Schnürbändel aus den Schuhen geklaut werden.«
Zehntausend US-Soldaten waren auf drei Kasernen verteilt in Fürth stationiert, das bedeutete, circa jeder zehnte Einwohner. Die Stadt brachte es sogar zu kurzem und zweifelhaftem Ruhm in den USA. Im FürthWiki steht im Artikel »US Army«:
»Der Militärgeistliche für die US-Truppen Betreuung, ein Dr. Carl Yaeger, hatte vor der lutherischen Synode in Atlantic City die moralische Verruchtheit verschiedener westdeutscher Städte, darunter Fürth, als Quelle des Sittenverfalls bei den GIs dargestellt. Die Stadt wurde daraufhin in verschiedenen US-Zeitungen als »Sündenbabel« bezeichnet, die örtlichen erotischen Versuchungen seien eine Gefahr für die Moral und Kampfkraft der Truppe. […] Der Fürther Dekan Christian Rieger gab zu, dass sich in der Mitte der Stadt ein »unsittliches Treiben und Schamlosigkeit breitgemacht hätten«. Besonderen Anstoß erregte, dass die Dirnen und Zuhälter ihr Unwesen um die altehrwürdige Michaeliskirche herum trieben. […] Die Altstadt war das Vergnügungsviertel für die amerikanischen Soldaten. Die engen, winkligen Gassen und der im Allgemeinen schlechte bauliche Zustand waren ein Nährboden für die unsittlichen Zustände. […] Am 6. November 1954 hatte Oberbürgermeister Hans Bornkessel auf Bitten der US-Amerikaner das Betretungsverbot erlassen. Von 17 Uhr an bis um 6 Uhr des nächsten Morgen mussten die GIs draußen bleiben. Auch der Polizeichef Kaltenhäuser hatte ein Verbot mehrfach schon erwogen – immer dann, wenn wieder einmal eine Häufung von Geschlechtskrankheiten, Kuppelei, Gewerbeunzucht und Schwarzhandelsfällen auf das Zentrum der Gustavstraße-Gegend allzu deutlich hinwies.«
Mein Vater mit mir auf dem Arm, rechts im Hintergrund seine Mutter, die »Schellers Oma«. Foto privat.
Mein noch nicht lange aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrter Vater wohnte auf der linken Seite des Kannengießerhofs, auf der gegenüberliegenden rechten Seite meine Mutter, es war quasi eine Hofliebelei. Vater wohnte bei seiner Mutter und seinem einbeinigen Stiefvater und seiner erst 1949 geborenen Halbschwester Karin. Meine Mutter lebte bei ihren Eltern und mit ihrer jüngeren Schwester und ihrem noch jüngeren, 1948 geborenen Bruder. Eigentlich meine Generation, dennoch meine Tante Karin und mein Onkel Reimund. Beide Wohnungen waren winzig und für ein frisch verheiratetes Paar mit Baby eine schreckliche Situation. Alles eng zusammengequetscht, ohne Privatsphäre, ohne Rückzugsmöglichkeit, alles auf das Notwendigste reduziert, kurz: Wir haben nicht gewohnt, sondern gehaust.
1951 konnten dann meine Eltern mit mir aus dem Kannengießerhof in die Nummer Dreizehn umziehen, in die Wohnung im Parterre, wo das Hauseck in die Straße hineinspringt und alle Lastwagen herunterschalten mussten, weil sie sonst nicht vorbeigekommen wären. Das alte Kopfsteinpflaster unterstützte die Verkehrsakustik der Bundestraße 13 von Nürnberg nach Würzburg erheblich und wenn die Panzer der Amerikaner auf Armeslänge entfernt unser Schlafzimmer passierten, dachte man, das alte Fachwerkhaus stürzt ein.
Die Wohnung war dunkel und feucht, zwei Fenster zur Gustavstraße vom Schlafzimmer aus, die Küche eines zur »Reia«, dem schmalen, lichtlosen Zwischenraum von unserem Haus zum Würzburger Fischhäusla, und ein Fenster zum Hof, vom Wohnzimmer aus. Ins Wohnzimmer ist man einige Stufen vom Hof aus hinuntergegangen und an der linken Wand befand sich eine große Falltür, die zu mehreren Kohlenkellern führte. Dieser Umstand brachte uns zur kalten Jahreszeit regen Besucherstrom in unser Wohnzimmer, denn die Kellerbesitzer hatten ein Wegerecht, um zu ihren Kohlen zu kommen, die sie dann aus dem Untergrund durch unser Wohnzimmer in ihre Wohnungen schleppten.
Wenn wir einmal nicht zu Hause sein konnten, wenn wir zum Beispiel zu Weihnachten für ein paar Stunden Verwandte besuchten, mussten wir unseren Wohnungsschlüssel immer bei einem Nachbarn abgegeben, damit die Wärmeversorgung im Haus gewährleistet blieb. Ein weiterer Nachteil dieses Wegerechts war, dass wir auf diese Seite des sowieso kleinen Zimmers keine Möbel stellen konnten. Dafür war das Klo außen auf dem Hof. In dieser dunklen, feuchten und lauten Wohnung holte ich mir Bronchialasthma und eine chronische Mittelohrentzündung, höchstwahrscheinlich, weil ich den Verkehrslärm nicht mehr hören wollte.
Die Schlafzimmerwand – keine Landkartentapete, sondern Stockflecken. Foto privat.
Mehr Erzählungen über das damalige Leben und viele zeitgenössische Fotos finden sich in meinem Buch »Hoffen kostet nichts«.
Volksschule »Michela« am Kirchenplatz, Klassenfoto ca. 1960 mit dem »Lehrer mit Kopfschuss«
Viele Lehrer an der Volksschule waren Veteranen, meiner in der dritten und vierten Klasse mit deutlich sichtbaren Spuren einer massiven Kopfverletzung. Er ging das Wagnis ein, mich Arbeiterkind aus der Gustavstraße bei den Aufnahmeprüfungen der Oberrealschule anzumelden. Ich bestand und betrat im September 1961 erstmals als Schüler die »höhere Lehranstalt«. Damals mussten wir alle Lehrer prinzipiell mit »Herr Professor« ansprechen. Lehrerinnen, also »Frau Professor«, gab es damals nicht an dieser Anstalt, nicht einmal im Musikunterricht.
In seiner Ansprache zum Schuljahresanfang sagte der Direktor: »Schulen und Universitäten haben einen Rektor. Gymnasien, Gefängnisse und Irrenanstalten einen Direktor.«
Ich wusste zumindest, wo ich mich einordnen musste.
Was der Klassenleiter von mir hielt, erfuhr ich ebenfalls gleich am ersten Tag. Der Herr Professor hatte eine Liste mit den Angaben zu allen neuen Schülern und examinierte jeden einzeln. Als ich an die Reihe kam, musterte er mich schweigend, dann sagte er: »So, so, Sohn eines Kraftfahrers aus der Gustavstraße ist er. Damit das klar ist: An dieser höheren Lehranstalt mögen wir keine Hochstapler.«
Oberrealschule, später Hardenberg-Gymnasium, Fürth
Da war ich froh, dass es in meiner Heimatstadt auch ganz andere Menschen gab, die sich um die Literatur kümmerten, wie zum Beispiel Dieter Vorbach, der Leiter der Volksbücherei im Berolzheimerianum. Der entdeckte mich als herumstromernde dreizehnjährige Brillenschlange zwischen den Regalen seiner Bibliothek und sprach mich an. Bei fast jedem meiner Besuche kamen wir ins Gespräch und er gab mir Tipps, was sich zu lesen lohnt. Behutsam führte er mich an die Literatur heran, übernahm quasi meine Ausbildung zum bewussten und auch kritischen Leser.
Anfang 1967 las ich »Kinder von Hiroshima. Japanische Kinder über den 6. August 1945«. Dieses Buch mit Berichten überlebender Kinder des Atombombenabwurfs inspirierte mich zu meinem ersten Gedicht. Es löste bei mir ein emotionales Überquellen aus, einen Zustand des Nicht-mehr-Ertragen-Könnens, der ein Ventil in Worten suchte und in der Lyrik fand.
HIROSHIMA
Fluch des Menschen, todbringender Vogel
Blitz des Hasses, meilenweit
Strom der Leiber, schmutziger Regen
Verbrannte Gesichter treibender Leichen
Das Heulen des Sturmes
peinigt die blaugefärbten Menschen
Sekunde der Ewigkeit, Zwinkern des Titanen
[.]
Trotz der schrecklichen Erfahrung des atomaren Feuers fiel zwanzig Jahre später wieder Feuer vom Himmel. Nun verbrannte man in Vietnam die Menschen mit nicht löschbarem Napalm.
Alte Postkarte mit dem »Berolzheimerianum«
Ein Jahr später durfte ich einen leibhaftigen Schriftsteller kennenlernen: Peter Handke las in »meinem Berolzheimer« aus seinem Band »Die Begrüßung des Aufsichtsrats«. Es war für mich eine Premiere, eine Dichterlesung zu erleben und sie beeindruckte mich sehr.
Noch mehr beeindruckte mich hinterher beim Gespräch im kleinen Kreis mit dem Bibliotheksleiter die Frage von Handke: »Gibt’s hier irgendwo einen guten Kicker?« Auf diesem Gebiet war ich Experte und so verbrachte ich den Rest des Abends mit dem Autor der »Publikumsbeschimpfung« in einem Fürther Wirtshaus beim Kneipensport. Es war eine entspannte, unbeschwerte Begegnung, bei der wir sogar über Literatur geredet haben. Das Treffen von einem, der gerade den Durchbruch geschafft hatte und einem anderen, der an diesem Abend beschloss, auch einmal ein »richtiger« Autor zu werden.
Die umstrittenen Themen »Serbien« und »Nobelpreis« lagen zum Glück von den Nebeln der Zukunft verhüllt in weiter Ferne.
Flucht 1967–1970
Kurz bevor ich aufs Gymnasium kam, zogen wir von der feuchten Wohnung im Erdgeschoss in eine enge Mansardenwohnung im dritten Stock. Dort schlief ich im winzigen Wohnzimmer auf der Couch. Ich weiß nicht mehr, wie ich es überhaupt schaffte zu schlafen, obwohl meine Eltern im selben Zimmer TV schauten. Spielen und Lernen fanden für mich am Küchentisch statt. Das blieb nicht ohne Einfluss auf meine schulischen Leistungen und mein schulischer Abstieg führte von der »höheren Lehranstalt« in den Aufbauzug der Volksschulen, der damals einzigen Chance in der Stadt, die Prüfung zur Mittleren Reife abzulegen. Dort wollte ich die neunte und zehnte Klasse absolvieren, um wenigstens einen vernünftigen Abschluss zu bekommen.
Gegen Ende des ersten Jahres bat mich meine Deutsch- und Englischlehrerin nach dem Unterricht zu sich und erzählte mir von einer Sommerschule in Schottland in den großen Ferien. Sie erklärte, dass der Bayerische Jugendring das Projekt unterstützt und die Kosten sehr niedrig wären. Ich wandte ein, dass ich nicht glaube, dass meine Eltern das bezahlen würden, sie gab mir dennoch das Formular und bat mich, mit meinen Eltern darüber zu reden. Mit wenig Hoffnung sprach ich mit ihnen und war überrascht, als sie zustimmten. So kam es, dass mein Vater mich zu Beginn der großen Ferien zum Bahnhof nach München brachte, wo ich die Zugreise nach Ostende, zur Fähre und zum Zug nach London bestieg. Bereits im Zug wurden wir von Lehrkräften betreut.
Sommer 1967 nach Großbritannien – es war wie in einem Traum. Aus jedem Radio erklangen »Whiter Shade of Pale« und »San Francisco«, »All You Need is Love« und »Let’s Spend The Night Together«. Vier oder fünf Tage sollten wir in London bleiben mit Sightseeing und individuellen Entdeckungstouren. Mir gefiel der Tower ebenso wie die Carnaby Street, das Zentrum des Mode-Universums der Beatniks. Mit zwei anderen Reiseschülern schafften wir es sogar, als Sechzehnjährige Zutritt zu einem Striptease-Club am Piccadilly Circus zu bekommen.
Nach aufregenden Tagen in London fuhren wir mit dem Zug nach Edinburgh, zur Whitehouse Loan School, unserem Domizil für die nächsten vier Wochen. Vier Wochen vormittags Englischunterricht, nachmittags Programm oder zur freien Verfügung. Der Unterricht fruchtete und ich bekam ein Gefühl für die Sprache, was sich in meinem späteren Leben als hilfreich erweisen sollte.
An den Wochenenden gab es Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten wie Melrose Abbey und Tantallon Castle, zum berühmten Golfplatz von San Andrews oder zum Hampton-Park-Fußballstadion in Glasgow.
Man muss bedenken, ich war vorher noch nie alleine im Urlaub gewesen, noch nie vorher im Ausland. Mit meinen Eltern gab es lediglich Tagesausflüge zu Burgen und Schlössern, die mich zwar durchaus interessierten, aber keinen Freiraum boten. Für den Familienurlaub gab es nur zwei Ziele: Tante Male in Schaftlach am Tegernsee und eine mit meinem Vater befreundete Schreinerfamilie in Bogen. Jetzt war ich hier und erlebte das große Tattoo (eigentlich Zapfenstreich, heute Musikfestival) auf Edinburgh Castle.
Ich spürte, dass ich meine ersten eigenen Schritte in die Welt gemacht hatte.
Als ich zum Ende der Ferien nach Hause kam, eröffneten mir meine Eltern, dass meine Mutter schwanger sei und sie siebzehn Jahre nach mir noch einmal Nachwuchs bekommen würden. Durch die Geburt meines Bruders im November 1967 verschlechterte sich meine häusliche Situation. Es war für mich ein Ereignis, das mein Leben noch mehr erschwerte und sich vor allem nachts negativ auswirkte. Meine Couch lag zwischen Elternschlafzimmer und Küche, wo das Babybrüderchen sein Fläschchen bekam und gewickelt wurde. Das alles fand nicht gerade geräuschlos statt und täglich wuchs meine Angst, dass ich bei den bald anstehenden Prüfungen scheitern würde. Dazu drohte mir mein Vater, dass er mich in eine Bäckerlehre stecken wird, wenn ich die Mittlere Reife nicht schaffe, damit ich lerne, früh aufzustehen.
Mein Schulkamerad Jürgen Below hatte ähnlich negative schulische Aussichten und so beschlossen wir, abzuhauen. Durch meinen Sommertrip nach England und Schottland war das Ziel klar: Swinging London. Nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten »Etwas Besseres als den Tod finden wir allemal!« brachen wir zu unserem Traumziel auf. Wir redeten uns gegenseitig ein, dass wir uns schon irgendwie durchschlagen und vielleicht sogar Rockstars werden könnten.
An einem Vormittag im Februar starteten wir vom Fürther Hauptbahnhof, stiegen in Aachen um und wurden am späten Nachmittag in Belgien von Grenzbeamten aus dem Zug geholt. Uniformierte belgische Grenzer übergaben uns in Aachen der deutschen Grenzpolizei, die uns in eine Übergangseinrichtung brachten. Von hier aus wurden Jugendliche entweder ins Gefängnis oder eine Erziehungsanstalt verfrachtet oder ihren Eltern übergeben.
Wir waren zu acht in einem Schlafsaal mit Aufenthaltsraum und die sechs anderen erzählten aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz vom Leben auf der Straße. Aussagen über begangene Straftaten wurden tunlichst vermieden, weil den Profis unter uns klar war, dass man uns abhörte und die Beamten jedes unserer Worte mitbekamen. Stifte wurden uns abgenommen, damit wir nicht lautlos schriftlich kommunizieren konnten. Wir wussten, dass sich unter dem Aufenthaltsraum das Büro des Chefs dieser Einrichtung befand. Wohl stündlich marschierten wir im Kreis umher, die Füße fest aufsetzend, in jeden Schritt unsere Wut und Hilflosigkeit legend, bis die Wärter auftauchten und uns zur Ordnung riefen oder gar einen von uns in eine Einzelzelle sperrte.
Diese durfte ich auch kennenlernen: Bei einem Kontrollgang stand ich nachdenklich am Fenster und der Beamte fragte mich, was ich da treibe. Ich antwortete, dass ich berechne, wie lange ich brauchen würde, mit den Zähnen die Gitter durchzunagen. Das war zu viel des Sarkasmus und man bestrafte mich – wegen Planung eines Ausbruchsversuchs. Am nächsten Tag, ich saß immer noch in der Einzelzelle, holte mich mein Vater ab. Da alle den Jähzorn meines Erzeugers kannten, hatte meine Mutter darauf bestanden, dass ihn ihr fast zwei Meter großer Schwager zu meinem Schutz begleitete. Die Fahrt von Aachen nach Fürth war die schweigsamste meines Lebens.
Einschub
Jahrelang hatte ich im Internet immer wieder nach Spuren von meinem Schulkameraden und Fluchtgefährten Jürgen Below gesucht und keinen einzigen Hinweis gefunden.
Am 25. Mai 2021 erhielt ich folgende überraschende Email:
»Hallo Gerd,
ich hoffe, du kannst dich überhaupt an mich erinnern. Nachdem ich dich im Internet entdeckt habe, wollte ich ja schon seit Langem mal Kontakt zu dir aufnehmen. Hat bisher aber irgendwie nie geklappt. Ich bin viel zwischen Asien und Deutschland gependelt und da bin ich dann nicht dazu gekommen. Jetzt sitze ich ja auch seit längerer Zeit pandemiebedingt gelangweilt zu Hause und da habe ich mich mal durchgerungen. Ich hoffe, auch in diesen Zeiten geht es dir gesundheitlich gut. Falls du Lust und Laune hast, lass mal von dir hören. Ist ja viel Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Erst mal herzliche Grüße. Jürgen«
Unsere letzte Begegnung lag ziemlich genau ein halbes Jahrhundert zurück …
Parallel zu Literatur und Musik interessierte ich mich sehr für Politik. Wir schrieben das Jahr 1968 und die APO (Außerparlamentarische Opposition) befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Wirkkraft. Vor allem Studenten und Schüler gingen auf die Straße und protestierten gegen das System. Und dann wurde kurz vor Ostern 1968, am 4. April, in Memphis, Tennessee Martin Luther King ermordet. Er, der auch für uns den Widerstand gegen die Unterdrückung verkörperte. Er, der für uns ein Symbol gegen die amerikanische Bombenpolitik in Vietnam war. Die USA war zum Feindbild geworden, jene Macht, die in Fürth drei Kasernen, dazu eine eigene Siedlung und in Dambach ein Nobelviertel für ihre Offiziere unterhielt.