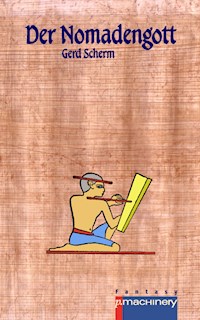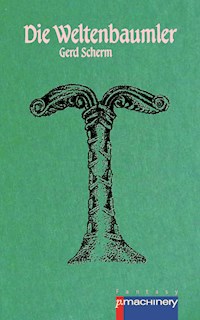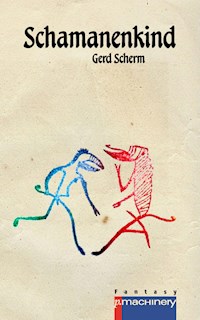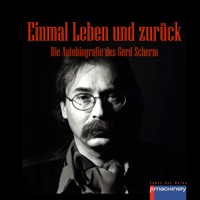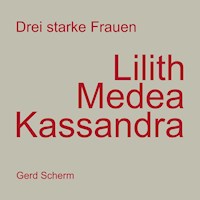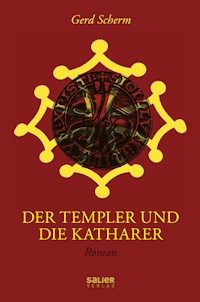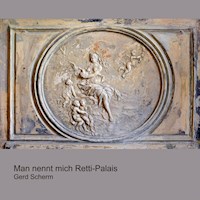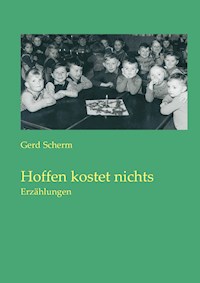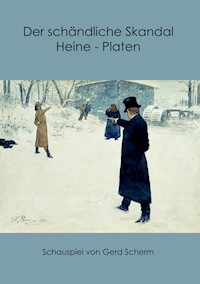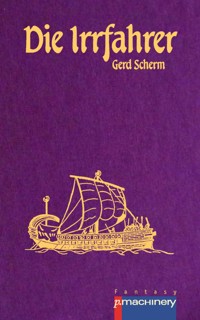
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
GON, der kleinste Gott der Welt, und sein Prophet Seshmosis sind wieder unterwegs. Diesmal geht es kreuz und quer durch die Ägäis und die Welt der olympischen Götter. Ob im Labyrinth des Minotaurus, vor den Toren Trojas oder auf der Irrfahrt des Odysseus, das bunte Völkchen der Tajarim sorgt dafür, dass die Geschichte ganz anders verläuft, als man sie gemeinhin kennt. "Gerd Scherm ist eine urkomische Achterbahnfahrt durch die Welt der Mythen gelungen – ein herrlich intelligenter Lesespaß." HUMANITÄT, Berlin "›Die Irrfahrer‹ entführt die Leser in eine Welt, in der Götter Realität sind und das Leben irreal und irrsinnig machen." Roter Dorn – Das Medienportal "Für Leute mit Neugier, Lust auf Ironie, Wissen und intelligenten Nonsens eine unverzichtbare Lektüre." Wochenzeitung Ansbach
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Gerd Scherm
DIE IRRFAHRER
Fantasy 23
Gerd Scherm
DIE IRRFAHRER
Fantasy 23
Die Irrfahrer im Internet:
www.irrfahrer.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2015
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Gerd Scherm & Friederike Gollwitzer
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 043 6
Gerd Scherm
DIE IRRFAHRER
»Sicher sind wir Götter eitel und grausam, aber wir sind die einzige Hoffnung, die den Menschen bleibt.«
Ein nicht genannt werden wollender anonymer Gott
Prolog
Brief des Schreibers Seshmosis an Elias in Jericho
Verehrter Elias!
Ich hoffe, Ihr seid wohlauf und auch Eurer Tochter Rachel geht es gut. Meine Gedanken wandern oft zu Euch und ich frage mich, ob die anderen Rückkehrer aus Ägypten immer noch um die Stadtmauern von Jericho streifen und ihre Shofarhörner blasen. Nach unserer Abreise aus Eurer schönen Stadt überfiel uns eine Horde von denen, doch unser gütiger Gott stand uns bei. Nachdem er ihren Anführer eingeäschert hatte, ließen die anderen schnell von uns ab.
Nun leben wir schon zwei Jahre in Byblos. Wir, die wir von Theben auszogen, um eine neue Heimat zu finden. Ich weiß nicht, ob wir das, was wir suchten, wirklich gefunden haben. Dazu müsste mir erst klar sein, was Heimat eigentlich ist. Wenn es nur darum geht, einen Ort zu finden, an dem man in Frieden leben kann, dann ist Byblos sicher unsere Heimat. Wenn es aber ein Platz sein soll, an dem mir warm ums Herz wird und wo jemand für mich da ist, dann bin ich immer noch auf der Suche.
Die meiste Zeit seit unserer Ankunft in dieser Küstenstadt habe ich damit verbracht, die Geschehnisse unseres Auszugs aus Ägypten niederzuschreiben. Doch diese Arbeit ist vollendet und es gibt für mich nicht viel, das die Monotonie meiner Tage unterbricht.
Wie oft denke ich an die schönen Stunden bei Euch und Eurer liebreizenden Tochter, deren Lächeln mich auch hier in der Ferne noch verzaubert. Doch ich schweife ab, bitte verzeiht! Wollte ich Euch doch berichten, wie es uns auf unserer Reise ergangen ist, da ich bei unserer Begegnung in Jericho nicht die Gelegenheit dazu fand.
Wie Ihr wisst, verließen wir Theben nicht ganz freiwillig. Um der Wahrheit genüge zu tun, es waren eigentlich alle hinter uns her: der Statthalter des Pharaos, die Palastwache, die Stadtwache, die Tempelwache und ungefähr die Hälfte der zahlreichen ägyptischen Götter.
Dabei haben wir im Prinzip nichts anderes getan als sonst und einfach unser Leben gelebt. Die einen mehr, die anderen weniger. Gut, ich muss zugeben, Raffim ging nicht gerade sanft mit den heiligen Krokodilen des Gottes Suchos um. Aber wie anders sollte er sie zum Weinen bringen, um die Krokodilstränen zu gewinnen? Als Glücksbringer in Gold oder Silber gefasst waren sie immerhin seine Haupteinnahmequelle. Auch Barsils Geschäfte waren nicht nach jedermanns Geschmack. Vor allem dann nicht, wenn den Leuten ihre eigene Inneneinrichtung auf dem Basar zum Kauf angeboten wurde. Sicher kam es auch vor, dass manch feuriger Stier, den unser guter Melmak veräußerte, sich als müder Ochse erwies, aber im Großen und Ganzen waren wir Hyksos in Ägypten wirklich integriert. Allerdings erschien es mir angebracht, unseren Namen zu ändern, als Raffim das Erdbeben ausgelöst hatte, bei dem halb Theben zerstört wurde. Aus Versehen hatte er dem Krokodilgott Suchos sein göttliches Ankh entrissen und so das Unglück ausgelöst.
Mit unserem neuen Namen Tajarim, der Touristen bedeutet, fahren wir auch hier in Byblos gut. Touristen sind überall gern gesehen und keiner sieht sie als Bedrohung.
Eigentlich wollte ich damals ja auf dem kürzesten Weg über das Rote Meer nach Kanaan, doch meine Gefährten überstimmten mich und forderten, die Pyramiden zu besichtigen, wenn wir doch schon Touristen sind. Also entschieden wir uns für die lange, gefahrvolle Route den Nil entlang, mitten durch ein feindlich gesinntes Land. Es war ein Graus für mich! Ihr kennt die Seele eines Schreibers und versteht sicher meine Qualen. Aus der Beschaulichkeit meiner Schreibstube gerissen, sah ich mich unvermittelt als Anführer von zweihundert Flüchtlingen samt Vieh und Habe. Ich will hier nicht die Einzelheiten ausbreiten, verehrter Elias, dafür sende ich Euch meinen umfangreichen Bericht, sobald die Abschrift fertig ist. Oder ich bringe ihn persönlich zu Rachel.
Doch lasst mich hier die wichtigsten Punkte herausgreifen, um Euch einen Eindruck zu geben.
Unter merkwürdigen Umständen erreichte unsere Karawane damals Abydos, besser gesagt die Nähe von Umm el-Qaab, wo die Gräber derer liegen, die vor den Pharaonen über das Land geherrscht hatten. Hier passierte etwas Ungeheuerliches: Mir erschien ein Gott.
Es ist sonst nicht meine Art, Dinge zu sehen, die andere nicht wahrnehmen und dann auch noch mit diesen zu reden, doch die Erscheinung war sehr überzeugend. Und Furcht einflößend.
Bis heute weigert er sich, mir seinen Namen zu verraten und ich nenne ihn deshalb Gott ohne Namen oder kurz GON. Er ist, wie soll ich sagen, eigensinnig. Er liebt es, mir in unterschiedlichen Formen zu erscheinen, mit denen er auf künftige Ereignisse hinweisen will, und er spricht oft in Rätseln, die ich nicht zu lösen vermag. Und so bin ich jetzt nicht nur Schreiber, sondern dazu noch Prophet, auch wenn mir dieser Beruf immer noch sehr fremd ist.
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten gab uns GON sechs Gebote, nach denen wir leben sollten und damit unser Gott immer unter uns sein kann, fertigte unser Karrenbauer Schedrach für ihn einen kleinen hölzernen Schrein als seine Wohnung. Jetzt steht dieser in meinem Zimmer.
Doch zurück zu unserer Reise, besser Flucht.
In der Stadt Sauti stießen dann weitere Menschen zu unserer Karawane: Die nubische Prinzessin Kalala mit ihrem Leibwächter Tafa, der Sänger El Vis aus Memphis und ein Prophet namens Nostr’tut-Amus, der sich uns mit der Begründung anschloss, endlich einmal eine erfüllte Prophezeiung erleben zu wollen.
In Sauti kam es dann zu einer wahren Nacht des Todes, in der alle Erstgeborenen starben, egal ob Mensch, ob Vieh. Mit der Hilfe von GON wurden wir von dieser Katastrophe verschont.
Später konnten wir in Krokodilopolis die Sache mit Raffim und dem Ankh bereinigen und hatten dadurch, GON sei Dank, wenigstens die meisten ägyptischen Götter vom Hals. Allerdings bin ich unter den Pyramiden von Gizeh dann Osiris in die Arme gelaufen und er war nicht sehr freundlich zu mir. Er warf uns schlicht aus Ägypten und der Pharao, den ich kurz darauf traf, bestärkte diesen Rausschmiss. Vor allem mit seiner Ritualaxt, die er über meinem Kopf schwang.
Ich hatte von Anfang an gesagt, wir sollten schnell und diskret über das Rote Meer verschwinden, aber Raffim und die anderen bestanden ja darauf, die Wunder Ägyptens zu sehen.
Als wir endlich dem Land den Rücken gekehrt hatten, kam uns auf dem Sinai ein Riesenzug von Hyksos gefährlich nahe. Sie standen unter der Führung eines gewissen Moses und waren äußerst unfreundlich und militant. Doch wieder half uns GON und wir konnten eine direkte Begegnung mit diesen Leuten um Haaresbreite vermeiden. Bald darauf erreichten wir Gaza und von dort aus reiste ich zu Euch nach Jericho, wo Ihr so freundlich wart, mir die Herkunft meines Volkes zu verraten.
Nun bin ich am überlegen, ob ich nicht doch noch Euer großzügiges Angebot annehmen soll, als Schreiber in Rachels Eurer Stadt zu arbeiten, falls denn die Stelle noch offen ist. Bitte gebt mir möglichst bald durch Boten Bescheid, da ich ernsthaft in Erwägung ziehe, Byblos zu verlassen.
Ich küsse die Erde vor meinem Herrn und neige mein Haupt vor Euch, edler Elias, und bitte Euch, Rachel von ganzem Herzen von mir zu grüßen.
Euer ergebener, treu verbundener
Seshmosis, Schreiber zu Byblos
Im Reich der Lebenden und der Toten
Hephaistos hielt seinem Vorarbeiter einen Donnerkeil direkt vors Gesicht. »Das kannst du besser, Rundauge!«, tadelte der göttliche Schmied den Kyklopen. Doch bevor dieser antworten konnte, öffnete sich knarrend das riesige Eisentor zur Schmiede und gleißendes Licht fiel in den sonst düsteren Raum. Schlagartig verstummten alle Geräusche. Geblendet blinzelte Hephaistos zum Tor und sah den Umriss eines Mannes, der kurz darauf aus dem Gegenlicht trat: Helios, der Sonnengott.
Hinter ihm wuchteten einige Gestalten einen zweirädrigen Wagen in die Werkstatt.
»Ich grüße dich, mein lieber Hephaistos! Ich brauche deine Hilfe. Bei der letzten Sonnenfinsternis kam mein Himmelswagen dem Mond zu nahe und holte sich einige Kratzer. Vielleicht ist auch die Achse verbogen, aber mit technischen Dingen kenne ich mich nicht aus, dafür haben wir ja dich.«
Hephaistos grummelte vor sich hin. Die ganze olympische Göttersippe hatte von Technik keine Ahnung und ruinierte alles, was sie in ihre Finger bekam. Laut sagte er: »Kein Problem, Helios, das bekomme ich schon wieder hin.«
»Fein, fein, mein Lieber. Aber da gibt es noch etwas, über das ich mit dir reden wollte.«
Er sah sich bedeutungsvoll um, bevor er Hephaistos beiseite zog, damit die neugierigen Kyklopen das Gespräch nicht hören konnten.
Dann fragte er mit verschwörerischem Unterton: »Weißt du eigentlich, dass gerade Ares deiner Gemahlin Aphrodite beiwohnt? Und das ist nicht das erste Mal.«
Hephaistos war wütend. Und enttäuscht. Er sah sich in seinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Bisher wollte er die unangenehme Wahrheit nur nicht zulassen. Der Schmied hatte schon lange diesen Verdacht und vermutete, dass die Zwillinge Phobos und Deimos nicht seine Söhne waren. Warum wollte Aphrodite die Kinder denn unbedingt »Furcht« und »Schrecken« nennen, wenn sie nicht vom Kriegsgott stammten? Seine eigenen Namensvorschläge »Feuer« und »Amboss« hatte seine Frau konsequent ignoriert.
Hephaistos bedankte sich bei Helios, obwohl diesem die Schadenfreude ins Gesicht geschrieben stand, und versprach ihm, seinen Himmelswagen schnell zu reparieren. Doch in Wirklichkeit interessierte ihn der Wagen überhaupt nicht, Hephaistos sann auf Rache. Er wollte den beiden Ehebrechern eine Falle stellen und eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen würden.
Tagelang fertigte der Geschickteste der achäischen Götter ein unsichtbares Netz aus feinsten Goldfäden. Dann baute er mit dem unzerreißbaren Gespinst eine Falle rund um sein göttliches Ehebett, bevor er sein Heim angeblich Richtung Lemnos verließ, um auf der Insel mit seinen Gläubigen ein Fest zu feiern.
Kaum war Hephaistos aufgebrochen, erschien auch schon der Kriegsgott Ares an der Schwelle des Hauses und begehrte Einlass, den ihm Aphrodite gerne gewährte. Ohne lange Begrüßung begaben sich die beiden sofort ins göttliche Schlafgemach. Ares riss sich die prunkvolle Rüstung vom Leib und die Liebesgöttin streifte lasziv ihr Gewand über die Schultern und ließ es zu Boden fallen. Nackt sprangen die beiden ins Ehelager. Doch in dem Moment, in dem sie mit dem Liebesspiel begannen, schnappte die Falle zu. Das goldene Netz zog sich um die beiden zusammen und presste sie aneinander. Die beiden begannen zu zappeln wie Fische und sich zu verrenken, um sich zu befreien. Augenblicklich erschien Hephaistos in der Tür und brüllte rasend vor Eifersucht: »Jetzt werdet ihr für alles bezahlen, was ihr mir angetan habt!«
Der Schmied nahm eine lange Eisenstange, die er bereitgelegt hatte, und hängte das Netz daran auf. Dann schulterte er mühelos die frivole Last und hinkte mit seinem Klumpfuß zur großen Halle des Olymps. Hephaistos litt sehr unter seiner Behinderung und der Schönste war er gerade auch nicht. Ganz im Gegenteil, alle nannten ihn den »hässlichen Krüppel«. Umso mehr verletzte es ihn, dass ihn Aphrodite mit diesem Schönling betrog, von dem man sagte, dass keiner so schnell zu Fuß sei wie er. Doch nun sollten alle Götter sehen, was ihm seine Gemahlin und ihr Liebhaber angetan hatten.
In der großen Halle angekommen, hängte Hephaistos das goldene Netz mit seinem nackten Inhalt an einen Haken an der Decke und rief: »Vater Zeus und ihr anderen ewigen Götter! Seht diese Schande!«
Aphrodite und Ares wanden sich verzweifelt in ihrem luftigen Gefängnis und der Kriegsgott setzte all seine Kraft ein, das Netz zu zerreißen. Doch es gelang ihm nicht, sich aus der peinlichen Situation zu befreien.
Die anderen Götter und Göttinnen strömten herzu und starrten verwundert, entsetzt oder amüsiert auf das ungewöhnliche Schauspiel.
Apollon stieß dem Götterboten Hermes den Ellbogen in die Rippen und fragte: »Na, würdest du nicht gerne mit Ares tauschen?«
»Aber sicher!«, antwortete dieser lachend. »Und wenn es dreimal so viele Fesseln wären, würde ich doch gerne bei Aphrodite liegen und ihr dürftet alle zuschauen.«
Auch Helios, auf dessen Indiskretion die Situation ja zurückging, genoss voyeuristisch den Anblick der nackten Liebesgöttin, die es inzwischen aufgegeben hatte, sich im Netz zu winden.
Als die Emotionen langsam verebbten, erhob der gehörnte Hephaistos seine Stimme: »Zeus, sieh! Das ist deine Tochter, die du mir zur Frau gabst. Die Göttin der Liebe soll sie sein, doch ist sie nur eine läufige Hündin! Wahrlich, ich werde diese beiden Ehebrecher solange in Fesseln halten und zur Schau stellen, bis du mir den Brautpreis zurückerstattet hast!«
Jetzt erschrak Zeus wirklich, der die Szene bisher als köstlichen Spaß genossen hatte. Nicht dass seine Tochter und ihr Liebhaber noch länger öffentlich zur Schau gestellt werden sollten, versetzte ihn in Missbehagen, sondern die von Hephaistos geforderte Herausgabe der Brautgeschenke. Schließlich hatte ihm der Schmied Aphrodite mit immensen Geschenken abgekauft – sein prunkvoller Palast, sein kostbarer Thron, seine mächtigen Donnerkeile, all diese wunderbaren Dinge stammten von Hephaistos als Preis für die ungleiche Ehe.
Zeus schüttelte sein mächtiges Haupt, seine Entscheidung war gefallen: »Mach mit den beiden, was du willst. Ich gebe die Geschenke nicht wieder her!«
Ein Aufschrei drang aus dem Netz und Aphrodite flehte: »Vater, ich bitte dich, rette mich aus dieser demütigenden Lage!«
»Es ist deine eigene Schuld. Ich werde auf keinen Fall für dein unmoralisches Vergnügen bezahlen!«
»Dann werde ich die beiden in der Menschenwelt zur Schau stellen. So wie ihr sie hier im Netz seht, werde ich sie in allen Städten und auf allen Inseln zeigen!«, drohte Hephaistos.
Entsetzensrufe gingen durch die Reihen der Götter.
»Hephaistos, du kannst uns alle doch nicht vor den Menschen bloßstellen!«, rief Hera, die Gemahlin des Zeus.
»Wer hat denn mit dieser Schande begonnen? Wer ist denn nackt und bloß? Ich habe Ares nicht die Rüstung abgenommen, ich habe Aphrodite nicht entkleidet und ich habe die beiden auch nicht in mein Ehebett gestoßen!«
Nun ergriff Poseidon, der mächtige Gott der Meere, das Wort: »Wir dürfen uns vor den Menschen nicht lächerlich machen! Sie würden den Glauben an uns verlieren und das würde unserer Macht ungeheuer schaden. Ich bin bereit, dafür zu sorgen, dass Ares dich gebührend entschädigt, Hephaistos.«
»Und wenn er flieht? Ich kenne ihn doch, diesen Windhund. Er wird sich wie immer aus der Verantwortung stehlen.«
»Ich übernehme für Ares die Bürgschaft. Wenn er sich davon macht, um sich der Schuld zu entziehen, werde ich selbst dich bezahlen. Das schwöre ich hier vor allen Göttern!«, bot Poseidon an.
Hephaistos wusste, dass er sich bei diesem Angebot nicht länger verweigern konnte, wollte er nicht seine erneute Verbannung aus dem Olymp riskieren. Also willigte er ein und öffnete das Netz. Aphrodite und Ares purzelten nackt zu Boden und einige mindere Halbgötter eilten herbei, ihre Blöße zu bedecken.
Dann klatschte Zeus in die Hände und forderte die anwesenden Götter auf: »Lasst uns nun wieder erfreulicheren Dingen zuwenden. Wir wollen ein neues Spiel beginnen!«
Alle stimmten begeistert zu, nur Hephaistos stand derzeit der Sinn nicht nach solchen Ablenkungen und er verließ immer noch wütend und gedemütigt den Olymp.
Mitten in der großen Halle stand ein riesiges dreidimensionales Modell. Es zeigte einen Ausschnitt der Erde, der von Kanaan bis zur Insel Ithaka, vom Nildelta bis nach Makedonien reichte. Die olympischen Götter versammelten sich nun um das Modell, das ihnen als Spielbrett diente, und betrachteten es aufmerksam. Gerade streute Eris, die Göttin der Zwietracht, ein schwarzes Pulver über eine lang gestreckte Insel.
»Eris, was tust du den Kretern diesmal an?«, fragte Hermes.
»Das Übliche: Neid, Streit und Hader säen. Ist ja schließlich meine Aufgabe.«
»Aber doch nicht vor Spielbeginn!«, warf Apollon ein.
»Zwietracht ist immer. Vor dem Spiel, nach dem Spiel und während des Spiels. Und sobald sich eine gute Gelegenheit ergibt, werfe ich meinen berühmten Zankapfel.«
»Lasst uns Regeln für das neue Spiel aufstellen!«, forderte Hermes und die Flügel an seinen Sandalen vibrierten in Vorfreude.
Aphrodite, nun wieder bekleidet, näherte sich dem Spielbrett und beklagte sich: »Die Liebe darf nicht wieder zu kurz kommen! Das letzte Mal gab es überhaupt keine Hochzeit.«
»Aber jede Menge Liebesnächte!«, warf Hermes in Anspielung auf das eben Geschehene ein, um Aphrodite zu ärgern.
»Du sollst diesmal deine Hochzeit haben, Aphrodite. Aber nur, wenn ich mindestens eine große Schlacht bekomme.«
Ares, der Kriegsgott, inzwischen wieder in seiner martialischen Rüstung, fuchtelte mit seinem Schwert über dem Spielbrett. Da jede Aktivität auf dem olympischen Modell Auswirkungen in der Welt der Menschen hat, kam es im selben Moment zu heftigen Sturmböen zwischen Sparta und Athen. In Mykene stürzte ein Baum auf eine Pilgerprozession und erschlug drei Gläubige und auf Salamis wurde ein einsamer Wanderer ins Meer geweht und ertrank.
»Und bitte diesmal kein Techtelmechtel mit Nymphen, Zeus! Und auch keine Verwandlungen in geile Stiere oder Schwäne!«, keifte eine Frauenstimme.
Zeus überging den Einwurf seiner Göttergattin Hera und verkündete: »Grundregel Nummer eins: Alles ist erlaubt! Dazu gehören wechselnde Koalitionen, ohne die Mitspieler darüber informieren zu müssen. Dito der Einsatz von Wetterphänomenen wie Blitz und Hagelschlag sowie von regional begrenzten Erdbeben. Ebenso gestattet ist der Einsatz von magischen Waffen, Gift und Politik durch auserwählte Menschen. Verboten ist natürlich wie immer das Stiften neuer Religionen.«
»Wollen wir die erreichten Punkte wie beim letzten Mal verteilen?«, fragte Athene.
»Einen Punkt für jeden neu gewonnenen Gläubigen, fünf Punkte für ein dargereichtes Opfer, zehn für einen willfährigen König, zwanzig für den Tod eines Helden und hundert für einen neu erbauten Tempel?«
»Und fünfzig für eine Hochzeit!«, bat Aphrodite, immer noch etwas kleinlauter als sonst.
»Und hundert Punkte Abzug für jeden Beischlaf mit Nymphen oder Menschenfrauen!«, verlangte Hera mit drohendem Blick zu ihrem Gatten Zeus.
»Ich will fünfzig Punkte für jedes versenkte Schiff!«, forderte nun Poseidon.
»Nichts da!«, lehnte Zeus ab. »Schiffe versenken gibt höchstens zwanzig Punkte. Das gehört für dich doch sowieso zum Alltagsgeschäft.«
Auf einmal erklang von der Hallenkuppel herab eine gestaltlose Stimme: »Es wäre überaus sinnvoll, wenn ich auch mitspielen dürfte!«
Die olympischen Götter ignorierten die Bitte aus der Höhe und feilschten weiter um die Punktewertung. Die Stimme verwandelte sich nun in eine kleine Feuersäule, schwebte über dem Spielbrett und sprach: »Bei diesem Spiel wäre es nur recht, mich einzubeziehen. Es geht schließlich auch um meine Gläubigen.«
Einige der olympischen Gottheiten blickten irritiert auf die Erscheinung. Doch Ares fegte die Feuersäule mit einer Handbewegung vom Spielbrett, was dazu führte, dass auf der Insel Samos eine Windmühle in Brand geriet. Auf Mykonos sorgte ein plötzlich vor einer Bauernfamilie entflammter Olivenbaum für einen neuen regionalen Kult mit exzessiven Brandopfern.
»Nein! Wir wollen unter uns bleiben. Wir sind eine eingeschworene, leidenschaftlich streitende und daher bestens bewährte Spielgemeinschaft«, stellte Hermes sachlich fest.
»Gut, dann werde ich eben nach meinen Regeln spielen!«, erwiderte die Feuersäule warnend.
»Wir wollen dich aber nicht dabei haben, wir mögen keine Fremden! Wer bist du überhaupt?«, fragte Ares unwirsch.
»Nennt mich einfach den Joker«, empfahl die Feuersäule und verschwand.
Athene schaute nachdenklich auf die Stelle, wo die Luft immer noch flirrte. »Wer immer das gewesen sein mag, ich habe das ungute Gefühl, dass wir noch von ihm hören werden.«
»Ich komme gerade vom Olymp zurück«, sagte die kleine, rot getigerte Katze und war sichtlich erbost.
Seshmosis sah erstaunt von seiner Papyrusrolle auf und fragte: »Mein Herr, was wolltest du auf dem Olymp?«
»Was soll ein Gott schon auf dem Olymp wollen? Mit meinen Kollegen reden, natürlich.«
Ziemlich lustlos begann die Katze, sich zu putzen.
»Sag schon, was war los?«, forderte sie ihr menschliches Gegenüber auf.
»Pah! Griechische Götter! Ich dachte, das wären alles Philosophen, hellenistische Denker. Pah!« Die Schnurrhaarenden der Katze glühten bedrohlich rot.
»Du solltest deine Götterkollegen doch inzwischen kennen«, wandte Seshmosis ein.
Die Katze strich ihre Schnurrhaare glatt, aus deren Enden nun verdächtige Funken sprühten.
»Ich dachte immer, die griechischen Götter wären eine vornehme Gesellschaft, so eine Art Versammlung von Weisen. Aber sie sind nichts anderes als ein Haufen eitler, hinterhältiger, missgünstiger, zänkischer Selbstdarsteller.«
»Und was ist schiefgelaufen?« Seshmosis schwante Böses.
»Sie haben mich ignoriert. Sie wollen nichts mit mir zu tun haben.«
Die Katze ließ ein bedrohliches Fauchen hören.
»Was wolltest du denn von den Olympiern? Wie ich dich kenne, machst du doch keinen Kollegenbesuch aus reiner Höflichkeit.«
Seshmosis erinnerte sich, wie der kleine Nomadengott mit der ägyptischen Götter Apis und Methyer Hilfe den Tajarim auf dem Sinai geholfen hatte, damals, gleich nach der Geburt des Goldenen Kalbes. Und er erinnerte sich, wie sein Stamm aufgebrochen war, weil die Ägypter die Hyksos, die Fremden, verfolgten. Rund zweihundert Personen waren sie gewesen, Kinder und Greise mitgezählt, und ihren Namen hatten sie in Tajarim geändert, was in ihrer alten Sprache so viel wie »Touristen« bedeutet, damit man nicht gleich erkannte, dass sie eigentlich Flüchtlinge waren.
Die Erinnerungen spülten Seshmosis fort, und dennoch kam es ihm so vor, als hätte nicht er selbst all dies erlebt, sondern ein anderer, und er, der Schreiber, sei nur der Berichterstatter. Von Theben in Ägypten wollten sie ins »Land der Väter« zurückkehren, in ein Land, in dem längst die Söhne anderer Väter lebten.
Mit Schaudern dachte er an den Abend im sagenumwobenen Abydos, wo ihn ein bis dahin unbekannter Gott zu seinem Propheten machte. GON, der »Gott ohne Namen«, der nicht wollte, dass man seinen wahren Namen kannte, auf dass ihn keiner aussprechen und ihn beherrschen könne.
GON war ein kleiner Gott, ein großer hätte auch gar nicht zu ihm, Seshmosis, dem einfachen Schreiber, und der Karawane der Nomaden gepasst. GON liebte es, sich in unterschiedlichen Erscheinungsformen zu materialisieren, um damit künftige Ereignisse anzudeuten. Allerdings war er dabei auf eine gewisse körperliche Größe beschränkt. Genauer gesagt, er konnte die Kleinheit von dreißig Zentimetern nicht überschreiten.
Seshmosis bevorzugte es, wenn ihm der kleine Gott als Katze erschien, denn dann war nichts Dramatisches zu erwarten. GON litt auch unter einem kleinen Handicap, das er nur ihm, seinen Propheten, verraten hatte: Er war extrem kurzsichtig. Und da ein Gott bekanntermaßen immer nur so weit wirken kann, wie seine Sehkraft reicht, beschränkte sich GONs Aktionsradius auf rund hundert Meter. Aber innerhalb dieser hundert Meter war der Nomadengott wirklich ein Großer, wie Seshmosis des Öfteren erleben durfte.
Laute Stimmen vor Seshmosis’ Zimmer schreckten ihn aus seinen Gedanken. Es dauerte einige Augenblicke, bis seine Erinnerungen der Gegenwart wichen. Richtig, es war die zehnte Stunde, die »Stunde des Dankes«. Seshmosis seufzte. Sicher war er GON dankbar, vielleicht dankbarer als jeder andere Tajarim. Ohne den kleinen Gott hätten sie Byblos kaum heil erreicht, ohne seine Hilfe wären sie längst unter den Pfeilen und Schwertern der Ägypter oder der Moses-Anhänger dahingeschieden.
GON hätte wahrlich einen Tempel zu seiner Verehrung verdient, um ihm jeden Tag zur zehnten Stunde und sogar noch öfter zu danken. Den Dank nahm der kleine Gott gerne an, den Tempel aber wollte er nicht. Er wohnte lieber in einem kleinen, hölzernen Schrein in Seshmosis’ Zimmer, das für diesen Schlafraum und Schreibstube zugleich war. Der Raum war sparsam möbliert und beherbergte nicht mehr als das Nötigste: ein schmales Bett, zwei Truhen für Wäsche und Habseligkeiten, ein mit Papyrusrollen und Keilschrifttafeln aus Ton übervolles Regal, einen Tisch und zwei Stühle. Und quasi als einzigen Schmuck eine schlanke Stele mit dem Schrein von GON darauf.
»Warum?«, fragte Seshmosis die kleine Katze auf dem hölzernen Schrein. »Warum willst du nicht endlich einen eigenen Tempel?«
»Es ist gut so, wie es ist. Ich habe doch meinen Raum, wo mich die Menschen verehren und mir danken können«, antwortete GON.
»Aber es ist mein Zimmer!«, lamentierte Seshmosis. »Jeden Tag trampeln die Leute durch mein Zimmer, sitzen auf meinem Bett und bringen meine Sachen in Unordnung. Neulich hat Raffim sogar das Tintenfass über meine Aufzeichnungen geschüttet.«
Seshmosis hatte sich darüber ziemlich aufgeregt. Außerdem vermutete er, dass Raffim das Tintenfass mit voller Absicht umgekippt hatte, um ihn zu ärgern, und keineswegs aus Versehen, wie er später grinsend behauptet hatte. Raffim, sein Intimfeind und Widersacher auf der Reise von Theben nach Byblos. Raffim, der Krokodilquäler und Devotionalienhändler, Raffim, der Reichste unter den Tajarim, der fette, immer gierige, egoistische und leider stets erfolgreiche Geschäftsmann. Bevor sich Seshmosis weiter in seinen Groll gegen Raffim steigerte, unterbrach ihn GON sanft, aber bestimmt: »Öffne endlich die Tür! Meine Gläubigen wollen zu mir.«
Dann verschwand er mit einem leisen Plopp.
Widerstrebend öffnete der Schreiber die Tür seines Gemachs, und ein gutes Dutzend Leute strömte herein und füllte schnell den kleinen Raum. Seshmosis nickte ihnen zur Begrüßung zu, und dann knieten sie vor dem schlichten hölzernen Schrein nieder, den Schedrach, der Karrenbauer, noch in Ägypten gefertigt hatte. Der Schrein symbolisierte den Dank der Tajarim für ihre Rettung vor dem Tod aller Erstgeborenen während der ägyptischen Plagen, damals, als der Schlangendämon Apophis die Sonne gestohlen und den Sonnengott Ra in seine Gewalt gebracht hatte. In erster Linie aber diente der Schrein dazu, GON mobil zu machen, denn in der Welt der Menschen konnte er anscheinend nicht ohne Hilfe reisen. Deshalb hatte der Kasten oben einen Bronzegriff, an dem er getragen werden konnte.
Jetzt waren die beiden Flügeltüren des Schreins geschlossen, denn GON selbst zeigte sich nicht zur Dankesstunde. Er zeigte sich nie jemandem außer Seshmosis, seinem Propheten. Nur ihm war es vorbehalten, die Materialisationen des kleinen Gottes zu sehen.
Nachdenklich betrachtete Seshmosis die knienden Menschen, die stumme Zwiesprache mit GON hielten. Zu den Gläubigen, die täglich zum Gebet kamen, gehörten Kalala, die dunkelhäutige Prinzessin aus Nubien, ihr Gefährte El Vis, Sänger aus Memphis, und Nostr’tut-Amus, der Seher. Erstaunlicherweise erschien seit einigen Tagen auch Raffim, der Händler, regelmäßig zur zehnten Stunde. Das wunderte Seshmosis, denn Raffim handelte zwar, solange er denken konnte, mit heiligen Gegenständen, Figuren und Amuletten, doch er schätzte die Götter nur insoweit, wie sie ihm Profit brachten. Sein Vermögen verdankte er dem Krokodilgott Suchos, zu dessen Ehren und zu Raffims Gewinn er Krokodilen Tränen abpresste, diese in Gold und Silber fassen ließ und als Amulette teuer verkaufte. Überhaupt hatte er damals in Theben mit allem gehandelt, was man nur im Entferntesten mit dem Kult des Krokodilgottes in Verbindung bringen konnte: von kleinen Statuen und vergilbten Krokodilzähnen bis zu Gürteln, Sandalen und Taschen. Dazu hatte er einen Imbissstand betrieben, an dem er Krokodilwurst, Krokodilmilch, Krokodilschnaps, Krokodilhackbällchen und geraspelte, mit Honig versetzte Krokodillederreste als Süßigkeiten feilgeboten hatte.
Da GON keinen Kult für sich forderte, war Raffim der kleine Gott völlig egal. Dass er nun täglich vor dem Schrein auftauchte, machte den Händler überaus verdächtig. Seshmosis fragte sich, welch finstere Pläne der Dicke diesmal verfolgte.
Dann dankte auch Seshmosis seinem Herrn, die anderen verließen nach dem Ritual schnell den Raum, und GONs Gebetsraum verwandelte sich wieder in Seshmosis’ Zimmer. Der Schreiber kniete sich erneut vor den Schrein und bat: »Herr, bitte offenbare mir Raffims Pläne. Ich weiß ganz genau, dass er nicht jeden Tag hierher kommt, um dir zu danken.«
Auf dem Schrein materialisierte augenblicklich die vertraute Katze und antwortete: »Wie kommst du darauf, dass ich in den Gedanken meiner Gläubigen herumschnüffle?«
»Nun, ich dachte, dass ein Gott von Natur aus weiß, was Menschen denken.«
»Da hast du falsch gedacht. Ich höre die Gedanken der Menschen nur, wenn sie sich direkt an mich wenden. Oder, wenn ich wissen will, was sie denken.«
»Dann weißt du nicht, Herr, was Raffim vorhat? Schade.«
Seshmosis wollte sich schon mit der Antwort zufriedengeben, als die Katze fortfuhr: »Ich weiß sehr wohl, was er vorhat, denn ich bin ziemlich neugierig. Aber ich bin auch sehr diskret. Du weißt ja, Glaubensangelegenheiten gehören zur Persönlichkeitsentfaltung, die ich über alles respektiere. Und ich kann, im Gegensatz zu dir, absolut verschwiegen sein.«
»Herr, warum quälst du mich so? Stets bemühe ich mich, alles zu deinem Besten zu richten. Warum tust du mir das an?«, fragte Seshmosis enttäuscht.
Es erschien ein Zug von Mitleid im Gesicht der Katze. Mitleid, umgeben von spitzen Eckzähnen. »Also gut, ich verrate dir, was er hier macht. Er stiehlt die Heiligen Rollen.«
»Aber, Herr, das kannst du nicht zulassen!«, schrie Seshmosis und stürzte zum Regal, das sein Archiv barg. Hektisch durchwühlte er die Fächer mit den unzähligen Papyrusrollen, zog die eine oder andere heraus und geriet in Wut: Vier der fünf Heiligen Rollen fehlten. Der Schreiber bebte vor Zorn. Und dann überfiel ihn die Angst. Man würde ihn verantwortlich machen für den Verlust, schließlich waren die Schriften in seiner Obhut. Wie sollte er beweisen, dass Raffim der Dieb war? GON pflegte ja nur mit ihm zu reden, sich nur ihm zu zeigen. Als öffentlicher Zeuge war er deshalb denkbar ungeeignet.
»Herr, diese Papyri wurden mir von meinem Vater anvertraut und diesem von seinem Vater. Sie sind der größte Schatz unseres Volkes.«
»Du weißt, dass ich mit diesen Schriften nichts zu tun habe. Lediglich ›Die Kleine Karawane‹ betrifft mich. Alle anderen entstanden vor meiner Zeit. Und ›Die Kleine Karawane‹ hat er noch nicht gestohlen«, stellte der kleine Gott lapidar fest, ohne auf die Nöte seines Propheten einzugehen.
Die fünf Heiligen Rollen, seit Generationen von Schreiber zu Schreiber weitergegeben, waren die Identität und das Gedächtnis der Hyksos von Theben, die sich nun Tajarim nannten: »Die Schöpfungsgeschichte«, »Die Tafel der Väter«, »Das Goldene Zeitalter«, »Die Große Flut« und »Die Kleine Karawane«.
Letztere enthielt den Bericht des Auszugs der Tajarim aus Ägypten unter Seshmosis’ Führung. An sich nichts Besonderes, wenn es Seshmosis gewesen wäre, der diesen Bericht geschrieben hätte. Aber statt seiner wirkte hier GON persönlich. Nun, nicht ganz persönlich, er benutzte einen Helfer. Seshmosis erinnerte sich an sein Entsetzen, als er von seinem Gott erfahren musste, dass die Schriftzeichen auf dieser Heiligen Rolle aus dem Hinterleib eines Käfers stammten.
Verzweifelt wandte sich Seshmosis an den kleinen Gott: »Wo hat Raffim die Rollen versteckt? Was hat er mit ihnen vor? Er kann doch außer Zahlen kaum etwas lesen.«
»Das, mein Lieber, musst du selbst herausfinden«, antwortete die Katze und verschwand.
Da GON nicht bereit war, ihm in dieser Angelegenheit zu helfen, flehte Seshmosis Thot an, den ägyptischen Gott der Gelehrsamkeit, dazu dessen Gattin Seshat, Göttin der Schreiber und der Archive, und Imhotep, der ebenfalls für die Schreiber zuständig war. Außerdem rief er vorsichtshalber die örtlichen Götter von Byblos an, Baal, Astarte und Mot. Allerdings bezweifelte er bei Letzterem, dass dieser ihm bei der Wiederbeschaffung der Heiligen Rollen helfen könnte. Denn Mot war der Gott der Unterwelt, der »Große Verschlinger«, und daher von Natur aus eher destruktiv veranlagt.
Seshmosis konnte ruhigen Gewissens auch diese Gottheiten anrufen, da GON in seinen sechs Geboten dies ausdrücklich gestattete. Denn das erste Gebot lautete: »Ich bin der Herr, dein Gott, den du verehren sollst, wie auch respektieren alle Mächte der universalen Schöpfung und alle Natur, die dich umgibt. Und verlasse dich nie darauf, dass es woanders keine anderen Götter gibt.«
Und so versprach er sich besonders von Seshat, der Bewahrerin der Archive, Hilfe. Außerdem gefiel ihm ihr Name, denn er bedeutete »Schreiberin«. Erst kürzlich hatte er hier in Byblos eine kleine Statue von ihr erworben. Diese zeigte eine junge, schlanke Frau, gehüllt in ein Leopardenfell, mit einem Schreibrohr in der einen und einem Tintenbehälter in der anderen Hand. Auf dem Haupt trug sie einen auffälligen Kopfputz, bestehend aus einer Rosette mit sieben Zweigen und einem umgekehrten Bogen darüber. Diese Figur stand nun bei den wenigen Habseligkeiten, die er aus seiner Schreibstube in Theben mit in die neue Heimat gerettet hatte: die kleine silberne Mondbarke der Göttin Nut, das Pavianfigürchen aus Elfenbein des Gottes Thot und der Skarabäus aus grünem Schmelzglas. Seshmosis war froh, dass Raffim ihm diese persönlichen Erinnerungsstücke nicht auch noch gestohlen hatte. Aber sie stellten materiell keinen besonderen Wert dar, und deshalb lagen sie außerhalb von Raffims Wahrnehmung und Begehrlichkeit.
Nun musste er also selbst herausfinden – möglichst mit der Hilfe gnädiger Götter –, wo Raffim die Rollen versteckt hielt und was er mit ihnen vorhatte.
Aram war Bademeister und tot, und dies schon zum zweiten Mal. Als Aram noch lebte, leitete er das Badehaus zu Theben, und obwohl es ihm nicht gehörte, war die Arbeit dort für ihn die Erfüllung seines Lebens. Die Aussicht, das Haus und das von ihm über alles geschätzte Wasser verlassen zu müssen, um mit den Tajarim durch eine wasserlose Wüste in ein unbekanntes Land zu ziehen, hatte ihn den Selbstmord als die bessere Zukunft erscheinen lassen. Zu seinem Bedauern hatte ihn Raffim, dem unter mysteriösen Umständen das göttliche Ankh des Krokodilgottes Suchos zugefallen war, damit wieder zu nicht mehr gewolltem Leben erweckt. Doch Anubis, der schakalköpfige Gott des Totenreichs, hatte Aram gnädig ein zweites Mal erlöst, und so wandelte er nun als Toter in Amentet, dem Reich jenseits des Sonnenuntergangs. Allerdings empfand Aram sein Dasein hier als äußerst unbefriedigend. Es gab kein Badehaus in Amentet.
Das Totenreich war Wohnsitz diverser Götter und sah auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale ägyptische Stadt. Erst auf den zweiten Blick fiel auf, dass hier statt des Nils ein tiefschwarzes Meer den Ort umgab. Und dass es in der Stadt keine Tempel gab. Doch Götter brauchen ja keine Tempel, zu wem sollten sie denn beten?
Es lebten hier aber auch Menschen. Allen war gemeinsam, dass sie ihr Leben bereits hinter sich und bei der Verhandlung vor dem Großen Gericht bestanden hatten. Im Gegensatz zu den Verlierern beim Totengericht, denn diese verschwanden sofort auf Nimmerwiedersehen im Rachen des zahnreichen Babi oder eines anderen der immer hungrigen Dämonen der Finsternis.
Doch auch die Gewinner waren keineswegs zu beneiden. Denn der Alltag in Amentet stand im krassen Gegensatz zu den Vorstellungen der Gläubigen, im Jenseits ein komfortables, herrschaftliches Dasein auf einer anderen Ebene zu führen. Im Gegenteil: Sie arbeiteten hier als Sklaven der Götter.
Dabei gaben die Ägypter ihren Verstorbenen so genannte »Uschebti« mit ins Grab, mehr oder weniger kunstvoll gefertigte Figuren, die den Toten im Jenseits dienen sollten. Nun gab es im Totenreich durchaus Diener, sehr viele sogar. Allerdings waren dies keineswegs lebendig gewordene Figuren, sondern durchweg die verstorbenen Menschen, die alle schweren Prüfungen des Totengerichts bestanden hatten.
Der Brauch mit den Uschebti-Figuren entsprang ganz einfach einem Missverständnis in der Kommunikationskette »Gott – Priester – Mensch«: Die Götter wollten Diener für sich und nicht für die Verstorbenen.
Nun zierten die schönsten der in die Gräber gelegten Uschebti-Figuren als leblose Dekorationsstücke die Wohnungen der Götter, und diejenigen, die den Haushalt der Götter versorgten und alle Arbeiten ausführten, waren erlöste Verstorbene. Das Totengericht sorgte lediglich dafür, dass nur qualifiziertes Personal nach Amentet kam.
Aufgrund seiner besonderen Beziehung zu Anubis hatte man Aram dessen Haushalt zugeteilt. Doch der schakalköpfige Gott weilte selten zu Hause, denn seine Tätigkeit als Totenrichter nahm ihn meist auswärts in Anspruch. Gestorben wurde schließlich immer und überall. Außer in Amentet natürlich.
So polierte Aram nunmehr seit zwei Jahren göttliche Artefakte und räumte in Anubis’ Wohnung Möbel von einer Ecke in die andere. Mal platzierte er die ungepolsterte Meditationsliege neben dem riesigen, bedrohlichen Ahnenschrein des Gottes, mal stellte er den Arbeitstisch an die mit schrecklichen Dämonenfratzen bemalte Wand, dann wieder frei in den Raum neben der mannshohen Skulptur aus ungezählten Schädeln. Doch der anfängliche Elan war dahin, und Aram langweilte sich zu Tode, besser gesagt im Tode. Er hatte sich das Jenseits anders vorgestellt, irgendwie lebendiger. Doch dann kam ihm eine Idee.
Als Anubis wieder einmal zu Hause weilte, wagte er den Gott anzusprechen: »Gnädiger Herr, als Euer nichtswürdiger Diener würde ich Euch gern einen Vorschlag unterbreiten.«
Anubis, der es sich auf seiner Meditationsliege bequem gemacht hatte, blickte auf. »Aram! Warum störst du mich in meinen Träumen?«
»Verzeiht, Herr, ich wusste nicht, dass auch Götter träumen.«
»Das Träumen ist eine unserer größten Schöpfungen. Warum sollten wir es nicht selbst genießen und nutzen?«
Der verwirrte Aram vergaß sein eigentliches Anliegen und fragte neugierig: »Großer Anubis, aber wovon träumt Ihr, der Ihr doch das Ende aller Träume seid?«
»Genau davon! Davon, nicht das Ende des Lebens zu sein, sondern sein Anfang. Fortan nicht mehr länger als der Gott der Toten zu wirken. Das dauernde Sterben ermüdet mich. Ich wünschte, es gäbe eine andere Perspektive für mich. Gott der Geburtshelfer wäre eine konstruktivere Tätigkeit, aber darum kümmert sich ja schon Taweret, die flusspferdgestaltige Göttin der Geburt. Und um die Schwangeren der zwergenwüchsige Bes. In Ägypten ist jede kleinste Kleinigkeit göttlicher Zuständigkeit schon vergeben, vieles sogar doppelt und dreifach. Es ist deprimierend! Als Gott hast du einfach keine Entwicklungsmöglichkeiten. Hier gibt es nichts, das mich aufheitern könnte«, seufzte der Gott.
Aram sah seine Chance. Anubis war, genau wie er, mit seiner Situation unzufrieden. Mutig unterbreitete er ihm deshalb sein Anliegen: »Das tut mir leid für Euch, Herr. Vielleicht könnte mein Vorschlag für etwas Zerstreuung sorgen?«
»Welcher Vorschlag?«
»Mir ist aufgefallen, dass es in Amentet an einem Badehaus mangelt. Wie Ihr wisst, Herr, kenne ich mich mit Badehäusern sehr gut aus. Und mir ist durchaus bekannt, dass auch Götter das Vergnügen eines wohltuenden Bades schätzen.«
»Aram! Ich hoffe, du spielst nicht auf einen gewissen Vorfall zwischen Hathor und Seth an.«
Einst hatte Seth, der Eigenbrötler unter den Göttern, die Fruchtbarkeitsgöttin Hathor beim Baden beobachtet. Eigentlich war ihr Anblick für die meisten männlichen Götter nicht sehr aufregend, da Hathor gemeinhin kuhgestaltig zu erscheinen pflegte.
Doch in diesem Fall hatte sie menschliche Formen bevorzugt und Seth die Beherrschung verloren. Das Göttergericht bestrafte den Vergewaltiger mit einer grässlichen, seine göttliche Männlichkeit betreffenden Krankheit, die erst viel später auf dem Gnadenwege geheilt worden war. Man sagt, seither bevorzuge Seth die Einsamkeit der wasserlosen Wüste.
Aram beeilte sich, Anubis zu versichern, dass er keineswegs auf irgendwelche Vorfälle anspiele, die er zudem ja gar nicht kenne, und er als Bademeister vor allem ein Meister der Diskretion sei.
»Dein Vorschlag gefällt mir, Aram. Allerdings bedürfen neue Bauvorhaben in Amentet einer Zweidrittelmehrheit im Bauausschuss der Götterversammlung. Wir wollen schließlich nicht, dass jeder kreuz und quer baut, wie es ihm gerade einfällt. Aber ich werde bei der nächsten Zusammenkunft einen Antrag stellen.«
Aram war endgültig davon überzeugt, dass die Götter wirklich alles erfunden hatten. Sogar die Bürokratie.
Byblos – freier Stadtstaat, reiche Handelsmetropole und seit zwei Jahren Zuflucht der Tajarim. Eine Tagesreise südlich von hier, im Land Kanaan, begann der ägyptische Einflussbereich, eine Pfeilschussweite nach Norden die Macht der Hatti, der Hethiter.
Von den Perlen der Levante – Ugarit, Sidon, Tyros und Byblos – war die Letztere die größte und die glänzendste. Hier kreuzten sich die Handelswege der Nord-Süd-Achse mit den Straßen aus dem Osten, die alle am Hafen der Stadt endeten. Von dort ging es per Schiff weiter nach Westen ins Abendland, nach Erob, wie die Hebräer und Phönizier zu sagen pflegten. Erob, das Dunkle, die Abenddämmerung, das Fremde jenseits des Meeres, die Region, die andere Europa nannten.
Seshmosis hatte Byblos ausgewählt, den Schmelztiegel der Völker, in dem man mehr Sprachen hörte als im sagenumwobenen Babylon, um mit seinen Tajarim nach der Flucht aus Ägypten unterzutauchen. Als Fremde unter Fremden fielen sie hier nicht auf.
Nun schlenderte Seshmosis langsam durch die Gassen des Hafenviertels. Er ging gern in diesen tiefer gelegenen Stadtteil, um seine Gedanken zu ordnen. Wenn er Sorgen hatte, führte ihn sein Unterbewusstsein immer wieder in das Gassengewirr, während sein Bewusstsein nur einen Tintenklumpen kaufen wollte. Außer Atmen, Essen und Schlafen gab es für einen Schreiber nichts Wichtigeres als Tintenklumpen, jenes Konglomerat aus Kienruß, Gummi Arabicum und verbrannter Weinhefe. Fein geraspelt, mit Wasser angerührt und mit Essig verdünnt, bildete diese Mischung den Stoff, mit dem man Ereignisse, aber auch Träume auf Papyrus festhalten konnte.
Seshmosis blieb vor der Auslage eines kleinen Ladens stehen. Direkt vor der Tür hatte der Händler auf einem groben Holztisch sein Angebot ausgebreitet: Griffel und Wachstafeln, Tintenfässer und Schreibried, Tintenklumpen und Siegellackstangen, kleine Raspeln und Stapel von Blättern aus Binsenmark, mit Steinen beschwert, um zu verhindern, dass sie mit dem Wind weggeweht wurden. Daneben warteten aber auch wertvollere Dinge, wie Amulette, kleine Statuetten, Ringe und Rollsiegel auf Käufer.
Seshmosis wandte seine Augen von den Waren ab und musterte den Händler genauer. Byblos war ein Schmelztiegel, in dem es keine Trennung zwischen Einheimischen und Fremden gab, nur eine Trennung zwischen Erfolgreichen und Gescheiterten. Und es gab Menschen, die ständig zwischen diesen beiden Gruppen pendelten, mal mehr zur einen, mal mehr zur anderen Seite tendierend, je nachdem, ob sie an diesem Tag ein paar Kupfermünzen einnahmen oder nicht. Für Seshmosis’ Gegenüber würde sich in den nächsten Minuten entscheiden, zu welcher Gruppe er heute gehörte.
»Ihr habt gewählt, weiser Herr?«, fragte der Händler.
Seshmosis schüttelte nur stumm den Kopf und ließ den Blick erneut über die Auslage schweifen. Ein rundes Amulett erweckte seine Aufmerksamkeit. Es war aus Bronze, ungefähr fünf Zentimeter im Durchmesser und trug spiralförmig angeordnete, fremde Schriftzeichen. Seshmosis deutete mit dem Finger darauf und fragte: »Woher ist das?«
»Ihr habt einen vortrefflichen Geschmack, edler Herr. Dieses erlesene Stück stammt von der Insel Kreta aus dem Reich des Königs Minos.«
»Ah, aus Keftiu Minos«, sagte Seshmosis mehr zu sich selbst.
»Ihr stammt aus Ägypten, weit gereister Herr? Nur die Ägypter nennen Kreta Keftiu Minos, das Fremdland des Minos.«
»Ja, ich habe lange dort gelebt, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wisst Ihr, was diese Zeichen bedeuten?«, wollte Seshmosis wissen.
»Leider nein, gelehrter Herr. Das Amulett stammt aus dem Nachlass eines Minoers, dessen Göttern es leider gefiel, ihn hier in der Fremde zu sich zu rufen.«
Seshmosis wusste, was diese Formulierung bedeutete. Der arme Mann war in Byblos schlicht unter die Räuber gefallen, und seine Habe befand sich jetzt im Angebot der Händler des Hafenviertels.
Der Schreiber schob alle Gedanken an den Vorbesitzer des Amuletts von sich und fragte: »Wie viel wollt Ihr dafür haben?«
»Fünf Schekel, edler Herr. Nur fünf Schekel, weil Ihr es seid, weit gereister Herr.«
»Mit fünf Schekel kann ich drei Diener eine Woche lang bezahlen! Mir deucht, Ihr bietet Eure Waren im falschen Viertel an. Einen Schekel will ich Euch wohl dafür geben.«
Wie alle Tajarim liebte es Seshmosis, zu feilschen.
»Ihr ruiniert mich, hoher Herr! Meine Frau und meine Kinder müssen essen, auch wenn ich selbst bereit bin zu hungern, nur um Euch einen guten Preis machen zu können. Vier Schekel ist das Minimum.«
»Ihr wisst ja nicht einmal, was auf dem Amulett geschrieben steht. Vielleicht ist es ein Fluch? Zwei Schekel, und ich gehe das Risiko ein, mit dem Fluch eines Toten zu wandeln.«
»Wen schert schon die Bedeutung dieser fremden Zeichen, nobler Herr? Hauptsache, sie sind hübsch anzusehen. Für drei Schekel wird das Amulett Euch zieren.«
»Wer weiß, ob mich nicht die Götter des Minoers zwingen, diesem in Bälde zu folgen? Bevor ich es trage, müsste ich das Amulett von einem Priester bannen und segnen lassen. Das kostet auch wieder. Zweieinhalb Schekel sind mein Höchstgebot!«
»Meine Frau wird mich verfluchen, weil ich die Kinder hungern lasse, harter Herr. Aber bevor wir heute darben, will ich einwilligen. Zweieinhalb Schekel, und das Prachtstück ist Euer!«
»Aber dann bekomme ich dazu noch einen Tintenklumpen!«, forderte Seshmosis, dem der Handel sichtlich Spaß machte.
»Ich wusste schon immer, dass die Leute aus Ägypten mein Ruin sein werden! So wahr ich Nefer heiße! Schließlich komme ich selbst dorther. Aber gut, weil wir beide aus dem Land des Nils stammen, lasse ich meine Familie zuschanden kommen, um Euretwillen!«
Der Händler nahm das Amulett und reichte es Seshmosis. Dann holte er aus einer Kiste unter dem Tisch einen Tintenklumpen und drückte diesen dem Schreiber in die Hand. Seshmosis verstaute das Amulett in einem ledernen, am Gürtel befestigten Beutel, den Tintenklumpen steckte er in eine Tasche seines Gewands, und dann sagte er versöhnlich: »Ich hoffe, Eure Frau und Eure Kinder verzeihen Euch, dass Ihr so großzügig zu mir wart.«
»Welche Frau? Welche Kinder?«, grinste ihn der Händler an.
Seshmosis konnte sich ein Lachen nicht verkneifen und verließ den Stand.
Die Händler von Byblos sind alle Krokodile, dachte er bei sich, und beim Stichwort »Krokodile« fielen ihm wieder Raffim und sein Diebstahl ein. Der dicke, pockennarbige Geschäftsmann passte wirklich gut in diese Stadt, sie war für ihn wie geschaffen. Oder er für sie.
Ohne zu überlegen, schlenderte der Schreiber die letzte Terrassenstufe zum Hafen hinunter. Bald schon sah er die Schiffe, die im geschützten Hafenbecken vor Anker lagen. Bereits während man in Ägypten an der großen Pyramide gebaut hatte, hatte man hier die natürliche Bucht genutzt, mit einer langen Kaimauer fast geschlossen und mit einer kleinen Festung geschützt. Von dieser Bucht aus, der Urzelle von Byblos, wuchs die Stadt terrassenförmig nach oben, dem Libanongebirge mit seinen reichen Zedernwäldern entgegen.
Das imposanteste Gebäude in der Häuserzeile direkt am Meer war das der Hafenmeisterei. Hier musste sich jeder Kapitän melden, der Byblos angelaufen hatte. Dann begleiteten ihn mehrere Inspektoren auf sein Schiff, taxierten seine Ladung und legten den Zoll fest, der zu entrichten war. Der Herrscher von Byblos war ein kluger, geschäftstüchtiger Mann, und deshalb verlangte er weniger Zoll als die Herrscher von Ugarit, Sidon oder Tyros. Während diese zehn Prozent des Warenwertes einforderten, begnügte man sich in Byblos mit bescheidenen vier Prozent. Die Rechnung des hiesigen Herrschers war denkbar einfach: Bei zehn Prozent Abgaben würden es die Kapitäne und Handelsherren vorziehen, zu dem Hafen zu segeln, der nur vier verlangte. Und wenn ein Schiff den Hafen verließ, wurden wieder vier Prozent Zoll fällig. Es gab Kapitäne, die seit zwanzig Jahren immer wieder Byblos und nur Byblos ansteuerten, um hier ihre Ladung zu löschen und neue zu fassen. Vierzig mal vier Prozent waren eben unterm Strich erheblich mehr als zwei mal zehn Prozent. Es war unter anderem diese Art zu rechnen, die den Herrscher zum reichsten Mann der Levante machte.
Außerdem profitierte er vom florierenden Zedernhandel mit Ägypten und der Gewinnung von Purpur. Tagein, tagaus sammelten Frauen und Kinder nördlich und südlich des Hafens die Schnecken im flachen Wasser des Meeres. In den Werkstätten der Stadt verwandelte sich dann das Sekret von zehntausend Schnecken in lediglich ein Gramm des wertvollen Farbstoffs, der sofort in den benachbarten Färbereien verarbeitet wurde. Ein einziges Mal war Seshmosis in diesem Viertel gewesen und hatte nicht vor, jemals dorthin zurückzukehren. Vor den Hütten liegen dort die wertvollen Schnecken zu Tausenden und geben einen gelblichen Schleim ab, der im Sonnenlicht erst grün, dann blau, schließlich purpurn und scharlachrot wird und dabei einen ekelhaften, lang anhaltenden Geruch erzeugt. Der ekelhafte Gestank haftete tagelang in Seshmosis’ Kleidern.
Dabei wurde kein Stoff der Welt von Königen und Priestern so teuer bezahlt wie Purpurstoff aus Byblos. Nicht einmal die federleichten Seidengewebe aus den Ländern jenseits von Babylon erzielten solch horrende Preise.
Gerade als sich Seshmosis auf Höhe der Hafenmeisterei befand, lief ein ungewöhnliches Schiff durch die schmale Zufahrt in den Hafen ein, nachtschwarz das Segel und nachtschwarz der Rumpf. Seshmosis hatte von solchen Schiffen gehört, aber noch nie eines zu Gesicht bekommen. Ein Schiff aus Kreta.
Er dachte an das Amulett in seinem Beutel, und es schien ihm, als ginge von dort eine Hitze aus, die seinen Oberschenkel erwärmte. Die Seeleute erreichten gerade das Hafenbecken und refften das auffällige Segel. Dunkle Gestalten blickten von Bord in Richtung Stadt, blickten genau auf Seshmosis, wie es diesem schien, und Panik stieg in ihm auf. Suchten sie nach dem Amulett? Wies ihnen Magie den Weg zu ihm? Würden sie an ihm Rache nehmen für ihren ermordeten Landsmann?
Seshmosis spürte das ungeheure Verlangen, sich umgehend nach Hause und in den Schutz von GON zu begeben. Seine Sandalen schienen Flügel zu bekommen, und in Windeseile erreichte Seshmosis wohlbehalten den kleinen Palast in der Oberstadt, der ihm und einigen anderen Tajarim seit zwei Jahren als Wohnstatt diente, dank der Großzügigkeit von Kalala – Kalala, der Prinzessin von Gebel Abjad, der schwarzen Perle Nubiens, des Sterns der Oase Salima, der Ex-Geliebten von Kamose, dem Statthalter von Theben. Letzteres war besonders wichtig, denn Kamose hatte auf Betreiben seiner eifersüchtigen Frau Psuta die Prinzessin Kalala verstoßen, was diese wiederum dazu veranlasst hatte, den Schatz des Statthalters als Entschädigung mitzunehmen. Die Tajarim sahen solches Vorgehen keineswegs als Diebstahl an, sondern als soziales Verhalten infolge gesellschaftlicher Notwendigkeiten. Die Wertgegenstände des Statthalters von Theben waren ja nicht weg, sie waren jetzt nur woanders, bei Kalala. Die hatte nämlich eine Umverteilung vorgenommen, gemäß dem vierten Gebot von GON: »Du sollst nicht stehlen, außer wenn du Hunger hast oder lebensnotwendige Dinge brauchst, die da sind Kleidung, Transportmittel und Souvenirs.«
Kalala hatte damals viele Dinge gebraucht, Kämme und Spiegel aus poliertem Kupfer in verschiedenen Größen, Salbgefäße und Salblöffel, Unmengen von Augenschminke, nicht zu vergessen unzählige Perücken und natürlich Schmuck. Schließlich hatte sich Kalala samt ihrer ganzen Habe im Hafen der ägyptischen Stadt Sauti gemeinsam mit dem Sänger El Vis den Tajarim angeschlossen.
Hastig und ziemlich atemlos stürzte Seshmosis in sein Zimmer in Kalalas Palast und legte sich sogleich auf seine Liege. Nach einigen Atemzügen beruhigte er sich wieder, und fast wäre es ihm gelungen, sich in einem souverän geführten Selbstgespräch zu überzeugen, dass alles, aber auch wirklich alles vollkommen in Ordnung sei.
Wenn ihm da nicht GON einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.
Der Nomadengott materialisierte nämlich als Fisch über dem Kopf von Seshmosis und versäumte es nicht, einige Wassertropfen auf das Gesicht seines Propheten fallen zu lassen.
Bevor Seshmosis protestieren konnte, begann der Fisch zu sprechen: »Ihr Tajarim besitzt die seltene Gabe, euch ganz besondere Artefakte anzueignen.«
Seshmosis beschloss, nicht darauf zu reagieren.
»Du sitzt in der Tinte, mein lieber Prophet, und das nicht nur, weil du den Tintenbrocken in deinem Gewand mit deinem Angstschweiß teilweise verflüssigt hast.«
Erschrocken sprang Seshmosis von der Liege. Wirklich, auf dem Laken zeigte sich ein großer schwarzer Tintenfleck, und ebenso auf seinem Gewand.
»Inek pu iuti-ibef!«, stieß der Schreiber einen altägyptischen Fluch aus, was so viel bedeutete wie: »Ich bin einer, dessen Verstand nicht da ist«, also schlicht gesagt: »Ich bin ein Dummkopf.«
Vorwurfsvoll wandte er sich wieder dem Fisch zu: »Herr, ich hätte eher erwartet, dass du sagst: ›Mein lieber Seshmosis, du hast mit der ganzen Sache nichts zu tun‹ oder ›Es besteht nicht der geringste Anlass, beim Anblick eines schwarzen Schiffes in Panik zu verfallen‹. Bitte sage mir, was habe ich falsch gemacht? Ich bin mir keiner Schuld bewusst.«
»Überleg doch einmal! Ich sage nur: Amulett, schwarzes Schiff und Dauerlauf hierher. Wer ein reines Gewissen hat, rennt nicht durch die ganze Stadt, nur weil er ein kretisches Schiff erblickt.«
»Gut, ich gestehe, das Gerede des Händlers über einen Minoer, den seine Götter zu sich riefen, machte mich nervös.«
»Zu Recht, völlig zu Recht.«
»Und wie bekomme ich das Ganze wieder bereinigt, mein Herr?«
»Oh, bei Tintenflecken nimmt man am … Aber das meinst du ja gar nicht. Die Sache mit dem Amulett ist schon schwieriger, weil es da etliche Beteiligte gibt – Menschen, Götter, Zwischenwesen. Das wird dich einige Mühe kosten, aus dieser Sache wieder heil herauszukommen.«
»Wieso nur habe ich das Gefühl, o Herr, dass du mich nicht mehr so magst wie früher? Zuerst lässt du zu, dass mir Raffim die Heiligen Rollen unter der Nase wegstiehlt, und jetzt lässt du mich mit dem Amulett im Regen stehen.«
»Das hat nichts mit der Beziehung zwischen dir und mir zu tun. Dinge geschehen nun einmal, vor allem, wenn Menschen beteiligt sind. Glaubst du wirklich, dass jede deiner Handlungen von einem Gott gelenkt wird? Dann wärst du nichts als eine Marionette, ohne eigene Verantwortung, ohne Willen. Und ohne Freiheit!«
»Aber die Götter greifen doch immer wieder ins Leben der Menschen ein. Das habe ich oft genug erlebt!«, widersprach Seshmosis.
»Eingreifen ja, wenn sie eine Sache interessiert oder wenn sie sich bedroht fühlen. Sie reagieren wie Menschen, wenn etwas in ihrer Nähe passiert. Wenn es weit genug weg von ihnen geschieht, spielt es für sie keine Rolle.«
»Und das Amulett? Ist es in der Nähe von einem Gott? Oder einem Etwas?«, fragte der Schreiber zaghaft.
Bevor der Fisch antworten konnte, verschwand er mit einem leisen Plopp. Im selben Augenblick klopfte es an Seshmosis’ Tür, und noch bevor er »Herein!« sagen konnte, stand ein Diener in seinem Zimmer. »Prinzessin Kalala wünscht dich in der großen Halle zu sprechen!«, verkündete er unmissverständlich und verließ den Raum, ohne eine Reaktion abzuwarten.
Seshmosis schaute noch einmal zum Schrein von GON, doch er wusste, dass er im Augenblick nicht mehr erfahren würde. Resigniert zog er das tintenbefleckte Gewand aus und legte ein frisches an. Er durfte nicht vergessen, den Nomadengott bei der nächsten Begegnung zu fragen, wie man Tintenflecke aus Textilien entfernt.
In den Badehäusern zahlreicher ägyptischer Städte kam es innerhalb kurzer Zeit zu einer Häufung plötzlicher und unerklärlicher Todesfälle beim Personal. Die Priester zeigten sich ratlos, rieten den Badehausbetreibern aber vorsichtshalber zu erhöhten Opfergaben in ihrem jeweiligen Tempel.
Die tragischen Schicksale der zu früh Verstorbenen verhalfen Aram unversehens zu einer großen Anzahl qualifizierter Fachkräfte für das eben fertiggestellte Badehaus in Amentet. Anubis hatte es nämlich geschafft, die anderen Götter von Arams Idee zu überzeugen, und war mit Feuereifer daran gegangen, die nötigen Uschebti zu besorgen. Natürlich gab es da eine gewisse Befangenheit des Totenrichters, und so mancher Badespezialist landete nicht gemäß seines zweifelhaften Lebenswandels im Maul des zahnreichen Babi, sondern fand die unverdiente Gnade der Erlösung. Allerdings erheblich früher als ursprünglich vorgesehen.
Anubis’ Traurigkeit wegen seiner deprimierenden finalen Tätigkeit wich der Freude am eigenen, sinnvollen göttlichen Wirken. Der Totengott ließ Aram völlig freie Hand und stattete ihn mit allen notwendigen Vollmachten aus.
So wurde das Badehaus von Amentet bis ins Kleinste eine Kopie des Badehauses von Theben, das Aram viele Jahre geleitet hatte. Jeder verborgene Versorgungsgang und jedes einzelne Handtuch entsprachen der Erinnerung in Arams unfehlbarem Gedächtnis. Es fehlte nur noch eines: das Wasser.
Das Wasser aus dem tiefschwarzen Meer, das Amentet umspülte, kam nicht infrage, denn es war salzig. Dieses Meer wurde nämlich seit Anbeginn der Zeit von den Millionen und Milliarden Tränen der trauernden Hinterbliebenen gespeist.
So befand sich Aram, tagelang das Westreich durchwandernd, auf der Suche nach einer geeigneten Quelle. Und er wurde fündig. Hinter dem Palast des Kriegsgottes Month entdeckte er einen kleinen, sauberen Fluss. Der falkenköpfige Herr des Krieges befand sich, Gott sei Dank, gerade auf einer Dienstreise in der Menschenwelt, sodass Aram nicht befürchten musste, auf ihn zu treffen. Immerhin hieß es über diesen Gott: »Er ernährt sich nicht von den Produkten der Erde. Sein Brot sind die Herzen, und sein Wasser ist das Blut.« Das ließ eine Begegnung mit Month auch für einen Toten kaum erstrebenswert erscheinen.
Aram stellte eine kleine Kolonne kräftiger Uschebti zusammen und ließ sie einen Kanal vom Fluss zum Badehaus graben und diesen ausmauern. Einer der Vorzüge Amentets war es, dass hier Arbeiten ungeheuer schnell vorangingen und kein Arbeiter je zu klagen wagte. Denn bei Faulheit, schlechter Leistung oder gar Verweigerung drohten die allgegenwärtigen großen »Zerreißer« und »Verschlinger« des Totengerichts.
Schon bald sprudelte frisches Wasser im Badehaus. Alle Becken zeigten sich wohl gefüllt, und Aram präsentierte seinem Herrn Anubis demütig das Ergebnis.
Mit sichtlichem Stolz inspizierte der Gott das fertige Werk. Er, der Herr des Endes, der Zerstörer des Lebens, der Begleiter der allerletzten Stunde, hatte etwas Neues geschaffen. Besser gesagt, schaffen lassen. Die völlig andersartige Erfahrung, für etwas Konstruktives verantwortlich zu sein, berauschte Anubis regelrecht. Ausgelassen tanzte der schakalköpfige Totenrichter um das große Kaltwasserbecken.
»Ich werde die Götter zu einem rauschenden Fest einladen. Jawohl, ich, Anubis, werde ein Fest ausrichten. Wie lange habe ich das schon nicht mehr getan! Ich denke, seit meiner göttlichen Existenzwerdung nicht mehr!«
Aram genoss die Freude seines Gottes. Plötzlich legte dieser eine Hand auf seine Schulter und verkündete: »Ich werde vorschlagen, dass man dich zum Gott der Badefreuden ernennt. Gleich bei meinem großen Einweihungsfest.«