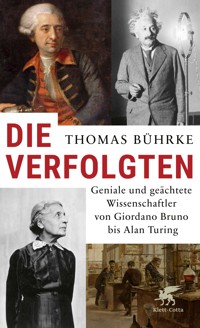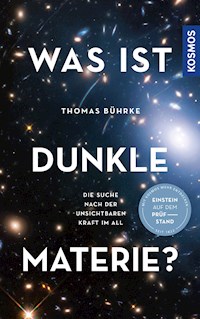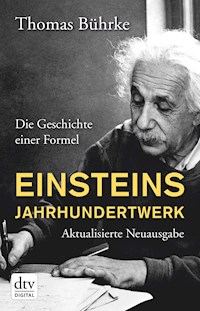
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Einsteins letztes Rätsel 2016 ging eine Sensationsmeldung um die Welt: Endlich war es gelungen, das letzte Element der Allgemeinen Relativitätstheorie direkt nachzuweisen, die Gravitationswellen, das Ergebnis eines kosmischen Crashs, bei dem zwei Schwarze Löcher vor 1,3 Milliarden Jahren miteinander verschmolzen sind. Diese Wellen erzeugen eine Verbiegung des Raumes, bei der sich die Abstände zwischen den Objekten kurzzeitig ändern. Zwei hochkomplexe Messinstrumente in den USA hatten das aufgezeichnet. Es war nur »ein kleines Zittern des Raumes, aber ein großes Beben für die Physik«. Es geschah 100 Jahre, nachdem Einstein seine Theorie der Welt vorgestellt hatte. Als hätte er seine Hand im Spiel gehabt. Thomas Bührke gehörte zu den wenigen Journalisten, die zur Veröffentlichung dieser Nachricht eingeladen waren. Er legt hier eine erweiterte Neufassung seines hochgelobten Buches vor, in der dieses Ereignis und seine Konsequenzen für unseren Blick ins Universum gewürdigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thomas Bührke
EINSTEINS JAHRHUNDERTWERK
Die Geschichte einer Formel
Mit s/w-Abbildungen und farbigem Bildteil
Vorwort: Einstein und sein Jahrhundertwerk
Es war ein kleines Zittern des Raumes, aber ein großes Beben für die Physik, als am 14. September 2015 über die Erde eine Gravitationswelle hinwegrauschte. Kein Mensch bemerkte etwas davon, nur zwei Messinstrumente namens Advanced Ligo in den USA registrierten eine kurzzeitige Verbiegung des Raumes. Das Signal dauerte lediglich zwei Zehntelsekunden, war aber so deutlich und wie aus dem Lehrbuch, dass die beteiligten Forscher anfangs an einen technischen Fehler glaubten. Eine genaue Analyse bewies letztlich: Sie hatten eine Gravitationswelle nachgewiesen – ein Jahrhundert nach Einsteins Vorhersage dieses Phänomens. Es war, als hätte der große Physiker selbst dabei seine Hand im Spiel gehabt.
Ursache waren zwei Schwarze Löcher, die zusammengestoßen und miteinander verschmolzen waren. Zu diesem Zeitpunkt war dieser Crash das gewaltigste Ereignis im Universum: In Form von Gravitationswellen wurde 50-mal mehr Energie frei als alle Sterne im Universum zusammen in Form von Licht und anderen elektromagnetischen Wellen abstrahlten!
Diese nobelpreiswürdige Entdeckung gilt nicht nur als fehlender Baustein der Allgemeinen Relativitätstheorie, sondern sie öffnet ein völlig neues Beobachtungsfenster ins Universum. Es stehen auch andere Vorgänge, wie die Kollisionen von Neutronensternen oder explodierende Sterne auf dem Beobachtungsplan. In ferner Zukunft lockt das Ziel, Gravitationswellen nachzuweisen, die in der extrem heißen und dichten Materie unmittelbar nach dem Urknall entstanden sind. Sie bieten nach dem derzeitigen Kenntnisstand die einzige Möglichkeit, mit Beobachtungen mehr über die Geburt des Universums zu erfahren – das wäre der vielleicht größte Triumph von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie.
Als Einstein vor einem Jahrhundert nach vielen Irrungen und Wirrungen die Allgemeine Relativitätstheorie vollendet hatte, war er überglücklich. In Briefen schrieb er von dem wertvollsten Fund, den er in seinem Leben gemacht habe, seine kühnsten Träume waren in Erfüllung gegangen. Und das, obwohl er zehn Jahre zuvor, in seinem Wunderjahr 1905, mit der Speziellen Relativitätstheorie die Physik schon einmal revolutioniert hatte.
Die Spezielle Relativitätstheorie löste mit einem Schlag einige grundlegende Probleme der Physik, die schon seit langem bekannt waren. Mit der Allgemeinen Relativitätstheorie hatte Einstein jedoch ein völlig neues Konzept der Schwerkraft (Gravitation genannt) entdeckt, das seine Kollegen weitgehend als unnötig empfanden. Schließlich hatte die Newton’sche Theorie der Gravitation 250 Jahre lang perfekt funktioniert. Sie erklärte den Fall des Apfels ebenso wie den Lauf des Mondes um die Erde oder die Bahnen der Planeten um die Sonne. Dennoch machte sich Einstein 1907 auf die Suche nach einer neuen Beschreibung der Gravitation.
Das Ergebnis, das er am 25.November 1915 präsentierte, war eine Theorie »von unvergleichlicher Schönheit«,1 wie er einem Freund schrieb. Ausgangspunkt der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die Tatsache, dass ein Körper im freien Fall gewichtslos ist. Die Schwerkraft scheint für ihn aufgehoben zu sein. Diese längst bekannte Tatsache offenbarte Einstein eine für ihn erstaunliche Wesensverwandtheit zwischen Schwerkraft und Beschleunigung. Acht Jahre lang fragte er sich, was hinter diesem Phänomen stecken könnte. Das Ergebnis: Die Gravitation ist keine auf unbekannte Art und Weise wirkende Kraft, wie Newton meinte, sondern eine Eigenschaft von Raum und Zeit: Die Materie krümmt den Raum, und der Raum zwingt die Materie zu bestimmten Bewegungen. Der Mond umkreist die Erde nicht, weil unsichtbare Kraftlinien die beiden Körper aneinanderbinden, sondern weil die Erde den umgebenden Raum eindellt wie eine Eisenkugel ein gespanntes Gummituch und der Mond sich in dieser Mulde um die Erde bewegt.
Dies ist der faszinierendste Aspekt der Allgemeinen Relativitätstheorie: Die Gravitation ist eine Eigenschaft der Geometrie von Raum und Zeit. Darin ist sie einzigartig: Alle anderen Naturkräfte wirken in der Zeit und im Raum. Die Gravitation ist Raum und Zeit. Max von Laue schrieb dazu, die gekrümmte Raumzeit »ist keineswegs eine mathematische Erfindung, sondern eine allen physikalischen Vorgängen zugrunde liegende Realität. Diese Erkenntnis ist Albert Einsteins größte Leistung.«2
Fast so erstaunlich wie das Ergebnis war auch der Weg dorthin. Während die andere große physikalische Theorie des 20.Jahrhunderts, die Quantenmechanik, das Werk von vielen ist, hat Einstein seine Gravitationstheorie so gut wie im Alleingang entwickelt. Lediglich einmal benötigte er die Hilfe seines Freundes Marcel Grossmann, als er im Dickicht der Mathematik nicht mehr ein und aus wusste.
Interessanterweise beschäftigten sich schon im 19.Jahrhundert vorwiegend Mathematiker mit der Frage, ob in dem uns umgebenden Raum wirklich die euklidische Geometrie gilt oder nicht. Wie das Leben in einer Welt mit einem gekrümmten Raum aussehen könnte, versuchten sie unter anderem in Form von Erzählungen darzustellen. Bemerkenswert sind aber auch die wenig bekannten Untersuchungen der Astronomen Johann Carl Friedrich Zöllner (1872) und Karl Schwarzschild (1900), die schon vor Einstein der Frage nachgingen, ob das Universum ein in sich geschlossener, sphärischer Raum, also ein »Kugeluniversum«, sein könne.
Nach der Veröffentlichung der Allgemeinen Relativitätstheorie verhielten sich die meisten Kollegen zurückhaltend bis ablehnend. Einstein beklagte die Jämmerlichkeit der Menschen und setzte nun alles daran, einige Vorhersagen, in denen seine Theorie von der Newton’schen abwich, mit astronomischen Beobachtungen zu bestätigen.
Es ist ein bemerkenswerter Aspekt der facettenreichen Geschichte der Allgemeinen Relativitätstheorie, dass ausgerechnet britische Astronomen im Jahre 1919 während einer totalen Sonnenfinsternis Einsteins Vorhersage der Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne bestätigten – ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges, in dem sich britische und deutsche Soldaten unerbittlich bekämpft hatten. Der britische Astronom Sir Arthur Eddington sagte, es sei für die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen England und Deutschland das Beste gewesen, was sich ereignen konnte. Der englische Physiker und Schriftsteller C.P.Snow bezeichnete Einstein als Fürsprecher für die Hoffnungen der Menschen. »Es scheint«, so schrieb er, »dass die Menschen – vielleicht als eine Art Befreiung von den Schrecken des Krieges – ein menschliches Wesen brauchten, das sie verehren konnten.«3
Die Bestätigung der Lichtablenkung verhalf der Allgemeinen Relativitätstheorie zum Durchbruch. Tageszeitungen in aller Welt berichteten euphorisch über den Sturz Newtons und die Revolution in der Physik. Dabei ist der damalige Rummel rational kaum nachvollziehbar. Wer verstand schon, was es mit dem gekrümmten Raum auf sich hatte? Es spielte offenbar gar keine Rolle, ob man die Worte des Meisters verstand, eher im Gegenteil. Gerade das Unvorstellbare und Rätselhafte verstärkte die Bewunderung für den genialen Denker. Einstein hat diese Aufregung um ihn und seine Theorie ebenso gesehen: »Ich bin sicher, dass es das Mysterium des Nicht-Verstehens ist, was sie [die Massen] so anzieht.«4
Trotz dieser Aufregung im Jahr 1919 fristete die Allgemeine Relativitätstheorie jahrzehntelang ein karges Dasein. Die Quantenphysik hingegen machte größere Fortschritte, weil sie in der aufstrebenden Erkundung der Elementarteilchen oder bei der Charakterisierung und Beschreibung von Materialien unerlässlich war und immer weiter entwickelt wurde. Das änderte sich erst ab den 1960er Jahren, als Astrophysik und Kosmologie immer neue Erfolge feierten: die Bestätigung der Urknalltheorie, die Entdeckung von Neutronensternen, Pulsaren, Schwarzen Löchern, Gravitationslinsen und der indirekte Nachweis von Gravitationswellen – dies alles lässt sich ohne Allgemeine Relativitätstheorie nicht erklären. Einige ihrer Konsequenzen waren so revolutionär, dass selbst Einstein vor ihnen zurückschreckte. Heute findet seine Gravitationstheorie sogar Eingang in den Alltag, nämlich bei den auf GPS basierenden Navigationsgeräten.
Ohne Übertreibung kann man sagen, Einstein hat einen völlig neuen Kosmos erschlossen – einzig und allein mit Papier und Bleistift. Doch selbst ihr Schöpfer ahnte, dass sie nur ein Vorstadium zu einer noch umfassenderen Theorie ist, die alle Phänomene in der Natur erklärt. Noch heute suchen seine Epigonen nach dieser Ur-Theorie, denn es ist bekannt, dass sowohl Relativitätstheorie als auch Quantentheorie in bestimmten Bereichen versagen, nämlich bei Schwarzen Löchern und dem Urknall: Keine der beiden Theorien ist in der Lage, diese »Singularitäten« zu erklären, in denen der Raum theoretisch unendlich stark gekrümmt und die Dichte unendlich groß ist. Hier versagt die heutige Physik. Deshalb sind seit Jahrzehnten Physiker und Mathematiker rund um die Welt auf der Suche nach einer Theorie der Quantengravitation. Sie ist gewissermaßen der Heilige Gral der Physik. Sie soll den Schleier des Unerklärbaren lüften. Wer weiß, was sie uns an neuen Erkenntnissen bringen wird.
Diese Vielfalt von historischen, physikalischen und kosmologischen Aspekten habe ich versucht, in diesem Buch zu beleuchten. Der Faszination gekrümmter Räume konnten sich auch Literaten und Maler nicht entziehen, wie zwei kulturelle Ausflüge belegen. Dabei ist anschauliches und verständliches Erklären in allen Fällen das Leitmotiv dieses Buches.
Jedem astrophysikalischen Phänomen ist ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem von den Anfängen der Einstein’schen Theorie ausgehend die Entwicklung bis in die aktuelle Forschung verfolgt wird. Am Ende dieser Chroniken stehen zum Beispiel Dunkle Materie und Dunkle Energie, verschmelzende Neutronensterne und Schwarze Löcher.
Experten, denen ich an dieser Stelle für ihre freundliche Unterstützung danken möchte, schildern in Interviews den Stand der Erforschung von Gravitationswellen, der Quantengravitation und der Dunklen Energie.
Die Allgemeine Relativitätstheorie ist heute aktueller denn je. Sie ist ein Jahrhundertwerk.
Thomas Bührke, Juli 2016
1: Eine kurze Geschichte von Raum und Zeit
Die Spezielle Relativitätstheorie
Auf einen Blick
Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant und kann nicht übertroffen werden.Zeit und Länge sind dynamische Größen, die vom Bewegungszustand des Betrachters abhängen.Die Abweichungen von der Newton’schen Physik machen sich erst bei Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit bemerkbar.Energie E und Materie m sind artverwandt und lassen sich ineinander umwandeln. Sie hängen über die Formel E mc2 miteinander zusammen.Der Äther existiert nicht.Die Allgemeine Relativitätstheorie krönte Einsteins wissenschaftliche Karriere. Sie steht jedoch insofern nicht allein da, als sie auf seiner 1905 veröffentlichten Speziellen Relativitätstheorie aufbaut. Es ist deshalb unerlässlich, die wichtigsten Erkenntnisse dieses nicht minder revolutionären Werkes zu verstehen. Der Kern beider Theorien ist ein fundamental neues Verständnis von Raum und Zeit. Um diesen Umsturz nachzuvollziehen, rufen wir uns kurz den Stand der entscheidenden physikalischen Gesetze ins Gedächtnis, die Ende des 19.Jahrhunderts als unumstößlich galten.
Alles ist relativ – wirklich?
Den Begriff der Relativität hat nicht Einstein eingeführt. Er bildete bereits die Grundlage der klassischen Physik von Galilei und Newton und beschreibt, wie die Gesetze der Physik Beobachtern erscheinen, die sich relativ zueinander bewegen. Galileo Galilei formulierte schon 1632 in seinem ›Dialog über die beiden hauptsächlichen zwei Weltsysteme‹ das Relativitätsprinzip. Demnach laufen in gleichförmig bewegten Systemen alle Vorgänge unverändert ab. Gleichförmig meint mit konstanter Geschwindigkeit.
Jeder kennt die Situation: Man sitzt in einem Zug, der im Bahnhof hält. Auf dem Nachbargleis steht ebenfalls ein Zug. Plötzlich, so meinen wir, fahren wir langsam los, denn die anderen Waggons bewegen sich aus unserem Blickfeld hinaus. Schließlich sind sie gänzlich verschwunden, doch zu unserem Erstaunen haben nicht wir den Bahnhof verlassen, sondern der Zug gegenüber. Im Nachbarzug aber hatten einige Reisende vermutlich genau das Gegenteilige empfunden und gemeint, sie selbst würden stehen bleiben und wir uns bewegen. Dieses Phänomen lässt sich nur dann beobachten, wenn die Beschleunigung des Zuges zu gering ist, um von uns wahrgenommen zu werden, das heißt wenn sich der Zug mit nahezu konstanter Geschwindigkeit bewegt. Dann können wir nicht zwischen Ruhe und Bewegung unterscheiden. Fahren wir in einem ICE mit 200km/h und lassen einen Kugelschreiber los, so wird er senkrecht nach unten fallen – genau so, als würden wir unbewegt am Bahnsteig stehen.
Vom Standpunkt eines Physikers aus sind beide Personen – oder wie man sagt: Bezugssysteme – gleichberechtigt. Alle Vorgänge laufen im gleichförmig bewegten System exakt so ab wie in einem ruhenden. Beide Systeme sind ununterscheidbar, weswegen der Begriff Ruhe aus physikalischer Sicht relativ ist, wie uns das Beispiel der Personen in den beiden Zügen im Bahnhof zeigt. Solche gleichförmig bewegten Systeme nennen Physiker Inertialsysteme.
Geschwindigkeiten sind immer relativ und hängen davon ab, von wo aus sie gemessen werden. Nehmen wir an, auf einer Autobahn versuchen zwei Autos, die bezüglich eines an der Straße stehenden Radars der Polizei mit jeweils 120km/h fahren, einander zu überholen. Auf der Gegenspur kommt ihnen ein PKW mit 150km/h bezüglich des Radars entgegen. Die beiden Autofahrer bewegen sich nun relativ zueinander gar nicht, haben also die Relativgeschwindigkeit 0km/h. Der von ihnen auf der anderen Seite entgegenkommende PKW rast indes mit 270km/h auf sie zu. Alle Bezugssysteme, sowohl das der Autos als auch das am Straßenrand stehende Radar, sind aus physikalischer Sicht gleichberechtigt. Begibt man sich von einem System in das andere, so müssen die Geschwindigkeiten abhängig von der Bewegungsrichtung addiert oder subtrahiert werden.
Isaac Newton übernahm in seinem 1687 erschienenen, fundamentalen Werk ›Philosophiae Naturalis Principia Mathematica‹ das Relativitätsprinzip und kombinierte es mit dem Trägheitssatz. Danach bleibt jeder Körper im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung, solange keine äußeren Kräfte auf ihn einwirken. Ein gutes Beispiel hierfür sind heute interplanetare Raumsonden. Ein Raketentriebwerk beschleunigt sie, bis sie schnell genug sind, um das Schwerefeld der Erde zu verlassen. Dann wird das Triebwerk abgeschaltet, und die Sonde fliegt näherungsweise auf einer geraden Bahn weiter – sieht man einmal von den Schwerkrafteinflüssen der anderen Himmelskörper ab.
Bleibt die Frage: Wie kann ich überhaupt feststellen, ob eine Bahn geradlinig verläuft oder nicht? Im All gibt es keine festen Markierungen, die man als Bezugspunkte nutzen könnte. Newton sah damals keinen anderen Ausweg, als einen absoluten Raum zu definieren. Er schrieb: »Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich.« Damit hatte er eine Art imaginäres Koordinatenkreuz geschaffen, anhand dessen sich absolute Ruhe und absolute Bewegung festmachen ließen. Er definierte sogar den Nullpunkt, indem er annahm, das Universum besitze ein ruhendes Zentrum. Dies sah er in dem Schwerpunkt des Sonnensystems, der etwas außerhalb des Sonnenzentrums liegt.
Um entscheiden zu können, ob eine geradlinige Bewegung auch mit konstanter Geschwindigkeit erfolgt, bedurfte es noch eines Zeitmaßes, denn Geschwindigkeit ist definiert als zurückgelegte Entfernung pro Zeitintervall. Hierzu legte Newton fest: »Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand.« Diese Festlegung ist deshalb so wichtig, weil die Zeitmessung bei der Definition nahezu aller physikalischen Größen der klassischen Physik, wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft, Impuls oder Energie, eine entscheidende Rolle spielt.
Der Raum bildet somit eine Art kosmische Bühne, auf der sich das Weltenspiel entwickelt. Die Zeit fließt gleichförmig wie ein Fluss, auf dem alle Körper mit gleicher Geschwindigkeit dahintreiben. Das Konzept des absoluten Raumes und der absoluten Zeit wurde zwar durchaus nicht von allen Kollegen akzeptiert, wie im nächsten Kapitel weiter ausgeführt wird, aber Newtons Mechanik vermochte alle Vorgänge sowohl auf der Erde als auch im Weltall so gut zu beschreiben, dass lange Zeit niemand an sie rührte.
Der Lichtsurfer betritt die Bühne
Neben dem Newton’schen Werk beherrschte die Elektrodynamik des schottischen Physikers James Clerk Maxwell die Physik des ausgehenden 19.Jahrhunderts. Um 1855 hatte er eine Theorie entwickelt, mit der er die zahlreichen experimentellen Ergebnisse aus dem Bereich der elektrischen und magnetischen Kräfte in einer einzigen Theorie zusammenfasste. Hierin beschrieb er Licht als eine Form von elektromagnetischen Wellen. Ähnlich, wie sich Wasserwellen auf einem See ausbreiten, sollte sich Licht im Raum bewegen, wobei es im Vakuum die maximale Geschwindigkeit von 300000km/s erreicht. In der Analogie zur Wasserwelle sollte sich auch eine elektromagnetische Welle in einem Medium ausbreiten. Die Physiker nannten es Äther.
Damit schien das theoretische Gebäude der Physik errichtet. Als Max Planck 1878 seinem Physikprofessor Philipp von Jolly seinen Entschluss mitteilte, theoretische Physik zu studieren, riet dieser ihm: »Theoretische Physik, das ist ja ein ganz schönes Fach. Aber grundsätzlich Neues werden Sie darin kaum mehr leisten können … Man kann wohl hier und da in dem einen oder anderen Winkel ein Stäubchen noch auskehren, aber was prinzipiell Neues, das werden Sie nicht finden.«1
Doch das Neue näherte sich bereits am Horizont. Man musste nur genau hinsehen. Überraschenderweise schien nämlich auf Licht die Newton’sche Physik nicht zuzutreffen. Die Gleichungen, mit denen man seine Ausbreitung beschrieb, nahmen unterschiedliche Formen an, wenn man sich in unterschiedlich schnelle, gleichförmig bewegte Bezugssysteme begab. Licht verhielt sich also nicht so wie Autos auf der Straße, bei denen man die Geschwindigkeiten einfach addieren muss.
Das zeigte sich eindeutig in einem Experiment des Physikers Albert Michelson. Ziel war es, die Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Bewegungsrichtungen relativ zum Äther zu messen. Als Bezugssystem diente Michelson sein Laboratorium, das mit der Erde um die Sonne herumwirbelte und somit auch durch den Äther flog. Zwar war weder bekannt, mit welcher Geschwindigkeit noch in welcher Richtung sich die Erde relativ zum Äther bewegt. Auf jeden Fall aber mussten Richtung und Geschwindigkeit an verschiedenen Punkten der Erdbahn, beispielsweise bei Frühlings- und Sommeranfang, unterschiedlich sein.
Michelson führte seine Messung nun nicht an zwei Tagen im Jahr durch, sondern er spaltete einen Lichtstrahl in zwei Teile auf, die sich anschließend senkrecht zueinander durch die Apparatur bewegten. Danach führte er sie wieder zusammen und maß im gemeinsamen Zielpunkt die Differenz der Geschwindigkeiten beider Lichtstrahlen. Diese sollte wegen der unterschiedlichen Bewegungsrichtung relativ zum Äther entstehen.
Ein erster Versuch im Jahre 1881, den Michelson bei einem Studienaufenthalt in Potsdam durchführte, erbrachte keinerlei Unterschied der Lichtgeschwindigkeit auf den beiden Lichtwegen. Daraufhin verfeinerte er seine Apparatur und wiederholte das Experiment sechs Jahre später in den USA mit seinem Kollegen Edward W. Morley. Wieder war das Ergebnis negativ. Das Licht schien stets dieselbe Geschwindigkeit aufzuweisen, egal wie man sich relativ zum Äther bewegte – ein krasser Widerspruch zur Newton’schen Physik.
Das Experiment von Michelson und Morley zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Ein Lichtstrahl wird an einem halbdurchlässigen Spiegel in zwei senkrecht zueinander laufende Teilstrahlen 1 und 2 aufgespalten. Da sich diese in unterschiedlichen Richtungen zum vermuteten Äther bewegen, hätte der Beobachter Laufzeitunterschiede messen müssen.
Die meisten Physiker ignorierten diesen Widerspruch, einige suchten nach Lösungen, ohne das Gebäude ganz einreißen zu müssen. So vermutete Hendrik Antoon Lorentz von der Universität Leiden, dass sich Michelsons Messapparatur in Bewegungsrichtung verkürze. Dann würde ein Lichtstrahl auf dieser Strecke weniger Zeit benötigen als auf der senkrecht dazu verlaufenden Strecke. Lorentz konnte sogar eine Formel für den Schrumpfungsgrad angeben. Sie war so gewählt, dass die beiden senkrecht zueinander laufenden Lichtstrahlen ihren jeweiligen Weg in derselben Zeit zurücklegen und gemeinsam im Detektor ankommen. Demnach hätte man mit keinem Experiment jemals eine Relativbewegung des Lichts gegen den Äther messen können. Außerdem wäre es auch nicht möglich gewesen, diese Verkürzung der Apparatur zu messen, da jeder angelegte Messstab im selben Maße wie sie schrumpfen würde.
Es bedurfte jedoch des Genies von Albert Einstein, um das Experiment von Michelson und Morley richtig zu deuten. Der Widerspruch zwischen Maxwells und Newtons Grundaxiomen war ihm mit 16 Jahren aufgefallen, wie er sich später erinnerte: »Wenn ich einem Lichtstrahl nacheile mit Geschwindigkeit c (Lichtgeschwindigkeit im Vakuum), so sollte ich einen solchen Lichtstrahl als ruhendes, räumlich oszillierendes elektromagnetisches Feld wahrnehmen. So was kann es aber nicht geben, weder aufgrund der Erfahrung noch gemäß den Maxwell’schen Gleichungen. Intuitiv schien es mir von vornherein klar, dass von einem solchen Beobachter aus beurteilt alles sich nach denselben Gesetzen abspielen müsse wie für einen relativ zur Erde ruhenden Beobachter. Denn wie sollte der erste Beobachter wissen bzw. konstatieren können, dass er sich im Zustand rascher gleichförmiger Bewegung befindet? Man sieht, dass in diesem Paradoxon der Keim zur Speziellen Relativitätstheorie schon enthalten ist.«2
Einstein brauchte weitere zehn Jahre, um diesen Widerspruch zu lösen. In seiner 1905 veröffentlichten Arbeit ›Zur Elektrodynamik bewegter Körper‹ behauptet er, das einfache Galilei-Newton-Gesetz der Geschwindigkeitsaddition sei falsch. Licht bewegt sich stets mit derselben Geschwindigkeit, egal, von welchem Bezugssystem aus ich sie messe. Die Lichtgeschwindigkeit ist nicht relativ, sondern konstant und beträgt (im Vakuum) immer 300000km/s. Sie ist eine Naturkonstante. Deswegen ist es auch nicht möglich, neben einer Lichtwelle mit gleicher Geschwindigkeit entlangzufliegen, wie es sich der junge Einstein noch vorgestellt hatte.
Mit mutigem Hieb hatte Einstein den Gordischen Knoten durchschlagen, in dem Newton, Maxwell und Michelson/Morley gefangen waren. Allerdings mit der provozierenden Konsequenz, dass Newton Unrecht hatte und Maxwell auf dem richtigen Weg gewesen war.
Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit hat enorme Auswirkungen, zum Beispiel auf den Lauf der Zeit.
Wenn die Zeit zu kriechen beginnt
Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit steht im krassen Widerspruch zu unserer Alltagserfahrung, wie ein Gedankenexperiment mit einer »Lichtuhr« beweist.
Bewegung eines Lichtstrahls in einem relativ zu einem Beobachter ruhenden (links) und einem bewegten System (Mitte). Unter der Voraussetzung konstanter Lichtgeschwindigkeit lässt sich mit dem Satz des Pythagoras (rechts) der Umrechnungsfaktor der Zeitdilatation herleiten.
Man denke sich zwei parallel angebrachte Spiegel, zwischen denen ein Lichtpuls hin und her reflektiert wird. Jede Reflexion diene als Taktgeber für eine Uhr. Solange diese Lichtuhr in Ruhe ist, schwingt ihr »Pendel« wie jedes andere auch. Doch die Situation ändert sich, wenn man die Uhr senkrecht zum Lichtstrahl in gleichförmige Bewegung versetzt.
Von außen betrachtet läuft der Lichtstrahl nun auf einer Zickzacklinie, und der zurückgelegte Weg wird länger. Entscheidend ist nun, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Deshalb dauert jeder Taktschlag von außen gesehen ein wenig länger als im ruhenden Fall. Die Zeit verläuft also von einem ruhenden Beobachter aus gesehen im bewegten System langsamer. Einstein folgerte: Je schneller man sich bewegt, desto langsamer vergeht von außen betrachtet die Zeit. Für einen Reisenden in dem bewegten System vergeht die Zeit jedoch so langsam wie immer.
Anhand der Lichtuhr kann man auch sehr leicht die Formel für die Zeitdilatation, also die Verlangsamung der Zeit, herleiten.
Für einen Beobachter im bewegten System legt der Lichtstrahl den Weg y’ zwischen den Spiegeln senkrecht von unten nach oben mit der Lichtgeschwindigkeit c in der Zeit t’ zurück: y’c∙t’ (Grafik links). Für den außen stehenden, ruhenden Beobachter schreitet aber während der Laufzeit t’ der Endpunkt der Reflexion, der obere Spiegel, mit der Geschwindigkeit v des bewegten Systems in x-Richtung, also um die Strecke xv∙t fort. Dadurch verläuft der Lichtstrahl vom unteren zum oberen Spiegel vom ruhenden Beobachter aus gesehen nun schräg (Grafik Mitte). Seine Laufstrecke beträgt sc∙t. Diesen Weg s durchläuft das Licht ebenfalls mit der Lichtgeschwindigkeit c, da c nicht vom Bewegungszustand abhängt. Die Addition (Grafik S. 19) der Strecken y’ und x ergibt s und bildet ein rechtwinkliges Dreieck, so dass sich der Satz des Pythagoras anwenden lässt: (c∙t)2(c∙t’)2 + (v∙t)2.
Löst man diese Gleichung nach der Zeit t auf, so erhält man das Ergebnis: .
Vom ruhenden Beobachter aus gesehen verlangsamt sich also der Zeitablauf im bewegten System um den Faktor: .
Physiker sprechen von der Zeitdilatation. Diesen Faktor hatte schon Lorentz gefunden, als er die Verkürzung einer Messapparatur in Bewegungsrichtung relativ zum Äther annahm. Physiker nennen dies Lorentz-Transformation.
Dieser Umrechnungsfaktor zeigt deutlich, warum im Alltag alle Uhren ununterscheidbar gleich schnell gehen. Die Geschwindigkeiten sind im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit verschwindend klein, und damit ist der Bruch (v/c)2 fast genau null. Erst im Bereich der Lichtgeschwindigkeit tritt ein merklicher Effekt auf (siehe Tabelle). Physikalisch bedeutet dies: Die Newton’sche Physik ist als Grenzfall für sehr kleine Geschwindigkeiten in der Speziellen Relativitätstheorie enthalten.
Umrechnungsfaktoren für die Zeitdilatation bei verschiedenen Relativgeschwindigkeiten.
Objekt
v (km/s)
Dauer eines Jahres
Auto
0,03
≈ 1
≈ 1
Flugzeug
0,5
0,9999999999986
1 Jahr + 0,00003s
Raumsonde
40
0,999999991
1 Jahr + 0,3s
10% von c
30000
0,995
1 Jahr + 44 h
50% von c
150000
0,866
1 Jahr + 56,5 d
90% von c
270000
0,436
2,3 Jahre
95% von c
285000
0,312
3,2 Jahre
99% von c
297000
0,141
7,1 Jahre
99,9% von c
299700
0,045
22,2 Jahre
Die Zeitdilatation wurde vielfach und auf unterschiedliche Weise experimentell bestätigt. In Teilchenbeschleunigern kann man heute messen, wie die schnelle Fahrt jung hält. Sogenannte Myonen, instabile Teilchen, die normalerweise mit einer Halbwertszeit von 1,5 Mikrosekunden (Millionstel Sekunden) zerfallen, »leben« dort bei 99,9997 Prozent der Lichtgeschwindigkeit rund 400-mal so lange. Experimentelle Ergebnisse stimmen mit der Vorhersage bis auf ein Milliardstel genau überein. Damit ist die relativistische Zeitdilatation einer der am genauesten überprüften Aspekte der Speziellen Relativitätstheorie.
Eine beeindruckende Bestätigung der Einstein’schen »Lebensverlängerung« demonstrierten 1941 die beiden Physiker Bruno Rossi und David Hall von der Universität Chicago mit einem trickreichen Experiment. In der Hochatmosphäre stoßen schnelle Teilchen, die aus dem Weltraum kommen, mit Kernen von Atomen zusammen. Dabei werden Myonen frei, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in Richtung Erde weiterfliegen. Da diese Teilchen etwa 33 Mikrosekunden bis zum Boden benötigen, sollten die allermeisten von ihnen auf dem Weg bis dorthin zerfallen sein. Nur sehr wenige Myonen dürften eigentlich auf der Erde ankommen.
Rossi und Hall maßen nun auf dem Gipfel des Mt. Washington in 1910 Meter Höhe die Zahl der ankommenden Myonen und verglichen diese mit der Anzahl auf Meereshöhe. Auf dem Berg registrierten sie 563 Myonen und auf Meereshöhe 408 Myonen pro Stunde. Wegen der kurzen Lebensdauer hätten es aber nur 31 sein dürfen. Ursache für diese Diskrepanz ist die Zeitdilatation. Im System der fast mit Lichtgeschwindigkeit eilenden Myonen vergeht die Zeit wesentlich langsamer als auf der Erde. Die Teilchen existieren deshalb länger und »überleben« weitgehend den Weg bis zum Erdboden.
Entscheidend ist bei all diesen Überlegungen, dass die Verlangsamung der Zeit nicht etwa durch eine mechanische Beeinflussung der Uhren zustande kommt. Die Zeit an sich vergeht unterschiedlich schnell. Und das wirkt sich auf alle Vorgänge aus, auch auf biologische. Nur lässt sich der Effekt am Menschen nicht nachweisen, weil es keine Raumschiffe gibt, die auch nur annähernd Lichtgeschwindigkeit erreichen. Die Apollo-Astronauten beispielsweise sind auf ihren acht Tage währenden Flügen zum Mond etwa um 250 Mikrosekunden (Millionstel Sekunden) weniger gealtert als ihre Kollegen am Boden – zumindest rein rechnerisch. Die Abhängigkeit der Zeitdilatation von der Geschwindigkeit demonstriert die Tabelle, in der angenommen wurde, dass ein Jahr exakt 365 Tage, entsprechend 31,536 Millionen Sekunden dauert.
Die einfache Formel, mit der sich die Zeitdilatation berechnet, führt zudem zu einem erstaunlichen Ergebnis: Kein Körper kann die Lichtgeschwindigkeit erreichen oder sie gar überschreiten. Hyperantriebe, mit denen Spock & Co. schneller als das Licht die Galaxis durcheilen, sind somit reine Science Fiction.
Einsteins Erkenntnis über die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit hatte eine weitere bemerkenswerte Konsequenz: Beschleunigte Körper müssen eine Massenzunahme erfahren. Nach Newton wird ein Körper bei konstanter Beschleunigung immer schneller. Nehmen wir ein Raumschiff, das mit der Erdbeschleunigung von etwa 10m/s2 ins All fliegt: Es wird in jeder Sekunde um 10m/s schneller. Ein solches Raumschiff würde gemäß Newton nach etwa einem Jahr die Lichtgeschwindigkeit erreichen und sie dann überschreiten. Das aber ist nach Einstein nicht möglich. Seine Erklärung für diese »Bremse«: Die träge Masse wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer größer. Bei Erreichen der Lichtgeschwindigkeit würde sie unendlich groß.
Diese relativistische Massenzunahme macht sich zum Beispiel in alten Röhrenfernsehern bemerkbar. In ihren Kathodenstrahlröhren werden Elektronen in einem Spannungsfeld von 20000 Volt bis auf etwa ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ihr Gewicht nimmt dabei um sechs Prozent zu. Beim Aufprall auf den Leuchtschirm erzeugen sie Lichtpunkte, die zusammen das Bild ergeben. Würde man bei der Konstruktion der Bildröhre die Spezielle Relativitätstheorie nicht berücksichtigen, so würden die Elektronen bis zu etwa einem Millimeter von ihrer Sollbahn abweichen. Die Bilder wären unscharf.
Das Zwillingsparadoxon
Die Zeitdilatation ist lange Jahre auf Kritik gestoßen. Immer wieder versuchten Physiker, sie zu widerlegen. Der berühmteste und wirklich verblüffendste Versuch dieser Art ist das Zwillingsparadoxon. Stellen wir uns eine Zukunftsvision vor. Im Jahre 2100 begibt sich der Astronaut Neil Armstrong jr. auf eine Reise zum 25 Lichtjahre entfernten Stern Wega, während sein Zwillingsbruder auf der Erde bleibt. Wir nehmen an, die Rakete würde nahezu ohne Zeitverlust auf 98 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und mit dieser Geschwindigkeit die Reise fortsetzen. Bei der Wega angekommen, dreht Neil ohne Aufenthalt um und kehrt mit derselben Geschwindigkeit wie auf dem Hinweg zurück. Auf der Erde stellt er fest, dass er um zehn Jahre gealtert ist, sein Bruder hingegen um fünfzig Jahre.
Zu einem Paradoxon, also einer in sich widersprüchlichen Beschreibung, wird dieses Beispiel durch den Grundsatz, dass alle Bezugssysteme gleichberechtigt sind. Das heißt, die Behauptung des Bruders, er habe sich auf der Erde in Ruhe befunden und Neil hätte sich schnell bewegt, lässt sich ebenso umkehren in die Behauptung, Neil sei unbewegt geblieben und der Bruder habe sich mit der Erde von ihm entfernt. Bei ihrem Wiedersehen müsste nun Neil schneller gealtert sein als sein Bruder. Wer hat recht?
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Situationen: Während sich der Bruder die ganze Zeit über in einem Inertialsystem befand, war dies bei Neil nicht der Fall. Sein Raumschiff musste mehrmals stark beschleunigen, einmal nach dem Start, ein zweites Mal bei der Umkehr an der Wega und ein drittes Mal bei der Rückkehr. In diesen Phasen bildete das Raumschiff kein Intertialsystem, so dass auf dieses die Spezielle Relativitätstheorie nicht angewandt werden darf. Eine genaue Analyse in einem Raum-Zeit-Diagramm klärt schließlich das Zwillingsparadoxon: Tatsächlich altert Neil langsamer als sein auf der Erde zurückbleibender Bruder.
Was heißt schon gleichzeitig?
Die Zeit kann unterschiedlich schnell vergehen, damit wird der Blick auf die Uhr zu einer relativen Angelegenheit. Selbst die Frage, ob zwei Ereignisse gleichzeitig stattfinden, lässt sich nicht mehr eindeutig beantworten. Hierzu wieder ein Gedankenexperiment.
Ein Beobachter steht in der Nähe eines Bahndamms, an dem ein Zug vorbeifährt. In dem Moment, in dem das vordere und hintere Zugende vom Beobachter gleich weit entfernt sind, schlägt direkt in die Lokomotive und den letzten Wagen jeweils ein Blitz ein. Weil das Licht von beiden Einschlagstellen her die gleiche Wegstrecke bis zum ruhenden Beobachter zurücklegen muss, sieht dieser beide Blitze gleichzeitig.
Zwei Blitze schlagen an den beiden Enden eines Zuges ein. Ein am Bahndamm stehender Beobachter nimmt sie gleichzeitig wahr, der in der Mitte des Zuges sitzende Schaffner jedoch wegen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit nicht. Der Begriff der Gleichzeitigkeit wird dadurch relativ.
Genau in der Mitte des Zuges befindet sich der Schaffner, dem es ebenfalls möglich ist, die Blitze zu sehen. Was beobachtet er? Der Schaffner fährt mitsamt dem Zug nach vorne weiter. Er bewegt sich also dem Lichtstrahl jenes Blitzes entgegen, der in die Lokomotive eingeschlagen hat. Gleichzeitig entfernt er sich von dem Zugende. Das Licht des vorderen Blitzes wird den Schaffner daher eher erreichen als das vom Zugende, das heißt, er wird den vorderen Blitz eher sehen als den hinteren. Nun nehmen wir an, dass der Schaffner bestens mit dem Phänomen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit vertraut ist. Dann wird er argumentieren, er befände sich schließlich genau in der Mitte des Zuges und beide Lichtstrahlen hätten ihn mit derselben Geschwindigkeit erreicht. Daher dürfe er mit Fug und Recht behaupten, die Blitze hätten nicht gleichzeitig eingeschlagen, sondern nacheinander. Wer hat nun recht, der Schaffner oder der Beobachter am Bahndamm?
Beide haben recht, denn die Relativitätstheorie macht zwischen ihren Standpunkten keinen Unterschied. Der Schaffner könnte sogar behaupten, er befände sich in Ruhe und die Person am Bahndamm hätte sich im Vergleich zu ihm bewegt. Das heißt: Die Blitze sind gleichzeitig und nacheinander eingeschlagen.
Die Begriffe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wurden damit in der Speziellen Relativitätstheorie neu definiert. Einstein selbst bezeichnete sie später als »hartnäckige Illusionen«. Allerdings kann nie das Kausalitätsprinzip verletzt werden, wonach stets die Ursache der Wirkung vorausgeht. Der Grund hierfür ist, dass sich jede nur denkbare Ursache maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und an einem anderen Ort wirken kann. Also: Erst kommt der Elfmeterschuss, dann fällt das Tor, nie umgekehrt. Das ist auch bei Einstein so.
Aus lang wird kurz
Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit hat noch eine weitere, seltsame Konsequenz: Wenn man sich sehr schnell mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegt, erscheinen einem alle Körper in Bewegungsrichtung verkürzt. Allerdings werden diese Körper nicht wirklich zusammengedrückt und gestaucht. Physikalisch verändern sie sich nicht. Die Kontraktion betrifft auch nicht nur Körper, sondern allgemein räumliche Abstände. Da aber alle gleichförmig bewegten Beobachter gleichberechtigt sind, gibt es keine richtige oder falsche Längenmessung. Nur in unserem Alltag ist ein Meter immer gleich lang, weil wir uns nie sehr schnell gegenüber Objekten bewegen, deren Ausmaße wir messen.
Übrigens lässt sich das Myonenexperiment von Rossi und Hall auch im Rahmen dieser sogenannten Längenkontraktion deuten. Aus der Sicht der mit fast Lichtgeschwindigkeit fliegenden Teilchen erscheint die vor ihnen liegende Wegstrecke zum Erdboden extrem verkürzt. Deshalb können so viele von ihnen sie überbrücken, ohne vorher zu zerfallen.
Jahrzehntelang dachten die Physiker, alle Objekte würden bei schneller Fahrt in Bewegungsrichtung verkürzt erscheinen. Doch Ende der 1950er Jahre bemerkten Theoretiker, dass man hierbei etwas Wichtiges vergessen hatte: Das Licht benötigt von unterschiedlich weit entfernten Stellen eines Körpers unterschiedlich lange Zeiten, bis es beim sich bewegenden Beobachter eintrifft. Dies hat zur Folge, dass bei sehr hohen Geschwindigkeiten Objekte nicht nur gestaucht, sondern auch verzerrt erscheinen, so als würde man sie durch ein Fischauge-Objektiv aufnehmen. Mit Computersimulationen lässt sich heute darstellen, was Einstein damals sicher auch gern gesehen hätte (s. Bild 1 im farbigen Mittelteil).
Im Zuge der Reform von Raum und Zeit wurde übrigens auch der Äther, von dessen Natur und Konsistenz die Physiker ohnehin keine einheitliche Vorstellung gewinnen konnten, überflüssig. Einstein schaffte ihn einfach ab.
E=mc2: Materie ist »kondensierte« Energie
Ist ein Glas mit heißem Wasser schwerer als eines mit derselben Menge kalten Wassers? Die Antwort ist ja – und ihre Erklärung hat erstaunlicherweise etwas mit der Energieerzeugung im Innern der Sterne und mit der enormen Sprengkraft von Atombomben zu tun.
Am 27.September 1905 reichte Einstein eine nur drei Seiten umfassende Arbeit zur Veröffentlichung ein. Dieser Nachtrag zur Speziellen Relativitätstheorie hatte die wohl berühmteste Formel der Weltgeschichte zum Ergebnis: Emc2. Sie besagt, dass Energie E und träge Masse m ineinander umwandelbar sind. Das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit c2 ist ein sehr großer Faktor – aus wenig Masse kann also sehr viel Energie werden.
Heute gehört beispielsweise die Erzeugung von Energie aus Kernspaltung zum Alltag. In Kernkraftwerken werden in einer kontrollierten Kettenreaktion Uran-Atomkerne gespalten. Hierbei wird ein Tausendstel der Kernmaterie in Energie umgesetzt. Bei Atombomben läuft die Kettenreaktion in Bruchteilen einer Sekunde unkontrolliert ab, wobei enorme Energiemengen frei werden. Bei der Explosion der Atombombe von Nagasaki lieferte nur etwa ein Kilogramm Plutonium die Sprengkraft von 12500 Tonnen TNT.
Ebenfalls nach dem Prinzip Materie-Energie-Umwandlung funktioniert die Kernfusion. Sie basiert auf dem Verschmelzen leichter Atomkerne. Alle Sterne – einschließlich unserer Sonne – erzeugen auf diese Weise ihre Energie. In mehreren Schritten verschmelzen insgesamt vier Wasserstoffkerne (Protonen) zu einem Heliumkern. Dieser ist jedoch leichter als die Summe der vier Protonen, weil er aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht. Die Massendifferenz von ungefähr einem Prozent wird bei jedem Reaktionsschritt in Form von Strahlungsenergie abgegeben. In jeder Sekunde verwandelt der »Kernfusionsreaktor Sonne« etwa vier Millionen Tonnen Materie in Energie. Diese Menge würde ausreichen, um eine Million Jahre lang den gesamten heutigen Energiebedarf der Menschheit zu decken.
Technisch hat die Kernfusion ihre Anwendung im Bau von Wasserstoffbomben gefunden. Die kontrollierte Fusion in einem Energie liefernden Reaktor ist noch nicht möglich. Sie ist das Ziel eines internationalen Projekts namens ITER. Dieser im Bau befindliche Fusionsreaktor soll zukünftig erstmals mehr Energie liefern, als in ihn hineingesteckt wird.
Da die Wesensverwandtheit von Energie und Masse für jede Art von Energie gilt, ist auch das Glas mit heißem Wasser schwerer als das mit kaltem. So wird ein Liter Wasser bei Erwärmung um zwanzig Grad um ein Milliardstel Gramm schwerer. Messen kann man das nicht. Aber wir können es Einstein glauben.
Zögerliche Anerkennung
Einstein war zu seinen bahnbrechenden Erkenntnissen gekommen, indem er mutig altbekannte Gesetze in Frage stellte und neue schuf. Ungezügelte Neugier und Hartnäckigkeit waren dabei unerlässliche Triebfedern. Seinem Kollegen James Franck hat er später einmal gesagt: »Der normale Erwachsene denkt über Raum-Zeit-Probleme kaum nach. Das hat er nach seiner Meinung bereits als Kind getan. Ich hingegen habe mich geistig derart langsam entwickelt, dass ich erst als Erwachsener anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern.«3
Die Spezielle Relativitätstheorie machte unter Physikern schnell die Runde, doch nur einige Koryphäen wie Max Planck oder Arnold Sommerfeld erkannten sofort die »Kopernikanische Leistung«, wie Planck sagte. Planck war es auch, der im September 1906 auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte in Stuttgart über Einsteins Arbeit berichtete und hierbei erstmals das Wort Relativtheorie verwendete, woraus sich dann bald der Begriff »Relativitätstheorie« entwickelte. Einstein selbst hielt noch einige Jahre an der etwas vorsichtigeren Formulierung des Relativitätsprinzips fest, übernahm aber schließlich selbst Plancks Formulierung.
Zu dieser Zeit spazierte Einstein noch Morgen für Morgen ins Berner Patentamt, wo er damals als Experte II. Klasse sein Geld verdiente. Weder lud man ihn auf Tagungen ein noch besuchte ihn jemand. Eine Ausnahme bildete Max Laue, der 1907 nach Bern reiste. Später beschrieb er die seltsame Begegnung so: »Im allgemeinen Empfangsraum sagte mir ein Beamter, ich solle wieder auf den Korridor gehen, Einstein würde mir dort entgegenkommen. Ich tat das auch, aber der junge Mann, der mir entgegenkam, machte mir einen so unerwarteten Eindruck, dass ich nicht glaubte, er könne der Vater der Relativitätstheorie sein. So ließ ich ihn an mir vorübergehen, und erst als er aus dem Empfangszimmer zurückkam, machten wir Bekanntschaft miteinander.« Dann gingen sie in Bern spazieren und rauchten Zigarre: »Ich erinnere mich, dass der Stumpen, den er mir anbot, so wenig schmeckte, dass ich ihn ›versehentlich‹ von der Aarebrücke in die Aare hinunterfallen ließ … Immerhin habe ich bei jenem Versuch einiges für das Verständnis der Relativitätstheorie davongetragen.«4
Erst 1908 tauschte Einstein das Patentamt gegen die Universität ein. Im Februar dieses Jahres erhielt er eine Stelle als Privatdozent an der Universität Bern, ein Jahr darauf wurde er Professor für Theoretische Physik an der Universität Zürich.
Die Spezielle Relativitätstheorie galt von Anfang an ausschließlich für gleichförmig, also mit konstanter Geschwindigkeit, bewegte Systeme. Schon 1907 fragte sich Einstein in einem Artikel im ›Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik‹, ob es denkbar sei, »dass das Prinzip der Relativität auch für Systeme gilt, welche relativ zueinander beschleunigt sind«.5 Acht Jahre lang sollte er diese Frage verfolgen. Am Ende stand eine neue Theorie der Schwerkraft, die Allgemeine Relativitätstheorie.
2: Der gekrümmte Raum vor Einstein
Geschichte der nicht-euklidischen Geometrie und ihre Auswirkungen
Auf einen Blick
Bedeutende Mathematiker versuchten vergeblich, das Parallelen-Postulat von Euklid zu beweisen.Mathematiker wie Carl Friedrich Gauß, Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski und Johann Bolyai entwickelten im 19.Jahrhundert die nicht-euklidische Geometrie gekrümmter Räume.Bernhard Riemanns Arbeit aus dem Jahre 1854 über die Mathematik in gekrümmten Räumen mit beliebig vielen Dimensionen bildete die Grundlage für die Allgemeine Relativitätstheorie.Die Astronomen Johann Carl Friedrich Zöllner (1872) und Karl Schwarzschild (1900) diskutierten ein in sich geschlossenes, sphärisches »Kugeluniversum«.Im 19.Jahrhundert entwickelten Mathematiker eine neue Art der Geometrie, mit der sich gekrümmte Räume beschreiben ließen. In diesen Räumen beträgt zum Beispiel die Winkelsumme in einem Dreieck nicht mehr 180 Grad, wie wir es nach der Geometrie Euklids in der Schule gelernt haben. Schon Jahrzehnte vor Einstein machten sich Wissenschaftler Gedanken darüber, ob das Universum gekrümmt und wie die Oberfläche einer Kugel in sich geschlossen sein könne.
In unserem Alltag spielt die Raumkrümmung keine Rolle, wir bemerken sie nicht. Für uns ist der Raum euklidisch. Ein gekrümmter Raum ist deswegen auch nur schwer vorstellbar oder, wie Hermann von Helmholtz schon 1870 sagte: »Anschauungen, die man hat, sich wegdenken ist leicht; aber Anschauungen, für die man nie ein Analogon gehabt hat, sich sinnlich vorstellen ist sehr schwer. Wenn wir deshalb zum gekrümmten Raume von drei Dimensionen übergehen, so sind wir in unserem Vorstellungsvermögen gehemmt durch den Bau unserer Organe und die damit gewonnenen Erfahrungen, welche nur zu dem Raume passen, in dem wir leben.«1
Um das Problem der Unvorstellbarkeit eines gekrümmten dreidimensionalen Raumes zu umgehen, reduziert man das Geschehen um eine Dimension: Der Raum wird zur Fläche. Gekrümmte Flächen kennen wir, denn wir stehen außerhalb von ihnen und können ihre Verbiegung unmittelbar sehen.
Vorbereitet wurde dieses neue Konzept des Raumes im 19.Jahrhundert, als Mathematiker die nicht-euklidische Geometrie entwickelten. Sie schufen damit das Handwerkszeug zur Berechnung gekrümmter Flächen und auch mehrdimensionaler Räume.
Von Euklid zu Riemann
Die Entwicklung der nicht-euklidischen Geometrie beginnt mit Euklid selbst beziehungsweise seinem etwa 300 v.Chr. entstandenen Werk ›Die Elemente‹. Hier finden wir das Parallelenpostulat in etwa dem folgenden Wortlaut: »Zu einer Geraden gibt es durch einen außerhalb der Geraden liegenden Punkt genau eine Parallele. Wobei zwei Geraden parallel sind, wenn sie in einer Ebene liegen und sich nicht schneiden.«2
Euklid zählte diese Aussage zu den nicht beweisbaren Postulaten, auf denen seine Geometrie beruht. Den Mathematikern blieb dies jedoch über 2000 Jahre hinweg ein Dorn im Auge. Immer wieder suchten sie nach einem Beweis für das Parallelenpostulat – ohne Erfolg. Im Jahre 1763 stellte der deutsche Theologe und Mathematiker Georg Simon Klügel in seiner Doktorarbeit 28 Pseudobeweise zusammen, von denen sich indes keiner als stichhaltig erwies.
Diese Versuche führten aber zu interessanten Teilergebnissen. Viele bezogen sich auf die Winkelsumme im Dreieck. Zum Beispiel: Wenn im Dreieck die Winkelsumme 180 Grad beträgt, gilt das Parallelenpostulat. Oder: Wenn in allen Dreiecken die Winkelsumme gleich ist, dann ist sie gleich 180 Grad. In Frankreich wähnte sich 1823 Adrien-Marie Legendre der Lösung des Problems schon ganz nah, als er zeigen konnte, dass die Winkelsumme im Dreieck höchstens 180 Grad beträgt. Aber auch er scheiterte am Beweis des Parallelenpostulats.
Es waren drei Mathematiker, die die Unmöglichkeit dieses Unterfangens erkannten und das Problem von einer anderen Seite angingen. Sie fragten: Kann man eine neue Geometrie so konstruieren, dass das Parallelenpostulat nicht gilt? Gibt es eine Geometrie, in der die Winkelsumme nicht genau 180 Grad beträgt?
Auf diesen Weg begab sich im letzten Jahrzehnt des 18.Jahrhunderts auch der Mathematikerfürst Carl Friedrich Gauß. Er beschäftigte sich mit der Geometrie auf gekrümmten Flächen und führte dabei das später nach ihm benannte Krümmungsmaß ein. Es kennzeichnet die Abweichung einer gebogenen Fläche in einem Punkt von einer Ebene. Gauß hatte die Möglichkeit nicht-euklidischer Geometrien erkannt, veröffentlichte seine Ergebnisse jedoch nie, weil er, nach seinen Worten, »das Geschrei der Böotier«3 scheute. Gauß bezog sich dabei auf eine aus der Antike überlieferte Beschimpfung des griechischen Volksstamms der Böotier, die als ländlich und ungebildet galten.
Gauß erlebte bei seinen »Meditationen«, wie er seine Beweisversuche selbst nannte, immer wieder Rückschläge. So schrieb er 1804 an seinen Freund, den Mathematiker Wolfgang Bolyai, der sich selbst schon vergeblich am Parallelenpostulat abgearbeitet hatte, er habe noch immer die Hoffnung, »dass jene Klippen einst, und noch vor meinem Ende, eine Durchfahrt erlauben werden«.4 Letztendlich blieb es aber zwei anderen Pionieren vorbehalten, das Fundament für eine nicht-euklidische Geometrie zu legen.
Da war zunächst Wolfgang Bolyais Sohn Johann, geboren 1802 in Klausenburg, dem heutigen Kolozsvár in Ungarn. Der Vater riet ihm aus eigener leidvoller Erfahrung dringend ab: »Du darfst die Parallelen auf jenem Wege nicht versuchen; ich kenne diesen Weg bis an sein Ende – auch ich habe diese bodenlose Nacht durchmessen, jedes Licht, jede Freude meines Lebens ist in ihr ausgelöscht worden – ich beschwöre Dich bei Gott, lass die Lehre von den Parallelen in Frieden!«5
Der Sohn war jedoch nicht nur hartnäckig, sondern auch erfolgreich. Er hatte seine Ergebnisse wohl schon Mitte der 1820er Jahre vorliegen, wartete jedoch mit deren Veröffentlichung bis zum Jahre 1831. Als der Vater seinem alten Freund Gauß ein Jahr später die Abhandlung seines Sohnes schickte, antwortet ihm Gauß: »Der ganze Inhalt der Schrift, der Weg, den Dein Sohn eingeschlagen hat, und die Resultate, zu denen er geführt hat, kommen fast durchgehends mit meinen eigenen, zum Teil schon vor 30 bis 35 Jahren angestellten Meditationen überein.«6
Doch als Johann Bolyais Arbeit endlich erschien, war ihm bereits Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski zuvorgekommen. Der 1792 in Nischni Nowgorod geborene russische Mathematiker hatte 1826 seine nicht-euklidische Geometrie herausgegeben.
Reaktionen auf Bolyais und Lobatschewskis Arbeiten blieben allerdings zunächst aus. Zum einen gab es noch keine große internationale Zeitschrift für Mathematik, in der sie ihre Ergebnisse verbreiten konnten, zum anderen waren die Arbeiten sehr schwer verständlich. Und nicht zuletzt schien es keinen Bedarf für diese abstrakte Mathematik zu geben.
Dennoch setzten sich im Laufe der Jahre die neuen Ideen bei einigen Mathematikern langsam durch. Einen vorläufigen Höhepunkt fanden sie in Bernhard Riemanns Habilitationsschrift aus dem Jahre 1854 ›Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen‹. In dieser Arbeit erweiterte Riemann die auf zwei Dimensionen, also gekrümmte Flächen, beschränkten Theorien auf beliebig viele Dimensionen. Im Hauptteil seiner Arbeit definiert Riemann für einen Raum (mathematisch gesprochen: »Mannigfaltigkeit«) mit beliebiger Krümmung eine zweckmäßige Metrik, mit der sich die Abstände zwischen Punkten in diesem Raum berechnen lassen. Damit wird es auch möglich, die kürzeste Verbindung (mathematisch: die »Geodäte«) zwischen zwei Punkten zu ermitteln. Für zwei Dimensionen entsprach die Riemann’sche Geometrie also derjenigen von Gauß, Bolyai und Lobatschewski.
In dieser neuen Geometrie bekam nun auch Euklids Parallelenpostulat eine völlig neue Form. Wir erinnern uns: In einer Ebene gibt es zu einer Geraden durch einen Punkt außerhalb dieser Geraden genau eine Parallele. In der sphärischen Geometrie einer Kugeloberfläche existieren überhaupt keine Parallelen: Auf der Erde schneiden sich alle Großkreise (Längengrade) in den Polen. Bei hyperbolischer Geometrie (ähnlich einer Satteloberfläche) dagegen existieren zu einer Geraden mindestens zwei Parallelen. Parallel bedeutet hier aber lediglich, dass sie in derselben Ebene liegen und keine gemeinsamen Punkte besitzen. Sie müssen hingegen nicht überall den gleichen Abstand aufweisen.
Winkelsummen, Kreisgrößen und Parallelen auf einer ebenen (euklidischen), einer negativ gekrümmten (hyperbolischen) und einer positiv gekrümmten (sphärischen) Oberfläche.
Wichtig an Riemanns nicht-euklidischer Geometrie war die Tatsache, dass sich Eigenschaften wie die Krümmung des Raumes intern bestimmen lassen. Der gekrümmte Raum muss also nicht in einen höherdimensionalen euklidischen Raum eingebettet sein, von dem aus man die Krümmung misst. In unserer Welt befindet sich jede irgendwie gekrümmte Fläche wie etwa die einer Kugel im dreidimensionalen Raum. Aus mathematischer Sicht bedeutet dies aber nicht, dass unser dreidimensionaler Raum sich in eine vierte Raumdimension hineinkrümmt. Es kann eine vierte Raumdimension geben (oder auch mehr), muss es aber nicht. Die Allgemeine Relativitätstheorie benötigt nur die drei bekannten Raumdimensionen und eine Zeitdimension.
Die Möglichkeit des gekrümmten Raumes
Die Geometrie war seit jeher anwendungsbezogen. So bedeutet das griechische Wort geometres sowohl Mathematiker als auch Landvermesser. Die neue nicht-euklidische Geometrie blieb jedoch unanschaulich und schien für praktische Zwecke entbehrlich zu sein. Doch irgendwann setzen sich große Ideen durch, und einige Forscher begannen nach der »Realgeltung« der nicht-euklidischen Geometrie zu fragen: Ist der uns umgebende Raum überhaupt euklidisch, wie er uns erscheint, oder könnte er nicht doch gekrümmt sein?
Nach der Veröffentlichung von Lobatschewskis und Bolyais Arbeiten hob tatsächlich das von Gauß gefürchtete Geschrei der Böotier an. Der am schwersten wiegende Grund hierfür war die Unvereinbarkeit der nicht-euklidischen Geometrie mit der Philosophie Immanuel Kants. Der Philosoph aus Königsberg hatte den euklidischen Raum als eine dem Menschen eigene Anschauungsnotwendigkeit postuliert.
Hiervon unbeeindruckt äußerte Riemann 1854, »dass die euklidische Geometrie des Raumes nur eine Hypothese sei, und man könne ihre Wahrscheinlichkeit, welche innerhalb der Grenzen der Beobachtung allerdings sehr groß ist, untersuchen und hiernach über die Zulässigkeit ihrer Ausdehnung jenseits der Grenzen der Beobachtung, sowohl nach der Seite des Unmessbargroßen, als nach der Seite des Unmessbarkleinen urteilen«.7 Bemerkenswerterweise sagt er speziell zur Geometrie des Mikrokosmos: »Nun scheinen aber die empirischen Begriffe, in welchen die räumlichen Maßbestimmungen gegründet sind, der Begriff des festen Körpers und des