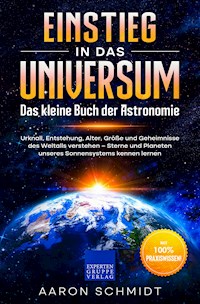
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GbR Corinna Krupp und Martin Seidel
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Einstieg in das Universum: Das kleine Buch der Astronomie Urknall, Entstehung, Alter, Größe und Geheimnisse des Weltalls verstehen – Sterne und Planeten unseres Sonnensystems kennen lernen Für unsere Begriffe – betrachtet von unserer kleinen Erde aus – wirkt das Universum unendlich. Millionen von Planeten, Sternen und Galaxien warten nur darauf, von uns erforscht zu werden. Dank der heutigen Technik ist es zumindest möglich, einen ersten Blick in diese Weiten zu werfen. Doch die Maßstäbe sind dabei derart gigantisch, dass sich schon ein Besuch einer Nachbargalaxie nur schwer realisieren lässt. Nicht nur die Weiten des Alls sind spannend und vielfältig. Auch in unserer Nachbarschaft – den Planeten unseres Sonnensystems – warten Rätsel darauf, gelöst zu werden. Und noch mehr: Selbst unser eigener Planet ist uns noch in vielerlei Hinsicht unbekannt. Starten wir also eine Reise von unserer Haustür bis zum Rand des Universums. Eines noch vorab: Die Komplexität des uns weitestgehend unbekannten Universums auf den Punkt zu bringen, ist eine Lebensaufgabe und vieles basiert auf Theorien. Spannend sind diese dennoch und einen Blick allemal wert. Über den Autor des Buches, Aaron Schmidt: Schon von Kindertagen an, war Aaron Schmidt von den Geheimnissen und den unglaublichen Dimensionen des Universums fasziniert. Das Zusammenspiel von Raum und Zeit und die schier unendlichen Möglichkeiten in der Weite des Raums haben ihn sein Leben lang begleitet. Direkt nach dem Schulabschluss 1967 begann er daher das Studium der Astrophysik und widmet sich seitdem nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich voll und ganz der Erforschung des Weltalls. So möchte er vor allem Neugierde für Welt um uns herum wecken und den Leser motivieren, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und die Wunder der Natur über unseren Planeten hinaus zu entdecken. So versucht er, seine eigene Leidenschaft an viele andere Menschen weiterzugeben, um die großen Fragen der Menschheit weiterzudenken und herauszufinden, wie viel mehr es im Universum wohl noch geben mag, außer uns kleinen Menschen. Sei gespannt auf viele Hintergründe und Erkenntnisse, die sich rund um unser Universum und die großen Geheimnisse der Menschheit drehen. Sichere Dir noch heute dieses Buch und erfahre... ... Wie das Universum aufgebaut ist und funktioniert. ... Welche Geheimnisse das Universum noch birgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Einstieg in das Universum: Das kleine Buch der Astronomie
Urknall, Entstehung, Alter, Größe und Geheimnisse des Weltalls verstehen – Sterne und Planeten unseres Sonnensystems kennen lernen
©2021, Aaron Schmidt
Expertengruppe Verlag
Die Inhalte dieses Buches wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Der Inhalt des Buches repräsentiert die persönliche Erfahrung und Meinung des Autors.
Sämtliche hier dargestellten Inhalte dienen somit ausschließlich der neutralen Information. Sie stellen keinerlei Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten Methoden dar. Dieses Buch erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität und Richtigkeit der hier dargebotenen Informationen garantiert werden. Der Autor und die Herausgeber übernehmen keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Information ergeben.
Einstieg in das Universum:Das kleine Buch der Astronomie
Urknall, Entstehung, Alter, Größe und Geheimnisse des Weltalls verstehen – Sterne und Planeten unseres Sonnensystems kennen lernen
Expertengruppe Verlag
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Vorwort
Das Universum: Unendliche Weiten?
Das Universum und das beobachtbare Universum
Die Grenzen des Universums
Der Beginn von wirklich Allem: Der Urknall.
Die Expansion des Universums
Raum, Zeit und Raumzeit
Die Begriffe Kosmos, Universum und Weltraum
Sterne, Galaxien und der Raum zwischen diesen
Der erdnahe Raum
Der interplanetare Raum und das interplanetare Medium
Der interstellare Raum und das interstellare Medium
Der intergalaktische Raum und das intergalaktische Medium
Galaxien und Sterne
Unsere Position im Universum
Das Universum verstehen: Unser Sonnensystem
Die Sonne
Der Merkur
Die Venus
Der Mars
Der Jupiter
Der Saturn
Der Uranus
Der Neptun
Die Erde
Exoplaneten und Planemos
Meteore, Kometen, Asteroiden
Schwarze Löcher
Leben im Universum
Nachwort
Buchempfehlungen
Hat Dir mein Buch gefallen?
Quellenangaben
Impressum
Über den Autor
S
chon von Kindertagen an, war Aaron Schmidt von den Geheimnissen und den unglaublichen Dimensionen des Universums fasziniert. Das Zusammenspiel von Raum und Zeit und die schier unendlichen Möglichkeiten in der Weite des Raums haben ihn sein Leben lang begleitet.
Direkt nach dem Schulabschluss 1967 begann er daher das Studium der Astrophysik und widmet sich seitdem nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich voll und ganz der Erforschung des Weltalls. Als Lehrkraft gibt er dieses Wissen nicht nur seinen Schülern und Studierenden weiter, sondern spricht im Rahmen verschiedener Publikationen auch die breite Masse der Menschen in Deutschland an.
Bei seinen Büchern liegen ihm solche Themen besonders am Herzen, die die Grundlagen der Astrophysik betreffen, die aber trotzdem nur wenigen geläufig sind. Zudem konzentriert er sich auf Themen, die auch für Laien interessant sind und bei denen neben allgemeinen wissenschaftlichen Recherchen auch viel eigenes Herzblut mit eingebracht werden kann. Jede seiner Veröffentlichungen basiert daher neben den unverzichtbaren wissenschaftlichen Grundlagen auch auf ganz persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen. So entstehen nicht nur reine sachliche Abhandlungen, sondern praktische Werke mit breitem Wissen und nützlichen Hinweisen, die leicht verstanden und nachvollzogen werden können.
Aaron Schmidt erschafft so leicht zu lesende Bücher, die dem Leser in entspannter und angenehmer Atmosphäre einen Einblick in Themenfelder geben, von denen fast jeder fasziniert ist , aber von denen die meisten nur wenig wissen.
So möchte er vor allem Neugierde für Welt um uns herum wecken und den Leser motivieren, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und die Wunder der Natur über unseren Planeten hinaus zu entdecken. So versucht er, seine eigene Leidenschaft an viele andere Menschen weiterzugeben, um die großen Fragen der Menschheit weiterzudenken und herauszufinden, wie viel mehr es im Universum wohl noch geben mag, außer uns kleinen Menschen.
Vorwort
„D
er Weltraum. Unendliche Weiten...“ so oder so ähnlich lauten die ersten Worte der Anfangssequenz einer beliebten Science-Fiction-Serie im Fernsehen. Um die nötige Spannung bei den Zuschauern aufzubauen, ist der Satz gerade richtig. Korrekt ist er hingegen nicht. Denn die Formulierung suggeriert, dass Raumfahrer mit ihrem Schiff immer weiter reisen könnten. Dabei stoßen sie wieder und wieder auf neue Sonnensysteme, Planeten, unerklärliche Phänomene und natürlich auf unzählige Gelegenheiten für spannende Abenteuer. Das mutet in etwa so an, wie ein Laufband, dass sich immer wieder erneuert. Und somit eine Reise, die kein Ende und keine Grenze hat. Doch die Wahrheit sieht ein wenig anders aus. Denn das Universum hat eine Grenze, so lautet zumindest die allgemeingültige Theorie in der Wissenschaft. Und dieses Ende des Universums verschiebt sich immer weiter. Ausgelöst durch den Urknall, ist das Universum in permanenter Expansion. Somit verschieben sich dessen Grenzen seit seiner Entstehung.
Aber: Für unsere Begriffe – betrachtet von unserer kleinen Erde aus – wirkt das Universum zumindest unendlich. Millionen von Planeten, Sternen und Galaxien warten nur darauf, von uns erforscht zu werden. Dank der heutigen Technik ist es zumindest möglich, einen ersten Blick in diese Weiten zu werfen. Doch die Maßstäbe sind dabei derart gigantisch, dass sich schon ein Besuch einer Nachbargalaxie nur schwer realisieren lässt. Nicht nur die Weiten des Alls sind spannend und vielfältig. Auch in unserer Nachbarschaft – den Planeten unseres Sonnensystems – warten Rätsel darauf, gelöst zu werden. Und noch mehr: Selbst unser eigener Planet ist uns noch in vielerlei Hinsicht unbekannt. Starten wir also eine Reise von unserer Haustür bis zum Rand des Universums.
Eines noch vorab: Die Komplexität des uns weitestgehend unbekannten Universums auf den Punkt zu bringen, ist eine Lebensaufgabe und vieles basiert auf Theorien. Spannend sind diese dennoch und einen Blick allemal wert.
- Kapitel 1 -
Das Universum: Unendliche Weiten?
D
as Universum – was ist das eigentlich? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit dem Anbeginn ihrer Tage. Schon immer blickten die Gelehrten der jeweiligen Epoche mit Neugierde und Demut in den Sternenhimmel und stellten sich die Frage, was dort oben wirklich ist. Das hat sich bis heute nicht geändert. Die Erforschung des Universums ist spannend und rätselhaft – und in gleichem Maße wunderbar geordnet und nachvollziehbar. Nur der Maßstab sprengt oft die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens. Um das Universum und die dortigen physikalischen Gegebenheiten auch für Nicht-Wissenschaftler begreifbar zu machen, unternahmen Forschungen in diversen Publikationen den Versuch, die komplexen Zusammenhänge für uns anschaulicher darzustellen. Albert Einstein war einer dieser Vorreiter und Stephen Hawking folgte ihm. Heute ist Michio Kaku ein prominenter Vertreter der Disziplin der theoretischen Physik. Folgt man den Ausführungen der genannten „Stars“ aus Physik, Kosmologie und Mathematik, ist das Universum so leicht erklärt, wie die Konstruktionspläne des Motors eines Autos. Für diejenigen, die sich nicht täglich mit Begriffen wie Raum, Zeit, Materie und dergleichen auseinandersetzen, ist die Vorstellung davon bizarr, komplex und experimentell. Die Spitze des schwer Begreiflichen stellt das „Nichts“ dar, ein Begriff, der uns noch oft begleiten wird. Selbstverständlich haben wir als Bewohner des Planeten Erde unsere „lokalen“ Definitionen dieser Begriffe. Zeit messen wir in Sekunden, Minuten, Tagen, Jahren und so weiter. Materie klingt für uns nach etwas „Körperlichem“, also etwas was wir sehen, anfassen und uns vorstellen können. Ein Raum gilt im allgemeinen Verständnis als eingrenzbarer Ort – dass ein Raum gar kein Ende, keine Grenze hat, wirkt für uns befremdlich. Dass alles ein Ende hat, liegt sogar nahe. Daher rühren auch die Geschichten der Seefahrer vergangener Zeiten, die vom „Ende der Welt“ ein ziemlich klares Bild hatten. Irgendwann ist auch die Welt vorbei, so glaubte man, und der Reisende, der auf die Suche nach dieser Grenze geht, ist gar bedroht. Schließlich läuft ein Besucher dieser Grenze Gefahr, von der damals vermuteten flachen Erde einfach herunterzufallen. Gemäß dieser Vorstellung hat ein Aufsuchen dieser Grenzregion etwas bedrohliches – eine Reise dorthin galt als lebensgefährlich.
Heute wissen wir, dass unser Planet Erde keine solche vermutete Grenze hat – diese Vermutung ist glücklicherweise seit Jahrhunderten überholt. Dies bedeutet, dass unser Planet unbegrenzt ist – aber nicht unendlich. Der Grund für diese Unbegrenztheit liegt in der geometrischen Form. Denn unsere Erde ist im weitesten Sinne eine Kugel, wobei diese Aussage nur begrenzt stimmt. Genauer genommen ist sie ein Ellipsoid, also eine Art zusammengestauchte Kugel. Diese Form ist auf die Rotation der Erde um die Sonne zurückzuführen. Generell ist der Planet Erde somit als leicht abgeplattet zu betrachten. Die genaue Form spielt jedoch in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle, wenn es um die Begriffe „unendlich“ und „unbegrenzt“ geht. Wichtig ist, dass die Erde eine Kugel ist und somit kein Ende im eigentlichen Sinne hat.
Würden wir heute ungeachtet der praktischen physikalischen Hindernisse und Gegebenheiten in eine beliebige Himmelsrichtung losmarschieren, kämen wir im theoretischen Sinne irgendwann an unserem Ausgangspunkt wieder heraus. Selbstverständlich haben wir zu diesem Gedanken die Unwägbarkeiten unseres Planeten wie Ozeane und Gebirge völlig zwangsläufig im Sinn. Im geometrischen und mathematischen Sinne ist diese Vorstellung der schieren Möglichkeit aber wichtig.
Genau so müssen wir uns das Universum vorstellen. Denn das Universum ist ebenfalls wie die Erde keineswegs eine flache Scheibe. Wie nun die absolut exakte Form des Universums aussieht, ist weiterhin Bestandteil verschiedener Spekulationen der Kosmologen. Gemäß der Urknalltheorie wird ganz automatisch die Physik einer Explosion angenommen. Das bedeutet, dass sich das Universum von einem Mittelpunkt in einer linearen Kugelform von innen nach außen ausdehnt. Es wird jedoch als sehr wahrscheinlich angesehen, dass das Universum ebenfalls wie die Erde eine ellipsoide Form besitzt. Entsprechende Daten wurden durch die Messungen der Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) gestützt, einer Raumsonde der NASA, die von 2001 bis 2010 in Betrieb war und entscheidende Fortschritte für die Kosmologie ermöglichte. Für unsere Vorstellung ist es jedoch weniger wichtig, ob das Universum eine perfekte Kugel ergibt oder nicht. Nur die Annahme, dass sie überhaupt rund ist (und kein Rechteck, kein Trapez etc.) ist wichtig für unsere Vorstellungen von Endlichkeit und Unendlichkeit, Begrenztheit und Unbegrenztheit.
Analog zur Erde müsste das Universum in der Schlussfolgerung also unbegrenzt sein. Es wäre somit – einfach ausgedrückt – für einen Raumfahrer möglich an einem Punkt des Universums zu starten und mit konsequenter Einhaltung genau an diesem wieder herauszukommen. Eine interessante Vorstellung, oder? Und dennoch reine Theorie. Was auf der Erde schon als ein schwieriges Unterfangen gilt, wird im Universum zur Unmöglichkeit. Denn das Universum dehnt sich aus – und das schon seit unfassbaren 13,8 Milliarden Jahren. Denn auf diesen Zeitpunkt verortet die Wissenschaft den Urknall und damit den Beginn von Zeit, Raum, Materie, Energie und einfach ausgedrückt allem dem, was wir uns vorstellen können. Und auch den Dingen, die wir uns bisher nicht vorstellen können.
Das Universum und das beobachtbare Universum
D
as Universum ist die Gesamtheit aller Dinge und nur innerhalb der Grenzen des Universum „befindet sich etwas“, nämlich Raum, Zeit und Materie. Während wir uns einen Einblick darüber verschaffen konnten, wie sich die Form des Universums nach außen darstellt, beobachten wir nun den Inhalt. Das Wort „beobachten“ ist nicht willkürlich gewählt. Wir können von der Erde aus einen Teil des Universums beobachten. Der ist überraschend groß. Im Laufe der Jahrhunderte nahmen durch technischen Fortschritt die Möglichkeiten zur Betrachtung des Universums stetig zu. Nehmen wir als Beispiel zunächst den Mond. Den Erdtrabanten können wir mit bloßem Auge sehen und dafür bedarf es keinerlei Hilfsmittel oder Werkzeuge. Das Auge erlaubt uns also einen kleinen Blick in das Weltall, auch wenn dieser nur sehr begrenzt ist. Aber schließlich ist auch der Mond und der Raum zwischen Mond und Erde beobachtbar und somit für uns sichtbar. Dass wir unseren Mond in einer klaren Nacht sehen können, liegt jedoch nicht am Himmelskörper selbst. Denn um Dinge beobachtbar zu machen, bedarf es Licht. In diesem Zusammenhang beschreibt das Licht jedoch nicht „Helligkeit“ oder dergleichen. Mit dem Begriff Licht beschreibt die Wissenschaft eine elektromagnetische Welle. Diese optisch wahrnehmbare Welle besteht aus Photonen, auch Lichtteilchen genannt. Um ein Objekt am Himmel also sehen zu können, muss dieses Objekt entweder Licht aussenden oder angestrahlt werden. Der Mond an sich sendet kein Licht aus – das übernimmt unsere Sonne für ihn. Somit ist der Mond für uns nur sichtbar, weil er Licht reflektiert.
Auch einige Objekte in unserem Sonnensystem werden so für uns beobachtbar, zum Beispiel die Planeten in der Nachbarschaft wie Venus und Mars. Gerade der „rote Planet“ Mars wurde im Altertum beschrieben und bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts entstanden erste Beschreibungen der Polkappen des Planeten und es wurden erste Karten vom Mars angefertigt. Somit war schon in früheren Zeiten eine relativ genaue Beschreibung des Planeten möglich, wobei das „relativ“ durchaus wörtlich zu nehmen ist.
Da auch der Mars ebenso wie der Mond selbst kein Licht aussendet, ist ein besonderer Umstand zu berücksichtigen, der für unsere Überlegungen über die Gesamtheit des beobachtbaren Universums sehr wichtig ist: Licht braucht Zeit, um von einem Ort zu einem anderen zu gelangen. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Kurz gesagt: Sie beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich Licht ausbreitet. Dass die Definition an strenge Regeln geknüpft ist, werden wir in einem anderen Kapitel näher betrachten. Gemessen wird diese Geschwindigkeit in Lichtjahren. Dies ist jedoch nicht als Zeiteinheit zu verstehen und somit nicht das, was wir mit dem Begriff „Jahr“ gleichsetzen würden. Es ist vielmehr ein Längenmaß. Das Licht ist in der Lage, in etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde zurückzulegen. Dies wurde einheitlich festgelegt. Die jüngste Festlegung fand zuletzt im Jahr 1983 bei der Generalkonferenz für Maß und Gewicht statt. Genauer betrachtet, beträgt die zurückgelegte Distanz des Lichtes 299.792,458 Kilometer pro Sekunde. Um die Rechnung zu vereinfachen, runden wir aber auf. Schon die Pioniere der Astronomie kamen bei ihren Berechnungen diesem Wert erstaunlich nahe. Im Jahre 1728 errechnete der britische Astronom James Bradley eine Geschwindigkeit von 301.000 km/s.
Diese Einheit, die Lichtsekunde, ist das richtige Maß, wenn wir von der Beobachtbarkeit des Mondes sprechen. Wie wir jetzt wissen, braucht Licht Zeit, um von Ort A nach B zu gelangen. Da das Licht die Beobachtbarkeit erst ermöglicht, sehen wir daher vom Mond nur ein Abbild, das nicht die Echtzeit darstellt. Wir sehen ein Bild des Mondes, wie er vor einiger Zeit war, nicht wie er jetzt ist. Durch die für kosmologische Maßstäbe vergleichsweise geringe Entfernung zu unserem Trabanten handelt es sich um einen sehr geringen zeitlichen Verzug. Der Mond ist von der Erde – und somit auch vom Posten unserer Beobachtung – 384.000 Kilometer entfernt. Da das Licht 300.000 Kilometer in der Sekunde zurücklegt, können wir die Entfernung errechnen. Das Licht braucht somit vom Mond bis zu unserem Auge 1,28 Lichtsekunden. Wie erwähnt ist dies keine Zeiteinheit, sondern ein Längenmaß. Hätten wir also ein Raumschiff, dass sich ohne jeglichen Widerstand und in Nichtbeachtung jeglicher physikalischen Gesetze mit dieser Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, wäre die Reise vom Mond zur Erde in 1,28 Lichtsekunden bewältigt.
Dies bedeutet, dass wir das Licht mit einer Verzögerung wahrnehmen. Da in unserem Beispiel der Mond der Erde sehr nahe ist, ist diese Verzug nur marginal und kaum wahrnehmbar. Auch, weil der Mond dauerhaft angestrahlt wird und auch dauerhaft reflektiert. Es gibt somit keinen „Puls“. Um diese Eigenschaft sichtbar zu machen, wurden bereits bei der Apollo 11-Mission im Jahr 1969 Retroreflektoren auf der Oberfläche des Mondes aufgestellt. Wird von der Bodenstation auf der Erde ein Laserpuls auf diese Reflektoren „geschossen“ wird dieser reflektiert und erreicht nach 2,6 Sekunden wieder die Messgeräte auf der Erde. Diese Zeit, die das Licht zum Durchlaufen einer Strecke benötigt, wird als Lichtlaufzeit bezeichnet. Zum Vergleich: Die Lichtlaufzeit zwischen Sonne und Erde beträgt circa acht Minuten und 20 Sekunden. Denn unser Stern ist im Mittel 149,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Der Hinweis „im Mittel“ ist wichtig, denn im Verlauf des Jahres schwankt der Abstand. Die Erde befindet sich nicht auf einer vollkommen runden Umlaufbahn um die Sonne. Sie ist elliptisch und nähert und entfernt sich. Diese Schwankungen in der Entfernung sind gut messbar und betragen rund fünf Millionen Kilometer. Die Variabilität ist auch die Basis für das beliebte Vorurteil, dass die jeweilige Entfernung der Sonne für die Jahreszeiten verantwortlich sei. Dies ist jedoch nicht der Fall. Verantwortlich ist die Neigung der Erdachse. Wenn in unseren Breiten Sommer ist, ist die Sonne gar etwas weiter entfernt als im Mittel.
Und das bedeutet – ganz lapidar ausgedrückt – dass das uns erreichende Licht der Sonne im Sommer etwas älter ist.
Um die Lichtlaufzeit etwas anschaulicher zu erklären, bedienen wir uns in einem Beispiel einer anderen Form von Verzögerung, die sicherlich jeder kennt: Dem Schall. Das, was wir in der Umgangssprache als Geräusch bezeichnen, hat nämlich ebenfalls eine „Reisegeschwindigkeit“. Die ist jedoch im Vergleich zum Licht um ein Vielfaches langsamer. Unter normalen Bedingungen ist der Schall in der Lage, 343 Meter pro Sekunde (umgerechnet also 1.236 Kilometer pro Stunde) zurückzulegen. „Normale“ Bedingungen beschreiben in diesem Beispiel die Fortbewegung der Schallwelle im Medium Luft bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius. Das ist wichtig, denn der Schall breitet sich je nach Umgebung schneller oder langsamer aus. Dies belegen Experimente: In reinem Helium breitet sich Schall rund dreimal so schnell aus wie es in dem Gasgemisch, das wir als Luft bezeichnen. Auch die Temperatur ist wichtig und sorgt für einen kleinen, aber feinen Unterschied. Bei 20 Grad Celsius beträgt die Schallgeschwindigkeit 1.236 km/h, bei minus 20 Grad Celsius nur 1.149 km/h. Für unseren Alltag spielt dies nur eine untergeordnete Rolle, zeigt aber auf, dass der Schall mit seiner Umgebung korreliert. Auch das Licht ist von der Umgebung abhängig. Im Wasser beispielsweise ist die Lichtgeschwindigkeit um 25 Prozent verlangsamt (225.000 km/s). Dies ist natürlich ein Wert, der uns bei der bloßen Betrachtung kaum auffällt. Die Laufgeschwindigkeit des Schalles hingegen können wir gut wahrnehmen. Ein beliebtes Beispiel, um dies anschaulich zu beschreiben, kommt aus der Leichtathletik. Der Start eines 1000-Meter-Rennens wird von einem Offiziellen, dem Starter, per Pistolenschuss ausgelöst. Die Läufer, die sich in unmittelbarer Nähe des Starters befinden, nehmen dieses akustische Signal sozusagen direkt wahr und laufen los. Stellt sich ein Betrachter der Szene am Ziel auf, also in einem Kilometer Entfernung auf, wird diese Person die Erfahrung machen, dass die Läufer bereits losliefen, ohne dass er oder sie den Schuss selbst gehört hat. Auch sieht der Betrachter den Starter seine Pistole abfeuern – doch auf das Geräusch muss der Betrachter noch etwa drei Sekunden warten. Denn der Schall muss erst die 1000 Meter zurücklegen und dies geschieht wie erwähnt mit einer Geschwindigkeit von 343 m/s. Dass der Betrachter den eigentlichen physischen Startvorgang der Läufer sieht, ist wiederum dem um ein Vielfaches schnellerem Licht zu verdanken.
Besonders anschaulich werden diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Falle eines Gewitters. Auch hier liegen beide Formen von Wellen vor. Der Blitz erzeugt Licht und der Donner wiederum Schall. Deshalb ist es – die Kenntnis der Schallgeschwindigkeit vorausgesetzt – auch mithilfe einer Faustformel möglich, auf einfache Art die Entfernung eines Gewitters zu bestimmen. Dazu müssen nur die Sekunden gezählt werden, die es braucht, bis auf den Blitz der Donner folgt. Werden diese verstrichenen Sekunden mit 343 multipliziert, ist ein relativ genauer Rückschluss auf die Entfernung des Gewitters möglich. Erreicht der Donner drei Sekunden nach dem Auftreten eines Blitzes unser Gehör, können wir davon ausgehen, dass der Ursprung dieses Knalls (und des Blitzes ebenfalls) in etwa 1.029 Meter entfernt liegt – perfekte Umgebungsbedingungen natürlich vorausgesetzt. Diese drei Sekunden beschreiben ein Zeitintervall, das für unser Sinnesorgan – in diesem Fall das Ohr – sehr gut wahrnehmbar ist. Zwischen dem Lichteinfall durch den Blitz und der Wahrnehmung des Knallgeräusches entsteht eine deutliche zeitliche Lücke.
Betrachten wir nun wieder unseren Mond, ist die Verzögerung durch die Lichtlaufzeit wie bereits erwähnt zu vernachlässigen. Und der Erdtrabant ist nicht der einzige Teil des beobachtbaren Universums, das wir mit unserem einfachsten „Gerät“ zur Betrachtung des Himmels – dem Auge – erkennen können. In einer klaren Nacht lassen sich – abhängig von dem Vorhandensein anderer künstlicher Lichtquellen in der Umgebung („Lichtverschmutzung“) – eine Vielzahl anderer kosmischer Objekte ausmachen. Dies können wie erwähnt die Planeten unseres Sonnensystems sein, aber auch weit entfernte Sterne und Galaxien. Je weiter dieses Objekt von unserem Punkt der Betrachtung aus entfernt ist, desto älter ist das Licht, das wir sehen. Dies ist wieder der Lichtlaufzeit zu verdanken, die durch die größere Distanz zu dem beobachteten Objekt ungleich höher wird, als es bei Mond und Sonne der Fall ist.
Einer der bekanntesten Sterne, die wir mit bloßem Auge gut sehen können, ist Sirius. Das Doppelsternsystem ist faktisch jedoch nicht der hellste Himmelskörper, den wir betrachten können. Eine höhere und sogenannte „scheinbare Helligkeit“ besitzen natürlich die Sonne und der Mond sowie einige Planeten unseres Sonnensystems. In der Rangliste der Helligkeiten folgen auf den Mond Venus, Jupiter, Mars und Merkur. Diese Aufzählung legt nahe, dass eine scheinbare Helligkeit in einer Korrelation mit der faktischen Nähe des beobachteten Objekts steht. Das ist bedingt richtig, doch Sirius strahlt heller als der in vergleichbar geringerer Entfernung liegende Saturn.
Diesem Umstand liegt die Tatsache zu Grunde, dass Sirius als Stern selber strahlt. Das ist jedoch ebenfalls nicht ganz richtig: Denn in diesem Falle sind es gar zwei Sterne. Sirius ist ein Doppelsternsystem. Das bedeutet, dass zwei Sterne umeinander kreisen, hier ist es Sirius A und Sirius B. Wenn wir von der Beobachtbarkeit sprechen, ist meist die Rede von dem Hauptstern Sirius A, der die 2,1-fache Größe unserer Sonne hat. Sein Begleiter, Sirius B, ist eher lichtschwach, in etwa so groß wie der Planet Erde und kreist in einer Umlaufbahn um den Hauptstern. Die Beobachtung des Sirius B ist nicht nur durch seine geringe Lichtabgabe besonders schwierig. Der Stern wird durch seinen Begleiter schlicht überstrahlt. Um es mit einem irdischen Vergleich zu versuchen, wäre das in etwa so, als würden wir eine Kerze direkt neben einem Flutlicht positionieren.
Durch die untergeordnete Position von Sirius B ist also meist die Rede von dem A-Stern, wenn wir den Begriff Sirius verwenden. Der Stern ist also gut mit dem bloßen Auge sichtbar und der hellste Stern am Nachthimmel. Nun soll es aber nicht darum gehen, dass wir ihn gut sehen können, sondern darum, was wir sehen. Sirius ist um ein Vielfaches weiter entfernt als der Mond, die Sonne und die anderen erdnahen Planeten, das steht außer Frage. Genauer ausgedrückt beträgt die Distanz 81,7 Billionen Kilometer. Diese Entfernung bedeutet, dass das von Sirius entsandte Licht um eine Vielfaches länger braucht, um unser Auge zu erreichen. Diese Entfernung wurde mit 8,6 Lichtjahren beziffert und beschreibt im gleichen Maß, wie „alt“ das Licht ist, das wir sehen, wenn wir auf den Stern blicken. Denn es braucht 8,6 Jahre, um von der „Erzeugung“ in unser Auge zu treffen. Das bedeutet, dass wir das optische Bild von Sirius von vor 8,6 Jahren sehen. Rein hypothetisch betrachtet: Wäre der Standort der Beobachtung genau umgekehrt und jemand würde von Sirius aus die Erde beobachten, sähe derjenige ein optisches Bild der Erde von vor 8,6 Jahren. Dieses gedankliche Experiment ist noch weiter ausführbar. Der im Allgemeinen recht bekannte und gut sichtbarer Polarstern ist beispielsweise 430 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wäre dort ein Beobachter mit einem unfassbar leistungsstarken Fernrohr positioniert und würde den Blick auf die Erde werfen, sähe er ein Abbild, das 430 Jahre alt wäre. Somit würde der Betrachter in unser 16. Jahrhundert blicken und würde möglicherweise Zeuge der Uraufführung von William Shakespeares Romeo und Julia.
Kommen wir von diesem Gedankenspiel wieder zurück zu den Fakten. Im Jahre 2007 war es den Forschern der NASA möglich, eine Supernova zu beobachten. Ein solches Ereignis, das das Ableben eines Sternes beschreibt, ist für die Wissenschaftler ein einmaliges Erlebnis. In diesem Fall wurde diese Supernova unter anderem durch optische Teleskope beobachtet. Das Ziel der Betrachtung war ein enorm massereicher, aber namenloser Stern in einer Entfernung von 250 Millionen Lichtjahren. Das bedeutet, dass diese Supernova – das Sterben des Sternes – bereits vor 250 Millionen Jahren stattgefunden hat, also zeitgleich zu einer Epoche, in der die Dinosaurier die Erde bevölkerten. Übrigens: Diese Supernova wurde nicht nur mittels optischer Teleskope beobachtet, sondern auch mithilfe der Messung von Röntgenstrahlung, die bei einer Supernova entsteht. Da sich Röntgenstrahlung in der gleichen Geschwindigkeit wie Licht fortbewegt, ist diese Messung ähnlich und ergibt – zumindest in diesem Bezug – einen gleichen Wert.
Durch die Eigenschaften der Lichtlaufgeschwindigkeit blicken wir zurück in die Zeit. Und diese Zeitspanne ändert sich, je weiter entfernt ein beobachteter Punkt ist. Bei dem Beispiel der Supernova können wir darauf schließen, dass sie bereits geschehen ist. Schließlich konnten die Wissenschaftler dieses Phänomen optisch registrieren. Nehmen wir für ein Beispiel noch einmal den Polarstern, der 430 Lichtjahre entfernt ist. Wir können ihn mit dem bloßen Auge sehr gut sehen. Das Licht, das wir sehen, wurde von dem Stern an einem festen Punkt ausgestrahlt und zwar vor ziemlich genau 430 Jahren. Doch befindet sich dieser Stern noch genau an diesem Ort, wo wir heute sein Licht sehen? Nein. Denn im Universum herrscht Bewegung. Der Ursprung dieser Bewegung ist nicht im Urknall zu finden. Zumindest nicht als allgemeingültige Lösung. Fakt ist, dass sich das Universum ausdehnt und das schon immer. Diese Vorstellung hat jedoch mit vielen falschen Details den Weg in unsere Populärkultur gefunden. So stellen sich viele Menschen die Ausdehnung des Universums wie eine sich gleichmäßig ausbreitende Druckwelle vor, in etwa so, wie wir es von der Explosion eines Feuerwerkskörpers und dessen Auswirkung auf die Umgebung kennen. Hier zu müssen wir uns zunächst vorstellen, dass der Urknall seine Umgebung überhaupt erst geschaffen hat. Dazu aber in einem späteren Kapitel mehr. Und ja, auch wenn sich das Universum ausdehnt, geschieht dies nicht gleichmäßig, sondern nur dort, wo es weder Gravitation noch Materie gibt. Denn nicht die Materie dehnt sich aus, sondern der Raum. Vergleichbar ist dies mit dem Backen eines Nusskuchens. Während des Backvorgangs (also im Laufe der Zeit) dehnt sich der Kuchen aus. Dies bezieht sich jedoch nur auf den Teig, nicht jedoch auf die Nüsse darin. Denn diese Einlage ändert nicht ihre Form, sondern nur der Raum, der sich darum befindet. Dass diese Nüsse dennoch ihre Lage verändern, ist ebenfalls der Ausdehnung des Raumes zu verdanken. Und genauso verhält es sich mit Galaxien. Sie bewegen sich mit dem Raum mit. Genauso wie eine Nuss beim Backen des Kuchens nicht größer wird, wird auch die Galaxie selbst nicht größer.





























