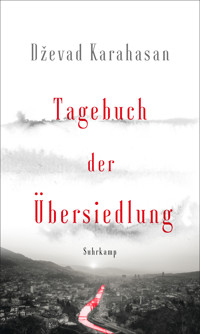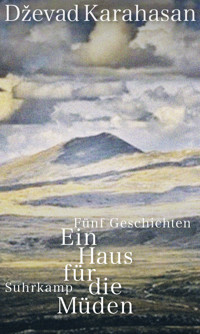21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Hurd, Altphilologe und Mythenforscher, kommt zu einer Lesung nach Sarajevo – wenige Tage vor Beginn des Krieges. Als sein Übersetzer und Bewunderer Rajko ihn am Busbahnhof wieder verabschieden will, fasst Peter spontan den Entschluss zu bleiben: die Chance, mitzuerleben, wie Menschen sich in Extremsituationen verhalten, will er sich nicht entgehen lassen. Mit Rajko teilt er den Alltag, er begleitet ihn durch die unter Granatenbeschuss liegenden Nachbarschaft, lernt Freunde und Verwandte kennen, auch Sanja, in die er sich verliebt. Eines Tages macht er sich allein auf den Weg und kehrt zurück, kaum wiederzuerkennen …
Noch nie hat Karahasan, der literarische Chronist Sarajevos, so eindringlich und facettenreich davon erzählt, was es bedeutet, in einer eingekesselten, von Rauchschwaden und Gestank durchzogenen Stadt die Tage und Nächte zu überstehen und dennoch die Hoffnung und den Humor nicht zu verlieren. Um eine unsichtbare Achse kreisend, lotet seine Geschichte eine ethische und existentielle Grenzerfahrung aus – die Einübung ins Schweben.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Titel
Dževad Karahasan
Einübung ins Schweben
Roman
Aus dem Bosnischen von Katharina Wolf-Grießhaber
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Uvod u lebdenje bei Connectum, Sarajevo, und Bulevar, Novi Sad.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfoto: mauritius images/Alamy Stock Photos/Kaja Bursa
eISBN 978-3-518-77544-8
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Widmung
Ich lass mir mein Lied nicht kaputt machen
Nur ein klein wenig
Über den Kristallzustand
Weitere Kristallzustände
In die Tiefe, in die Unterwelt
Weiter in die Tiefe
Aufzeichnungen aus der Unterwelt
Vor der Nacht der Offenbarung
Die Nacht der Offenbarung
Die Coolen bezirzen sich
Über die Scham / De pudore
Manch guter Bissen
Wieder klein zu sein
Trost und andere Miseren
Hochzeit mit sich selbst
Verteidigung und Schutz
Nur ein bisschen hinter die Vorhänge
Verschiedene Seiten des Falls
Widmung
Unamuno
Epilog
Informationen zum Buch
Widmung
Nein, dies ist keine Apologie, Peter Hurd bedarf meiner Verteidigung nicht, denn sein Werk, sein würdevolles Leben und sein Platz in der europäischen Kultur verteidigen ihn überzeugend genug. Wer hätte nach dem Tod von Robert Graves dessen Platz als Symbol und klares Zeichen der kulturellen Kontinuität vom antiken Griechenland bis heute einnehmen können, wenn nicht Peter Hurd – zugleich Dichter, Denker und Wissenschaftler?! Er erforschte die klassischen Kulturen und toten Sprachen nicht nur, er lebte sie; alle, die ihn gekannt haben, können bestätigen, dass er wie ein Hellene gelebt hat und in allem ein wahrer Hellene war. Wer außer ihm hätte »Die Hymnen der dunklen Welt« (Anthems of the Dark World) schreiben können? Ich bin sicher, dass jeder, aber auch wirklich jeder Leser dieses Buches die Ekstasen ausgekostet hat, wie sie die Eingeweihten der Mysterien von Dionysos, Demeter und Orpheus erlebt haben. Ist es überhaupt möglich, das Buch zu lesen und nicht in Ekstase zu geraten, in eine dunkle Welt voll goldenen Lichts? Muss man den Mann in Schutz nehmen, der »Die Hymnen der dunklen Welt« geschrieben hat? Wovor oder vor wem müsste man ihn in Schutz nehmen?
Gibt es in der Weltliteratur Bücher, die mit seinem Buch »Das Flüstern der Muschel« (The Shell's Whisper) zu vergleichen wären? Wer vor ihm wäre denn überhaupt auf die Idee gekommen, in einem Buch die Gedichte der alten Kulturen zu versammeln, die der heiligen Unzucht gewidmet sind? Wer außer ihm hätte all die Gedichte übersetzen können, mit der begnadeten Inspiration und dem Wissen, die ihm eigen waren?! Wer kennt all diese Kulturen und Sprachen so gut wie er, wer außer ihm hätte an die Originaltexte herankommen können? Und wer wäre fähig gewesen, das alles so zu übersetzen, als würde es heute, in diesem Moment hergesagt! Während du liest, ist dir, als hörtest du das Flüstern der kosmischen Muschel, die diese Welt geboren hat.
Ich habe sein Buch »Die weiße Wölfin« (The White She-Wolf) übersetzt, wir stellten das Buch in Sarajevo Anfang April 1992 vor (das ist noch einer von unzähligen Beweisen für mein Talent, das Richtige zur falschen Zeit zu tun). Die Arbeit an der Übersetzung des Buches hat Kenntnisse und Fähigkeiten in mir freigesetzt und aus mir herausgeholt, von denen ich nichts ahnte – als Leser, Übersetzer und Dichter habe ich in dieser Übersetzung mehr gegeben, als ich in mir habe. Kann man die Größe eines Autors deutlicher zeigen und beweisen? Nur die größten sind imstande, aus anderen alles herauszuholen und ihnen dabei zu helfen, sich selbst zu übertreffen. Die Menschen in Sarajevo waren, als wir »Die weiße Wölfin« vorstellten, bereits von der Angst und der Erwartung des Krieges befallen, aber dieses mächtige Buch riss sie mit und richtete sie auf, befreite sie von der Angst und erfüllte sie mit einer ganz anderen Spannung, so dass wir die Lesung in einer Art Verzückung beendeten, beglückt und gestärkt, als hätten wir einen Tanz von Verliebten getanzt oder an einem Ritual teilgenommen. Ich erinnere mich gut, als wäre es heute geschehen – so etwas vergisst man nicht, solche Erlebnisse spielen sich immer heute ab. Wir gingen kurz vor Mitternacht auseinander, berauscht und beglückt wie Verschwörer, die an ihre Sache glauben. Es war Donnerstag, der 2. April 1992.
Dies ist auch keine Polemik gegen die Gerüchte über Peters Zustand, die schon seit Monaten im Umlauf sind und in besseren Kreisen erzählt werden, wann immer sich an einem Ort ein paar ernsthafte Intellektuelle treffen. Es fällt mir nicht ein, die wohlmeinenden Texte zu widerlegen und zu kommentieren, deren Autoren an die zweifelsfreie Größe von Peter erinnern, dann aber auf die Aussagen von Zeugen verweisen, die entsetzliche, unmenschliche Schreie gehört haben wollen, als sie an seinem Haus vorübergingen, und jetzt dazu aufrufen, dem armen Mann um Himmels willen zu helfen. Schon gar nicht fällt mir ein, mich mit spöttischen und böswilligen Aussagen zu befassen, etwa mit dem Witz, der in besseren Gesellschaftskreisen die Runde macht und tagtäglich erzählt wird, wonach »der große erhabene Geist ausgerutscht und auf ein Niveau unter dem eines gesitteten Tiers gefallen« sei. Diesen schändlichen Witz habe ich leider auch in einer angesehenen Zeitschrift gelesen, die ihn zwar verurteilt, aber dreimal genüsslich zitiert. Wozu erklären, vor allem denen, die es nicht begreifen können, dass sich auch an der Tiefe des Falls die Höhe eines Aufstiegs ermessen lässt? Nein, zu ihnen oder über sie spreche ich nicht, sollen sie das Böse in sich mit fremdem Unglück nähren, sollen sie Trost und Freude in fremdem Schmerz finden, sollen sie ihrer Wege gehen, wie ich meinen gehe, in der Hoffnung, dass sich unsere Wege niemals kreuzen werden. Zu ihnen und über sie spreche ich nicht, ich glaube, ich könnte es nicht, selbst wenn ich wollte, und schon gar nicht würde ich für sie und um ihretwillen über Peter Hurd schreiben – ich weiß, dass die Sonne sich nicht schmutzig macht, wenn sie einen Müllhaufen bescheint, dennoch würde ich diesen leuchtenden Namen nicht vor unreine Personen zerren.
Dies ist auch keine Antwort an jene, die meine Freundschaft zu Peter kommentieren oder, wie sie sagen, »laut über unsere Beziehung nachdenken«. Der einzige Inhalt ihrer Geschichten über »unsere Beziehung« ist ihr eigenes Böses, daher kommt es mir nicht in den Sinn, über diese Geschichten zu sprechen und mich mit den Leuten, von denen sie ausgehen, zu befassen. In einer glücklicheren Zeit, als es noch mehr guten Geschmack und menschliche (Selbst-)Achtung gab, hätte ich gar nicht zu betonen brauchen, dass ich an solche Geschichten und ihre Urheber nicht denke und nicht über sie spreche, denn in glücklichen Zeiten waren solche Leute nicht in der Mehrheit, so dass anständige Menschen sich nicht über sie zu äußern brauchten, also auch nicht zu sagen brauchten, dass sie es ablehnen, sich über sie zu äußern. Aber leider lebe ich heute, in einer Welt ohne Geschmack und Größe, daher muss ich betonen und doppelt unterstreichen, dass ich nicht bereit bin, auch nur ein einziges Wort über Leute zu sagen oder zu schreiben, die ihre Fantasie mit Geschichten über Peter und mich anstacheln. Sie sind Kinder dieser Zeit, etwas Großes, Erhabenes oder Heiliges können sie nicht ertragen, sie verstehen sich ebenso wie ihre Welt nur auf den Nutzen und auf ein wenig nüchterne, allzu nüchterne Macht über andere Menschen. An einen großen Geist erinnern sie sich nur, wenn sich ihnen die Gelegenheit bietet, etwas an ihm zu verdienen, z. B. wenn es sein Geburts- oder Todesjahr zu begehen gilt. Und auch dieses unglückliche Jubiläum eines verstorbenen großen Geistes feiern sie hauptsächlich, indem sie einander versichern, der Verstorbene sei schmutzig und unordentlich, ein Polizeispitzel oder pathologischer Lügner, krankhaft geizig und blöd – mit einem Wort, in allem so, als wäre er einer von ihnen gewesen. Deshalb kann ich weder zu ihnen noch über sie sprechen, weil Welten und Jahrhunderte zwischen mir und ihnen liegen.
Nun könnte mir jemand sagen: »Du hast uns erklärt, guter Mann, für wen und warum du das nicht schreibst, aber komm schon und sag uns endlich, für wen und warum du schreibst«, und ich geriete in Verlegenheit, weil ich es ihm nicht kurz und bündig erklären könnte. Ich weiß gut, dass es getan werden muss, und weiß, wie wichtig es ist, aber ich könnte einem Unbekannten nicht erklären, warum. Durch Peters Zusammenbruch haben wir einen unermesslichen Verlust erlitten, weil wir niemanden haben, der ihn ersetzen könnte, wie er für unsere Eltern Robert Graves ersetzt hat. Heutzutage gibt es keine Menschen von solcher Größe, diese Welt erträgt eine Größe dieser Art nicht und ist nicht zu ihr fähig. Der Mensch von heute erwirbt nur brauchbares Wissen, er ist gewillt, nur das zu erkennen, was dazu angetan ist, ihm Nutzen zu bringen, ihm zu helfen, eine weitere Hierarchiestufe zu erklimmen, ihm zu ermöglichen, jemanden zu etwas zu überreden. Peter nannte solche Menschen Sklaven, er sagte, der Sklave habe auf seiner linken Schulter immer den Dämon des Nutzens sitzen, der ihm sagt, was er entscheiden und wie er vorgehen soll, weil nur ein Sklave ständig an den Nutzen denkt und nur seinem Nutzen dient. Ein freier Mensch verachtet den Nutzen nicht und lehnt ihn nicht ab, aber er dient ihm auch nicht, schon gar nicht das ganze Leben lang und mit geradezu allem, was er tut. Ein freier Mensch erwirbt sich das Wissen um seiner selbst willen und nicht um die Welt zu erringen, erkennen will er nicht, um einen Nutzen, sondern um sich selbst zu gewinnen. Aus diesem Grund erwarb er hauptsächlich unbrauchbares und völlig nutzloses Wissen, lernte alte Kulturen und Menschen kennen, studierte tote Sprachen und in diesen Sprachen geschriebene Bücher, heroische Zeiten und Welten, die zu heroischen Idealen fähig waren.
Wir haben als Gemeinschaft durch Peters Zusammenbruch einen unersetzlichen Verlust erlitten, und das Einzige, was wir jetzt tun können, ist, nach der Erkenntnis zu suchen, die uns dieser Zusammenbruch bringen könnte. Peters geliebte Hellenen liebten und kultivierten die dramatische Form der Tragödie, weil sie Erkenntnis aus ihr zogen, vielleicht die wichtigste Erkenntnis, zu der die Menschen fähig sind – die Erkenntnis von der Größe der Niederlage und der Heiligkeit des Leidens. Hundertmal hat mir Peter erklärt, dass die Aufführung einer Tragödie mit einer Erkenntnis endet, die allein die Tragödie hervorbringen kann und die das Ziel und der Zweck dieser dramatischen Form ist. Eine solche Erkenntnis können wir gewinnen, so hoffe ich, wenn es uns gelingt, den Verlust zu begreifen, der uns mit dem Zusammenbruch von Peter Hurd getroffen hat. Ich bin sicher, dass wir diesen Verlust nicht begreifen können, wenn wir Peters Aufenthalt in Sarajevo während der Belagerung der Stadt vernachlässigen. Ich denke, ich habe Peter während meines dreimonatigen Aufenthaltes in Palermo gut kennengelernt, und bin sicher, dass Ende März 1992 der Mensch nach Sarajevo kam, den ich damals, auf Sizilien, kennengelernt und liebgewonnen hatte. Und ich bin sicher, dass nach dem Verlassen von Sarajevo ein anderer Mensch nach Sizilien zurückkehrte, der mit dem, der fünf, sechs Monate zuvor nach Sarajevo gekommen war, kaum noch Ähnlichkeit hatte.
Was ist während dieser fünf, sechs Monate geschehen? Was hat Sarajevo Peter angetan? Was hat sich in ihm während seines Aufenthalts unter uns abgespielt? Hat die Angst in ihm Abgründe aufgetan, von denen selbst er nichts wusste? Hat er in Sarajevo Formen der Freiheit kennengelernt, die er nur unter jenen wahnsinnigen und in allem außergewöhnlichen Bedingungen kennenlernen konnte? Haben die Angst, die Entsagungen und neuen Formen der Freiheit einige der Säulen beseitigt, die Peters geistiges Wesen trugen, jenen brillanten Geist, den wir kannten und wenigstens ebenso sehr liebten, wie wir ihn bewunderten? Ist dieses Wesen durch den Verlust der Säulen, auf denen es stand, zusammengebrochen oder ist nur etwas Neues entstanden, sagen wir, ein neuer Mensch, vielleicht genauso wertvoll, nur völlig verändert? Aber warum, lieber Gott, ist das Neue, das durch seine Zerstörung entstanden ist, so schrecklich und dem Peter, den wir kennen und den wir immer mehr brauchen, so wenig ähnlich?!
Ich bekenne meine Ohnmacht und Unfähigkeit, das, was geschehen ist, zu begreifen (oder wäre es treffender zu sagen, ich bekenne meine Weigerung, es zu akzeptieren?), deshalb habe ich beschlossen, so ruhig und detailliert, wie ich kann, alles zu erzählen, was mir aus der Zeit, die wir zusammen in Sarajevo verbracht haben, im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht kommt durch diese Aufzeichnungen ein Gespräch in Gang, und vielleicht hilft dieses Gespräch mir oder jemand anderem zu begreifen, was mit unserem großen Lehrer passiert ist. Das könnte, wenn wir Glück hätten, die Erkenntnis sein, welche die Tragödie Peters hellenischen Brüdern gebracht hat. Eine Erkenntnis, die niemanden über einen erlittenen Verlust oder die Schrecken, die das Drama aufgezeigt hat, trösten konnte, aber diese Erkenntnis konnte jeden davon überzeugen, dass Verlust und Schrecken unvermeidlich und daher gerechtfertigt sind. Wenn wir sie gewönnen, würde uns die Erkenntnis, die ich herbeisehne, Peter nicht zurückbringen und auch den Verlust des großen Lehrers nicht ersetzen, sie würde uns auch nicht über das schreckliche Schicksal von Peter trösten, das womöglich auch manche von uns erwartet, aber sie würde uns einen Teil von uns selbst bringen oder wenigstens die Ahnung von einem Teil unserer selbst, von dem wir nichts gewusst haben.
Ich glaube fest, dass Peter Hurd, jener Peter, den wir gekannt und geliebt haben, sich freuen würde, wenn uns sein Zusammenbruch einen solchen Gewinn brächte, hat denn nicht gerade er ständig gesagt, man müsse sich selbst erlangen und gewinnen und nicht die Welt?! Aus diesem Glauben und wegen dieses Glaubens zeichne ich diese Erinnerungen für Freunde auf, mit denen ich, hoffe ich, über das, was uns getroffen hat, sprechen werde.
Ich lass mir mein Lied nicht kaputt machen
Sank ein Goldfaden vom Himmel herab.
Hei, schlang sich dem Bräutigam um den Fes,
Hei, vom Fes um den Schleier der Rosenbraut.
Eine junge Sängerin beendete ihr Lied zwei, drei Minuten nachdem eine Granate ein dreißig Schritte vom Haus geparktes Auto getroffen hatte. Das Auto ging in Flammen auf, das Feuer griff auf das Auto daneben über, und die Hochzeitsgäste gingen ins Haus, wohl aus Angst, die Autos könnten explodieren, wenn in einem der Tanks noch Benzin wäre. Draußen blieben nur Peter, ich, ein junger Bursche mit einem automatischen Gewehr über der Schulter, nach allem zu urteilen, der Freund der jungen Sängerin, und die Sängerin selbst. Sie hatte gesungen, als hätte sie die Granaten nicht bemerkt, deren Einschläge immer näher kamen, als hätte sie die immer wildere Schießerei der Infanterie nicht gehört, sie hatte gesungen wie in Trance, als hinge ihr Leben davon ab. Und es war ihr gelungen, ihr Lied war deutlich neben den Granaten, trotz der Granaten und der Schüsse zu hören, als hätte der Trotz ihre ohnehin mächtige Stimme verstärkt (ich werde nie verstehen, wie dieser zerbrechliche kleine Körper eine derart starke und mächtige Stimme hervorbringen konnte) und ihr geholfen, den Explosionen, Rufen, allen Tönen, die aus der Welt ringsum kamen, Widerstand zu leisten. Aber nun, am Ende des Lieds, war klar, wie schwer ihr diese unmenschliche Anstrengung gefallen war, weil sie sichtlich am ganzen Körper zitterte. An ihrem dunkelhäutigen Gesicht sah man zwar keine Veränderung der Farbe, aber das Zittern des Körpers und die Tränen in den Augen sah man ganz deutlich. Die großen hellen Augen waren vor Anstrengung rot geworden und hatten sich mit Tränen gefüllt, die jeden Moment über das Gesicht rollen konnten.
Als ich die Tränen in den roten Augen sah, erinnerte ich mich, woher mir das Gesicht der kleinen Sängerin bekannt vorkam. Sobald ich sie etwa zwei Stunden zuvor erblickt hatte, begann ich mich zu fragen, woher ich sie kennen könnte, wahrscheinlich hatte ich sie deshalb ein wenig mehr angestarrt, als anständig gewesen wäre, und dadurch die wütenden Blicke des jungen Burschen mit dem Gewehr hervorgerufen, aber es war mir nicht gelungen, mich zu erinnern. Erst jetzt, am Ende des Lieds, als sich die Tränen und die rote Farbe der Augen verbanden, ging mir auf, dass ich sie früher einmal im Traum gesehen und jetzt wiedererkannt hatte. Das pechschwarze Haar umrahmt das kleine Gesicht, das im Zentrum des Bildes und in seiner Tiefe steht, wenn ich so sagen kann, aber im Vordergrund dominieren die Hände, mit denen das Mädchen Zeichen gibt. Sie bewegt sie langsam, rhythmisch, diese Hände ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich und verdrängen alles andere und machen es unwichtig, und ich quäle mich wie ein Hund, versuche, ihre Zeichen zu verstehen, und frage mich dabei, woher ich sie kenne, wann, wo und warum ich sie gesehen habe. Und ich habe sie schon einmal gesehen, ich kenne sie, daran gibt es keinen Zweifel. Sie möchte mir offenbar helfen, mich zu erinnern, denn sie streckt die Arme nach mir aus, immer weiter und immer näher, und aus diesen Armen, aus den Fingern und Handflächen, aus den Unterarmen und Ellenbogen fallen Feuertropfen. Von Grauen gepackt, lenke ich den Blick von den Armen auf den Rest des Körpers, der im Hintergrund geblieben ist, und sehe, dass ihr Feuertropfen aus dem ganzen Körper und sogar aus den Augen fallen. Diese Tropfen sind grellrot, sie müssen höllisch schmerzen, schon der Blick auf sie verrät, dass sie schmerzen müssen. Feuertränen. Und sie streckt weiter die Arme aus und gibt Zeichen, die Arme dehnen sich und werden immer dünner, mich packt der Wunsch, mich mit diesen Armen zu erhängen wie mit einem wertvollen geliebten Strick, aber ich weiß, dass ich mich nicht damit erhängen werde, weil ich mich vor Verbrennungen fürchte.
Zum Glück vergaß ich diesen Traum und alles, was ich in ihm gesehen hatte, aber offensichtlich war das kleine dunkelhäutige, in dichtem schwarzem Haar verborgene Gesicht tief in mir haften geblieben. Es tauchte leibhaftig vor mir auf, als Peter und ich in das Haus im Stadtteil Dobrinja kamen, wo wir auf den Mann warten sollten, der uns zur Demarkationslinie bringen würde. Wir hatten uns am Morgen beim Handelszentrum in Otoka mit jemandem getroffen, der uns auf einem Weg, der ziemlich sicher sein dürfte, weil er ihn jeden Tag mindestens zweimal ging, nach Dobrinja brachte. Unterwegs sagte er uns, er werde uns im Haus der Delalićs abliefern, auf einer Hochzeit, und dort würden wir zur passenden Zeit abgeholt. Obwohl er unsere verwunderten Blicke bemerkt haben musste, erklärte er uns nicht, warum wir ausgerechnet auf eine Hochzeit gingen, und so schloss ich, dass es das fast unmögliche Unterfangen, jemanden in dieser Zeit aus Sarajevo hinauszubringen, auf eine nur mir nicht bekannte Art erleichtern mochte.
Als wir nach gut zwei Stunden Geschwindmarsch zu dem betreffenden Haus kamen, ging die Hochzeitszeremonie gerade zu Ende. Unter einem großen Zwetschgenbaum stand die festlich gekleidete Braut in fortgeschrittener Schwangerschaft, und auf dem Stuhl neben ihr war ein blutiges Hemd ausgebreitet. Vor der jungen Frau und dem Stuhl standen nebeneinander ein Imam und ein Mann im schwarzen Anzug, nach allem zu urteilen der Standesbeamte, der, als wir kamen, gerade verkündete, dass zwischen Alen und Jasna Delalić eine rechtmäßige Ehe geschlossen worden sei. Jasna nahm nach dieser Verkündung das blutige Hemd vom Stuhl und ging auf die zwei Männer zu, die vor ihr standen, während sich die Gäste, etwa zwanzig, um sie herum versammelten, und so näherten auch wir beide uns. Zwei Frauen weinten, drei junge Mädchen, fast noch Kinder, überschütteten Jasna mit Blumen und riefen laut Glückwünsche, und dann ging eine Frau, sie mochte in ihren Fünfzigern sein, auf Jasna zu, umarmte sie und verharrte lange in dieser Umarmung. Als sie sich trennten, waren beide verweint, woraus ich schloss, dass es sich bei der Frau um die Mutter des umgekommenen Alen handelte. »Willkommen, Tochter«, sagte Alens Mutter zu Jasna und nahm dann ein Fladenbrot aus der Hand einer jungen Frau, hielt es über Jasnas Kopf, brach es in zwei Hälften und reichte Jasna beide Hälften. Eine Hälfte steckte sie unter ihren linken Arm und die andere hielt sie in der linken Hand; mit der rechten begann sie mundgerechte Stückchen abzureißen und sie den Gästen zu reichen. Während die Frauen »Maschallah, Maschallah!« zu rufen begannen, ging Jasna von einem zum andern, riss Stückchen vom Fladenbrot ab und reichte sie den Gästen, die ganze Zeit unhörbar weinend. Dabei war ihr Gesicht ruhig und hell, als hätten die Tränen es gewaschen und vom Schmerz gereinigt.
Sie war schon in der Nähe der Haustür, kaum zehn Schritte entfernt, als sie den Gästen die letzten Stückchen des Hochzeitbrots gab. Da kam wieder Alens Mutter auf sie zu und reichte ihr einen Krug Wasser. Jasna nahm den Krug, bückte sich tief, goss ein wenig Wasser in die linke Hand und wusch damit ihr Gesicht, das bereits von den Tränen gewaschen war, dann richtete sie sich auf und ging zur Haustür. Und noch während sie sich aufrichtete, rief eine alte Frau »We enkihulejama«, und im Hof vor dem Haus der Delalićs hob das Murmeln des Gebets an, das den feierlichen Gang der Braut zur Tür ihres künftigen Hauses begleitete.
Ich weiß nicht und ich möchte es nicht erfahren, ob mich die Gefühle mitgerissen haben oder mich das Spiel des Lichts getäuscht hat, aber ich bin sicher, dass ich gesehen habe, wie Jasnas Gesicht buchstäblich aufleuchtete, als sie sich aufrichtete und aufs Haus zuging. Ich behaupte nicht, dass es wirklich geschehen ist, ich gebe zu, dass mich das seltsame Ritual, das sich vor meinen Augen abspielte, fast zu Tränen rührte, aber ich bin heute noch sicher, dass ich auf dem Gesicht der Braut einen Glanz gesehen habe und wie ihre Gesichtshaut schimmerte, als ginge das Licht durch sie hindurch. Das dauerte einen Moment, einen Augenblick oder noch weniger, aber ich habe es gesehen. Vielleicht war es ein Spiel des Lichts, vielleicht war es eine Verbindung des verspielten Lichts und meiner von den aufsteigenden Tränen vernebelten Augen, aber ich habe es, wiederhole ich, mit eigenen Augen gesehen. Als hätte jeder von uns wenige Male gesehen, was vielleicht gar nicht geschehen ist!
Auf der ersten von drei Stufen, die ins Haus führen, verneigte sie sich tief, dann richtete sie sich auf und sprach still ein Gebet, vielleicht eins, mit dem sie um Glück in diesem Haus bat. Danach wandte sie dem Haus den Rücken zu, trat von der Stufe auf den Boden, verneigte sich wieder tief und schüttete Wasser auf die Erde. Ich wusste von früher, dass sie damit alles Böse, das sich an sie binden konnte, abwusch und den Wunsch (das Gebet?) ausdrückte, dass ihr das Glück wie dieses Wasser nachlaufe, und während ich sah, wie die Erde das Wasser aufsog, begriff ich, dass sie mit diesem Abwaschen zugleich ihre Vergangenheit und ihr vergangenes Ich in dem Wasser auslöschte, damit genau in diesem Augenblick eine neue Jasna geboren werden konnte. Die neue Jasna richtete sich auf und hob die Arme zum Himmel, während Alens Mutter, ihre Schwiegermutter, Jasnas Haupt mit dem Koran berührte und ihr das Buch dann unter den rechten Arm schob, sie umarmte und zur Haustür führte. Während die beiden ins Haus gingen, erschallte die mächtige Stimme der jungen Sängerin. Sie sang »Freue dich, Hausherr« und brachte damit zwei, drei Frauen zum lauten Aufschluchzen, weil das Lied, wie ich später erfuhr, sie daran erinnerte, dass es in diesem Haus keinen Mann und keinen Hausherrn mehr gab. Alens Vater war bereits Anfang April auf ihrem Gut in Rakovica ermordet worden, wo er sich zu Beginn der Belagerung Sarajevos aufgehalten hatte, während Alen vor acht Tagen im Kampf gefallen war. Seine Hochzeit mit Jasna war schon vor seinem Tod für den heutigen Tag anberaumt worden, und so hatten Alens Mutter und Jasna sich abgesprochen, dass sie die Hochzeit halten würden und dass Jasna in ihr Haus ziehen würde, sie hofften wohl, zu zweit könnten sie wenigstens ein Flämmchen von Leben unter diesem Dach aufrechterhalten.
Jasna und ihre Schwiegermutter kehrten nach etwa einer halben Stunde in den Hof zurück, jetzt in Alltagskleidung, sie trugen Tabletts, auf denen sie aufgeschichtet hatten, was im Haus zu finden war, um die Gäste zu bewirten. Der Mann im schwarzen Anzug kam auf Peter und mich zu, stellte sich als Standesbeamter Salem vor und begrüßte uns wie alte Bekannte. Von ihm erfuhren wir, dass man uns erwartet hatte und niemand über unsere Anwesenheit auf einer Feier unbekannter Menschen irritiert war. Alens Kampfgefährte hatte unser Kommen vor ein paar Tagen angekündigt und gebeten, uns freundlich aufzunehmen, das hatte sich sein Freund und mein Schulkamerad Kopf gewünscht. Von ihm erfuhren wir auch, dass er und der Imam Fehim, den wir während der Eheschließung neben ihm gesehen hatten, überhaupt nicht darüber gesprochen hatten, ob sie kommen und Jasna mit dem verstorbenen Alen verheiraten wollten, es verstand sich von selbst. Er versicherte uns, es sei gut, dass sie die Eheschließung hier vollzogen hätten, weil dies ein außergewöhnlicher Ort und eine außergewöhnliche Eheschließung hier irgendwie normal sei – er habe das Eheregister mitgebracht, in das Buch eingetragen, dass die beiden geheiratet hätten, und keinem habe es geschadet. Aber auf dem Standesamt wäre alles anders verlaufen, ein ernsthafter Standesbeamter könne dort nicht ohne besondere Begründung ein Mädchen mit einem toten Mann verheiraten, doch was für eine Begründung könne man heute finden? Von ihm erfuhren wir auch alles andere, alles, was uns an den Schicksalen und Lebensbedingungen der Menschen um uns herum interessierte und nicht interessierte. Er erklärte uns, dass auf der Hochzeit außer ihnen dreien, die gewissermaßen dienstlich zu tun hätten, nur Frauen anwesend waren, weil die Männer dieser Frauen im Kampf oder tot seien, was ihm aber keine zu großen Sorgen bereite, weil Frauen ohnehin den wertvollen Keim des Lebens bewahrten, im Krieg ebenso wie unter den besten Bedingungen. »Wir entscheiden über Leben und Tod, doch letztlich entscheiden wir nur über den Tod, während die Frauen über nichts entscheiden, weil sie sich mit dem Leben abplagen und es vor uns retten müssen, so ist das auf der Welt.« Solange die Frauen sich um das Leben kümmern wollten und könnten, wachse dieser zarte Keim und gedeihe gut, doch wenn sie, Gott behüte, ermüdeten oder aus einem anderen Grund aufgäben, sei es aus mit dem Leben.
Gott allein weiß, was wir von diesem unwahrscheinlich gesprächigen Mann noch erfahren hätten, wenn nicht Explosionen seinen Wortfluss unterbrochen hätten. Zum Glück begann das Schießen, es rettete uns vor dem Standesbeamten Salem und erklärte mir nebenbei dessen Gesprächigkeit. Denn er verstummte nach den ersten Granaten, begann sich umzusehen, auf die Unterlippe zu beißen und sie einzuziehen, als wollte er sie verschlucken. Seinen schwarzen Anzug hatte er in dieser Hitze stundenlang getragen, ohne sich auch nur im Geringsten anmerken zu lassen, dass es ihm zu heiß oder wenigstens etwas unangenehm wäre, doch nun tauchten, obwohl wir im Schatten standen, an seinen Schläfen winzige Schweißtropfen auf. Schon lange war mir aufgefallen, dass manche Menschen, eigentlich die meisten, fast alle, die ich kannte, auf die Kriegserfahrung zuerst mit einer Änderung ihres Redeverhaltens reagierten. Ein Mensch, der sein ganzes Leben lang schweigsam wie ein Fisch war, ließ nach zehn Tagen Krieg niemanden mehr zu Wort kommen. Während ein anderer, der als unerträglicher Schwätzer bekannt war, in Schweigen versank, als hätten ihm die Unbilden des Krieges sowohl den Willen als auch die Fähigkeit zu sprechen genommen. Der eine begann lauter zu reden denn je, der andere wurde stiller und flüsterte so leise, dass du ihn kaum hören konntest, und dabei drehte er sich um und sah stur an seinem Gesprächspartner vorbei; der eine sprach in kurzen oder halb ausgesprochenen Sätzen, und der andere schaltete sich ein und redete ohne Punkt und Komma, schmückte seine Sätze wie eine Neujahrstanne und war selbst dann nicht bereit zu schweigen, wenn er einatmen oder schlucken musste. Ich kenne fast niemanden, der auf den Krieg und die Belagerung nicht zuerst mit der Veränderung seiner Sprechweise, seinem Sprechverhalten reagiert hätte. Der Standesbeamte Salem schien einer von denen zu sein, die ihre Ängste und nervlichen Anspannungen hauptsächlich aussprechen. Sie überschütten die Menschen um sich herum mit Wortkaskaden, als gössen sie Eimer mit Wasser über sie aus, mit dem sie die Qual, die sich in ihnen angesammelt hat, auszuwaschen versuchen.
Die übrigen Gäste kümmerten sich nicht um die Granaten, solange diese etwas weiter entfernt niedergingen, sondern standen in Zweier- und Dreiergruppen zusammen, unterhielten sich und tranken von Zeit zu Zeit einen kleinen Schluck Apfelsaft oder aßen Brot mit Zwetschgen- oder Erdbeermarmelade. Aber auch sie wurden unruhig und gingen langsam zum Haus. Da traf eine Granate ein kaum dreißig Schritte entfernt geparktes Auto und setzte es in Brand, und bevor alle es geschafft hatten, im Haus Zuflucht zu finden, hatte das Auto daneben Feuer gefangen. Daran, wie lebhaft sie brannten, sah man, dass in den Tanks Benzin gewesen sein musste, aber zum Glück nicht so viel, dass die Tanks explodiert wären. Es hieß, ein angezündetes Auto, das explodierte, weil sein Tank voller Benzin war, könne mehr Menschen töten als eine Granate, die an seiner Stelle explodierte, deshalb flohen die Sarajevoer schon seit dem Spätfrühling in den ersten Luftschutzkeller, sobald sie ein brennendes Auto sahen. Dann griff das Feuer auch auf einen Müllhaufen über, der unweit der in Brand geratenen Autos lag, so dass sich ein schwerer Gestank auszubreiten begann und danach schwarzer Rauch (wahrscheinlich hatten die Reifen der Autos zu brennen begonnen, und sicher war auch im Müll Gummi und Plastik gewesen, das jetzt brannte und Gestank in der Welt verbreitete). Die Hitze, die schon seit dem späten Morgen auf die Stadt drückte, erlaubte nicht, dass der Rauch und der Gestank zum Himmel stiegen, so dass sie sich ausbreiteten, dicht über dem Erdboden schwebten, als hätten sie sich wie Schnee oder eine Infektion auf Dinge und Menschen gelegt. Seit dem Morgen hatte ich keine Fliege und keinen Schmetterling, keinen Vogel und keine Katze gesehen, wahrscheinlich hatte sich alles, was beweglich und lebendig war, vor der glühenden Hitze verkrochen und verborgen, und jetzt war es, als hätte sich auch die Luft verzogen und uns dem dunklen Rauch und schweren Gestank ausgesetzt. Aber mit eigenen Augen sah ich, dass sie schwebten, wie konnten sie nur schweben, wo sie doch so höllisch schwer waren?!
Peter und ich mussten im Hof bleiben und die Angst, den Gestank und Rauch ertragen, weil wir nicht wussten, ob unser Führer bereit wäre, ins Haus zu gehen und uns dort zu suchen. Aber auch wenn er dazu bereit gewesen wäre, dachte ich, sei es besser, im Hof auf ihn zu warten, aufbruchbereit. Im Hof blieben auch die kleine Sängerin und ihr Freund, sie wahrscheinlich, weil es ihr nicht gelungen war, sich aus ihrer Trance zu befreien, und der junge Mann wahrscheinlich, weil er dachte, er müsse auf sie aufpassen.
»Das war gut«, wandte sich Peter an die Sängerin, »gut gut, wie man in Bosnien sagt.«
Sie sah ihn an und zuckte mit den Achseln, als wüsste sie nicht, was sie auf sein Lob sagen sollte, nur, dass sie etwas sagen musste.
»Ja, wirklich«, sprang ich ihnen bei. »Eigentlich ist es zu wenig zu sagen, dass es gut war. Was du getan hast, war ein wahres kleines Wunder. Unter Granatenhagel ein Lied zu Ende zu singen! Und jeder Ton war klar, jeder Übergang und jedes Wort so deutlich, als hätten wir es im Tonstudio gehört. Alle Achtung! Schon der Versuch, das zu tun, was du getan hast, war verrückt, aber du hast es zu Ende gebracht, und zwar großartig.«
»Was hätte ich denn tun können? Erlauben, dass sie mein Lied ermorden?«, antwortete das Mädchen, als rechtfertigte sie sich. »Dann wäre alles aus gewesen, Mann! Als wäre nie etwas gewesen.«
»Du hast dein Lied weiß Gott verteidigt und zwar heldenhaft«, lobte ich sie wieder, ganz aufrichtig. »Das muss man dir lassen.«
»Was bleibt mir übrig. Sie müssen mich umbringen, wenn sie mein Lied umbringen wollen.«
Die Stimme des Mädchens klang in dieser Aussage hart, so hart, dass ich mich verwundert fragte, ob wirklich diese Stimme vor kurzem all die Lieder gesungen hatte.
»Mein Lied ist erst tot, wenn ich tot bin«, erklärte mir die kleine Sängerin noch einmal, als wollte sie sicher sein, dass ich begriffen hatte.
»Nicht unbedingt«, sprang Peter ein.
»Wie dann?«, fragte sie.
»Wie bei Orpheus. Sie haben ihn zerstückelt, ihm den Kopf abgerissen und in den Fluss geworfen. Aber er, der Kopf, schwimmt den Fluss hinunter und singt, als wäre nichts geschehen. Dasselbe Lied, das er sang, als man ihn in den Fluss geworfen hat.«
»Im Ernst?«, fragte die Sängerin misstrauisch, aber aus ihrer Stimme war die Bitte herauszuhören, dass Peter seine Behauptung bestätigen möge.
»Im Ernst. Ehrenwort!«, bestätigte Peter entschieden.
»Alle Achtung! Ach, wie gern würde ich es auch so machen!«
In dem kleinen dunklen Gesicht leuchtete ein Wunsch auf, eine Hoffnung, was auch immer, und etwas in mir sagte, dass ich sie schon einmal gesehen hatte, dass ich sie sicher irgendwo einmal gesehen hatte, auch außerhalb des Traums. Sie war mir zu nah, irgendwie wichtig und lieb, das alles konnte nicht jenem hässlichen Traum entsprungen sein.
»Wie heißt du«, fragte ich sie. (Es wäre unnatürlich gewesen, wenn ich ihren Namen nicht gekannt hätte, es ist nicht in Ordnung, jemanden so gut zu kennen und den Namen nicht zu wissen.)
»Lejla«, antwortete sie.
»Warum fragst du?«, ließ sich zum ersten Mal der junge Bursche mit dem Gewehr vernehmen.
»Wir gehen fort. Es wäre wunderbar, wenn ihr für mich die letzte, die lebhafteste Erinnerung an Sarajevo wärt.«
»Komm, gehen wir ins Haus, damit sie sich keine Sorgen machen«, sagte der junge Bursche zu Lejla und führte sie ins Haus. Offensichtlich hatte ihn meine Erklärung nicht befriedigt.
So blieben Peter und ich allein im Hof zurück. Die Granateneinschläge kamen immer näher, die Schießerei der Infanterie auch, und um uns schwebten stinkende, dunkle Wolken.
»War das ein Scherz? Einer deiner Scherze?«, fragte ich Peter, kurz nachdem Lejla und der junge Mann weggegangen waren.
»Was?«
»Orpheus und das alles.«
»Ich weiß nicht«, antwortete Peter nach längerem Nachdenken. »Vielleicht war es ein Scherz, vielleicht aber auch Hoffnung.« Als ich die Kleine gesehen und gehört habe, habe ich einen Moment lang geglaubt, dass Orpheus wieder möglich wäre, man müsse ihn nur rufen. Vielleicht habe ich es geglaubt, ich wünschte, ich könnte es geglaubt haben. Wer könnte ihn in diese Welt rufen, wenn nicht dieses Mädchen und Menschen wie sie?
Die Worte berührten Peters wahrscheinlich tiefste Obsession, und so hoffte ich, es werde einer seiner improvisierten Vorträge folgen, die ich unsagbar liebte und aus denen ich mehr gelernt hatte als während meiner gesamten Schul- und Studienzeit. Schon in seiner Dissertation, die er vor seinem dreißigsten Geburtstag geschrieben hatte und die zum Glück keine Universität angenommen hatte, versuchte Peter zu beweisen, dass die Welt ein Organismus sei, weil alles, was existiert, mit allem zusammenhänge, und alles abhängig sei von allem. Da analysierte er Stellen aus verschiedenen Mythen, an denen es darum geht, wie die Götter sich über die Gebete und Opfer freuen, die ihnen die Menschen darbringen, oder darum, wie ein Gott wächst und gedeiht, während einer dieser Menschen zu ihm betet. Alles hängt mit allem zusammen, alles ist von allem abhängig, wie in jedem Organismus, wenn die Götter von den Menschen abhängen und sich über ihre Gebete freuen. Wenn also die Götterwelt von dieser Menschenwelt abhängt, ist klar, dass in dieser, der Menschenwelt, fast alles von allem abhängen muss. Ungefähr das hatte Peter versucht, in seiner Dissertation zu beweisen, einem außergewöhnlich aufregenden Buch, das im Manuskript zu lesen ich die Gelegenheit hatte, weil er es aus irgendeinem Grund nie veröffentlichte. Nun, da er sich fragte, ob er vor kurzem gescherzt oder seine verborgene Hoffnung ausgedrückt hatte, als er zu Lejla über Orpheus gesprochen hatte, wies er darauf hin, dass er glaube, Orpheus werde in der Welt erscheinen, wenn wir Menschen es verstünden, ihn herbeizurufen. Ich freute mich schon auf einen langen Vortrag von Peter, über die Entdeckungen, mit denen mich der Lehrer überschütten würde, wenn er über die Ähnlichkeiten und Abhängigkeiten spräche, die niemand bemerkte und die für mich offensichtlich wurden, wenn er auf sie hinwies. Ich erinnerte mich, dass er in einem seiner improvisierten Vorträge behauptet hatte, es existiere nur das, was wir Menschen durch unsere Gebete, Wünsche, Bedürfnisse, Handlungsweisen ins Dasein gerufen hätten, und ich machte den Mund auf, um ihn an diese Behauptung zu erinnern und meine tiefe Uneinigkeit damit auszudrücken, in der Hoffnung, meine offene Uneinigkeit werde ihn zu einem Vortrag über Orpheus, über die Wirksamkeit der menschlichen Worte und Wünsche, über alles, was uns heute fehlt, veranlassen.
Ich erreichte nicht, was ich wollte, weil von irgendwo ein fürchterlich magerer junger Mann in Jeans und einem Armeehemd auftauchte und auf uns zukam.
»Hat euch Kopf geschickt?«, fragte er, statt zu grüßen.
»Ja.«
»Los, beeilt euch, damit wir die Schlacht ausnutzen.«
Sofort machte er sich halb rennend auf, so dass Peter und ich ihn kaum einholten, weil er schon ein gutes Stück voraus war, bis wir beide unsere Rucksäcke umgehängt hatten. Ich brauchte bestimmt an die zehn Minuten, um nach dem Gerenne wieder zu Atem zu kommen. Im Bemühen, Schritt mit ihm zu halten, fragte ich ihn, wie er das denn meine, »damit wir die Schlacht ausnutzen«.
»Solange dort gekämpft wird, wird uns hier niemand kontrollieren. Wenn uns überhaupt jemand sieht«, antwortete der magere junge Mann, und dann legte er noch einen Zahn zu, als wollte er damit weitere Fragen und jedes Gespräch verhindern.
So begann an diesem 23. September unser Weggang aus Sarajevo. Haben wir damals wirklich gefühlt, haben wir geglaubt, dieser Weggang werde Rettung bringen?
Nur ein klein wenig
Unser Weggang aus Sarajevo hatte eigentlich am 8. April begonnen. Die Stadt war bereits blockiert und von allen Seiten umzingelt, aus den Randgebieten ergossen sich täglich kleinere oder größere Ströme von Menschen ins Zentrum, die vertrieben worden waren oder glaubten, sich im Zentrum besser als in ihrem Haus vor der Gewalt in Sicherheit bringen und vor dem Tod retten zu können. Die Behörden oder das, was von den Behörden übriggeblieben war, brachten diese Menschen vorübergehend in Hotels, Sporthallen und ähnlichen Einrichtungen unter, so dass man den wenigen Gästen in den Hotels mitteilte, dass sie ausziehen müssten. Um die Wahrheit zu sagen, brauchten sie es ihnen gar nicht mitzuteilen, weil jeder normale Mensch sich bemühte, die Stadt möglichst schnell zu verlassen, wenn er dort nicht alles, was ihm lieb und wichtig war, zurücklassen wollte. So entschloss sich auch Peter zum Gehen, obwohl er Ende März mit der Absicht nach Sarajevo gekommen war, mindestens einen Monat zu bleiben und seine Erinnerungen an die siebziger Jahre aufzufrischen, als er oft und gern nach Jugoslawien gekommen war. Aus Sarajevo fuhren noch immer Busse ab, mit denen die Ausländer und die Sarajevoer Bürger wegfuhren, die sich mehr vor der Belagerung und den mit ihr verbundenen Übeln fürchteten als vor dem Verlust des Hauses, der Freunde, all dessen, was sie hier gehabt und vielleicht geliebt hatten. Wir beschlossen, dass es das Beste wäre, wenn Peter mit einem dieser Busse bis Split oder Zagreb fahren und dann von dort mit dem Flugzeug heim nach Monreale fliegen würde, und so fanden wir uns am Mittwoch, dem 8. April, am frühen Morgen mit Peters Gepäck am Busbahnhof ein.
Ich wollte, ich hätte das, was sich an diesem Morgen vor meinen Augen abspielte, nicht einmal von ferne gesehen, geschweige denn erlebt. Viele Reisende, aber niemand, der sie begleitet hätte. Erwachsene, die plötzlich schwer seufzten und sich die Tränen aus den Augen wischten, die sie auch vor sich selbst verbergen wollten. Eine Frau, die aus heiterem Himmel aufschrie, ihre ziemlich kleine Reisetasche umarmte und sie wie ein liebes Kind zu wiegen begann. Menschen, die um die Busse strichen und nicht wussten, in welchen sie einsteigen sollten. Der einzige Passagier, den jemand begleitete, war Peter, weil ich ihn im Hotel abgeholt und an den Bahnhof gebracht hatte, mit der Absicht, nach seiner Abfahrt nach Hause zurückzukehren, aber auch das war nicht mehr sicher, als wir zum Bahnhof kamen, weil es Peter unterwegs fast gelungen war, mich dazu zu überreden, mit ihm zu fahren, obwohl ich nichts außer meinen Papieren bei mir hatte.
Wir blieben bei dem Bus stehen, der um halb neun nach Split abfahren sollte, und setzten unser Gespräch fort, in dem ich mich immer schwächer gegen Peters Aufforderung wehrte, mit ihm zu fahren. Es war eigentlich kein Gespräch mehr, beide wussten wir, dass die Sache entschieden war, und nun tauschten wir nur unwillig Sätze aus, um etwas zu sagen, wir standen einander wohl noch nicht nahe genug, um uns auch dann zusammen wohlzufühlen, wenn zwischen uns und in uns Schweigen geherrscht hätte.
Eine Frau bemühte sich, im Gepäckraum des Busses zwei große Koffer zu verstauen – vergeblich: Die Koffer waren zu schwer und zu sperrig. Sie bat den Fahrer, der an der Bustür stand, ihr zu helfen, und dieser stellte einen Koffer in den Gepäckraum und kehrte an seinen Platz zurück.
»Den auch«, forderte ihn die Frau auf und zeigte auf den anderen Koffer.
»Zwei gehen nicht, jeder Passagier hat das Recht auf einen Koffer«, antwortete der Fahrer.
»Und was soll ich mit dem anderen machen?«, fragte ihn die Frau verwirrt.
»Weiß ich nicht, das ist eine Anordnung«, rechtfertigte sich der Fahrer. »Wir bräuchten zwei Busse nur für die Koffer, wenn jeder so viel mitnehmen könnte, wie er will.«
»Ich darf nicht, aber Ihr Freund hier schon, was?!«, schrie die Frau wütend nach einer kürzeren Pause und stieß mit dem Fuß gegen den Koffer vor ihr. »So geht's auch nicht!«
»Was für ein Freund denn?«, fragte der Fahrer verwirrt.
»Der hinter Ihnen, der hätte den Platz nicht bekommen, wenn er nicht Ihr Freund wäre«, schäumte die Frau weiter.
Der Fahrer rief, noch immer an der Tür stehend, dem Fahrgast, der auf dem Platz hinter seinem saß, zu:
»He, Kumpel, die Frau behauptet, Sie sind mein Freund.«
»Bestimmt auch kein Feind, soll mir passieren, was ich Ihnen wünsche«, antwortete der rundliche Fahrgast, ohne zu zögern.
»Aber sind Sie wirklich mein Freund?«
»Das bin ich, Alter, was sonst! Ich wünsch dir nichts Böses, hab nichts an dir auszusetzen …«
»Wir sehen uns heute zum ersten Mal, stimmt's?«, erkundigte sich der Fahrer hartnäckig, als wäre es ihm überaus wichtig, die Behauptung der Frau zu widerlegen, er sei mit diesem Fahrgast befreundet.
»Warum hätten wir uns verdammt noch mal sonst sehen sollen?«, fragte der Fahrgast verwundert, der die Gründe für diese Befragung offensichtlich nicht verstand.
»Trotzdem hast du das Recht auf zwei Koffer und ich nur auf einen«, kreischte die Frau wütender als zuvor, wenn das möglich ist.
Der Dicke stieg aus dem Bus und stellte sich zwischen den Fahrer und die wütende Frau.
»Hast du ein Problem?«, fragte er die Frau.
»Allerdings«, schrie die Frau, »Mein Problem sind deine zwei Koffer. Ich hab mit eigenen Augen gesehen, dass du zwei große Koffer hineingestellt hast.«
»Ich hab Sachen für das Kind mitgenommen«, erklärte der Dicke. »Der Sommer kommt, kaufen kann man nichts, und sie haben nichts, weder meine Frau noch der Kleine.«
»Aber wieso ist dein Kind besser als meins?!«, schrie die Frau weiter. »Warum soll deins was haben und meins nicht?!«
»Alles ist vergeblich«, sagte ich zu Peter, der wie ich die Szene aufmerksam verfolgte. »Der Mensch ist vollkommen allein – wenn er geboren wird, wenn er stirbt und wenn er sich fürchtet.«
»Du hast gar kein Kind«, äußerte der Dicke ruhig, griff zwei Koffer aus dem Gepäckraum, setzte sie auf dem Bussteig ab und kehrte an seinen Platz zurück.
»Das ist gut!«, rief Peter begeistert und wandte sich mir zu. »Wie schnell fällt alles Überschüssige von einem ab!«
»Der zweite kann trotzdem nicht mit«, erklärte der Fahrer der zornigen Frau, breitete seine Arme aus und zündete sich eine Zigarette an.
»Ich hab große Lust hierzubleiben«, verkündete Peter. »Kann ich bei dir wohnen?«
»Welcome to hell!«, rief ich und lachte laut. Freude und Erleichterung überfluteten mich, wahrscheinlich habe ich deshalb lauter gelacht und gerufen, als es sich gehört, und viel lauter, als ich es sonst tue. Aber worüber freute ich mich so sehr? Dass ich zu Hause bleiben würde, obwohl ich mich schon damit abgefunden hatte zu gehen? Dass ich die Gelegenheit haben würde, Peter, den ich schon seit Jahren aufrichtig bewunderte, besser kennenzulernen und ihm näherzukommen? Dass sich ein weiteres Mal in meinem Leben alles ohne mein Zutun entschieden hatte?
»Dann lass uns gehen.«
Am Busbahnhof war kein einziges Taxi zu finden, daher machten wir uns zum Bahnhof auf. Peters ziemlich großer Koffer hatte zwar Räder, so dass man ihn nicht schleppen musste, sondern ziehen konnte, aber es war doch ein größeres Unterfangen, ihn zu Fuß nach Dolac Malta zu schaffen, wo wir wohnten. Aber auch am Bahnhof gab es keine Taxis, wahrscheinlich hatte man den Treibstoff, der in der Stadt vorrätig war, als die Belagerung anfing, der Polizei, dem Gesundheitswesen und der Feuerwehr gelassen, so dass die Taxis nicht mehr fuhren. Wir gingen zur Džemal-Bijedić-Straße, in der Hoffnung, es werde doch noch ein Taxi oder ein guter Mensch kommen und uns mitnehmen, wenn er sah, mit was für einem Trumm von Koffer wir uns abplagten. Es ist die Hauptverkehrsader in der Stadt, wenn man irgendwo ein Auto erwischen konnte, dann dort.
Unsere Rechnung ging auf, etwa zehn Schritte von der Kreuzung, an der die Tršćanska-Straße in die Džemal-Bijedić-Straße mündet, kreuzte ein Taxi auf, es hielt sogar an, und der Fahrer kurbelte die Fensterscheibe herunter. Ob er uns nach Dolac Malta mitnehmen würde, fragte ich ihn.
»Nein«, antwortete er, »und ich würde euch auch abraten, ich bin kaum mit dem Auto rausgekommen, wie wollen Sie das dann zu Fuß schaffen.«
»Warum?«
»Um die Brücke der Brüderlichkeit und Einigkeit herum wird gekämpft. Alles brennt.«
»Und auf einem anderen Weg?«, versuchte ich es erneut.
»Einmal und nicht wieder.«
»Kommen Sie, Mann, das ist doch Ihr Job.«
»Ich kann nicht, ich bin bestellt.«
»Wer soll Sie denn so plötzlich bestellt haben?«
»Meine Familie«, antwortete der Taxifahrer, schloss das Fenster und fuhr davon.
Solange es nicht möglich war, sich nach Dolac Malta durchzuschlagen, mussten wir uns etwas einfallen lassen, wo wir unterschlüpfen konnten. Wir kehrten im Hotel Zagreb ein. Genauer gesagt, wir wollten einkehren, aber ein junger Mann in Uniform erlaubte uns nicht, das Restaurant zu betreten. Ich erinnerte mich an eine beliebte Bierstube und Pizzeria in unmittelbarer Nähe, und dort hatten wir mehr Glück, ein Mann mittleren Alters in Jeans und Lederjacke erklärte uns, wir könnten nicht in den Keller, wo früher der Disco-Club war, jetzt sei der Stab seiner Einheit dort stationiert, wir könnten uns aber auf die Terrasse oder ins Erdgeschoss setzen, wo früher die Bierstube und Pizzeria war.
»Welcome to hell«, wiederholte ich meinen Gruß, als wir uns setzten.
Dieses Mal lachte Peter und bemerkte, beides könne wahr sein – der Willkommensgruß und besonders die Hölle.
»Willst du in deiner Hölle mein Vergil sein?«, fragte er mich nach kurzem Schweigen.
»Nein, auf keinen Fall, selbst in meinem eigenen Haus kann ich nur derjenige sein, der folgt, und du nur derjenige, der führt«, antwortete ich. Seine Frage ehrte und erschreckte mich. »Du kannst mir wahrscheinlich sogar mich selbst besser erklären als ich.«
Es krachte – zwei, drei schwere Explosionen, die direkt aufeinander folgten, was bedeutete, dass man systematisch auf ein Ziel schoss, um es zu zerstören. Wenige Minuten nach der letzten Explosion kamen eine Frau in den Dreißigern und ein kaum älterer, langhaariger Mann in das Bierlokal gerannt. Die Frau zitterte, ihre Bluse unter der kurzen Jacke war eingerissen, im Gesicht hatte sie Staub oder Ruß, am rechten Mundwinkel etwas Blut. Der Mann war ebenfalls staubig und sichtlich erschrocken, hatte sich aber ziemlich gut im Griff. Das Rote Kreuz und das Kino Sutjeska seien getroffen und in Brand gesteckt worden, teilten sie dem Mann in der Lederjacke mit, beide Gebäude »brennen jetzt lichterloh«. Gott weiß, was mit ihnen geschehen wäre, hätten sie sich dort an der Kreuzung nicht rechtzeitig auf die Erde geworfen.
Sie setzten sich an unseren Nachbartisch. Der Mann in der Lederjacke brachte ihnen eine große Karaffe mit Wasser und fragte, ob sie ein scharfes Getränk wollten. »Ihr seid nicht aus unserer Einheit, aber ihr seid Menschen«, rechtfertigte er sein Angebot.
»Das käme wirklich gut«, antwortete der langhaarige Mann, dann rief er ihm nach: »Danke!«
Er nahm ein Tuch aus seiner Tasche, befeuchtete es, stand auf, ging zu der Frau und begann ihr vorsichtig das Blut im Mundwinkel abzuwischen. Als er damit fertig war, wischte er ihr den Staub vom Gesicht, wobei er ihr mit der linken Hand zärtlich über das Gesicht strich, etwas gründlicher als notwendig war, um eventuelle Staubreste zu entfernen. Der Mann in der Lederjacke brachte zwei Gläschen Schnaps und stellte sie auf den Tisch, aber der andere war so mit dem Gesicht der Frau beschäftigt, dass er sich gar nicht bedankte. Er hörte auf zu wischen, begann das Gesicht aufmerksam anzuschauen, es beinahe ohne Abstand buchstäblich anzustarren, näherte sich dem verletzten Mundwinkel, befeuchtete seinen Zeigefinger mit Spucke und legte ihn auf die Lippen der Frau, fuhr langsam mit dem Finger über die Lippen, als liebkoste oder putzte er sie.
»Na dann zum Wohl«, sagte er, immer noch neben ihr stehend, nahm ein Gläschen und reichte es ihr, nahm das andere, stieß mit ihrem Gläschen an und trank mit einem Schluck aus. Die Frau probierte einen Schluck, seufzte tief, schüttelte den Kopf, trank mit einem zweiten Schluck den Rest aus und stellte das Gläschen auf den Tisch. Ihre Hand zitterte nicht mehr.
Der Mann fuhr nun mit den Händen über die Jacke der Frau, dann schob er seine Hände unter die Jacke und strich sanft über ihren Körper, so dass man nicht entscheiden konnte, ob er sie streichelte oder sich bemühte, den Staub von der Bluse zu entfernen.
»Was tust du da?«, fragte die Frau, als hätte sie erst jetzt bemerkt, dass er sich unentwegt mit ihrem Körper beschäftigte.
»Ich mach dich ein bisschen zurecht.«
»Lass das!«
»Was hast du denn?«
»Hände weg, sag ich.«
»Was macht das schon, wenn ich dich ein bisschen berühre?«
»Es macht was, weil ich die Frau von deinem Freund bin, du fieser Hund! Hast du das etwa vergessen?«
»Wie könnte ich. Du weißt, wie verknallt ich bin, seit ich dich das erste Mal gesehen hab. Seit sieben Jahren schweig ich wie ein Grab. Oder nicht?«
»Schämst du dich nicht, so zu reden, verdammt?«
Der Mann schob seinen Stuhl bis etwa zehn Zentimeter an den der Frau, setzte sich und drang mit seinen Augen in ihre ein, als wollte er sie hypnotisieren.
»Vielleicht schäme ich mich ja, aber was soll ich machen? Wir sind Menschen, du weißt, wie mir ist.«
»Was weiß ich? Wie soll ich von deinen Unverschämtheiten wissen, du Hornochse?!«
Der Mann begann unsicher, die Schenkel der Frau zu berühren und zu streicheln, und schließlich nahm er seinen Mut zusammen und schob seine Hände unter den Rock ihres strengen Kostüms.
»Du weißt genau, wie verrückt ich nach dir war, du hast gesehen, wie ich dich angeschaut habe, und hast zufrieden gelächelt.«
»Hörst du endlich auf, du widerlicher Kerl?!«
»Und wie soll ich nicht wahnsinnig sein? Der Blitz hat mich verbrannt, als ich dich gesehen habe. Aber er hat mich wieder aufgerichtet, so wie jetzt auch.«
»Du weißt, dass wir das nicht dürfen.«
»Wieso sollen wir nicht dürfen?! Es ist Krieg, wann, wenn nicht jetzt?«
Der Mann stand auf und reichte der Frau die Hand. Doch sie zögerte, und so ergriff er ihre Hand und zog sie, als wollte er ihr beim Aufstehen helfen. Dann legte er den rechten Arm um sie, während seine linke noch immer ihre Hand hielt, und ging mit ihr zur Treppe, die hinunterführte, in jene Räume.