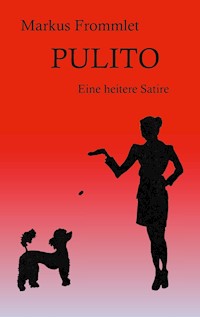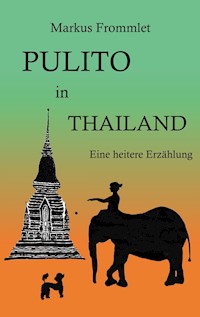Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eisige Stille des Mondes - das ist niveauvolle, spannungsgeladene Unterhaltung pur! In drei voneinander unabhängigen Erzählungen bestehen die Hauptpersonen aufregende Abenteuer in weitgehend unberührter Natur. Dabei sind die Schauplätze sind so unterschiedlich, wie die Protagonisten: Der Fotograf James Bradey gerät in Südafrika inmitten der Kalahari-Wüste in eine skurrile Lage, während der Indiojunge Anax im dichten Regenwald des Amazonas lebensgefährlichen Widrigkeiten trotzt. Die literarische Trias wird vervollständigt durch den finnischen Bandleader Toivo Harinen, dem binnen 48 Stunden im tief verschneiten Lappland auf schicksalhafte Weise drastisch die Fallstricke der existenziellen Vielfalt des Lebens vor Augen geführt werden. Wer stilvolle, fesselnde Unterhaltung mit Tiefgang und einem Schuss Skurrilität sucht, der liegt mit diesem Erzählband genau richtig!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
„Das Geheimnis des Lebens offenbart sich in den alltäglichen Dingen“ - so etwa ließe sich, ganz auf die Schnelle, die fiktive Frage nach dem philosophischen Hintergrund der schriftstellerischen Tätigkeit von Markus Frommlet beantworten.
Die Entwicklung eines subjektivistischen Realismus, zusammen mit dem Prinzip des Zen-Buddhismus „Alles ist eins, und eins ist alles!“, führte ihn zur Erkenntnis, dass es DIE Wirklichkeit nicht gibt und dass alles, was um uns ist, allumfassend ist. In jeder noch so unbedeutenden Situation liegt Weisheit, die es zu erfassen und zu begreifen gilt.
Eine derartige, empathisch geistige Befindlichkeit bildet die Grundlage für das Schreiben des Autors, mit dem er auf leicht verständliche und kreative Weise aufzeigen möchte, dass die Faszination des Lebendig-Seins im unteilbaren Moment des Augenblicks liegt, welche sich beim Umgang miteinander in den kleinsten, oft unscheinbarsten Gesten äußert.
Wachheit, differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeit, die Phänomenologie einer Situation exakt und treffend zu beschreiben, darin liegen für den Autor die großen Herausforderungen, aber auch ein wunderbarer Impetus für sein Schreiben.
In einer Vielzahl unterschiedlichster Situationen, ob skurril, komisch, oder ganz banal und alltäglich, die in den mannigfaltigen Handlungssträngen der vorliegenden Geschichte heraufbeschworen und gelegentlich bis aufs kleinste seziert werden, versucht er, erzählerische Dichte zu schaffen, die im besten Falle das Lesen zu einem Erlebnis macht.
Wer glaubt,
er habe sein Leben im Griff,
der irrt,
denn es ist
genau umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis
Eine fantastische Geschichte
Anax
Eisige Stille des Mondes
Eine fantastische Geschichte
Wer das Leben liebt,
wird niemals untergehen!
Hallo Leute, hört mal alle her …
Die Story, die ich euch jetzt erzähle, wird euch totsicher umhauen.
Ja, echt, das ist alles passiert, was ich euch gleich auftische, nix gelogen oder übertrieben. Keine Sorge, ich bleib´ bei der Wahrheit, so wahr mir Gott helfe, an dessen Vorhandensein ich allerdings nicht so recht glaube. Aber das ist ein anderes Ding.
Ich tue das alles, damit ihr euch hinter die Ohren schreibt, wie ein einziges unglaubliches Erlebnis euer ganzes Leben verändern kann, so richtig, wisst ihr, nicht nur einfach so! Die Sache hat mein Inneres berührt, mir viele Fragen über mein Dasein beantwortet und genauso viele Neue wieder aufgeworfen, mich tüchtig durchgerüttelt, mir meine Oberflächlichkeit gezeigt und mir gleichzeitig meine Würde und meinen Stolz wiedergegeben. Und mich für kommende Dinge abgehärtet und stark gemacht …
„Fang nicht schon wieder an, altklug herum zu schwafeln, James! Und erzähl den Leuten mal ordentlich, was da passiert ist!“, hätte mein Dad jetzt gesagt. Also gut, dann spanne ich euch nicht länger auf die Folter.
Wo fange ich an? Natürlich am Anfang, ganz ordentlich der Reihe nach.
Vor nicht mal ganz sechs Wochen rief mich eines Morgens mein Freund Al an. Al ist Chefredakteur bei einer der größten Zeitungen in Johannesburg. Wir haben gemeinsam bereits viele Reportagen gemacht. Ihr müsst wissen, ich bin in der Zeitungsbranche tätig, als freier Fotograf, seit über zwanzig Jahren. Ein echt cooler Job - vor allem, wenn man so erfolgreich ist, wie ich.
Jedenfalls sagte mir Al am Telefon: „Hey, Jami, was treibst Du in den nächsten Wochen, hast du noch frei? Wir benötigen für eine Naturdokureihe in unserer Wochenausgabe Landschaftsbilder von der Kalahari. Am liebsten stimmungsvolle Schnappschüsse, die die Schönheit der Gegend aufzeigen. Du kriegst ´nen flotten Jeep, alle Spesen und ein ordentliches Honorar obendrauf. Wie wär’s, Buddy?“
Wisst ihr, ich war noch ein bisschen benebelt von der Nacht vorher und hab Al nur so nebenbei zugehört. Aber als der Name Kalahari fiel, da war ich wach!
„James Brady, da sagst du nicht Nein! Den Job nimmst du mal artig an“, zischte mir die Stimme von meinem Dad ins Ohr.
Da hab ich nicht lange gefackelt und zugesagt.
Cooler Auftrag, dachte ich. In die Kalahari, nur meine Kamera und ich, und auch noch bezahlt!
Ein paar Tage später brauste ich dann mit einem nagelneuen Original 67er Jeep auf der R 360 nordwärts Richtung Botswana. In Askham hab ich übernachtet, mir noch Proviant und ´ne Flasche Whiskey besorgt, und tags darauf gings bei strahlendem Wetter und vierzig Grad hinein in die Wüste. Ich plante, so lange wie nötig alleine in dieser Einsamkeit zu verbringen. Nur die Natur und James, mit Zelt und Rucksack, das mache ich am liebsten. Nur James und die Natur. Schon mehr als zwanzig Jahre. Bevor ich´s vergesse, ich bin siebenundvierzig. Ganz gutes Alter. Klar, nicht mehr fünfundzwanzig, aber auch nicht viel schlechter.
Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist mein Erzählstil nicht gerade bühnenreif. Aber auf Bühnen stehe ich sowieso nicht so. Das ganze Kulturgetue war noch nie meins. Ich bin eine ehrliche Haut, sagen die Leute. Und was ich sage, meine ich auch. Wie ich das tue, ist mir nicht wichtig.
„Drück´ dich mal ordentlich aus!“, haben mir meine Lehrer immer gesagt. Ich hab’s versucht, mehr nicht.
Da ist das Fotografieren was ganz anderes.
Da muss man nicht die passenden Worte finden und den richtigen Satzbau. Nee, da bist du nicht am Rumüberlegen, da bist du Jäger des Augenblicks. Hat irgendwann ein Lehrer in der Berufsschule gesagt. Finde ich passend.
Und ich jage gerne. Jagen ist aufregend, aber nur mit der Kamera.
Ich hab ´ne Nikon, cooles Gerät! Robust und einfach zu bedienen.
Natürlich kann ich auch mit komplizierten Fotoapparaten umgehen, hab das gelernt, wie man so sagt.
Aber wenn du in der Natur Aufnahmen machen willst, da muss alles einfach gehen, sonst verpasst du den Augenblick.
Welchen Augenblick, fragt ihr euch?
Na, den Augenblick eben, den Moment, wo alles passiert, wo sich das Leben abspielt und nicht abgespielt wird, versteht ihr?
So sag ich das.
Aber ich schweife schon wieder aus.
„James, back to the story“, würde mein Dad jetzt sagen …
Also, dann mal weiter.
Da kam ich nun an, im Outback sozusagen, dreißig Kilometer von der nächsten Ansiedlung entfernt. Über eine Stunde war ich auf Holperpisten und durch unbewohntes Weideland unterwegs. Hier, am Ende des Weges, war das Tor zur Wildnis.
Und jedes Mal, wenn ich wieder an den Endpunkt von so ´ner Straße komme, überwältigt mich dasselbe unbeschreibliche Gefühl. Das ist dann fast, wie ich mir eine Geburt vorstelle: Du gehst in eine neue Welt hinein, siehst die unendliche Weite und die Möglichkeiten, dort einzutauchen, alles zu entdecken, zu erleben. Und das jagt dir vibrierende Schauer über deine Nackenhaare. So stehe ich dann ein paar Minuten, staune, komme an.
Ich liebe die Kalahari! Keine Menschenseele, alles ruhig.
Du hörst die Natur: Die Zweige eines Gebüschs, die sich im Wind bewegen, vielleicht einen Vogel oder das Rascheln einer Maus.
Und du hörst dich selbst, deine Schritte im Sand, das Gluckern, wenn du aus der Feldflasche trinkst.
In so ´ner Umgebung solltest du alles dabeihaben, vor allem Wasser. Es ist ganz schön heiß da draußen, außerdem gibts eine Menge wilder Tiere, auf die du achtgeben musst, Schlangen, Skorpione, Spinnen, oder auch größere Kaliber wie Löwen oder Elefanten …
Aber das kennt ihr alle aus den Fernsehdokus. Da wird dir die Natur frei Haus gebracht. Du sitzt auf der Couch und isst Chips aus ´ner Tüte, während vor deinen Augen ein paar Löwen eine Antilope verspeisen.
„Jedem das Seine!“, würde mein Dad jetzt sagen.
Wie auch immer … Ich packte also meine Ausrüstung, Rucksack, Wasserkanister, Proviant, Kamera und noch ein paar andere Sachen, und zog los. Die Gegend um mich herum kannte ich nicht besonders gut. Aber das hatte ich absichtlich so geplant. Ich mag es, in unbekannte Gebiete vorzudringen. Und für einen Fotografen ist das, glaube ich, nicht schlecht. Man bleibt wachsam und aufmerksam, wenn die Umgebung um einen herum neu ist.
Also schlenderte ich so vor mich hin, hinein in die Wüste, auf einem kleinen Pfad, der vermutlich von umherziehenden Tieren benutzt wurde. Die Buschgewächse gelangten allmählich zur Blüte. Die zu Ende gehende Regenzeit tauchte die Halbsavanne in leuchtende Farben. Es war noch früh am Tag, die Hitze war erträglich. Ein leichter Wind verschaffte Abkühlung und trug dazu bei, dass ein angenehmes Klima herrschte, um unterwegs zu sein. Ich war noch nicht weit gegangen, so ungefähr ´ne Stunde. Bis dahin hatte ich schon ein paar Aufnahmen gemacht, hauptsächlich die blühenden Büsche fotografiert, aber auch ein paar Antilopen in der Ferne abgelichtet. Da kam ich an ein Wasserloch.
Der Tümpel weckte sofort meine Aufmerksamkeit. Er maß ungefähr fünfzig Meter im Durchmesser und war rundlich geformt mit ein paar kleinen Ausbuchtungen. Das ungewöhnliche an der Pfütze war, dass sie fast senkrechte Wände aus ockerfarbenem Lehm besaß, die überall über mindestens fünf Meter steil abfielen. So etwas war mir in dieser Landschaft noch nie begegnet. Vielleicht war der Ort eine alte Schürfstelle gewesen, dachte ich, denn in früheren Zeiten wurde in dieser Gegend intensiv nach Diamanten gesucht.
Das grünbraune Wasser stand schätzungsweise drei bis vier Meter hoch. Es war brackig und stank erbärmlich. Die letzten Regenfälle lagen immerhin fast zwei Wochen zurück. Der ganze Tümpel schien völlig unberührt zu sein. Kein Wunder, dachte ich, denn die Wände fielen fast senkrecht ab und erlaubten es nicht, dort hinunterzugelangen, um zu trinken. Ich hatte Mitleid mit all den durstigen Tieren, die hier vorbeikamen und feststellten, dass es unmöglich war, an das kühle, lebenswichtige Nass heranzukommen.
Ich legte meinen Rucksack ab und beschloss, mir diesen naturbelassenen Swimmingpool ein wenig näher anzuschauen. Als Fotograf hielt ich die ungewöhnliche Location für sehr interessant, um ein paar spektakuläre Fotos zu schießen.
Ich schmunzelte, als ich mir ausmalte, wie sich die Leser der ´Johannesburg Post`, für die ich unterwegs war, später meine Bilder zu Hause auf dem Sofa genüsslich betrachteten.
Als ich den Tümpel umrundete, knirschten meine Schritte im Sand. Das Wasser hatte eine eigenartige grünlichgraue Färbung. In dem völlig ruhig daliegenden Gewässer spiegelte sich die Landschaft. Zum Licht hin hatten sich ein paar gewaltige Gewitterwolken aufgebaut. Das ist am Ende der Regenzeit in dieser Gegend völlig normal. Die Sonne versteckte sich für einen Moment hinter diesen Wolken. Dadurch veränderte sich das Licht. Es wurde unwirklich und kalt. Zusammen mit der Reflexion im Wasser ergab dies ein interessantes Bildmotiv. Spontan entschloss ich mich, ein paar Schnappschüsse von dem Szenario zu machen. Ich begab mich zur Südostseite des Tümpels und richtete meine Kamera über das Gewässer.
Das Licht und der Widerschein der Umgebung im See waren äußerst spektakulär. Um den Himmel und seinen sich im Tümpel spiegelnden Reflex eindrucksvoll ablichten zu können, war ich gezwungen, mich möglichst tief und direkt über den Boden abzuducken. Also legte ich mich auf den Bauch ins harte Savannengras, direkt an den Rand des steil abfallenden Ufers. Eine fette, gräulich violette Wolke steuerte auf die Sonnenscheibe zu, die sie schon bald erreichen würde. Genau dann kam der geeignete Moment.
Ich wartete gespannt darauf, meine Kamera im Anschlag.
Es dauerte länger als gedacht, bis das graue Ungetüm in die Nähe der Sonne gezogen war. Inzwischen war ich völlig eingenommen von der Situation und starrte fasziniert auf die Szenerie wie ein Jäger, der darauf wartet, bis sein Opfer sich im Kreuz des Zielfernrohrs befindet. Meine Beine schmerzten in der ungewohnten Liegeposition, meine Zehen kribbelten unangenehm und die Füße schliefen mir ein. Aber das war mir egal. Ich war versessen darauf, den besten Zeitpunkt für die Aufnahmen nicht zu verpassen und ein fabelhaftes Foto zu schießen.
Endlich schob sich die Gewitterwolke vor die Sonnenscheibe und dunkelte sie ab. Meine Anspannung wurde immer größer. Gleich würden die Sonnenstrahlen wie eine spektakuläre Lasershow auf mich herunterschießen. Genau in diesem Augenblick wollte ich abdrücken.
Plötzlich raschelte es hinter mir im Gebüsch ...
Und nun, Leute, haltet euch fest! Wenn ich euch jetzt erzähle, was in den nächsten zwei Sekunden geschah, wird es mich ungefähr fünf Minuten kosten.
Als ich das Geräusch hinter mir hörte, erschrak ich zu Tode!
In meinem Kopf liefen auf der Stelle mehrere Gedanken auf einmal ab:
„Was raschelt hier? Ein Lebewesen? Das Raschelgeräusch klingt dunkel, also was Größeres. Warum direkt hinter mir? Kein Zufall, das hat mit mir zu tun, totsicher! Verdammt, das Geräusch wird lauter, oder entfernt es sich? Keine Ahnung. Flucht oder Angriff? Verdammt, James, umdrehen! Das ist gefährlich!“
Der Schreck, der mich in dieser Sekunde packte, durchbohrte mich wie eine unsichtbare Faust, die sich von hinten durch meinen Rücken direkt ins Zentrum meines Körpers hineinarbeitet. Er brachte Herz und Atmung zum Erstarren.
Blitzschnell schaute ich nach hinten.
Meine Augen erfassten im Bruchteil einer Sekunde die Situation.
Etwa zwanzig Schritt vor mir wuchsen einige mannshohe Akazienbüsche, jeweils ein paar Meter breit. Der Busch zu meiner Linken wackelte, dort bewegte sich raschelnd das Steppengras.
Auf der Stelle versuchte ich, mich aufzurappeln. Doch es ging nicht. Meine eingeschlafenen Beine gehorchten mir nicht. So schnell es ging, stützte ich mich auf meine Knie, um besser erkennen zu können, was hier vor sich ging. Das Rascheln wurde immer lauter. Im Steppengras bildete sich wie von unsichtbarer Hand eine Schneise.
Und, verflixt, sie kam direkt auf mich zu.
Panik schnürte mir die Kehle zu. Doch dann machte ich das, was wohl alle Menschen in einem solchen Moment nackter Angst tun: Ich schrie aus vollem Leibe. Um mich zu schützen, streckte ich die Arme nach vorne.
Einen Augenblick später knickte die Schneise ab und entfernte sich genauso schnell wieder von mir, wie sie auf mich zugekommen war.
Die unsichtbare Faust in meinem Leib zog sich zurück. Es gelang mir, einen befreienden Atemzug zu nehmen. Erleichtert stöhnte ich auf.
Gefühllos hielt ich inne. Alles war still.
Nichts rührte sich mehr. Der Spuk war vorbei.
Es dauerte eine Unendlichkeit, bis meine Körperempfindungen wieder zu mir zurückkamen. Schmerzhaft schoss das Blut in meine Beine.
Mühsam und unendlich langsam stand ich auf und stolperte einige Schritte nach vorne. Als ich spürte, dass ich währenddessen meine Handflächen gegeneinander rieb, um sie vom Schmutz zu befreien, stutzte ich.
Wie ein Blitz durchfuhr mich ein Gedanke.
Wenn meine Handflächen in der Lage waren, sich den Sand und den Schmutz auf diese Art abzuwischen, dann waren sie leer.
Wo, um alles in der Welt, befand sich dann aber meine Kamera?
Fieberhaft suchte ich meine unmittelbare Umgebung ab.
Das mehr als kniehohe Steppengras war undurchschaubar. Forschend drehte ich mich in Richtung des Wasserlochs um und sah den Abdruck, den ich durch meine liegende Position im Gras hinterlassen hatte.
Wacklig und unsicher ging ich dorthin. Als ich über die Uferböschung spähte, erblickte ich unter mir meine Nikon. Eine Welle der Erlösung durchflutete mich. Sie war mir in meiner Panik wohl unbemerkt entglitten, über die Uferböschung gerutscht und wie durch ein Wunder kurz über dem Wasserspiegel auf einer kleinen Landzunge zum Liegen gekommen.
Vor Erleichterung gab ich einen Jubelschrei von mir. In der absoluten Einsamkeit an diesem Ort hörte sich das sehr komisch an. Ich lachte laut auf. Die Kamera lag fast fünf Meter unter mir in einer instabilen Position. Die Wasseroberfläche des Teichs war spiegelglatt. Aber ich wusste, schon ein leichter Windhauch konnte dort unten Wellen produzieren, die meinen geliebten Fotoapparat ins Wanken bringen konnten. Dann würde er womöglich auf den Grund des Wasserlochs hinabsinken und wäre für immer verloren.
Ich fürchtete, dass mir nicht viel Zeit blieb, die Kamera zu bergen.
Meine Nikon, mit der ich schon so viel erlebt hatte und die mindestens ein paar Tausend Rand wert war! Ihr Verlust wäre nicht nur emotional, sondern auch materiell bitter für mich. Ich war zwar ein erfolgreicher Fotograf, aber trotzdem nicht besonders wohlhabend. Zwischen meinen gut bezahlten Jobs brachte ich allzu oft die Honorare mit schnellen Autos oder bei kostspieligen Partys wieder unter die Leute.
Ich überlegte scharf. Dann kam mir eine erste Idee.
Wie wäre es, die Kamera mit einem langen Ast oder etwas ähnlichem zu mir hinaufzuziehen?
Alsbald verwarf ich diesen Einfall wieder, weil ich befürchtete, dass ein einziger Fehlversuch, sie über das steile Ufer nach oben zu befördern, zum erneuten Absturz und damit zum endgültigen Verlust führen konnte.
Folglich musste ich es irgendwie schaffen, selbst nach unten zu gelangen, um den Fotoapparat mit eigenen Händen zu bergen.
Die Uferböschung des Tümpels war mindestens fünf Meter hoch, annähernd senkrecht und unbewachsen. Es war absolut unmöglich, die steinhart getrocknete Böschung hinunterzuklettern. Hätte ich so etwas versucht, ich wäre unweigerlich ins Wasserloch hinuntergerutscht. Deshalb musste ich einen anderen Weg finden, meine gestrandete Kamera zu bergen, und zwar schnell.
Im Reden war ich noch nie ein Genie, aber im Nachdenken bin ich gar nicht so schlecht, wenn ich dafür einige Augenblicke zur Verfügung habe.
Als ich noch ein kleiner Junge war nannten mich im Kindergarten alle den ‚Grübler‘, weil ich beim Wettbewerb im Burgenbauen am Anfang nicht wie alle anderen in den Sandkasten stürmte und hektisch anfing, darin herum zu wühlen, sondern meinen Zeigefinger in den Mund steckte und mit leerem Blick verharrte, bevor ich mir langsam, aber bestimmt einen geeigneten Platz aussuchte. Dort baute ich dann meine Sandburg, die ich während der teilnahmslosen Minuten zuvor in meinem Kopf schon längst entworfen hatte.
So stand ich auch jetzt geraume Zeit unbeweglich am Rand des Wasserlochs, bis ich mir einen Plan zurechtgelegt und ihn zu Ende gedacht hatte.
Ich entschloss mich, mithilfe von Trittstufen hinab zu meiner Kamera zu gelangen, um sie zu bergen. Zuerst machte ich mich daran, in der Umgebung etwa handtellergroße Felsbrocken zu suchen. Das war einfach, denn die Kalahari ist „steinreich“, wie sie in Anspielung auf die Diamanten bezeichnet wird.
Nachdem ich ungefähr ein Dutzend abgeflachte Steinplatten zusammengesucht hatte, fing ich vorsichtig damit an, Trittstufen zu bauen.
Ich musste sehr aufpassen, nicht abzustürzen, da das Ufer extrem steil abfiel. Um die erste Treppenstufe in die Uferböschung hinein zu schlagen, legte ich mich zunächst an deren Rand dem Wasserloch zugewandt bäuchlings auf den Boden. Dann griff ich eine der Steinplatten und rammte sie mit energischen Hammerschlägen meiner gestreckten Arme so weit unten wie möglich ins harte Erdreich des Steilufers hinein. Sodann rappelte ich mich auf und drehte mich um. Mit dem Gesicht vom Teich abgewandt tastete ich mit meinem rechten Fuß langsam abwärts hinunter. Als ich spürte, dass ich auf der Stufe angelangt war und dort Halt fand, belastete ich sie vorsichtig. Obwohl ich die Platte ziemlich schief in die Böschung hineingerammt hatte, bewegte sie sich kaum. Beherzt belastete ich sie mit meinem ganzen Körpergewicht. Sie hielt. Die erste Stufe meiner abwärtsführenden Leiter war vorhanden. Damit war ich in der Lage, weiter hinunterzukommen. Das Setzen der nachfolgenden Trittstufen war bedeutend schwieriger. Zunächst stellte ich mein rechtes Standbein erneut auf den ersten Tritt. Dann ging ich so weit wie möglich in die Hocke, um mit der Stiefelspitze meines linken Beins etwa vierzig bis fünfzig Zentimeter weiter unten die zweite Trittstufe in das harte Erdreich zu hacken. Als dies gelungen war, richtete ich mich wieder auf, stieg nach oben und holte mir eine zweite Steinplatte. Die nahm ich in die linke Hand. Erneut positionierte ich mich mit meinem rechten Stiefel auf die erste Trittstufe, brachte nun aber mein gebeugtes linkes Bein so weit nach oben wie möglich und bugsierte die Platte mit der Hand zur Stiefelspitze hinunter. Der Moment, an dem ich die Platte mit meiner Hand unter meinen linken Fuß schob, war spannend. Ich war gezwungen, den steinernen Gegenstand geschickt direkt unter meine Schuhsohle zu platzieren, ihn mit dem Fuß gegen den steil abfallenden Untergrund zu drücken, um ihn dann vorsichtig mit meinem Stiefel nach unten in die vorbereitete Trittstufe zu schieben. Das ging viele Male schief. Die jeweilige Steinplatte rutschte ab, polterte die Böschung hinab und durchdrang mit lautem Platschen die Wasseroberfläche, um glucksend in der erdbraunen Brühe zu versinken. Nach unzähligen erfolglosen Versuchen gelang es mir schließlich, eine zweite Platte in der vorbereiteten Trittstufe zu fixieren und festzutreten. Jetzt konnte ich schon zwei Stufen nach unten klettern. In der nächsten Stunde trat und rammte ich weitere sieben improvisierte Stufen in die annähernd senkrecht abfallende Böschung hinein, bis ich mich von oben zum Uferbereich hinuntergearbeitet hatte, wo meine Kamera lag.
Obwohl ich mein T-Shirt abgelegt hatte, war ich von oben bis unten durchgeschwitzt. Meinen Durst und das aufkommende Hungergefühl beherrschte ich, denn ich wollte die Kamera so schnell wie möglich bergen. Danach konnte ich essen und trinken, soviel ich wollte.
Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel. Ich machte mir Sorgen um meine Haut, die ich nur nachlässig mit viel zu wenig Sonnencreme eingeschmiert hatte. Aber ich hatte ja nicht ahnen können, dass ich so lange von meinem Rucksack fernbleiben würde.
Ich befand mich nur noch etwa einen Meter oberhalb der Wasseroberfläche, als ich erleichtert bemerkte, dass sich die Uferböschung zum Wasser hin deutlich abflachte. Dort war es möglich, die Stiefelspitze tiefer ins Erdreich hinein zu rammen und auch ohne eine steinerne Auflageplatte genügend Halt zu finden, um die Stufe zu belasten. Also verzichtete ich auf das kraftraubende Manöver, weitere Steine in die letzten Trittstufen hinunter zu manövrieren. Beharrlich arbeitete ich mich weiter abwärts. Auch die letzte Trittstufe hackte ich ins Erdreich hinein, ohne einen Trittstein zu fixieren.
Ich freute mich wie ein Kind, als ich endlich in die Reichweite meiner Nikon kam. Wie ich vermutet hatte, lag sie äußerst instabil ganz knapp über dem Wasserspiegel. Ein winziger Stoß hätte sie ins Wasser und auf den Grund des Wasserlochs rutschen lassen. Ich musste bei der Bergung der Kamera sehr sorgfältig zu Werke gehen. Der erste Versuch musste klappen, das war klar!
Ihr haltet mich höchstwahrscheinlich für total übergeschnappt, für einfältig, leichtsinnig, oder was sonst noch. Recht habt ihr, verdammt recht, würde sich mein Dad jetzt freuen. Aber eins sage ich euch. Dumm bin ich nicht. Denn schon seitdem ich mit der Erzählung meiner Geschichte begonnen habe, habe ich bemerkt, dass ihr euch fragt, wie es dazu kommt, dass ausgerechnet ich, James Bradey, an diesem gottverlassenen Ort in diesem stinkenden Wasserloch nach meiner Kamera fischte. Nun, dann lasst es euch gesagt sein, das ist eine komplett andere Story. Sie beginnt damit, wie ich zu dem kam, was mich Zeit meines Lebens fasziniert hat …
Meine Liebe zur Fotografie habe ich unfreiwillig meinen Eltern zu verdanken. Als drittes von vier Kindern wuchs ich in einer kanadischen Kleinstadt in der Nähe von Winnipeg auf. Mein Vater war bei der Eisenbahn als Gleisleger beschäftigt, meine Mutter kümmerte sich um uns Kinder und arbeitete als Schneiderin zu Hause. Meine Eltern waren fromme Presbyterianer. Kein Wunder also, dass unsere Erziehung streng und lieblos verlief. Tadel und Strafe waren an der Tagesordnung. Unter uns Geschwistern entwickelte sich ein verbissener Fight um das Wohlwollen und die Anerkennung meiner Eltern.
Ich machte schlechte Erfahrungen mit dem Reden. Deshalb schwieg ich lieber, was meine Eltern zur Weißglut brachte und mir eine gehörige Anzahl Prügel bescherte. Ich lernte, die Welt mit meinen eigenen Augen zu sehen und baute mir fantasievolle Gegenwelten auf, um mein unglückliches Dasein erträglich zu machen.
Über Onkel Richie, den Bruder meiner Mutter, der in der Nähe des Bahnhofs arbeitete, kam ich zur Fotografie. Er hatte dort ein kleines Atelier, in dem er vorwiegend Passbilder und Porträts für seine Kunden anfertigte. Immer wieder bekam er Aufträge von der hiesigen Polizei und machte erkennungsdienstliche Fotos von Verbrechern im Gefängnis. Deswegen nannten ihn alle den „Knastknipser“.
Eines Tages, ich war ungefähr zwölf Jahre alt, nahm mich Onkel Richie mit in sein Atelier. Ich spürte sofort, dass mich die Fotografie faszinierte. In Onkel Richies kleiner Welt konnte ich der unbarmherzigen Umgebung meines Elternhauses entfliehen und mir im Betrachten der Bilderwelten einen neuen, ganz eigenen Blick aufs Leben verschaffen.
Doch gerade eben, am Ufer des Wasserlochs, waren mir die diversen Aspekte meiner Existenz einerlei, denn ich spähte wie gebannt auf meine Kamera. Da lag sie beinahe vor mir, meine Nikon, und war schon zum Greifen nahe! Um sie mit den Händen sicher fassen zu können, war ich jedoch gezwungen, mit beiden Beinen in die brackige Brühe hinunterzusteigen.
Ganz behutsam setzte ich den linken Stiefel hinein. Das Wasser war erstaunlich warm und fühlte sich angenehm weich an, als es durch den festen Lederstiefel und die dicke Wollsocke an meinen Fuß drang. Der schlammige Untergrund setzte sich unter der Wasseroberfläche fort, was mich nicht im Geringsten erstaunte. Dort, wo ich mich gerade hingestellt hatte, drang ein dicker Schwall modrig riechenden, dunkelgrünen Schlamms an die Oberfläche.
„Macht nichts, ist nur Dreck“, sagte ich mir trotzig und setzte auch den rechten Stiefel hinunter, um endlich zu meiner Kamera zu gelangen.
Doch kaum stand ich mit beiden Beinen im steil abfallenden Untergrund des Tümpels, als es passierte!
Unvermittelt rutschte ich mit meinem linken Schuh ab und sauste mit voller Wucht in die dreckige Suppe. Das Gewicht meines Körpers drückte mich unter Wasser. Ich schmeckte das faulige Aroma der brackigen Pampe, bevor ich wieder zurück an die Oberfläche kam.
Das Ufer unter mir war tief und grundlos. Ich musste schwimmen, um nicht unterzugehen.
„Verflixt und zugenäht!“, schrie ich prustend und schlug wutentbrannt mit beiden Händen auf die Wasseroberfläche.
Jetzt war ich von Kopf bis Fuß durchnässt, würde wahrscheinlich bald fürchterlich stinken und hatte sogar noch ein oder zwei Schluck von dieser ungesunden Soße verschluckt.
Was war ich für ein Idiot!
Meine unfreiwillige Landung im Tümpel hatte ein paar größere Verdrängungswellen produziert. Als die kaum eine Sekunde später ans Ufer schwappten, zerrten sie tüchtig an meiner Kamera. Das gute Stück rutschte ab und war gerade dabei, endgültig und unwiederbringlich in der Tiefe des Teichs zu versinken. Instinktiv griff ich energisch danach. Dann nahm den Fotoapparat an mich und versuchte, ihn mit ausgestreckt emporgereckten Armen in der Luft zu halten. Das funktionierte zunächst leidlich, war aber äußerst anstrengend, da ich mit den Beinen kräftig strampeln musste, um mich selbst über Wasser zu halten. Mir war sofort klar, dass ich dies nicht lange durchhalten würde.
„James, du musst hier raus“, dachte ich verzweifelt.
Alsbald stellte ich jedoch mit Schrecken fest, dass der Uferbereich so glitschig und verschlammt war, dass ich mit meinen Stiefeln keinerlei Stand hatte. Langsam wurde das Paddeln mit den Beinen und das gleichzeitige Halten der Kamera über meinem Kopf unerträglich. Zudem sogen sich meine Kleidung und die schweren Lederstiefel voll Wasser und drohten, mich und meine Kamera endgültig hinunter zu ziehen. Ich musste die Nikon auf schnellstem Weg loswerden. Hastig versuchte ich, sie in die unterste Trittstufe hineinzudrücken. Aber das war unmöglich, denn der Absatz war viel zu hoch, fast außerhalb der Reichweite meiner Arme, und sehr glitschig.
Ich atmete schwer.
Allzu lange würde ich in meiner Lage hier nicht mehr durchhalten.
Ich überlegte.
Vielleicht konnte ich zu einem anderen Teil des Tümpels schwimmen.
Doch ich erinnerte mich, dass die übrigen Uferregionen mindestens genauso steil und unzugänglich gewesen waren wie die Stelle, an der ich mich gerade befand. Schnell verwarf ich diesen Gedanken wieder.
Meine Beine fühlten sich schwer und schwerer an. Die verflixten Stiefel zogen mich bleiern nach unten. Ich schluckte mehr von dem jauchigen Wasser, als mir lieb war. Mir wurde klar, ich musste unverzüglich etwas unternehmen, sonst würde ich hier jämmerlich ertrinken.
Erneut hämmerte der Gedanke in meinem Kopf, dass ich schnellstens die Kamera loswerden musste.
Meine Kräfte verließen mich und meine Beinmuskeln schmerzten höllisch, denn sie waren vom hektischen Strampeln völlig übersäuert.
Verzweifelt nahm ich einen tiefen Atemzug, bevor ich mich nach hinten überstreckte. Mit dem Arm, mit dem ich die Kamera hielt, holte ich weit aus, und warf den Fotoapparat mit voller Kraft schräg nach oben. In hohem Bogen flog die Nikon durch die Luft und verschwand hinter der Uferböschung. Von dort hörte ich einen dumpfen Aufprall. Geschafft! Meine Kamera war vorläufig gerettet.
Jetzt konnte ich endlich wieder ungehindert mit beiden Armen rudern, um an der Wasseroberfläche zu bleiben. Doch das Gewicht der vollgesogenen Stiefel war fürchterlich. Es zog mich unerbittlich nach unten. Obwohl ich beide Arme frei hatte, war mir klar, dass ich es so nicht mehr lange aushalten würde. Angestachelt durch den erfolgreichen Wurf meiner Kamera, beschloss ich, mit meinem Schuhwerk ebenso zu verfahren, denn ich konnte es hier im tiefen Wasser dieses Dreckstümpels wahrlich nicht gebrauchen. Unter beträchtlicher Anstrengung und einigen weiteren unfreiwilligen Schluck fauliger Brühe gelang es mir, meinen linken Stiefel auszuziehen. Sobald ich ihn über die Wasseroberfläche gebracht hatte, leerte ich ihn aus und schleuderte ihn genauso wie zuvor meine Kamera in hohem Bogen von mir. Das Abstreifen des zweiten Stiefels war um vieles einfacher. Erleichtert warf ich ihn ebenfalls über die nahezu senkrechte Mauer der Uferböschung.
Die Barriere, die ich während meiner frühen Kindheit um mein Inneres aufgebaut hatte, um mich und meine Gefühle vor meinen Eltern zu schützen, war für mich in der darauffolgenden Lebensphase unüberwindlich. In der Schule galt ich als ein ziemlicher Versager. Ähnlich wie meine Geschwister in der Familie betrachtete ich meine Klassenkameraden als Feinde und Konkurrenten. Meine Mitschüler hassten mich. Ich hasste sie dafür umso mehr! Was die Lehrer zu mir sagten, war mir egal. Wenigstens prügelten sie mich nicht, wie es mein betrunkener Dad tat, wenn ich wieder einmal „schwieg, wie ein verdammtes Grab“. Das pflegte mein lausiger Vater immer zu sagen, bevor er mich schlug …
So war es nicht verwunderlich, dass ich schon nach der achten Klasse aus der Schule genommen wurde. Onkel Richie bot mir an, bei ihm in die Lehre als Fotograf zu gehen. Meine Eltern hatten nichts dagegen. Sie meinten, dann würde „wenigstens irgendetwas“ aus mir werden.
Bei Onkel Richie verbrachte ich mehrere glückliche Jahre. Ich war wissbegierig und er brachte mir viel bei. Zu meinem vierzehnten Geburtstag schenkte er mir eine von seinen ausrangierten Kameras, eine Minolta. Ich war überglücklich, denn nun konnte ich selbst fotografieren. In Ermangelung menschlicher Modelle porträtierte ich begeistert die zwei jungen Kätzlein unserer Nachbarin. Das hat mich nachhaltig geprägt …
Bescherte mir das Glück damals den Zugang zur Fotografie, so schien der Erfolg auch hier und jetzt in diesem namenlosen Wasserloch inmitten der Kalahari auf meiner Seite zu sein, denn ich hatte gerade meine Nikon gerettet und die schweren Stiefel, die mich unter Wasser gezogen hatten, war ich endgültig los. Und obwohl ich müde und erschöpft umher paddelte, überkam mich ein positives Gefühl von Hoffnung. Denn jetzt musste ich mich nur noch selbst aus der grundlosen Brühe dieses dreckigen Pools befreien. Keine Menschenseele sollte jemals von diesem peinlichen Vorkommnis erfahren, das schwor ich mir.
Voller Zuversicht schwamm ich zurück zu meinen Trittstufen. Dort wollte ich versuchen, aus dem Wasser zu kommen. Doch barfuß war es umso schwieriger als mit Schuhen, sich im Schlamm des schlickigen Grunds festzukrallen und hochzudrücken, denn die entblößten Füße fanden dort keinerlei Halt. Wieder und wieder rutschte ich ab und platschte geräuschvoll zurück in die Fluten.
Wut stieg in mir auf.
Mit voller Energie krallte ich mich mit meinen Händen an die unterste Trittstufe und versuchte mit ganzer Kraft, mich aus dem Wasser zu ziehen. Gleichzeitig strampelte ich mit den Beinen, so stark ich konnte, um mehr Auftrieb zu erlangen. Es nutzte alles nichts. Mit ein paar zornigen Flüchen rutschte ich wieder zurück in die faulig stinkende Badewanne. Erschöpft ließ ich mich in Rückenlage auf der schmutzigen Brühe treiben, um mich zu erholen.
Der Gestank des modrigen Wassers war mir inzwischen egal.
Ich hatte andere Sorgen. Gedankenverloren schob ich den rechten Zeigefinger in meinen Mund. Das fühlte sich gut an. Für einen Augenblick dachte ich zurück an die Zeit im Sandkasten. Ich überlegte …
Natürlich war es ein großer Fehler gewesen, aus Bequemlichkeit die beiden untersten Trittstufen nicht ebenfalls mit Steinplatten zu versehen. Da sie nur aus Lehm bestanden, waren sie durch mein wildes Herumplanschen nass und unendlich glitschig geworden.
Zwar war es vernünftig gewesen, meine wertvolle Kamera ans rettende Ufer zu werfen. Sich in gleicher Weise seiner Stiefel zu entledigen, entpuppte sich dagegen als äußerst unvorteilhaft. Denn ohne Schuhwerk barfuß im schlammigen Wasserloch Halt zu finden, war beinahe unmöglich. Vielleicht gab es anderswo eine Stelle, an der es möglich war, aus dem Wasser zu kommen.
Neugierig glitt ich durchs Wasser. Ohne Stiefel war das Schwimmen um ein Vielfaches weniger anstrengend. Die Stille hier unten im tief eingeschnittenen Wasserloch wirkte geheimnisvoll und erdrückend. Die einzigen Geräusche waren das glucksende Wasser und mein röchelnder Atem. Ich tauchte ab, um hinunter auf den Grund zu spähen. Doch die grünliche Suppe, in der ich mich befand, war so trüb und undurchsichtig, dass ich nicht einmal die Schwimmbewegungen meiner eigenen Hände erkennen konnte.
Mit ruhigen Zügen arbeitete ich mich durchs Wasser und schaute mich um. Überall stieg das Ufer annähernd senkrecht an. An manchen Stellen war es tief unterhöhlt und sogar überhängend. Hier gab es keine Chance, aus dem Wasserloch herauszukommen. Ich schwamm weiter. Alle zwei bis drei Meter testete ich aus, ob meine Füße Grund fanden. Jedes Mal vergeblich. Das Wasserloch war tief, denn bei meinen Stehversuchen spürte ich, dass das Wasser unten an den Füßen ziemlich kühl war. Die Beschaffenheit des Ufers änderte sich nicht, auch als ich schon mehr als die Hälfte des Teichs umrundet hatte. Bald erreichte ich einen Abschnitt, an dem es einige kleine Einbuchtungen gab. Hier war die Uferböschung abwechslungsreicher. Spärlich belaubte Bäume überragten das Ufer und auf der Wasseroberfläche trieben kleine Äste und Zweige. Zwischen zwei Ausbuchtungen entdeckte ich eine Landzunge. Sie war knapp zwei Meter lang, fast ebenso breit und mit Moos bewachsen. Ein modriger, fauler Geruch ging von ihr aus. Ich schwamm hin und stellte fest, dass ich sie mit ein wenig Glück erklimmen konnte. Mit aller Kraft stützte ich mich auf meine Arme und es gelang mir, mich auf das halbwegs trockene Stück Land hinaufzuschieben. Erleichtert ließ ich mich auf der winzigen Insel nieder. Sie war gerade groß genug, um sich mit angezogenen Beinen darauf niederzulegen, ohne nass zu werden. So gut ich konnte, säuberte ich meine vollkommen verschlammte Kleidung. Der glitschige Moosüberzug meiner Rettungsinsel roch intensiv nach Zersetzung. Aber er war weich und angenehm. Nach mehr als einer Stunde war ich aus der Gefangenschaft des Wassers endlich auf festen Grund gelangt. Diese wiedergewonnene, bescheidene Freiheit ließ meine Grabesstimmung ein wenig ansteigen.
Mit der überragenden Bedeutung der Freiheit wurde ich im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung zum Fotografen konfrontiert, als mich Onkel Richie zum ersten Mal ins Gefängnis der Stadt mitnahm. Er fuhr dort einmal in der Woche hin, um neu angekommene Sträflinge für die unterschiedlichen Strafregister abzulichten. Das Gefängnisgebäude machte mir Angst. Überall gab es Stacheldraht und Scheinwerfer, an allen Ecken waren Lautsprecher angebracht. Onkel Richie nannte sie humorvoll die ‚Stimmen des Herrn‘. Mir aber gefielen die kalten Durchsagen und knapp formulierten Befehle und Anordnungen, die aus ihnen herausdrangen, ganz und gar nicht. Das Innere des Gebäudes war ein einziges Labyrinth. Stockwerk für Stockwerk war absolut identisch eingerichtet, manche waren spiegelsymmetrisch angeordnet. Ich war froh, dass wir bei unseren Besuchen jedes Mal von einem Vollzugsbeamten begleitet wurden, sonst hätten wir uns zweifellos bei jedem unserer wöchentlichen Visiten heillos verirrt.
Der Raum, in dem Onkel Richie und später auch ich selbst fotografierten, war spärlich eingerichtet. In einer der hinteren Ecken befand sich eine abgegriffene Stehlampe, daneben ein dreibeiniges Tischchen, auf dem mein Onkel seine Kameraausrüstung ablegte. Stühle waren nicht vorhanden, sodass wir die Arbeit stehend verrichteten, ebenso der Vollzugsbeamte, der während unserer Knastfotografie immerzu anwesend war. An einem einzigen Vormittag fotografierten wir oft mehrere Dutzend Häftlinge. Alle waren ruhig und versuchten, freundlich zu wirken. Aber die meisten von ihnen besaßen einen traurigen, leeren Blick, gebrochene und entwurzelte Männer, denen anzusehen war, dass sie ihre Freiheit für lange Zeit, vielleicht sogar für immer, verloren hatten.
Doch auch ich hatte durch eine einzige Unbedachtheit die Möglichkeit eingebüßt, mich hinzuwenden, wohin ich wollte. Wie verloren kauerte ich noch immer auf meiner rettenden Landzunge. Nach und nach wurde es dämmrig. Je länger ich darüber nachgrübelte, umso mehr kam mir zu Bewusstsein, dass ich hier in diesem Drecksloch eingesperrt war. Nach einigen weiteren Erkundungsrunden auf dem Wasser begrub ich die Hoffnung endgültig, aus eigener Kraft und ohne Hilfsmittel aus dem Tümpel herauszukommen.
Die Wände der gesamten Uferböschung waren spiegelglatt, erdig und verwandelten sich bei der leisesten Berührung mit nassen Händen sofort in komplett glitschigen Schlamm. Zudem war das Wasser überall grundlos tief, man konnte an keiner Stelle im Wasserloch stehen. Wahrscheinlich handelte es sich tatsächlich um ein in der Vergangenheit ausgebaggertes Erdloch, vielleicht eine ehemalige Diamantenmine.
Zum wiederholten Mal schwamm ich in Richtung meiner Einstiegstelle, um nachzusehen, ob ich dort nicht doch irgendetwas zurückgelassen hatte, was mir von Nutzen sein konnte, als mich plötzlich etwas unter Wasser streifte. Ganz deutlich fühlte ich es zwischen meinen Beinen, glatt und glitschig, eine kleine Strömung nach sich ziehend. Ich erschrak fürchterlich, Panik stieg in mir auf. Nur mit größter Mühe schaffte ich es, kontrolliert weiter zu schwimmen. Als ich vor Angst zitternd an meiner morgendlichen Einstiegsstelle angekommen war, atmete ich ruckartig und schnell. Ich wagte es nicht, noch einmal zu versuchen, aus dem Wasser herauszuklettern. Lautlos ließ ich mich an der Oberfläche treiben und traute mich kaum noch, mich zu rühren. Ein paar Minuten verstrichen, ohne dass sich unter Wasser auch nur irgendetwas regte. Langsam beruhigte ich mich wieder. Die Sonne stand schon tief am Himmel und tauchte die ockerfarbenen Wände meines Gefängnisses in gleißendes, gelboranges Licht. Unversehens glitt ich im Wasser durch ein lichtdurchflutetes Amphitheater. Hätte ich jetzt doch nur meine Kamera hier! Doch die lag einige Meter über mir im Gras, zum Greifen nahe. Wie ohnmächtig paddelte ich weiter und starrte dabei ins grell leuchtende Licht. Ein Gefühl von Verzweiflung brannte sich oberhalb der Magengegend in mich hinein. Es ließ mich erschaudern und verursachte einen krampfartigen Würgereiz. Ich war den Tränen nahe. Entkräftet, frustriert und vor Kälte zitternd machte ich mich auf den Rückweg zu der kleinen Landinsel, um dort die Nacht zu verbringen. Morgen würde ich bestimmt hier herauskommen, beruhigte ich mich selbst, bevor mich erneut unter Wasser etwas berührte! Dieses Mal stärker als zuvor, an der Außenseite meines rechten Oberschenkels.
Blind vor Angst kraulte ich, so schnell ich konnte, davon. Hilfe, verflixt, was war das? Schneller, schneller …
Es war mir einerlei, als ich mit voller Wucht Kopf voraus auf den moosigen Schlamm meiner Rettungsinsel krachte. Schreiend und wimmernd wühlte ich mich aufs glitschig bemooste Land, kauerte mich dort in völliger Hysterie hin, zog meine Beine dicht zu mir her und starrte entgeistert auf die Wasserfläche des Tümpels, die ich durch meinen olympiareifen Kraulsprint kräftig in Wallung gebracht hatte.
Einige Minuten saß ich so da. Die Panik und die furchtbare Angst, die sich in mir ausgebreitet hatten, ebbten nur ganz allmählich ab, genau so langsam wie die Wasserbewegungen im Tümpel. Doch letztlich fiel meine Beklommenheit mehr und mehr von mir ab. In mir kehrte so etwas wie Ruhe ein. Mein Atem ging regelmäßig und ich war wieder halbwegs in der Lage, mich selbst zu spüren.
Jetzt erst bemerkte ich, in welch miserablem körperlichen Zustand ich mich befand. Zunächst war da der Durst. Meine Kehle und mein gesamter Rachenraum fühlten sich rau und ausgetrocknet an. Gleichzeitig bemerkte ich den ekelhaften, modrig fauligen Geschmack in meinem Mund, der vom unfreiwilligen Genuss des Teichwassers herrührte. Des Weiteren meldete sich beinahe ebenso vehement der Hunger. Das hohle Gefühl in der Magengegend kannte ich, allerdings nicht den Gedanken, dass ich nichts dagegen tun konnte. Jetzt einen fetten Burger und eine Pulle Bier, das wäre meine Rettung …
Gedankenverloren schweifte mein Blick an mir hinunter. Erstaunt stellte ich fest, dass ich mir im Laufe des verhexten Tages einen gewaltigen Sonnenbrand geholt hatte. Wegen der unerträglichen mittäglichen Hitze hatte ich mich während meiner verzweifelten Befreiungsversuche zeitweise meines T-Shirts entledigt. Das hatte ich nun davon. Am ganzen Oberkörper war ich krebsrot. An den Schultern fühlte ich die typischen Bläschen, die sich bei einem Sonnenbrand schwereren Ausmaßes bildeten. Zudem fröstelte ich von innen heraus, obwohl es draußen noch warm war. Das war ein weiteres Indiz für viel zu intensive Sonneneinwirkung. Zu allem Übel hatte ich mir bei meinen verzweifelten Kletterversuchen fast überall, vor allem aber an den Gliedmaßen, Kratzund Schürfwunden zugezogen, die wie Feuer brannten.
„Lausiger Zustand, Jamie“, flüsterte mir mein Dad ins Ohr.
„Wie recht du wieder mal hast“, gab ich trotzig zurück.
Unweigerlich musste ich grinsen. Trotz meiner erbärmlichen Situation breitete sich für einen kurzen Moment der Hauch eines positiven Gefühls in mir aus ...
Gegen den Hunger konnte ich im Augenblick wenig tun. Doch gegen den Durst gab es genügend Wasser. Das stank zwar und war nahezu ungenießbar, aber ich musste dringend Flüssigkeit zu mir nehmen, sonst würde ich nicht lange durchhalten, das wusste ich.
Unter Schmerzen zog ich mein verdrecktes, kakifarbenes Baumwoll-T-Shirt über meine verbrannten Schultern und wusch es gründlich im tiefen Wasser. Danach schnürte ich die weite Bauchöffnung sorgfältig mit beiden Händen zusammen. Dann füllte ich das Shirt von oben wie einen Wassersack auf und drückte es in Richtung der Verknotung vorsichtig aus. Dadurch entstand ein Filtereffekt, der mir unterhalb des Knotens halbwegs geklärtes Wasser bescherte. Ich hielt das Shirt senkrecht über mich und fing gierig mit weit geöffnetem Mund das vom Knoten herabtropfende, grob gereinigte Wasser auf. Unter normalen Verhältnissen hätte ich keinen einzigen Schluck der fauligen Suppe bei mir behalten, aber in meiner jetzigen Situation schmeckte mir mein naturtrüber ‚Wüstencocktail ohne Eis‘ gar nicht mal schlecht. Ich trank, so viel ich konnte. Danach ließ ich mich genüsslich auf den Rücken fallen.
Erschöpft blickte ich hinauf zum Himmel, der sich abendlich orangerot verfärbt hatte. Einige harmlose Schichtwolken wurden von der tief stehenden Sonne rosaviolett angestrahlt. Normalerweise ein Bild des Friedens. Aber in meinem Inneren, da war nichts mehr in Ordnung, da war nichts friedlich, das sage ich euch!
Mühsam bekämpfte ich meine Verzweiflung und zwang mich, zu überlegen. Beinahe unglaublich, was dieser heutige Tag mir beschert hatte. Aus einigen kleinen Fehlern war eine lebensbedrohliche Situation entstanden.
Wie verrückt das Leben war! Alles, einfach alles konnte sich so schnell verändern!
Um mich abzulenken, richtete ich meine Gedanken auf die merkwürdigen Ereignisse im Wasser. Zwei Mal hatte mich etwas Kaltes, Glitschiges berührt. Schlingpflanzen konnten es nicht gewesen sein, denn das Gewässer machte einen vollständig leblosen Eindruck. Außerdem war es nur während der Regenzeit, also nicht mehr als ein paar Wochen lang mit Wasser gefüllt. Da konnte sich unmöglich eine nennenswerte Unterwasservegetation ausbilden.
Höchstwahrscheinlich war das verdammte Loch tatsächlich von Menschenhand geschaffen worden. Dann konnte sich darin auch Zivilisationsmüll befinden, Plastikplanen oder sonstige Stoffe, die unter dem Wasserspiegel verborgen waren.
Wodurch aber hätten sie bewegt werden können, fragte ich mich?
In dieser Pfütze, durch ihre Lage völlig windgeschützt, existierte nicht der Hauch einer Strömung.
Je länger ich darüber nachgrübelte, was mich unter Wasser berührt hatte, desto intensiver erhärtete sich ein schrecklicher Verdacht, den ich unbedingt hatte verdrängen wollen: Was, wenn es ein Lebewesen war?
Ein Krokodil? Unweigerlich lachte ich laut auf. Das war völlig absurd!
„James, ich fürchte, du tickst aus!“, ermahnte mich mein Dad.
Fische? Ich lachte noch lauter! Womöglich Piranhas, die direkt vom Amazonas hierhergeschwommen waren ...
„Nein, James Brady, du bist wohl einmal mehr einer panischen Wahnvorstellung zum Opfer gefallen, auch ohne Alkohol“, versuchte ich, mich selbst zu beruhigen. Waren solche Halluzinationen nach all den absurden Erlebnissen des heutigen Tages nicht etwa normal, fragte ich mich?
Mit einem Gefühl von Erleichterung beobachtete ich den Himmel, der mir mit einmal heller und friedlicher vorkam. Jetzt musste ich nur noch etwas gegen meinen Sonnenbrand und meine Schürfungen unternehmen, dann würde die Welt schon bald wieder freundlicher aussehen …
Die weltzugewandte Freundlichkeit Onkel Richies war unbestreitbar. Für lange Zeit war er der wichtigste und liebste Mensch in meinem Leben. Als ich meine Lehre als Fotograf erfolgreich beendet hatte, übertrug er einen Teil seiner Arbeit an mich und ich wurde sein Kompagnon. Gerne lichtete ich glückliche Brautpaare kurz vor der Hochzeit ab, und auch die tägliche Porträtfotografie war gute Arbeit. Ins Bezirksgefängnis ging ich weiterhin ungern und nur, wenn ich mich nicht davor drücken konnte. Die hoffnungslosen Gesichter der Gefangenen erinnerten mich zu deutlich an meine Kindheit, die so unfrei und freudlos verlaufen war.
Am liebsten fotografierte ich Tiere, angefangen bei den Haustieren meiner Kunden, was mir gelegentlich einen erwünschten Nebenverdienst einbrachte. Mehr und mehr interessierten mich jedoch die Geschöpfe der freien Natur. Zunächst lauerte ich früh morgens noch vor Sonnenaufgang den Kaninchen auf, die sich auf den Wiesen vor der Stadt ein Stelldichein gaben. Später trieb mich meine Neugier immer weiter in die unberührten Wälder von Manitoba hinein, um Elche und manchmal sogar einen Bären vor die Kameralinse zu bekommen. Bei meinen Ausflügen in die wilde Natur war ich alleine unterwegs, stundenlang umherstreifend, bevor ich lange nach Einbruch der Dunkelheit bei Onkel Richie anklopfte. Er machte sich jedes Mal große Sorgen um mich, wenn ich draußen durch die Wildnis wanderte und war jedes Mal sichtlich erleichtert, wenn ich wieder wohlbehalten zu Hause ankam. Das gefiel mir sehr!
Heute war ein dreckiger Tümpel mitten in der Kalahari mein zu Hause. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen. Ich hatte mir meine am schlimmsten zugerichteten Hautstellen mit einer Art Schlammmaske versiegelt, die ich aus dem Schlick des Untergrunds, aus trockenem Sand und ein wenig Speichel hergestellt hatte. So war das brennende Gefühl erträglich.
„Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, munterte mich die Stimme meines Dads in gewohnter Banalität auf. Wenn der mal wüsste …
Der nächtliche Himmel zog sich mehr und mehr zu, der Mond zeigte sich nur selten und wurde zumeist von schnell vorüberziehenden Wolken verdeckt. Es war totenstill. Hin und wieder vernahm ich das schüchterne Quaken eines Frosches. Einmal erschreckte mich das nervöse Quieken eines Warzenschweins, ansonsten war einzig das helle Sirren der Moskitos zu hören, wie sie sich, lüstern auf Blut, hinterhältig im Schutze der geheimnisvollen Dunkelheit näherten.
Doch das störte mich alles nicht besonders, das war ich gewohnt.
Ich hatte nichts zu tun, verdammt, ich konnte nichts tun!
An Schlaf war nicht zu denken. Mein Körper war müde und erschöpft, doch mein Gehirn arbeitete auf vollen Touren, um die Ereignisse des heutigen Tages zu verarbeiten und meine Situation zu analysieren.
Hier aus diesem feuchten Gefängnis zu entkommen, war beileibe nicht einfach, auch wenn es mir nicht unmöglich erschien.
Ich wusste nur noch nicht, wie ich das bewerkstelligen sollte.
Meinem derzeitigen Feind, der unerbittlichen Wildnis, hatte ich zwei Trumpfkarten entgegenzusetzen, die nicht zu verachten waren.
Zum einen war ich bis auf ein paar harmlose Schürfungen physisch unversehrt. Nur wer sich öfters in der wilden Natur bewegt hat kann ermessen, wie wichtig dies für ein Überleben ist. Wer sich verletzt oder körperlich angeschlagen in der Wildnis durchschlagen muss, der hat schon fast verloren.
Zum anderen stellte ich fest, dass ich unendlich viel Zeit bei meinem Überlebenskampf gegen die Natur hatte. Erfrieren konnte ich hier draußen nicht, ebenso hatte ich mehr als genug Wasser, ein nicht zu unterschätzendes Plus.
Zwar hatte ich im Augenblick nichts zu essen, aber mit den reichlich vorhandenen Fettreserven um meine Taille würde ich viele Tage ohne Funktionseinbußen überleben können. Außerdem hatte ich hier in diesem feuchten Loch keinerlei natürliche Feinde. Ich war also in der Lage, mir in aller Ruhe eine Lösung meines Problems auszudenken.
„Kommt Zeit, kommt Rat“, würde mein Dad jetzt sagen …
Eine merkwürdige Ruhe stieg in mir auf, als mir klar wurde, dass ich nur lange genug warten musste, bis sich etwas an meiner aussichtslosen Situation verbesserte, bis sich ein Ausweg auftat.
Denn das Leben um mich herum wogte, veränderte sich stetig, selbst in dieser vermeintlichen Einsamkeit!
Ich konnte es nur nicht fassen, nicht greifen, weder hören, noch sehen ...
Leute, habt ihr eigentlich jemals erlebt, wie das Leben um euch herumtobt, selbst an den stillsten Orten des Universums? Wer von euch sich schon irgendwann einmal in der Natur aufgehalten hat, einfach mal gewartet hat, um still zu verharren, natürlich nicht bloß ´ne Minute oder so, sondern ein paar Stunden, nur so dagesessen ist, der weiß, von was ich rede. Ich wette mit jedem von euch, ihr werdet dabei eine spannende Erfahrung machen, irgendetwas Bedeutungsvolles. Glaubt mir, das Leben wird euch zeigen, wie lebendig es ist! Ihr müsst es nur an euch heranlassen, auch wenn es ein wenig dauert …
Einmal, da saß ich irgendwo mitten in einem gottverlassenen Wald in Manitoba und hab eine gefühlte Ewigkeit bewegungslos verharrt.
(Allerdings hatte ich am Tag zuvor auch zu viel getrunken und das verrate ich euch jetzt nur, weil ihr meine Geschichte bis hierher gelesen habt …)
Jedenfalls lag ich auf einer bequemen Moosinsel in diesem verwunschenen Wald. Da spürte ich, wie etwas an einem meiner Stiefel knabberte. Ich hob den Kopf ein wenig an und erblickte eine zarte Haselmaus, die sich eifrig über meine Stiefelsohle hermachte.
„Gut, Mäuschen, ich lass dich mal machen“, dachte ich bei mir und stellte mich schlafend.
Nach einer Weile tippelte das drollige Ding an meinem Bein hoch, lief über meinen Körper und schnurstracks auf mein Gesicht zu. Ich war fast schon dabei, dem Spiel ein Ende zu machen, aber die Maus war einfach zu putzig. Unweigerlich zog sie mich in ihren Bann. Also ließ ich sie gewähren. Sie trippelte weiter an mir hinauf, zuerst über meine Schulter, dann auf meine rechte Wange. Dort begann sie, sich eifrig ihr bräunlich glänzendes Fell zu putzen. Als ich vorsichtig mein rechtes Auge öffnete, blickte mich das Tier neugierig an. Keiner von uns bewegte sich. Ich schaute das Mäuschen an, das Mäuschen schaute mich an. Es bewegte sich keinen Zentimeter. Sein sanfter Blick drang tief in meine Seele, friedlich, entspannt, wach, aufmerksam. Oder einfach nur so, zweifelte ich? Machte sich die Maus in diesem magischen Moment Gedanken über mich, über ihre Situation? Ich hatte keine Ahnung, aber ich war voll freudiger Demut, wie perfekt friedvoll mich dieses niedliche Geschöpf anblickte. Das ging vielleicht eine Minute, oder zwei, ich weiß es nicht mehr. Doch dieser gänzlich unspektakuläre Moment war einer der bewegendsten Augenblicke in meinem ganzen Leben. Dieses Wesen schenkte mir sein bedingungsloses Urvertrauen und vermittelte mir damit einen Hauch von Erkenntnis, warum das Zusammenleben in der Natur so harmonisch funktioniert. Die Maus knabberte noch ein wenig an meinem Bart herum, dann trippelte sie wieder von mir herunter. Zur Belohnung schenkte ich ihr eine Weintraube. Eilig verzog sie sich damit ins Unterholz. So meine ich das mit dem Leben, Leute - es tobt um euch herum, glaubt mir! Und ich war mir totsicher, das Leben pulsierte auch hier, an diesem gottverdammten Tümpel. Ich nahm es in meiner verzweifelten Situation nur nicht wahr, ich war unfähig, es zu erfassen. Keinerlei Spur von Weisheit. James Bradey, das idiotische Prachtexemplar eines degenerierten Homo sapiens …