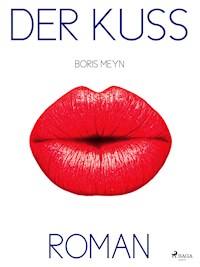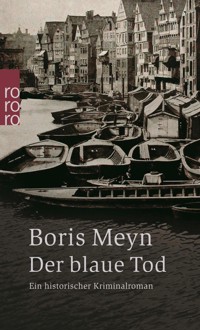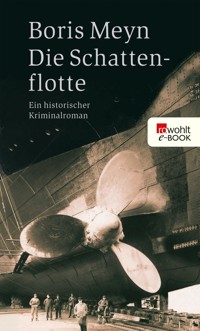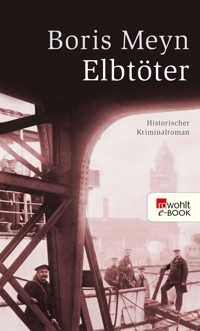
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Familie Bischop ermittelt
- Sprache: Deutsch
Rote Fahnen und dunkle Geschäfte Winter 1918, der Krieg ist verloren. Auf dem Hamburger Rathaus hat das rote Banner der Arbeiterbewegung die Fahne des Kaiserreichs ersetzt, Aufständische ziehen bewaffnet durch die Straßen, das Bürgertum der Stadt hat Angst, die kleinen Leute hungern. Inmitten dieser Zeit der Anarchie wird Sören Bischop mit Nachforschungen zu einem jungen Mann beauftragt, der aus einem Kriegsversehrtenheim verschwunden ist. Kurze Zeit später wird der Vater des Vermissten, ein angesehener Hamburger Kaufmann, ermordet. Sörens Recherchen führen ihn ins Herz der guten Hamburger Gesellschaft, wo es weniger um Vaterland geht als um Gewinn. Egal womit … Auch Boris Meyns neuer Roman entführt den Leser wieder in eine faszinierende Epoche der Hamburger Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Boris Meyn
Elbtöter
Historischer Kriminalroman
Über dieses Buch
Rote Fahnen und dunkle Geschäfte
Winter 1918, der Krieg ist verloren. Auf dem Hamburger Rathaus hat das rote Banner der Arbeiterbewegung die Fahne des Kaiserreichs ersetzt, Aufständische ziehen bewaffnet durch die Straßen, das Bürgertum der Stadt hat Angst, die kleinen Leute hungern. Inmitten dieser Zeit der Anarchie wird Sören Bischop mit Nachforschungen zu einem jungen Mann beauftragt, der aus einem Kriegsversehrtenheim verschwunden ist. Kurze Zeit später wird der Vater des Vermissten, ein angesehener Hamburger Kaufmann, ermordet. Sörens Recherchen führen ihn ins Herz der guten Hamburger Gesellschaft, wo es weniger um Vaterland geht als um Gewinn. Egal womit …
Auch Boris Meyns neuer Roman entführt den Leser wieder in eine faszinierende Epoche der Hamburger Geschichte.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Werner Irro
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
Umschlagabbildung ullstein bild - Süddeutsche Zeitung Photo/Scherl
Abbildungen im Tafelteil Staatsarchiv Hamburg (wenn nicht anders angegeben); mit freundlicher Unterstützung von Joachim Frank
ISBN 978-3-644-55961-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marian
Pour que je continue à recevoir des truffes fraîches de la part de notre «ennemi héréditaire»
So gibt es also ein begründetes Interesse daran, dass dieses sinnlose Morden niemals ein Ende finden soll.
Ascan von Wesselhöft
Kapitel 1
Es liegt was in der Luft. Egal, was ihr hört, macht euch keine Sorgen um mich. David»
Sören Bischop las die Depesche, die er vor drei Tagen erhalten hatte, immer wieder. Als könnte er den zwei Sätzen mehr Informationen entlocken.
Natürlich machte er sich Sorgen. Und sogar noch mehr, nachdem er heute Morgen in der Zeitung die kurze Notiz über angebliche Unruhen in Kiel gelesen hatte. Nichts Konkretes stand da, aber von Meuterei unter Matrosen war die Rede gewesen. Er erinnerte sich nur zu genau. Vor drei Jahren hatte man in Kiel Gehorsamsverweigerer standrechtlich füsiliert. David gehörte zwar keiner Schiffsbesatzung an, aber auch die Werftdivision unterstand der Marine. Und selbst mit vierzig war sein Ziehsohn immer noch der Hitzkopf von früher. Grund genug also, sich richtig Sorgen zu machen.
Sören versuchte sich abzulenken. Doch was er auch tat, die Angst um seine Familie, um alle hier im Haus, vor allem um Robert, ihren Jüngsten, hielt ihn fest umklammert. Bislang waren sie glimpflich davongekommen. Aber was, wenn der Krieg noch mehrere Jahre andauerte? Würde auch ihr Jüngster noch auf die Schlachtbank geführt? Mit fast sechzehn gehörte Robert zum nächsten Jahrgang, den die Kriegsmaschine verschlingen würde. Noch stand er im Schutz der Schule, aber die Häscher lauerten schon. Robert hatte erzählt, dass vonseiten einiger seiner Lehrer händeringend um Nachwuchs für den großen vaterländischen Kampf geworben wurde. So hatte er es natürlich nicht ausgedrückt, aber Tilda hatte Roberts Berichte entsprechend interpretiert.
Über vier Jahre ging der Wahnsinn nun schon. Es war zwar die Rede von Waffenstillstandsverhandlungen, aber bis wann würde sich das hinziehen? Noch sprach die Werbung für Kriegsanleihen die Sprache des Kampfes, nicht der Vernunft: Deutsches Gut für Deutsches Blut. Man konnte niemandem mehr trauen. Wie er über Tilda erfahren hatte, auch nicht mehr der Berichterstattung in der Presse. Gedruckt werden durfte nur, was die Kampfmoral des Volkes nicht unterwanderte. Was wirklich an der Front geschah, bekamen die Daheimgebliebenen nicht mit, es sei denn durch Berichte der Feldgrauen im Urlaub. Und ein Ende war nicht abzusehen. Was blieb, war der tägliche Irrsinn des Überlebens. Es gab so gut wie nichts mehr.
In der Stadt stand die geordnete Versorgung der Bevölkerung kurz vor dem Kollaps. Brot, Gas, Kohle, Kartoffeln, Kerzen, es mangelte inzwischen an allen Dingen, die vor ein paar Jahren noch als Selbstverständlichkeit gegolten hatten. Selbst Sauerkohl wurde jetzt über Warenbezugskarten des Kriegsversorgungsamts verteilt. An Fleisch und Butter in ausreichender Menge war überhaupt nicht mehr zu denken. Trotz immer neuer Rezepte, die Agnes und Liane mitbrachten – Sören konnte Miesmuscheln und Krabben einfach nicht mehr sehen.
Dabei waren sie noch bessergestellt als die meisten, seit sie vor fünf Jahren aus der Stadt in die von David entworfene Villa in die Walddörfer gezogen waren. Der Verkauf des Stadthauses in der Feldbrunnenstraße hatte ihnen nicht nur den Erwerb eines geeigneten Bauplatzes in Ohlstedt ermöglicht, das Geld hatte zudem noch für mehr als fünf Hektar angrenzende Acker- und Weideflächen sowie einen eigenen Forst gereicht. Vor allem Brennholz hatten sie so ausreichend einlagern können, um über den Winter zu kommen. Für Kleinholz wurde mittlerweile 36 Mark der Raummeter aufgerufen, für Klobenholz zahlte man 50. Vorausgesetzt, man fand überhaupt eine Bezugsquelle.
Sören Bischop schritt durch die nassen Gräser zu den Kaninchenställen hinter dem Haus, schob etwas Grünzeug und Wurzelreste durch die Futterklappe, dann schaute er nach den Hühnern und öffnete den Taubenschlag. Wer hätte gedacht, dass sich der damalige Wunsch ihres Sohnes, Nutztiere anzuschaffen, im Nachhinein als grandiose Idee herausstellen würde. Er erinnerte sich, wie er damals versucht hatte, Robert das Vorhaben auszureden. Auch weil er ahnte, dass die damit einhergehenden Pflichten nach anfänglicher Begeisterung schnell als lästiger Ballast empfunden werden würden. Doch Tilda hatte gemeint, so würde ihr Sohn Verantwortung lernen, und seine Bedenken aus dem Weg geräumt. Und nun sicherten ihnen nicht nur der Gemüsegarten, sondern auch die Tiere den Luxus der Selbstversorgung.
Wie von ihm vorausgesagt, hatte Robert die Verantwortung schnell an seinen Vater abgetreten. Aber es war nicht nur die Genugtuung, die Sören verspürte, wenn er sich nun selbst um die Tiere kümmerte. Ihr ganzes Refugium empfand er seit Jahren als friedliches Idyll gegenüber den Schrecken und Ängsten, welche der Krieg über das Land getragen hatte. Sören zählte neun Eier im Korb.
Das Wetter war seit Tagen trübe, wenngleich mild. Vormittags hingen grieselige Nebelschwaden über den Feldern, dann setzte meist zur Mittagszeit leichter Niederschlag ein. Von Sonne weit und breit keine Spur. An den Glasplatten der Gewächshäuser zeichneten Regentropfen ein bizarres Muster. Eine Amsel beäugte ihn neugierig, als er nach dem empfindlichen Gemüse schaute, dann flüchtete sie mit klagenden Protestlauten. Der Blick aufs Thermometer befriedigte ihn, kein Frost war zu befürchten. Auch wenn ihm langsam der Sinn nach Grünkohl stand, trotz ihrer Vorsorge hoffte Sören auf einen milden Winter.
Vom Waldrand her vernahm Sören eine bekannte Stimme. «Tach auch, Herr Nachbar!» Der Hof von Bauer Semmerling lag direkt hinter ihrem Forst. Semmerling kam mit schlurfenden Schritten über die Wiese. Seine kauzige Gestalt und der Gang waren unverwechselbar. Krummer Rücken, Stiefel, die drei Nummern zu groß wirkten, eine Mistforke, geschultert wie ein Gewehr, auf dem Kopf die obligatorische Schirmmütze aus grünem Drillich.
«Moin auch», erwiderte Sören, als Semmerling näher kam. Auch wenn man sich hier draußen duzte, mied Sören die vertrauliche Anrede genauso wie das förmliche Sie. Ein Spagat, der nur durch das Weglassen jeglicher Pronomina gelang. Eine nüchterne, geradlinige Sprache, die ihrem nachbarschaftlichen Verhältnis entsprach.
Der Landwirt war fast einen Kopf kleiner als er, hatte allerdings riesengroße Pranken. Die Rechte umschloss Sörens Hand wie ein Schraubstock. «Ich wollt nur sagen, übermorgen schlachten wir ’n Schwein. Wenn also Bedarf is …» Die Wangen von Semmerling waren rotblau geädert, auf der Stirn besaß er ein dunkles Muttermal. Seine Augen funkelten erwartungsvoll.
Es war klar, worauf er abzielte. In dieser Zeit reichte man Fleisch nur in der Familie weiter. Zumal selbst Hausschlachtungen inzwischen der Meldepflicht unterlagen. Also hieß die Devise Fleisch gegen Wein. Im letzten Monat war Mathilda zu den Nachbarn gegangen, als ihnen die Milch ausgegangen war. Bauer Semmerling hatte noch zwölf Milchkühe im Stall stehen. An Geld war nicht zu denken gewesen, stattdessen hatte Tilda ihnen Wein angeboten. Als von Rotwein die Rede war, hatte der Landwirt erst die Nase kraus gezogen, es aber schließlich auf einen Versuch ankommen lassen. Und der 98er St. Estèphe hatte ihn dann wohl doch überzeugt. Eine andere Erklärung gab es für sein heutiges Erscheinen eigentlich nicht.
«Bedarf ist immer.» Er wartete einen Augenblick, ob Semmerling ein konkretes Angebot für den Tauschhandel unterbreiten würde. Als er nichts sagte, schlug Sören eine Flasche fürs Kilo vor, und Semmerlings Gesichtszüge hellten sich auf.
Die Bestellung wurde ohne viele Worte mit einem Handschlag besiegelt. «Ich sag dann Bescheid, und die Trine bringt’s rüber.» Bauer Semmerling trottete sichtlich zufrieden davon.
Es war ein Wahnsinn. Vor drei Jahren hätte eine Flasche wahrscheinlich für zwei ganze Schweine gereicht. Aber so war es nun mal. Und im Keller lagerten noch genügend Kisten von Martins Grands Crus. Ein Vorrat von unvorstellbarem Wert, vor allem zu den jetzigen Zeiten. Martin hatte in seinem Kellerbuch alle Einkäufe dokumentiert. Den Einkaufspreis von bis zu 25 Goldmark je Flasche konnte man nun allerdings nicht mehr zugrunde legen.
Sören freute sich bereits auf das Wochenende. Vorerst wollte er nichts verraten. Die anderen würden Augen machen, wenn Semmerlings Magd mit dem Fleisch anrückte. Dabei hatte er vergessen zu fragen, welchen Teil des Schweins sie erhalten würden. Für einen Moment ärgerte er sich, hätte er sonst doch einen Braten fürs Wochenende ankündigen können. Ein makabrer Scherz. Aber eigentlich war es ihm egal. Hauptsache, keine Miesmuscheln mehr. Und Semmerling würde, was die Menge betraf, bestimmt nicht kleinlich sein.
Das alles war der Dekadenz seines besten Freundes geschuldet. Über dessen Tod war Sören immer noch nicht hinweggekommen. Er vermisste ihn wie nichts anderes – den Frieden einmal ausgenommen.
Als der Krieg ausbrach, war Martin nach Norwegen geflüchtet. Er könne das anstehende Gemetzel, vor allem gegen die Franzosen, nicht ertragen, hatte er gesagt. Anders als Sören, der zugegebenermaßen damals auch überzeugt gewesen war, der Krieg sei nach wenigen Wochen entschieden, hatte Martin die Tragik des Geschehens sehr wohl vorausgeahnt. Seine häufigen Reisen nach Frankreich, insbesondere die mondänen Badeorte hatten es dem Lebemann angetan, hatten seine frankophile Lebensfreude geprägt. Zwei Wochen nachdem er sich bei einem Freund nahe Stavanger einquartiert hatte, war er bei einem Badeunfall in einem Fjord ertrunken. Ein Unfall, wie es hieß. Doch die Art und Weise, wie sie sich zuvor verabschiedet hatten, legte nahe, dass Martin Hellwege es vorgezogen hatte, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Er hatte Tränen in den Augen gehabt, als sie sich die Hand gaben. Eine letzte Berührung. Mehr nicht.
Zu ihrer aller Überraschung hatte Martin testamentarisch verfügt, dass Ilka, Sörens mittlerweile erwachsene Tochter, den Großteil seines Vermögens erben sollte, darunter die riesige Villa an der Alten Rabenstraße mitsamt dem Mobiliar. Nur der Weinkeller war an Sören gegangen und das kostbare Schachspiel, das ihnen viele schöne gemeinsame Stunden beschert hatte. Es stand im Musikzimmer am Fenster, unberührt wie Tildas Instrument, das sie seit Kriegsausbruch nicht mehr angerührt hatte. Als wäre die Zeit ihres Violinspiels nicht würdig. Und so war es wirklich. Jeder versagte sich die schönen Dinge des Lebens, weil es denen gegenüber anmaßend schien, die ihr Leben und ihre Gesundheit in den Schützengräben aufs Spiel setzten. Für einen Kampf, bei dem es keinen Sieger geben konnte. So viel war allen bereits klar. Nur aussprechen durfte man es immer noch nicht.
Die Kanzlei in der Schauenburgerstraße hatte Sören verkauft, nachdem sie ihr neues Refugium am Rande von Ohlstedt bezogen hatten. Der tägliche Weg in die Stadt war einfach zu anstrengend gewesen, und die Strapazen des Alltags waren mit fast siebzig auch nicht weniger geworden. Bis heute hatte er seinen Entschluss nicht bereut, was auch daran lag, dass er sich trotz seines Alters noch nicht vollends zur Ruhe gesetzt hatte. Doch es kam nur noch selten vor, dass er ein Mandat übernahm, und wenn, dann meist auf Drängen von Tildas Parteigenossen, die ihn immer wieder überredeten, war er doch für seine Loyalität gegenüber Sozialdemokraten bekannt.
Für solche Fälle hatte er sich eine kleine Schreibstube eingerichtet, in der nicht nur seine rechtswissenschaftliche Bibliothek untergebracht war, sondern auch ein Gästebett für den Notfall, falls Mandanten nirgendwo sonst unterkommen konnten. Vor zwei Monaten war Otto Stolten mit einem jungen Genossen im Schlepptau angerückt, der angeblich wegen Schiebergeschäften zur Fahndung ausgeschrieben war. Drei Tage hatten sie ihn beherbergt, bis er eine andere Unterkunft gefunden hatte. Bislang hatte Sören nichts wieder von ihm gehört, und auch Stolten gab sich wortkarg, wenn er nachhakte. Wahrscheinlich waren die Anschuldigungen gegen den Genossen doch nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen.
Sie waren zusammengerückt in der Villa, die David so großzügig geplant hatte. Ein Sammelbecken für die ganze Familie, das sie eigentlich nie hatte sein sollen. Aber jetzt waren sie dankbar, konnten sie doch die vielen Räume gebrauchen. Nachdem David vom Hochbauamt für einen Lehrauftrag an der Baugewerkschule Eckernförde freigestellt worden war, hatten er und Liane ihre Wohnung im Karolinenviertel aufgegeben und zwei Zimmer im Obergeschoss bezogen. Liane bewohnte sie nun bis auf Davids Urlaubstage allein. David hatte sich nach Kriegsausbruch freiwillig für die Arbeit auf einer Kieler Werft gemeldet, denn an einen geregelten Unterricht in Eckernförde war spätestens ab dem Zeitpunkt nicht mehr zu denken gewesen, als das Gros der dortigen Schüler in den Krieg gezogen war. Für die verbleibenden Unterrichtsstunden pendelte David zwischen Kiel und Eckernförde. Schlafen konnte er in der Kaserne. Liane arbeitete vormittags in der Vereinsförderung des Curio-Hauses und war für das dortige Programm zuständig. Abends trat sie mit einer skurrilen Tänzergruppe im Altonaer Trichter auf, wo sie vor Publikum an athletischen Damenwettspielen teilnahm. Ein zweifelhaftes Amüsement, wie Sören fand, aber Liane hatte ihm versichert, dass alles sittsam zugehe und sie den direkten Kontakt zum Publikum einfach brauche. Allerdings kamen solche Auftritte immer seltener vor, seit für sämtliche Lokale, Lichtspielhäuser und Theater in der Stadt eine Nachtruhe verordnet worden war.
Vorher kümmerte sich Liane um Robert, wenn der aus der Schule kam, da Agnes tagsüber als Erntehelferin tätig war. Sie hatten es nicht übers Herz bringen können, Agnes zu kündigen, nachdem Robert kein Kindermädchen mehr benötigte. Sie hatte immer in ihrer Obhut gestanden und jederlei Selbstverantwortung vehement abgelehnt. So hatten sie Agnes schließlich einen neuen Arbeitsplatz zukommen lassen und sie als Herrscherin über die Küche eingesetzt. Dankbar bewohnte sie eine kleine Kammer im Dachgeschoss. Und selbst wenn Ilka am Ende des Monats aus Schweden zurückkommen würde und sie zusätzlich noch den jungen Herrn Sjöberg zu Gast hatten, reichte der Platz. Und wenn nicht, würden sie eben nochmals enger zusammenrücken.
Sören fragte sich, warum Ilka nicht in Schweden blieb, bei all den Entbehrungen, die sie hier erwarteten. Das Angebot, Ture Sjöberg als Gast aufzunehmen, so wie Ilka bei seiner Familie in Schweden willkommen geheißen worden war, stammte aus einer Zeit, in der die gegenwärtige Lage nicht abzusehen gewesen war. Fast zwei Jahre lebte Ilka nun schon bei den Sjöbergs. Dabei war anfangs nur von einem einjährigen Aufenthalt die Rede gewesen, und auch dafür hatte ihre Tochter schwere Überzeugungsarbeit leisten müssen, schließlich kannten sie die Familie Sjöberg nicht persönlich. Selbst Ture hatte Ilka zuvor nur ein einziges Mal gesehen, was zum Zeitpunkt der Reise nach Schweden auch schon sechs Jahre zurückgelegen hatte. 1910 waren sie sich als Fünfzehnjährige zufällig in einem Ferienlager an der Ostsee begegnet, wo ihre Schulklassen benachbart untergebracht gewesen waren. Und da ihre Lehrkräfte beide Esperanto unterrichteten, hatte man wohl einige Exkursionen zusammengelegt. Eine harmlose Urlaubsbekanntschaft, wie man hätte meinen können. Aber sie hatten sich unermüdlich Briefe geschrieben – auf Esperanto. Mindestens einen im Monat. Tilda und er waren sich sicher gewesen, die Sache würde von selbst einschlafen, aber das war erstaunlicherweise nicht geschehen. Mit ihrer Volljährigkeit waren die beiden dann irgendwann auf die Idee gekommen, Ilka könnte für einen längeren Zeitraum nach Stockholm kommen. Zum Erlernen der Sprache, so hatten sie es zumindest dargestellt. Als sich Tures Familie damit einverstanden erklärt hatte, war es natürlich obligatorisch gewesen, Ture das Gleiche in Deutschland zu ermöglichen. Aber da hätte der Krieg längst zu Ende sein sollen, was er immer noch nicht war. Dennoch wollten Ilka und Ture nun kommen. Was für ein Wahnsinn.
Bei Sjöbergs in Stockholm hatten sie all das, wovon man hier nicht einmal zu träumen wagte. Tures Vater war Professor für Staatswissenschaften an der dortigen Universität und saß zudem im Beirat der Nobel-Stiftung. Die Sjöbergs lebten mit ihren acht Kindern auf einem schlossartigen Anwesen am Rande der Stadt und beschäftigten mehr als zwei Dutzend Hausangestellte. Dazu unterhielten sie ein Pferdegestüt und besaßen eine riesige Segelyacht, einen 75er-Schärenkreuzer mit eigener Mannschaft, wie Sören auf Nachfrage erfahren hatte. Die Schilderungen in Ilkas Briefen lasen sich wie ein Leben im Paradies. Und sie klang glücklich. Warum also konnte sie ihre Rückkehr nicht noch ein wenig verschieben? In seinem letzten Brief hatte Sören versucht, drastische Worte zu finden, um halbwegs realistisch zu schildern, wie es hier aussah. Und die Wirklichkeit war weitaus schlimmer. Von der grausigen Seite des Krieges, der Tilda tagein, tagaus bei ihrer Arbeit im Krüppelheim begegnete, war dabei noch überhaupt nicht die Rede gewesen.
Er fragte sich schon länger, wie seine Frau das aushielt. Wo sie noch nicht einmal eine entsprechende Ausbildung hatte. Er selbst hatte 1870/71 nach seinem ersten Studium als angehender Medicus für kurze Zeit in einem Feldlazarett hospitiert, aber wenn er hörte, was Mathilda schilderte, dann waren die damaligen Verletzungen der Soldaten mit dem, was in diesem Krieg vor sich ging, gar nicht zu vergleichen. Der Brandgeruch fauligen Fleisches, der sie bei den ständigen Amputationen begleitet hatte, war schlimm genug gewesen. Nun aber hatte sich die Zahl der verkrüppelt Überlebenden verhundertfacht. Der Anblick der von Maschinengewehren, Granatensplittern und von Gas Verstümmelten war so unerträglich, dass allerorts Hospize und geschlossene Heime eingerichtet werden mussten, um der Allgemeinheit den Anblick dieser Unglücklichen zu ersparen. Und in diese Welt wollte Ilka zurück? Nur damit Ture Sjöberg im Gegenzug Deutsch lernen konnte? So war es verabredet gewesen. Wäre er selbst in Ilkas Alter gewesen, ungebunden und noch ohne Familie, Sören hätte sich ernsthaft Gedanken darüber gemacht, Deutschland ganz den Rücken zu kehren und in Schweden zu bleiben.
Das Klingeln des Weckers erinnerte ihn daran, Holzscheite im Kamin nachzulegen. Zwei Eschenkloben die Stunde reichten, um das Haus nicht auskühlen zu lassen. Aber nur, wenn man in der oberen Etage die Türen öffnete. Am Nachmittag würde er Buche nachlegen, um es im Wohnzimmer wohlig zu haben, wenn Tilda nach Hause kam.
«Hast du Mehl und Butter bekommen?» Sie unterstanden hier den Landherrenschaften, wodurch die Ausgabe der Bezugsscheine sowie die entsprechende Verfügbarkeit der Lebensmittel gegenüber den innerstädtischen Bereichen ein sonderbar gelassenes Eigenleben führte. Das betraf auch streng kontingentierte Dinge wie Butter und Mehl. Die wöchentliche Ration lag derzeit bei knapp zwei Kilogramm Brot, 100 Gramm Mehl, sieben Pfund Kartoffeln, 60 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker und einem halben Pfund Zwiebeln pro Kopf. Kartoffeln und Zwiebeln hatten sie selbst im Garten, aber bei Butter und Mehl mussten auch sie anstehen.
Liane nickte und hievte den Leinenbeutel auf den Küchentisch.
«Gibt es Neuigkeiten von David?» Sie reichte Sören die Mittagsausgabe des Hamburger Echos. «In Kiel scheint die Hölle los zu sein. Verdammt! Wüssten wir doch nur Genaues!»
«Nein, keine Neuigkeiten.»
Sören überflog die Spalten der Titelseite, den Deutschen Heeresbericht, zum zehnten Mal den Hinweis auf das gewaltige Ringen der Truppen zwischen Schelde und Oije, die Erklärung, General von Winterfeldt solle an der Westfront die Waffenstillstandsverhandlungen führen, sowie eine Auflistung der absurden Forderungen der Entente an Deutschland. Keine wirklich neuen Schlagzeilen. Selbst der längst überfällige Antrag von Senat und Bürgerschaft auf Anbindung der Walddörfer an die Stadt fand nur beiläufig Erwähnung.
In den lokalen Nachrichten wurde von einem verheerenden Brand in den Eidelstedter Tran- und Fischmehlwerken berichtet, außerdem über einen Gerichtsprozess gegen einen Brotkartenfälscher. Dem Mann drohte eine Zuchthausstrafe von mindestens fünf Jahren. Ein absurdes Strafmaß, das Sören empörte. Man wollte anscheinend ein Exempel statuieren. Aus den Vororten wurde mitgeteilt, dass das Kriegsamt die Durchsetzung des Personenverkehrsbetriebs von Volksdorf nach Großhansdorf mit der Walddörferbahn verhindert hatte. Eigentlich betraf sie das direkt, und er hätte sich abermals aufregen können. Aber Sören suchte nach etwas anderem. Unter den Meldungen aus dem Umland fand er endlich die neuesten Nachrichten aus Kiel.
Die Besatzung der Markgraf, unterstützt von einer großen Menge Werft- und Hafenarbeiter, hatte sich am vergangenen Sonntag auf dem großen Exercierplatz versammelt und lautstark die Freilassung der Schiffsheizer gefordert, die wegen Gehorsamsverweigerung arrestiert worden waren. Die aufgebrachte Menge, der sich immer mehr Personen anschlossen, zog danach weiter zur Waldwiese, wo eine Kompanie der 1. Matrosendivision untergebracht war. Man demolierte das dortige Gebäude, befreite einige der dort arrestierten Kameraden und plünderte schließlich das Waffenlager. Dann zog der Trupp weiter zur inneren Stadt und erreichte, unterstützt von Trommlern und Bläsern, um 7 Uhr abends den Hauptbahnhof. Von dort marschierte man weiter Richtung Feldstraße, um die im Militärgefängnis inhaftierten Meuterer zu befreien. Trotz Warnsalven der dort postierten Maschinengewehrabteilung drängte die Menge ungestüm weiter, woraufhin Feuerbefehl gegeben wurde. Beim folgenden Schusswechsel wurden acht Demonstranten getötet und neunundzwanzig verletzt.
«Unvorstellbar.» Sören atmete tief durch und las weiter.
Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, nahm der Gouverneur die Forderungen der Demonstranten schließlich entgegen und ließ die Arrestanten des 3. Geschwaders frei, woraufhin die ganze bewaffnete Garnison einen großen Umzug durch die Stadt unternahm, um Staatssekretär Haussmann und den Reichstagsabgeordneten Roske vom Bahnhof abzuholen, die inzwischen von der Regierung nach Kiel geschickt worden waren. Für morgen wurde in Kiel ein allgemeiner Sympathie- und Generalstreik angekündigt.
«Das klingt wie der Anfang einer Revolution!»
«Sie haben einen Soldatenrat aufgestellt. Hast du die Forderungen gelesen?»
«Ja. Die sofortige Anerkennung des Rates, eine bessere Behandlung der Mannschaften, die allgemeine Befreiung von der Grußpflicht, eine Verpflegungsgleichheit von Offizieren und Mannschaften, die Aufhebung der Offizierskasinos, die Freigabe der wegen Gehorsamsverweigerung verhafteten Personen sowie keine Bestrafung der nicht auf die Schiffe zurückgekehrten Mannschaften. Ich kann nur hoffen, dass David nichts passiert ist. Wie ich ihn kenne, ist er in der ersten Reihe mitmarschiert.»
Sören faltete die Zeitung zusammen. «Warum meldet er sich nicht?»
«Glaubst du, David würde anrufen? Der hat sicher anderes zu tun. Das ist doch das, was er immer gesagt hat: Eine geschlossene Gruppe muss den Anfang machen, dann werden die anderen mitziehen.» Es klang nicht danach, als würde sie sich ernsthaft Sorgen machen. «Wann kommt eigentlich Robert? Er müsste doch längst …»
«Robert ist heute nach der Schule mit zu Erdings gegangen und übernachtet dort auch. Sie wollen morgen mit der Klasse einen naturkundlichen Ausflug machen.»
«Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Irgendwas mit Fledermäusen und Bibern.»
«Es gibt also nichts zu tun für dich. Willst du heute noch nach St. Pauli?»
«Am liebsten würde ich umgehend nach Kiel fahren.» Liane strich sich fahrig durchs Haar und schob sich ein paar Strähnen hinters Ohr. «Aber was könnte ich dort schon tun?» Vor ein paar Monaten schon hatte sich Liane von ihren filigran geflochtenen Zöpfen getrennt und ihr Haar auf Kinnlänge schneiden lassen, aber Sören hatte sich noch immer nicht an ihre neue Frisur gewöhnt.
«Nein, vorerst sind alle Abendaufführungen im Trichter wegen der Sperrstunde abgesagt. Ich bin heute mit Ora Doelk verabredet. Sie ist Tänzerin und kommt aus Breslau, lebt aber in der Schweiz. Eine Schülerin von Isadora Duncan. Sie möchte im Curio-Haus mit ihrem neuen Programm auftreten. Das soll der Auftakt zu einer Tournee durch Deutschland sein. Wir treffen uns bei Lewandowskis, weil ich denke, Erna käme als begleitende Pianistin in Frage. Ihr braucht mich fürs Abendessen also nicht einzuplanen.»
Als Sören den Brennabor die Einfahrt hinaufknattern hörte, nahm er den Kupferkessel vom Kamin, legte noch ein paar Scheite nach und setzte eine Kanne Tee auf. Eine Kerze sorgte am Essplatz wenigstens für schummriges Licht. Agnes hatte einen Selleriesalat vorbereitet, danach wollte sie gebratene Teltower Rübchen und Petersilienwurzeln mit Meerrettich anrichten. Aber erst, nachdem sich die gnäd’ge Frau ein wenig von den Strapazen des Tages erholt hatte. So wie jeden Tag. Sie hatten es aufgegeben, Agnes diese untertänige Anrede abzugewöhnen. Immerhin hatten sie ihr abringen können, dass sie bei den Mahlzeiten mit ihnen allen am Tisch zu sitzen hatte.
Die schwere, mit Fell gefütterte Lederjacke verbarg Tildas zierliche Figur. Auch ihre Beine blieben zwischen dem dicken Wollrock und den hohen Schaftstiefeln unsichtbar. Mit der Fellmütze und den Ohrklappen sah sie aus wie eine Fliegerin. Die mächtige Brille hatte sie bereits draußen abgesetzt, die Handschuhe folgten gerade.
Der offene Brennabor hatte zwar ein Verdeck, aber zu dieser Jahreszeit musste man sich dennoch warm kleiden, um dem Fahrtwind zu trotzen. Allein deshalb hatte Sören sich Anfang des Jahres schon mehrere geschlossene Coupés angeschaut, aber auch die in Frage kommenden Fahrzeuge, die in den Schauräumen von Hansa Lloyd am Alsterdamm standen, waren mit zwei Sitzreihen fast so voluminös wie Martins früherer Double Phaeton. Und Tilda kam mit dem kleinen, wendigen Zweisitzer einfach besser zurecht.
Nachdem sie sich aus ihrer Montur geschält hatte, umarmte sie Sören, und er drückte ihr einen zärtlichen Kuss auf die eiskalte Stupsnase. Ihre Hände, die trotz der Handschuhe ebenso kalt waren, schob sie vorsichtig unter seine Strickjacke. Nach diesem Begrüßungszeremoniell stellte sie sich rücklings vor den Kamin. Sören brachte ihr eine Tasse heißen Tee und half ihr aus den Stiefeln. Auch mit zweiundfünfzig hatte sie immer noch die Statur einer jungen Frau.
«Ich werde mich nie an diese dunkle Jahreszeit gewöhnen», bibberte Tilda und rührte den Kandis in der Tasse. «Weniger die Kälte als vielmehr die Dunkelheit macht mir zu schaffen. Danke für die Kerze.»
Ihr Lächeln zeigte, dass sie diesen luxuriösen Willkommensgruß sehr genau wahrgenommen hatte.
«Ich kann das Licht der Karbidlampen langsam nicht mehr ertragen. Es kommt mir vor, als würde man ständig in einem Keller leben.»
«Wir könnten uns einen dieser Generatoren kaufen. Ich habe mir letzte Woche Dieselaggregate zur Stromgewinnung von der Firma Körting im Biberhaus vorführen lassen. Sie verbrauchen nicht viel, machen aber einen ganz schönen Lärm. Vielleicht könnten wir so einen Generator hinten beim Hühnerstall unterbringen, dann sollte es erträglich sein.»
«Und dafür legen die Hühner dann keine Eier mehr.» Tilda rang sich ein Lächeln ab und schüttelte den Kopf. «Ein ziemliches Risiko. Mein Frühstücksei ist mir heilig.»
Der immergleiche Versuch, dem alltäglichen Grauen mit makabrer Heiterkeit zu begegnen. Sören hatte sich daran gewöhnt.
«Es gibt sie je nach Leistung in unterschiedlichen Größen. Und wenn wir nur Glühlampen damit betreiben, reicht wahrscheinlich das kleinste Aggregat. Sag, hast du die Abendausgabe mitgebracht?»
«Das Echo gab’s noch nicht. Aber die Neue Hamburger Zeitung war schon da. Was Kiel betrifft, halten sie sich bedeckt. Es scheint, als wolle man dort nicht wahrhaben, was gerade passiert. Die erste Kompanie der Werftdivision ist von Mannschaften der Torpedodivision entwaffnet worden. Es gab dabei weder Tote noch Verwundete. Die angeforderten Infanterieeinheiten aus Flensburg und Neumünster wurden noch auf dem Bahnhof entwaffnet und haben sich den Aufständischen zum größten Teil angeschlossen. Alle Kriegsflaggen sind eingeholt und durch rote Fahnen ersetzt worden. Das dürfte ganz nach Davids Geschmack sein.»
«Hauptsache, ihm ist nichts passiert.»
«Ja. In der Mittagsausgabe war von acht Toten und vielen Verletzten die Rede. Aber er schrieb doch, wir sollen uns keine Sorgen machen.»
«Das sagt sich so einfach. Möchtest du noch Tee?»
«Gerne.» Mathilda reichte Sören die Tasse und rückte sich den Sessel vor den Kamin. «Anscheinend brodelt es auch in Hamburg schon. Wie ich gehört habe, soll es gestern in der Kantine von Blohm + Voss zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Angeblich, weil das Essen zu schlecht war, aber ich denke, das war nur ein Vorwand. Es soll jedenfalls die Parole ausgegeben worden sein, sich mit den Kameraden in Kiel zu verbrüdern. Ich werde morgen im Parteibüro sein, da werde ich mehr erfahren.»
Sören schob einen weiteren Sessel vor den Kamin und postierte ihn so, dass Mathilda ihre Füße auf seine Knie legen konnte. Dann entkorkte er eine Flasche weißen Burgunder und goss sich ein. Um diese Uhrzeit stand ihm nicht mehr der Sinn nach Tee.
«Was gibt es Neues aus Heinrichsdorf? Wie war dein Tag?»
«So wie immer. Bedrückend. Auch wenn es nur drei Tage in der Woche sind. Man kann sich nicht daran gewöhnen. Aber wenn ich die armen Kerle sehe, weiß ich erst, wie gut wir es haben. Ach ja, es ist doch etwas passiert. Ich habe dir doch von dem jungen Offizier erzählt, dem man das halbe Gesicht weggeschossen hat und der nur mit Hilfe eines Schlauchs Nahrung aufnehmen kann.»
«Von Wesselhöft.»
«Ja, Ascan von Wesselhöft.»
«Eine angesehene Familie. Sein Vater sitzt in der Bürgerschaft, Albrecht von Wesselhöft.»
«Mag sein. Ich kann ihn nicht ausstehen.» Es kam selten genug vor, dass in Tildas Worten Abscheu mitschwang. «Er war nur ein einziges Mal bei seinem Sohn. Danach hat er der Genesungsstätte mitgeteilt, dass er selbstverständlich alle Kosten für die Betreuung und Pflege tragen würde. Dabei sagte er doch tatsächlich, es könne ja nicht sein, dass sein Sohn als Krüppel auch noch dem Volk zur Last falle. Es reiche schon, dass er nicht wie Seinesgleichen den ehrenhaften Heldentod gestorben sei. Stell dir das vor. Das hat er wörtlich so zu Doktor Reuter gesagt. Ich war dabei.»
«Ja, der Krieg hat viele Menschen verkrüppelt. Die einen körperlich, die anderen seelisch.»
«Jedenfalls ist Ascan von Wesselhöft verschwunden. Heute Morgen war sein Bett leer.»
«Wie, verschwunden? Ich dachte, jemand wie er kann nicht allein für sich sorgen und ist auf ganztägige Hilfe angewiesen.»
«Wir können es uns auch nicht erklären und stehen vor einem Rätsel. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Er hat ja nicht nur diese furchterregende Verletzung im Gesicht, sondern ist auf der linken Seite auch fuß- und armamputiert. Man hat ihm zwar eine hölzerne Prothese für den verlorenen Fuß angepasst, sodass er mit Hilfe zweier Krücken hätte aufstehen können, aber dazu hat ihm bislang der Wille gefehlt. Wir haben das ganze Areal abgesucht. Nirgends eine Spur von ihm. Undenkbar, dass er die Anlage ohne fremde Hilfe verlassen hat.»
«Was denkt ihr? Sein Vater?»
«Nein, bestimmt nicht. Wir haben die von Wesselhöfts natürlich verständigt. Die waren außer sich. Aber es war wohl mehr Zorn als Sorge. Doktor Reuter musste sich am Telefon die wüstesten Beschimpfungen anhören. Er hat das Gespräch dann mit dem Hinweis beendet, dass das Genesungsheim schließlich kein Gefängnis, sondern eine Heilstätte sei.»