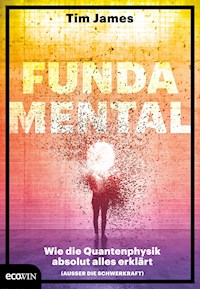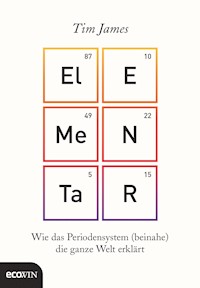
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Sprache: Deutsch
Die Bausteine, aus denen unsere Welt gemacht ist Welche Flüssigkeit kann sich durch eine Mauer hindurchbewegen? Was ist das chemische Symbol für Menschlichkeit? Und welches ist die stärkste Säure, die je hergestellt wurde? Diese und viele andere Fragen mehr beantwortet das Periodensystem: Mit viel Detailwissen und Faszination sowie einer guten Portion Humor zeigt uns der passionierte Naturwissenschaftler Tim James, was wir daraus für unser alltägliches Leben lernen können. Vor rund 14 Milliarden Jahre bestand unser Universum aus einer endlosen Partikelsuppe, die vor sich hin schäumte, viele Male heißer als die Sonne. Als es sich dann ausweitete, kühlte die Suppe glücklicherweise ab und die Partikel festigten sich – die Elemente wurden geboren. Heute gibt es davon 118, und wir sind in der Lage, alle Zutaten, die unsere Welt ausmachen, zu identifizieren. In seinem Buch erzählt der leidenschaftliche Chemie-Experte Tim James die Geschichte des Periodensystems, von seinen Anfängen im Alten Griechenland bis hin zu den Alchemisten der Gegenwart. Auf informative und unterhaltsame Weise zeigt er uns, wie diese abstrakte und scheinbar durcheinandergewürfelte Grafik unser Leben bestimmt und wie die Substanzen darin unsere Welt schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tim James
ELEMENTAR
Wie das Periodensystem (beinahe)die ganze Welt erklärt
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Elemental.
How the Periodic Table Can Now Explain (Nearly) Everything bei Robinson, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
Die Illustrationen im Buch stammen vom Autor. Die Rechte für die Porträtillustration auf Seite 256 liegen bei © Claudia Meitert/carolineseidler.com.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2019
Copyright © 2018 by Tim James
Alle Rechte der deutschen Ausgabe © 2019 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Redaktion: Usch Kiausch, Mannheim
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus Palatino, Adobe Caslon, DIN
Umschlaggestaltung: www.b3k-design.de, Andrea Schneider, diceindustries,nach einer Vorlage von Andy Allen
ISBN 978-3-7110-0221-0
eISBN 978-3-7110-5253-7
Den Schülern derNorthgate High School gewidmet
Inhalt
Einleitung: Eine Rezeptur für alles, was ist
1Flammenjäger
2Unzerschneidbar
3Das Maschinengewehr und der Kuchen
4Woher kommen die Atome?
5Block für Block
6Die Quantenmechanik sorgt für Klarheit
7Entzündliche Krachmacher
8Der Traum des Alchemisten
9Die Linken
10Säuren, Kristalle und Licht
11Es ist lebendig! Es ist lebendig!
12Neun Elemente, die die Welt veränderten (und eines, das es nicht tat)
Anything else? (Ein Anhang)
Dank
Anmerkungen
Über den Autor
Einleitung Ein Rezept für alles, was ist
Vor circa 14 Milliarden Jahren entschloss sich unser Universum zu existieren. Wir wissen nicht, was davor war (falls es ein Davor gab). Wir wissen nur, dass das Universum begann, sich in alle Richtungen auszudehnen und seit damals nicht damit aufgehört hat.
In den ersten Nanosekunden nach dem Urknall bestand alles Seiende aus einer glühenden Partikelsuppe. Der Teilchenschaum war Millionen Mal heißer als die Sonne. Doch als sich die Partikel im wachsenden Universum verteilten und stabilisierten, kühlten sie ab, und es wurden, vereinfacht gesagt, die Elemente geboren.
Die Elemente sind die Bausteine, mit denen die Natur den Kosmos bastelt; sie sind die reinsten Stoffe, aus denen einfach alles entsteht, von der Roten Bete bis zum Rennrad. Das Studium der Elemente und ihrer Einsatzgebiete bezeichnen wir als Chemie. Bedauerlicherweise klingt dieses Wort in den Ohren vieler Leute verdächtig.
Auf einer beliebten Gesundheitswebsite beklagte sich kürzlich ein Autor über die »Chemikalien in unserem Essen« und gab Ratschläge dazu, was man tun könne, um sich von Lebensmitteln »ohne Chemie« zu ernähren. Solche Panikmacher scheinen zu glauben, dass Chemikalien Giftstoffe sind, die von verrückten Wissenschaftlern im Labor erzeugt werden. Diese Vorstellung ist natürlich vollkommen abwegig. Nicht nur die Flüssigkeiten, die in den Reagenzgläsern blubbern, sind Chemikalien: Auch die Reagenzgläser sind Chemikalien.
Die Kleidung, die Sie tragen, die Luft, die Sie atmen, und die Buchseite, die Sie gerade lesen, bestehen allesamt aus Chemikalien. Wenn Sie keine Chemikalien in Ihren Lebensmitteln wollen, muss ich Ihnen leider sagen, dass es ohne Chemikalien keine Nahrung für Sie geben wird – denn alle Lebensmittel sind Chemikalien.
Nehmen wir an, wir mischen zwei Teile des Elements Wasserstoff mit einem Teil Sauerstoff. Die wissenschaftliche Schreibweise für diese Mischung ist H2O: Wasser ist die berühmteste Chemikalie der Welt. Wenn wir ein bisschen des Elements Kohlenstoff dazutun, erhalten wir C2H4O2 – Essig. Wenn wir ein Molekül zusammenbauen, das dreimal so viele Atome jedes dieser Elemente enthält, so erhalten wir C6H12O6, eine Chemikalie, die allgemein unter dem Namen Zucker bekannt ist.
Der Unterschied zwischen Kochkunst und Chemie ist, dass uns ein Kochrezept verrät, aus welchen Gemüsesorten sich eine Speise zusammensetzt, während die Chemie auf einer tieferen Ebene funktioniert und untersucht, woraus sich das Gemüse zusammensetzt. Es gibt praktisch keine Grenze für die Beschreibung der Dinge, wenn wir einmal wissen, aus welchen Elementen sie bestehen. Nehmen wir zum Beispiel das folgende Monster:1
H375,000,000O132,000,000C85,700,000N6,430,000Ca1,500,000P1,020,000S206,000Na183,000
K177,000Cl127,000Mg40,000Si38,600Fe2,680Zn2,110Cu76,I14Mn13F13Cr7Se4Mo3Co1
Man sollte meinen, das sei etwas, was man in einem Giftmüllfass finden kann. Tatsächlich ist es der chemische Ausdruck für die Zusammensetzung des menschlichen Körpers. Sie müssen alle diese Werte mit 700 Billionen multiplizieren, aber sie geben den jeweiligen Anteil der einzelnen Elemente im menschlichen Körper korrekt wieder. Wenn Ihnen also jemand sagt, dass er der Chemie misstraut, so können Sie ihn beruhigen: Er selbst besteht aus Chemie.
Die Chemie ist keine abstrakte Wissenschaft, die in dubiosen Laboratorien stattfindet: Sie findet überall in unserer Umgebung und in uns selbst statt.
Um die Chemie verstehen zu können, müssen wir das Periodensystem der Elemente verstehen, dieses bedrohliche Gebilde, das Ihnen wahrscheinlich aus der Schulzeit in Erinnerung geblieben ist. Da hing die Periodentafel wie ein Damoklesschwert an der Wand im Chemielabor, mit all diesen Feldern, Buchstaben und Zahlen. Aber das Periodensystem ist eigentlich nichts anderes als eine Liste der Zutaten des Lebens, und wenn wir es entschlüsseln können, wird es zu einem unserer wichtigsten Verbündeten in dem Bemühen, das Universum zu verstehen.
Die Periodentafel der Elemente ist tatsächlich sonderbar und sie ist tatsächlich kompliziert. Aber dasselbe gilt für die Natur. Darin liegt ihr Wert. Darin liegt ihre Schönheit.
1 Flammenjäger
Die am leichtesten entflammbare Substanz, die je erzeugt wurde
Die Wissenschaft von der Chemie entstand im Grunde, als es unseren Vorfahren erstmals gelang, eine chemische Reaktion auszulösen, das heißt, als sie es erstmals schafften, Dinge in Brand zu setzen. Die Fähigkeit, Feuer zu erzeugen und es zu beherrschen, ermöglichte es den Menschen der Frühzeit, zu jagen, zu kochen, Raubtiere abzuschrecken, sich im Winter warmzuhalten und primitive Werkzeuge herzustellen. Anfangs verbrannten die Menschen Dinge wie Holz und Fett, aber im Lauf der Zeit stellte sich heraus, dass die meisten Substanzen brennbar sind.
Dinge brennen, weil sie in Kontakt mit Sauerstoff kommen, einem der reaktionsfreudigsten Elemente überhaupt. Dass die Dinge nicht unentwegt in Flammen aufgehen, hat einen einzigen Grund: Sauerstoff ist zwar sehr reaktionsfreudig, aber für die Reaktion mit einem anderen Stoff braucht er Energie. Daher ist zumeist Hitze oder Reibungsenergie erforderlich, um ein Feuer zu entfachen. Sauerstoff muss erhitzt werden, um zu entflammen.
Die am leichtesten entflammbare Chemikalie, die je erzeugt wurde, ist jedoch sehr viel reaktionsfreudiger als Sauerstoff. Sie wurde im Jahr 1930 von zwei Forschern namens Otto Ruff und Herbert Krug entwickelt.2 Darf ich vorstellen: Chlortrifluorid.
Diese Chemikalie, die im Verhältnis 1 zu 3 aus Chlor und Fluor besteht, besitzt die einzigartige Fähigkeit, praktisch alles in Brand zu setzen, mit dem sie in Kontakt kommt, einschließlich von Flammschutzmitteln.
CIF3 ist ein farbloses bis hellgelbes Gas, das bei circa 12 Grad Celsius in einen flüssigen Zustand übergeht und dann eine gelbgrüne Farbe annimmt. Es erstarrt bei –76,3 Grad Celsius. Als Feststoff ist es farblos. Mit Wasser reagiert Chlortrifluorid explosionsartig, setzt es in Brand und dabei Sauerstoff frei. Bei dieser Reaktion entsteht Fluorwasserstoffsäure.3 Es verbrennt auch Glas und Sand und lässt auch Asbest und Kevlar entflammen. (Kevlar ist das Material, aus dem die Schutzanzüge von Feuerwehrmännern gemacht sind.) Es gibt jedoch nur sehr wenige Anwendungsgebiete für CIF3, was eben daran liegt, dass es fast alles verbrennt, mit dem es in Kontakt kommt. Man muss schon sehr verrückt sein, um zu denken: »Interessant, das könnte ich einmal ausprobieren.«
Der spektakulärste Zwischenfall mit Chlortrifluorid ereignete sich in einer Chemieanlage in Shreveport (Louisiana) – wann genau, ist nicht bekannt. In einem versiegelten Metallbehälter wurde eine größere Menge der Chemikalie, die unter den Gefrierpunkt abgekühlt worden war, um eine Reaktion mit dem Metall zu verhindern, durch die Fabrik bewegt. Doch die extrem niedrige Temperatur (Chlortrifluorid geht erst bei –76,3 Grad Celsius in den festen Zustand über) hatte das Metall brüchig gemacht: Der Behälter zerbrach, und sein Inhalt verteilte sich über den Boden. Das Chlortrifluorid setzte sofort den Boden der Fabrikhalle in Brand und fraß sich über einen Meter durch den Zement, bevor es durch die Reaktion aufgezehrt war. Der Mann, der den Behälter befördert hatte, wurde Berichten zufolge 150 Meter durch die Luft geschleudert und starb durch Herzstillstand. So viel zu der Möglichkeit, Chlortrifluorid einzufrieren.4
In den 1940er-Jahren versuchten einige Länder, CIF3 als Treibstoff für Raketen zu nutzen, aber da es sämtliche Raketen in Brand setzte, wurden diese Versuche bald wieder eingestellt.
Ernsthafte Versuche, die Reaktionsfähigkeit dieser Chemikalie zu nutzen, unternahmen nur die nationalsozialistischen Waffenentwickler im Bunker Falkenhagen.5 Sie wollten Chlortrifluorid in Flammenwerfern einsetzen, aber da die Flammenwerfer samt Bedienungspersonal in Flammen aufgingen, mussten sie ihr Vorhaben aufgeben.
Man stelle sich das vor: Chlortrifluorid setzt nicht nur Wasser in Brand, sondern ist so bösartig, dass sogar die Nazis lieber die Finger davon ließen. Aber warum ist diese Substanz so ungeheuer aggressiv?
Die Antwort ist, dass sich Fluor ganz ähnlich verhält wie Sauerstoff, jedoch weniger Energie braucht, um mit anderen Elementen zu reagieren. Es ist das reaktionsfreudigste Element überhaupt und sticht den Sauerstoff in dem Bemühen aus, andere Elemente aufzuzehren. Und wenn es sich mit dem Element zusammentut, das den zweiten Platz in der Rangliste der reaktionsfreudigen Stoffe einnimmt – Chlor –, entsteht eine unselige Allianz, die Feuer entfacht, ohne dass man sie dazu ermutigen müsste.
Brennendes Wasser
Der griechische Philosoph Heraklit liebte das Feuer so sehr, dass er es zur reinsten Substanz erklärte, zu dem Stoff, aus dem die Welt gemacht sei. Heraklit war davon überzeugt, dass alles auf die eine oder andere Art seinen Ursprung im Feuer habe. Das Feuer war in seinen Augen also elementar.
Heraklits Vorstellung ist nachvollziehbar, denn das Feuer scheint wirklich magische Eigenschaften zu besitzen. Es sollte jedoch nicht verschwiegen werden, dass Heraklit sich von Gras ernährte und versuchte, seine Wassersucht zu heilen, indem er sich drei Tage lang in Kuhdung legte (anschließend wurde er von Hunden gefressen).6 Vermutlich sollten wir Heraklits naturwissenschaftliche Theorien mit Vorsicht betrachten.
Es hat einen Grund, dass es den Menschen in der Antike so schwerfiel, die Elemente zu identifizieren: Die frühen Philosophen konnten nicht wissen, dass nur wenige Elemente in Reinform vorkommen. Die meisten sind instabil und treten nur in Verbindung mit anderen Elementen auf.
Es funktioniert ähnlich wie in einer Singlebar: Die Gäste einer solchen Bar sind alle unglücklich allein und auf der Suche nach einem Partner. Am Ende des Abends sind die meisten Gäste Verbindungen eingegangen, was die allgemeine Stabilität erhöht.
Nur einige wenige Elemente wie zum Beispiel Gold, dem es nichts ausmacht, für sich zu bleiben, verharren in ihrer Reinform.
Fast alle Stoffe, die wir in der Natur finden, sind Verbindungen. Substanzen wie Speisesalz mögen rein wirken, aber das ist eine Täuschung: Salz ist eine Verbindung von Natrium und Chlor, die wirklich elementare Stoffe sind.
Sie werden nie einen Klumpen Natrium in der Erde finden oder eine Chlorwolke vorbeiziehen sehen, denn beide Elemente sind sehr reaktionsfreudig. Die Folge ist, dass sie kaum erkennbar sind, vor allem, wenn man mit ähnlich rudimentären Laborwerkzeugen arbeiten muss wie die Wissenschaftler der Antike.
Zu berücksichtigen ist auch, dass viele Elemente ausgesprochen selten vorkommen. Nehmen wir beispielsweise Protactinium, ein Zerfallsprodukt von Uran, das von den Atomphysikern in der Forschung verwendet wird: Der weltweite Vorrat besteht in einem einzigen Klümpchen, das 125 Gramm wiegt und im Besitz der britischen Atomenergiebehörde ist.7 Es ist kaum verwunderlich, dass es den griechischen Philosophen nicht gelang, die Elemente richtig zu verstehen.
Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wies ein deutscher Alchemist namens Hennig Brand nach, dass alltägliche Stoffe aus verschiedenen Elementen bestanden und die meisten Substanzen, die man bis dahin für rein gehalten hatte, keineswegs rein waren.
Im Jahr 1669 brachte Brand eines Nachts in seinem Labor große Mengen Urin zum Kochen (man braucht schließlich einen Zeitvertreib). Für diese Substanz hatte er sich vermutlich entschieden, weil Urin goldfarben ist: Brand hoffte, ein reicher Mann zu werden, indem er die Flüssigkeit zu dem Edelmetall verfestigte.
Nachdem er viele Stunden mit dieser zweifellos unangenehmen Beschäftigung verbracht hatte, hatte Brand schließlich einen zähflüssigen roten Sirup eingekocht und einen schwarzen Rückstand gewonnen, der Ähnlichkeit mit den Überresten verkohlten Brots hatte. Er vermischte die beiden Substanzen und erhitzte die Mischung erneut. Nun geschah etwas, auf das sich der Forscher keinen Reim machen konnte.
Seine Mischung aus Urinsirup und Kohle verwandelte sich plötzlich in eine wachsartige feste Substanz, die stark nach Knoblauch roch und blaugrün glühte. Obendrein war sie extrem leicht entzündlich und erzeugte eine blendende weiße Flamme. Irgendwie war es Brand gelungen, aus Wasser Feuer zu gewinnen.
Er nannte diesen Stoff phosphorus. Den Namen leitete er vom griechischen Wort für »Lichtbringer« ab. Die folgenden sechs Jahre verbrachte Brand damit, heimlich mit diesem Stoff zu experimentieren. Es waren keine vergnüglichen sechs Jahre: Um 60 Gramm Phosphor zu gewinnen, musste der unermüdliche Forscher fünfeinhalb Tonnen Urin eindampfen.
Nachdem seine Experimente das Vermögen seiner Frau aufgezehrt hatten, ging Brand mit der Entdeckung an die Öffentlichkeit und verkaufte den Phosphor an den Alchemisten Johann Daniel Kraft, der die Leuchtkraft des Phosphors an Fürstenhöfen und in wissenschaftlichen Einrichtungen in ganz Europa vorführte.8
Doch die genaue Methode der Phosphorerzeugung hielt Brand nach wie vor geheim. Dass seinerzeit niemand sein Geheimnis aufdeckte, ist stets ein Rätsel geblieben. Er muss sich wohl eine tolle Geschichte ausgedacht haben, um seinen Riesenbedarf an Urin zu erklären.
Heute verstehen wir genau, was Brand damals tat. Der menschliche Organismus braucht täglich zwischen 0,5 und 0,8 Gramm Phosphor, aber da dieses Element in fast allem enthalten ist, was wir essen, übersteigt unsere tatsächliche Phosphoraufnahme die empfohlene Menge in der Regel um das Doppelte. Der überschüssige Phosphor wird mit dem Urin ausgeschieden. Hennig Brand beseitigte durch das Eindampfen einfach alle anderen Bestandteile des Harns.
Seine Entdeckung war ein Wendepunkt in der chemischen Forschung, denn der von ihm gewonnene Phosphor unterschied sich deutlich von der Substanz, aus der Brand ihn gewonnen hatte. Urin leuchtet nicht im Dunkeln (was schade ist), aber offenkundig enthält er einen Stoff, der es sehr wohl tut. Brands Experimente hatten bewiesen, dass es Stoffe gibt, die wir nicht sehen können, obwohl wir sie vor der Nase haben. Die elementaren Stoffe lagen nun nicht mehr außerhalb jeder menschlichen Reichweite.
Die Männer, die mit dem Feuer spielten
Gestützt auf die neue Erkenntnis, dass allgegenwärtige Substanzen aus nicht sichtbaren elementaren Stoffen bestehen können, entschloss sich Georg Ernst Stahl, ein weiterer deutscher Forscher, Anfang des 18. Jahrhunderts, eine Erklärung für das Feuer vorzulegen.
Wenn Metalle verbrennen, entstehen farbige Pulver. Zu jener Zeit wurden sie als »Metallkalke« (Metalloxide) bezeichnet. Aus der Tatsache, dass diese Metallkalke nur schwer entzündlich waren, schloss Stahl, dass sie Elemente sein mussten, die kaum brannten, weil ihnen das Feuer entzogen worden war.
Seine Hypothese lautete, dass alles, was brennbar ist, einen Stoff enthalten muss, der bei Erhitzung in die Luft entweicht, sodass nur die verkohlten Überreste der ursprünglichen Substanz übrig bleiben. Dieser Stoff wurde nun als »Phlogiston« bezeichnet, abgeleitet vom griechischen phlogizein (»brennen«). Stahl glaubte, ein Verbrennungsprozess bestehe in der Trennung des Phlogiston vom Metallkalk.9
Stahls Feuerhypothese war bedeutsam, denn anders als frühere chemische Theorien konnte man sie überprüfen. Wenn sie zutraf, sollte es möglich sein, das Phlogiston einzufangen und mit einem Metallkalk zu verbinden, um das ursprüngliche Metall wiederherzustellen. Indem Stahl eine Behauptung aufstellte, die widerlegt werden konnte, stellte er eine wissenschaftliche Hypothese auf – die sich wie die meisten wissenschaftlichen Hypothesen rasch als falsch erwies.
Die ersten Zweifel an der Phlogistontheorie weckte der französisch-britische Forscher Henry Cavendish (1731–1810). Dieser für seine Schüchternheit und seine ausgefallene Möbelsammlung bekannte Mann genießt wegen seiner Beiträge zum Nachweis der Schwerkraft große Anerkennung bei den Physikern. Sein wichtigster Beitrag zur Chemie bestand in einer Reihe von Experimenten mit Säuren und Eisen.
Bei der Reaktion zwischen Eisen und einer Säure wurde stets ein unsichtbares Gas freigesetzt, das Cavendish zu sammeln begann. Anfangs glaubte er, es sei ihm gelungen, das Phlogiston einzufangen, doch dann entdeckte er etwas Sonderbares: Das Gas war explosiv.10 Wenn das Feuer dadurch entstand, dass das Phlogiston entwich, wie konnte dann das Phlogiston selbst brennen? Wie konnte das Phlogiston aus sich selbst entweichen?
Und es geschah etwas, das noch seltsamer war: Als das von Cavendish gesammelte Gas (das er als entflammbare Luft bezeichnete) explodierte, entstand reines Wasser. Wenn man Wasser aus anderen Stoffen gewinnen konnte, so folgerte Cavendish, war Wasser möglicherweise ebenfalls kein Grundstoff.
Der häretische englische Geistliche Joseph Priestley stieß im Jahr 1774 auf ein weiteres Rätsel. Priestley experimentierte mit dem »Metallkalk« von Quecksilber (mit dem roten Quecksilberoxid, das man erhält, wenn man Quecksilber verbrennt) und lenkte mit einem Brennglas Sonnenstrahlen darauf. Er beobachtete, dass die Reaktion ein Gas freisetzte.11 Er fing es ein und stellte fest, dass andere Dinge darin sehr viel besser brannten als in normaler Luft. Was für ein Gas es auch sein mochte: Es war offensichtlich gut dazu geeignet, das Phlogiston zu beseitigen. Natürlich musste dieses Gas frei von Phlogiston sein, weil es in der Lage war, das Phlogiston zu absorbieren. Daher bezeichnete er es als »dephlogistierte Luft«.
Zweihundert Jahre früher hatte der polnische Alchemist Michał Sędziwój entdeckt, dass die Luft aus einer Mischung von zwei Gasen bestehen musste. Das eine Gas war seiner Meinung nach »der Nährstoff des Lebens«, das andere Gas schien ihm nutzlos.12 Konnte es sein, dass hier ein Zusammenhang bestand?
Priestley entschloss sich, Mäuse in einen mit dephlogistierter Luft gefüllten versiegelten Behälter zu setzen, und stellte fest, dass sie keinen Schaden nahmen. Er testete das Gas auch an sich selbst und entdeckte, dass ihn die Inhalation in eine euphorische Stimmung versetzte, weshalb er zu dem Schluss gelangte, dass dieses Gas der normalen Luft vorzuziehen sei. Sędziwójs lebensspendendes Gas war anscheinend dasselbe wie Priestleys dephlogistierte Luft.
Priestley entdeckte auch, dass Pflanzen dieses Gas offenbar abgaben und einen Raum, in dem etwas verbrannt worden war, wieder mit Atemluft füllten. All das war sehr verwirrend. Feuer erzeugte Wasser, Metalle erzeugten Feuer, Pflanzen erzeugten Luft … Was war da los?
Es wird für Ordnung gesorgt
Gelöst wurden diese Rätsel im Jahr 1775 von dem französischen Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier, mit dem Priestley seine Erkenntnisse über das Phlogiston geteilt hatte.
Lavoisier war von Beruf Steuereintreiber im Staatsdienst, aber seine wahre Leidenschaft galt der Wissenschaft. Er hatte bereits eine Weile mit »Metallkalken« experimentiert, als er von Priestleys Experimenten erfuhr.13 Nun entschloss er sich, die Phlogiston-Theorie zu überprüfen: Wenn Feuer dadurch entstand, dass das Phlogiston aus einem Metall entwich, musste der zurückbleibende Metallkalk zwangsläufig weniger wiegen als der Ausgangsstoff.
Priestley hatte versucht, bei seinen Versuchen mit Quecksilberoxid Messungen anzustellen, aber im 18. Jahrhundert existierten noch keine Präzisionsmessgeräte. Wie sollte man eine Pulvermenge, die 1 Gramm wog, von einer Menge unterscheiden, die 1,1 Gramm wog? Das war eine große Herausforderung.
Um sich Klarheit zu verschaffen, entschloss sich Lavoisier, Priestleys Experiment in größerem Maßstab zu wiederholen. Den Unterschied zwischen 1000 und 1100 Kilogramm konnte man zweifellos mit bloßem Auge erkennen. Also gab Lavoisier den Bau eines Brennglases mit circa drei Metern Durchmesser in Auftrag und erhitzte mit Hilfe des Sonnenlichts eine große Menge Quecksilber.14
Die Ergebnisse ließen keinen Zweifel zu: Der durch Verbrennung erzielte »Quecksilberkalk« (das Quecksilberoxid) wog mehr als der Ausgangsstoff. Bis dahin war das Gegenteil angenommen worden. Lavoisier erkannte, dass beim Verbrennen nicht das Phlogiston aus einem Stoff entfernt wurde, sondern dass aus der Luft etwas hinzugefügt wurde. Substanzen wie Metalle und Phosphor waren die elementaren Stoffe, und das Feuer war das, was auftrat, wenn sie mit dem von Priestley entdeckten Gas reagierten.
Dies war eine brillante Erkenntnis, aber auch Lavoisier irrte in einem Punkt. Er nahm an, Priestleys Gas sei auch für den sauren Geschmack von Säuren verantwortlich. Daher nannte er es oxygène nach dem griechischen oxysgenes, »Sauermacher«.
Das explosive Gas, das Henry Cavendish isoliert hatte, war ein anderes Element (das nicht im Metall, sondern in der Säure enthalten war), und wenn man es mit Sauerstoff erhitzte, entstand Wasser. Lavoisier nannte dieses Gas hydrogène (griechisch hydros-genes, »Wassermacher«). Das war der Wasserstoff.15
Diese neuen Erkenntnisse erklärten auch, warum man in einem Raum nicht atmen konnte, nachdem dort ein großes Feuer gebrannt hatte. Es lag nicht daran, dass das Feuer eine giftige Substanz abgab, sondern daran, dass die Luft teilweise aus dem »Sauerstoff« bestand, der im Feuer verbrannt wurde, sodass nur das andere Gas zurückblieb.
Schließlich stellte sich heraus, dass dieses nutzlose Gas unter extremen Bedingungen Verbindungen einging, bei denen Nitrat (Salpeter) entstehen konnten, einer der Hauptbestandteile von Schießpulver, weshalb der Staatsmann Jean-Antoine Chaptal es auf den Namen nitregène taufte. Die englische Bezeichnung nitrogen wurde davon abgeleitet (deutsch: Stickstoff).
Die Wissenschaft macht immer dann einen Fortschritt, wenn eine Hypothese widerlegt wird. Mit seinen Experimenten machte Lavoisier der Phlogistontheorie den Garaus. Wie sich herausstellte, war Luft eine Mischung aus Stickstoff und Sauerstoff, Wasser war eine Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff, und Feuer war eine Reaktion zwischen Sauerstoff und beliebigen Chemikalien. Weder Luft noch Wasser oder Feuer waren elementare Stoffe.
Für seine Bemühungen wurde Lavoisier im Mai 1794 mit einem Gang zur Guillotine belohnt. Einer der Gründe für seine Verurteilung war möglicherweise, dass er im vorrevolutionären Frankreich als Steuereintreiber gearbeitet und sich damit sehr unbeliebt gemacht hatte, wahrscheinlicher ist jedoch, dass er in Ungnade fiel, weil er Jean-Paul Marat, einen führenden Kopf der Revolution, als untalentierten Wissenschaftler bloßgestellt hatte. Ein unglückliches Ende für einen brillanten Kopf.
Noch viel größeres Pech hatte ein Chemiker namens Carl Wilhelm Scheele.
Der größte Unglücksrabe in der Geschichte der Chemie
Cavendish, Lavoisier und Priestley waren Genies einer neuen Wissenschaft, der sich rasch weitere Forscher anschlossen, die auf ewigen Ruhm durch die Entdeckung eines neuen Elements hofften. Allerdings besteht nicht immer Einigkeit darüber, wer eine Entdeckung für sich in Anspruch nehmen darf.
Einige Elemente sind seit der Antike bekannt, weshalb wir unmöglich wissen können, wer sie als Erster entdeckte. In dreitausend Jahre alten Passagen des Alten Testaments ist von Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zinn, Schwefel und Eisen die Rede. Bei Jesaja 54,16 wird beispielsweise auch die Herstellung von im Feuer geschmiedeten Waffen erwähnt.
Sodann gibt es Fälle, in denen ein Forscher die Existenz eines Elements voraussagte, ohne es tatsächlich isolieren zu können. Zum Beispiel gelangte Johan August Arfwedson im Jahr 1817 zu der Überzeugung, dass sich im Mineral Petalit ein Element verbarg, das er nach dem griechischen lithos (»Felsen«) als Lithium bezeichnete. Der Erste, dem es gelang, das Element zu isolieren, war jedoch William Thomas Brande, der das Kunststück im Jahr 1821 zuwege brachte.16
Um Verwirrung zu vermeiden und die Debatten über die Entdeckung von Elementen zu klären, wird normalerweise die erste Person genannt, der eine Isolierung gelingt: Die Anerkennung gilt nicht unbedingt dem Entdecker, sondern dem Forscher, der eine reine Probe eines elementaren Stoffs in der Hand hält und als solche erkennt. Was uns zu dem deutsch-schwedischen Chemiker Carl Wilhelm Scheele führt.
Im Jahr 1772 gelang es Scheele, ein braunes Pulver zu gewinnen, das er auf den Namen Baryt taufte (abgeleitet von dem griechischen Wort barys, das »schwer« bedeutet). Scheele wusste, dass sich in dem Pulver, das wir heute als Bariumoxid kennen, ein Element versteckte. Aber der Mann, der es schaffte, Barium zu isolieren und sich den Entdeckerruhm zu sichern, war nicht Scheele, sondern Humphry Davy.
Zwei Jahre nach der Entdeckung des Bariums gewann Scheele das Gas Chlor (vom griechischen chloros, »grün«), erkannte jedoch nicht, dass es sich um ein Element handelte. Einmal mehr war es Davy, der das erkannte und im Jahr 1808 die Lorbeeren für die Entdeckung einheimste.
Ebenfalls im Jahr 1774 entdeckte Scheele das Manganoxid (Pyrolusit), konnte das darin enthaltene elementare Mangan jedoch nicht isolieren. Das gelang wenige Monate später seinem Kollegen Johan Gottlieb Gahn.
1778 setzte sich Scheeles Pechsträhne fort: Er erzeugte Molybdänoxid und vermutete, dass es sich um das Oxid eines bisher unbekannten Elements handelte. Isoliert wurde Molybdän jedoch erst drei Jahre später von Peter Hjelm.
1781 gewann Scheele ein Oxid, aus dem Fausto Elhuyar elementares Wolfram isolierte. Den Ruhm erntete Elhuyar.17
Und damit nicht genug: Im Jahr 1771, drei Jahre vor Priestley, entdeckte Scheele sogar den Sauerstoff – aber der Druck seiner Schrift, in der er über die Entdeckung berichtete, verzögerte sich, und als seine Ergebnisse endlich veröffentlicht wurden, war ihm Priestley bereits zuvorgekommen.18
Um an Scheeles zahlreiche Beiträge zur Chemie zu erinnern, wurde das Mineral Tung Sten (das Wolfram enthält) in Scheelit umbenannt – aber einmal mehr wurde Scheeles Name aus den Geschichtsbüchern entfernt, denn schließlich erhielt das Mineral die offizielle Bezeichnung Calciumwolframat. Wenn es einen Gott der Chemie gibt, so hegt er offenbar eine Abneigung gegen Carl Wilhelm Scheele.
2 Unzerschneidbar
Diamanten, Erdnüsse und Leichen
Im Jahr 1812 entwickelte der deutsche Chemiker Friedrich Mohs eine von 1 bis 10 reichende Skala zur Einstufung der Härte von Mineralen. Zahnschmelz hat einen Härtegrad von 5, während Eisen lediglich auf einen Wert von 4 kommt. Das bedeutet, dass Ihre Zähne theoretisch in der Lage sind, einen Eisenklumpen zu zermahlen, obwohl ich Ihnen davon abrate, es auszuprobieren. Denn wenn Sie versehentlich auf Stahl beißen (das heißt auf mit Kohlenstoff verunreinigtes Eisen), werden Sie es bereuen – diese Mischung hat nämlich einen Härtegrad von etwa 7,5.
Der Wert 10 wurde ursprünglich an den Diamanten vergeben, denn er war seinerzeit das härteste bekannte Mineral. Aber im Jahr 2003 wurde er vom Thron gestoßen, als es einer japanischen Forschergruppe gelang, einen noch härteren Super-Diamanten zu erzeugen.
Eine populäre Erklärung für die Entstehung von Diamanten ist, dass Kohle (fossilisierte Pflanzen) im Erdinneren derart großem Druck ausgesetzt wird, dass sie schließlich extrem hart und transparent wird. Das zumindest haben viele von uns in der Grundschule gelernt. Es ist ein Mythos. Diamanten entstehen nur unter sehr viel extremeren Bedingungen.
Im selben Jahr, in dem der Super-Diamant entwickelt wurde, wartete auch Hollywood mit einer unglaublichen Schöpfung auf: Den Science-Fiction-Film The Core (der deutsche Titel lautet The Core – Der innere Kern) muss man gesehen haben, um zu verstehen, warum er so unglaublich ist. Zu den Glanzlichtern des Films zählen ein Mann, der von einem Laptop aus das globale Internet hackt, Sonnenlicht, das stark genug ist, die Golden Gate Bridge einzuschmelzen, und Hilary Swank, die eine Raumfähre im San Fernando Valley landet.
Mir hat es insbesondere eine Szene angetan: Ein Forscherteam wird in den Erdmantel hinuntergeschickt, um den Kern des Planeten mit einer Atombombe zu sprengen, und muss auf dem Weg Diamanten ausweichen, die so groß wie Häuser sind.19
Interessant an dieser Szene ist, dass sie durchaus realistisch wirkt, wenn man davon absieht, dass Riesendiamanten unwahrscheinlich sind. Denn Diamanten entstehen tatsächlich im Erdmantel, nicht in der Kruste.
Ein Diamant besteht ausschließlich aus Kohlenstoff, und seine Entstehung dauert mehrere Milliarden Jahre. Zwar enthalten Pflanzen Kohlenstoff, aber es gibt sie noch nicht so lange, dass die Diamanten, die heute aus dem Boden geholt werden, aus pflanzlichen Überresten hätten entstehen können. Außerdem bedarf es gewaltigen Drucks und extrem hoher Temperaturen, um Kohlenstoffmoleküle dazu zu bewegen, sich zu einem Kristall anzuordnen – in der Kruste eines Planeten sind dieser Druck und solche Temperaturen unmöglich zu erreichen.
Tatsächlich entstehen Diamanten einige hundert Kilometer tief im Erdmantel, wo der Druck mehrere hunderttausend Mal höher ist als in der Atmosphäre und die Temperaturen etwa mit denen an der Oberfläche der Sonne vergleichbar sind. An die Erdoberfläche gelangen die Kristalle durch Vulkanausbrüche.
Der Mythos vom zusammengepressten pflanzlichen Material hat seinen Ursprung vermutlich darin, dass wir auch Kohle zutage fördern, die tatsächlich aus unter hohen Temperaturen komprimierten Pflanzenresten besteht. Doch diese Temperaturen und Druckniveaus sind viel zu gering für die Entstehung von Diamanten.
Es stimmt auch, dass sich das eine auf natürlichem Weg in das andere verwandelt, aber der Prozess verläuft umgekehrt wie der im Mythos beschriebene: Diamanten sind nicht vollkommen stabil und zerfallen im Lauf von Tausenden Jahren zu Kohle. Die naheliegende Frage lautet also: Könnten wir diesen Prozess umkehren?
Im Jahr 2003 entschloss sich Tetsuo Irifune vom Institute of Technology in Tokio, genau das zu versuchen und Kohle zu einem Diamanten zu pressen. Irifune setzte einen Klumpen kohleartigen Kohlenstoffs in einer Art von extremem Drucklufttopf einem Druck aus, der den im Erdmantel deutlich überstieg. Das Resultat war ein Super-Diamant, eine chemische Substanz, die es nie zuvor gegeben hatte.20
Super-Diamanten haben eine Mohs-Härte (benannt nach dem deutschen Mineralogen Friedrich Mohs) von mehr als 10, aber der genaue Wert ist noch nicht berechnet worden, denn der Super-Diamant ist winzig, weil das ursprüngliche Stück Kohle so stark komprimiert wurde: Wir sprechen hier von einigen millionstel Gramm.
Aber man muss keine Kohle als Ausgangsmaterial verwenden. Dan Frost vom Bayerischen Geoinstitut hat es geschafft, einen Diamanten durch Kompression von Erdnussbutter zu erzeugen,21 und die in Illinois ansässige Firma LifeGem kann aus der Asche unserer verstorbenen Angehörigen künstliche Diamanten pressen. Alles, was man dazu braucht, ist Kohlenstoff.
Die Tatsache, dass Kohle, Diamanten und Super-Diamanten alle aus demselben Element bestehen, jedoch unterschiedliche Eigenschaften aufweisen (wir sprechen von »Kohlenstoffallotropen«), zeigt, dass sich Elemente auf unterschiedliche Art anordnen können.
Um dieses Phänomen zu erklären, müssen wir uns genauer mit der Vorstellung auseinandersetzen, dass etwas wie ein Diamant oder »unzerschneidbar« sein kann. Das griechische Wort für »unzerschneidbar« kennen Sie vermutlich bereits: átomos.