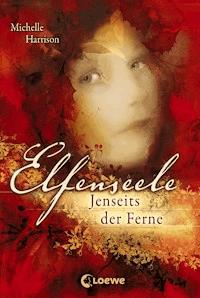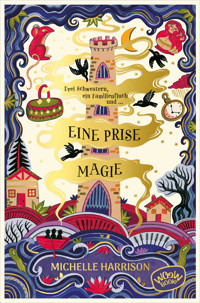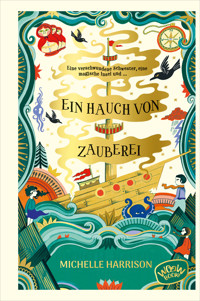Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Elfenseele
- Sprache: Deutsch
Mit der Elfenseele-Trilogie nimmt Michelle Harrison Leserinnen ab 12 Jahren mit in das mysteriöse Reich der Elfen. Ein packendes Fantasy-Abenteuer, das sich alle Fans von Plötzlich Fee nicht entgehen lassen dürfen! Der Sommer auf Elvesden Manor wird ein Albtraum, da ist sich Tanya sicher. Niemand will sie dort haben, nicht ihre Großmutter und nicht die Elfen, die zu Tausenden die Wälder um das alte Herrenhaus bevölkern. Während sie versucht, ihrer Großmutter aus dem Weg zu gehen, stößt sie auf ein Geheimnis: Vor fünfzig Jahren ist ein Mädchen spurlos im Wald von Elvesden verschwunden. Tanya ahnt, dass sie die Einzige ist, die das Rätsel lösen kann. Denn die Elfen scheinen darin eine unheimliche Rolle zu spielen. "Hinter dem Augenblick" ist der erste Band der Elfenseele-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für Mum
PROLOG
Schon als kleines Kind hatte Tanya gewusst, dass das Herrenhaus ihrer Großmutter ein Ort dunkler Geheimnisse war. Natürlich waren ihr die Gerüchte über die Fluchttunnel unter dem Gebäude zu Ohren gekommen, die längst nicht mehr genutzt wurden. Und wie alle Kinder hatte sie manchen regnerischen Nachmittag damit zugebracht, Jagd auf die geheimen Eingänge zu machen, nur um immer wieder aufs Neue enttäuscht aufgeben zu müssen. Als Tanya dreizehn wurde, hatte sie die Hoffnung, jemals auf einen jener mysteriösen Zugänge zu stoßen, längst begraben und fragte sich stattdessen immer öfter, ob sie überhaupt existierten.
Als dann unvermittelt der Bücherschrank in der Wand vor ihr zurückschwang und den Blick auf eine schmale steinerne Treppe freigab, die in modrige Finsternis hinabführte, hatte sie dies nicht unbedingt überrascht. Allerdings blieb auch der so lang erhoffte köstliche Nervenkitzel aus, da es nun unter so ganz anderen Umständen als in ihren Kindertagträumen zu dieser Entdeckung gekommen war.
Wäre nur einer in dem gewaltigen Haus ein wenig aufmerksamer gewesen gegenüber allem, was um ihn herum vorging, so hätte ihm auffallen müssen, dass die Tunnel eben doch benutzt wurden – und zwar schon seit einiger Zeit – und jemandem Zugang zum Haus gewährten, der hier absolut nichts zu suchen hatte. Aber keiner der vielen Hinweise, angefangen bei den Radiomeldungen nach der Entführung bis hin zu dem seltsamen Scharren in den alten Dienstbotengängen mitten in der Nacht, war beachtet worden. Denn für sich allein schien keines dieser Zeichen viel zu bedeuten.
Jetzt stand sie dem Eindringling mit den wild lodernden Augen in diesem düsteren Gewölbe tief unter dem Haus gegenüber und alle warnenden Hinweise passten plötzlich zueinander wie Schlüssel und Schlüsselloch. Tanya wusste nicht, was sie hier unten vorzufinden erwartet hatte – dies jedoch nicht.
Das Mädchen war nicht viel älter als sie selbst; fünfzehn höchstens. Ihre grünen Augen täuschten über eine Härte und Reife weit jenseits dieses Alters hinweg. Das Messer, das sie an einem Riemen um ihren Oberschenkel trug, ließ Schlussfolgerungen zu, über die Tanya lieber nicht nachdenken wollte, und deshalb zwang sie sich, das winzige Baby auf dem Arm des Mädchens anzusehen.
Das Kind erwiderte ihren Blick, ohne zu blinzeln. Was dann geschah, drehte ihr fast den Magen um. Die Gesichtszüge des Babys zerflossen und veränderten sich. Die Ohren wurden länger und spitzer, die Haut verfärbte sich grünlich. Augäpfel und Pupillen schienen sich mit schwarzer Tinte zu füllen; ein unheimliches Funkeln erfüllte sie. Schon im nächsten Moment war der widerwärtige Anblick verschwunden – aber Tanya wusste, was sie gesehen hatte.
Und das rothaarige Mädchen auch.
»Du hast es gesehen.« Ihre Stimme klang rau.
Tanya konzentrierte sich wieder auf das Ding in ihren Armen und würgte einen Schrei hinunter.
»Ich glaub’s nicht«, murmelte das Mädchen. »Du hast es gesehen. Du kannst sie auch sehen.«
Ein Moment wortloser Verständigung verstrich, bis das Mädchen leise etwas flüsterte.
»Du hast das Zweite Gesicht.«
Tanya wich zurück. »Was hast du mit dem Baby vor?«
»Gute Frage«, erwiderte das Mädchen. »Setz dich hin, ich erzähle dir meine Geschichte. Sie wird dich interessieren, da bin ich mir sicher.«
1
ie war sich ihrer Anwesenheit im Zimmer bewusst, noch bevor sie erwachte.
Es begann mit einem unheilvollen Zucken in den Augenlidern, für Tanya stets ein sicheres Zeichen dafür, dass Ärger bevorstand. Genau dieses Zucken weckte sie. Schlaftrunken öffnete sie die Augen. Wie üblich hatte sie sich die Bettdecke über den Kopf gezogen – eine Angewohnheit aus Kindertagen, die sie nicht ablegen wollte, und das aus gutem Grund. Sie lag unbequem, aber daran ließ sich jetzt nichts ändern. Wenn sie sich bewegte, verriet sie ihnen, dass sie wach war.
Unter der Decke war es stickig und Tanya wollte nichts lieber, als sie von sich zu strampeln und den sanften Lufthauch auf Gesicht und Armen zu spüren, der durch das offene Fenster hereinkam. Sie versuchte sich einzureden, dass sie nur schlecht geträumt hatte; vielleicht waren sie in Wirklichkeit ja gar nicht da. Trotzdem rührte sie sich nicht. Denn tief in ihrem Innersten wusste sie, dass sie da waren, wusste es so sicher, wie sie wusste, dass sie die Einzige war, die sie sehen konnte.
Ihre Lider zuckten erneut. Tanya konnte sie spüren, durch die Decke hindurch, konnte spüren, dass die Luft erfüllt war von einer sonderbaren Energie. Sie konnte sogar die erdige Feuchtigkeit von Laub, Pilzen und reifen Beeren riechen. Es war ihr Geruch.
Eine leise Stimme zerschnitt die Dunkelheit.
»Sie schläft. Soll ich sie wecken?«
Tanya versteifte sich in ihrer Zuflucht unter der Decke. Die Blutergüsse vom letzten Mal waren noch nicht verschwunden. Sie hatten sie buchstäblich grün und blau gezwickt. Ein heftiger Stoß in die Rippen ließ sie nach Luft schnappen.
»Die schläft nicht.« Die zweite Stimme klang eisig, beherrscht. »Sie tut nur so. Egal. Mir gefallen diese kleinen … Spielchen.«
Jetzt fiel die Schläfrigkeit endgültig von ihr ab. Die unterschwellige Drohung in diesen Worten war unmissverständlich. Tanya wollte die Decke von sich schleudern – aber ganz plötzlich war das Ding unglaublich schwer, wie ein Tonnengewicht lastete es auf ihr. Und es wurde immer schwerer.
»Was soll das? – Was macht ihr?«
Sie riss und zerrte an dem Stoff und versuchte wie rasend, ihn loszuwerden. Aber er schien sich nur noch fester um sie herumzuwickeln, wie ein Kokon. Ein entsetzlich langer Moment verging, in dem sie nur nach Luft rang, dann bekam sie den Kopf frei und sog gierig die kühle Nachtluft ein. In ihrer Erleichterung sah sie den gläsernen Stern vor ihrem Gesicht und die Glühbirne darin erst nach ein paar Sekunden und eine weitere halbe Sekunde verging, bis sie begriff, dass der Stern ihre Schlafzimmerlampe war.
Plötzlich wusste Tanya, warum die Bettdecke so schwer war. Sie schwebte anderthalb Meter hoch über ihrem Bett – und trug ihr ganzes Gewicht.
»Lasst mich runter!«
Langsam und ohne dass Tanya auch nur den geringsten Einfluss darauf gehabt hätte, drehte sie sich in der Luft der Länge nach um sich selbst. Prompt glitt die Bettdecke von ihr herunter und landete auf dem Teppich; nur sie hing immer noch hier oben, im Schlafanzug, das Gesicht nach unten gewandt. Ohne den Schutz der Decke fühlte sie sich furchtbar verletzlich. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht und blinzelte in ihr Zimmer hinab. Die Katze schien das einzige Lebewesen in der Dunkelheit dort unten zu sein, ein flauschiger grauer Perser, der zusammengerollt auf dem Fensterbrett lag. Jetzt erhob er sich, warf ihr einen hochmütigen Blick zu, drehte sich, bis er ihr den Rücken zuwandte, und machte es sich wieder gemütlich.
»Wo steckt ihr?«, fragte sie. Obwohl sie flüsterte, zitterte ihre Stimme. »Zeigt euch!«
Irgendwo in der Nähe des Betts stieß jemand ein unangenehmes, fast bösartiges Lachen aus. Bevor Tanya wusste, wie ihr geschah, schlug sie mitten in der Luft einen Purzelbaum, dann einen zweiten, einen dritten und noch einen.
»Hört auf damit!«
Nur allzu deutlich hörte sie die Verzweiflung in ihrer Stimme und hasste sich dafür.
Immerhin wurde ihr ein fünfter Salto erspart; sacht landete sie auf den Füßen – allerdings kopfüber an der Zimmerdecke. Geisterhaft bauschten sich die Vorhänge in der Nachtluft. Sie wandte den Blick ab und holte tief Luft. Es war, als habe sich die Schwerkraft nur für sie allein umgekehrt. Das Blut schoss ihr nicht in den Kopf, ihre Hosenbeine rutschten nicht nach oben und die Haare fielen ihr jetzt über den Rücken.
Sie ließ sich im Schneidersitz auf der Zimmerdecke nieder und gab sich geschlagen. Aus genau diesem Grund kamen sie jedes Mal mitten in der Nacht. Das war ihr schon vor langer Zeit klar geworden. Bei Nacht war sie ihnen hilflos ausgeliefert, wohingegen sie tagsüber weit bessere Chancen gehabt hätte, ein merkwürdiges Geschehnis als einen ihrer Streiche oder Tricks abzutun. Nur ein weiterer von so vielen ›Streichen‹ und ›Tricks‹ im Lauf der Jahre.
Tanya konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann genau sie sie zum ersten Mal gesehen hatte. Eigentlich waren sie immer da gewesen. Sie war mit ihnen aufgewachsen. Als kleines Kind hatte sie noch unter den amüsierten Blicken ihrer Eltern mit ihnen geplappert. Später waren diese Blicke nicht mehr amüsiert gewesen, sondern immer besorgter geworden.
Die Zeit verging und sie lernte, überzeugend genug zu lügen. Es kam gar nicht gut an bei den Erwachsenen, wenn man ihnen etwas von Feen und Elfen erzählte, jedenfalls nicht, wenn man aus einem gewissen Alter heraus war. Plötzlich erntete man dafür keine wissenden Blicke und auch kein liebevolles Lächeln mehr wie früher als kleines Kind. Tanya hatte das nie allzu persönlich genommen. Die Leute glaubten nur, was sie mit eigenen Augen sahen.
In letzter Zeit waren die ›Geschehnisse‹ zunehmend rachsüchtig geworden. Es war ein Unterschied, ob man nach einer feindlichen Begegnung mit einer verzauberten Haarbürste ein paar Haare einbüßte oder feststellen musste, dass sich die Hausaufgaben über Nacht in das Gekrakel eines Geisteskranken verwandelt hatten. Doch jetzt – diese Sache war ernst. Schon seit Monaten wurde Tanya das nagende Gefühl nicht los, dass über kurz oder lang etwas wirklich Schlimmes passieren würde, etwas, aus dem sie sich nicht mehr herausschwindeln konnte. Wenn sie Pech hatte, landete sie wegen ihres merkwürdigen Benehmens noch auf der Couch eines Psychiaters; das war ihre größte Angst. Und diese Angst nahm ständig zu.
Nachts in der Luft herumzusegeln, trug eindeutig nicht dazu bei, ihre Lage zu verbessern. Wenn ihre Mutter aufwachte und sie an der Zimmerdecke herumspazieren sah, würde sie ganz bestimmt keinen Arzt rufen, sondern einen Priester.
Sie steckte in Schwierigkeiten, in großen, großen Schwierigkeiten.
Plötzlich spürte Tanya einen kühlen Luftzug auf der Wange, wie von einem flüchtigen Pinselstrich oder einer gefiederten Schwinge. Tatsächlich stürzte ein großer schwarzer Vogel auf sie herab und landete auf ihrer Schulter. Seine glitzernden Augen blinzelten einmal, dann verwandelte er sich so übergangslos, wie ein Schatten im hellen Sonnenschein verschwand. Seidig schwarzes Haar und zwei rosarote, spitz zulaufende Ohren ersetzten den mörderisch gekrümmten Schnabel und schon nahm eine Frau den Platz des Vogels ein, die kaum größer war als er. Sie trug ein Kleid aus schwarzen Federn. Es hob sich hart von ihrer elfenbeinbleichen Haut ab.
»Raven«, wisperte Tanya. Sie beobachtete, wie sich eine Feder aus dem Kleid der Elfe löste und dem Teppich entgegenschwebte. »Warum seid ihr hier?«
Raven gab keine Antwort. Sie landete am Fußende des Bettes neben zwei anderen kleinen Gestalten, die eine dicklich und mit einer roten Knollennase im Gesicht, die andere dunkelhäutig, drahtig und immer in Bewegung. Beide starrten sie konzentriert zu ihr herauf. Die kleinere von ihnen ergriff als Erste das Wort.
»Du hast wieder etwas über uns geschrieben.«
Tanya spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. »Hab ich nicht, Gredin – wirklich nicht.«
Gredins gelbe Raubtieraugen glitzerten erschreckend intensiv, sein nussbraunes Gesicht verzog sich verächtlich. »Das hast du letztes Mal auch behauptet. Und vorletztes Mal.«
Draußen bewegte sich etwas: Wie von der Nachtluft herangetragen segelte ein dunkler, rechteckiger Gegenstand auf das offene Fenster zu. Anmutig zerteilte er die Vorhänge, schwebte ins Zimmer und verharrte dicht vor Tanyas bestürztem Gesicht. Es war ein Tagebuch, ziemlich neu und gut erhalten – allerdings über und über mit Erdkrumen bedeckt. Sie hatte es erst heute Mittag unter dem Apfelbaum im Garten vergraben. Wie dumm sie doch gewesen war.
»Deines, nehme ich an?«, knurrte Gredin.
»Ich habe es noch nie gesehen.«
Der rundliche kleine Bursche neben Gredin schnaubte.
»Ach, komm schon«, sagte er. »Du willst doch wohl nicht die ganze Nacht da oben sitzen, oder?« Er hob die Hand und strich sacht die Pfauenfeder an seinem Schlapphut entlang, dann zwirbelte er seine Schnurrbarthaare zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Feder schimmerte wie unter einem Zauberbann auf. Der dicke kleine Mann zupfte sie vom Hut und schnipste sie an.
Das Tagebuch öffnete sich und ein Erdklümpchen fiel zu Boden, wo es auf einem von Tanyas Hausschuhen zerbarst. Ein unterdrückter Nieser ertönte darin und gleich darauf krabbelte der vierte und letzte Elf daraus hervor, grobschlächtig und hässlich. Die Kreatur schlug ein paarmal angestrengt mit ihren zerrupften braunen Flügeln und landete in einem uneleganten Gewirbel aus Armen und Beinen auf dem Bett. Nachdem sie unbeholfen ihr Gleichgewicht wiedergefunden und sich zurechtgesetzt hatte, kratzte sie sich hingebungsvoll und ließ einen Schauer aus abgestorbenen Fellbüscheln und Flöhen auf die Bettwäsche niedergehen. Der Elf gähnte ausgiebig und rieb sich mit winzigen braunen Pfoten über die Schnauze.
Als Tanya noch kleiner gewesen war, vor der Scheidung ihrer Eltern, hatte sie nach Zurechtweisungen oft geschmollt. Nach ein paar Minuten hatte ihre Mutter die Geduld verloren und gefaucht: »Sei bloß nicht so ein Rüsselmops!«
Natürlich war sie ungeachtet aller Vorsätze neugierig gewesen. »Was ist das denn, ein Rüsselmops?«
»Das ist ein ganz schrecklich rücksichtsloses kleines Ding, das immer schlechte Laune hat«, hatte ihre Mutter geantwortet. »Und mit dem Gesicht, das du gerade ziehst, siehst du ihm total ähnlich.«
Daran musste Tanya jedes Mal denken, wenn sie diesen flohzerbissenen braunen Elf sah. Der mürrische Gesichtsausdruck passte so perfekt zu dem Geschöpf, das ihre Mutter beschrieben hatte, dass sie ihn insgeheim bis in alle Ewigkeit Rüsselmops nennen würde. Außerdem hatte er anders als die anderen Elfen nie seinen richtigen Namen genannt und so war der Name, den sie ihm gegeben hatte, erst recht hängen geblieben. Abgesehen von den Flöhen und seinem Geruch – der stark an nassen Hund erinnerte – war der Rüsselmops ein zurückhaltender Geselle. Er sagte nie etwas, wenigstens nicht in einer Sprache, die Tanya verstand, war stets hungrig und hatte die Angewohnheit, sich ständig den Bauch zu kratzen. Davon abgesehen schien er vollauf damit zufrieden, mit seinen schwermütigen braunen Augen zu beobachten, was um ihn herum vorging, mit diesen Augen, die das einzig Schöne an ihm waren. Als könne er ihre Gedanken erraten, sah er zu ihr herauf und begann zu schnurren.
Das Tagebuch ruckelte ein wenig nachdrücklicher vor Tanyas Nasenspitze herum. Sie zuckte zusammen und konzentrierte sich wieder darauf.
»Lies vor!«, befahl Gredin.
»Geht nicht«, erwiderte Tanya. »Es ist zu dunkel.«
Gredins Augen waren so hart wie Feuerstein. Die Seiten des Tagebuchs wurden wie von Windstößen umgeblättert, hierhin und dorthin, als müsse sich der Wind erst noch entscheiden, bei welchem Eintrag er innehalten wollte. Schließlich kamen sie bei einem Abschnitt ziemlich weit hinten zur Ruhe. Er wirkte, als sei er ganz besonders hastig niedergeschrieben worden. Tanya erkannte das Datum sofort – es lag weniger als vierzehn Tage zurück. Die Schrift war so gut wie unleserlich, weil sie damals vor lauter Tränen beinahe die eigene Hand nicht mehr gesehen hatte. Dann hörte sie die Stimme, die ihr wie ein Echo aus den Seiten entgegenwehte, nicht ganz so laut, dass sie jemanden hätte aufwecken können, aber laut genug für sie. Ihre Nackenhärchen stellten sich auf. Es war ihre eigene Stimme, fern und kränklich, als habe sie die lange Reise durch die Zeit geschwächt.
»Heute Nacht sind sie wiedergekommen. Warum ich? Ich hasse sie. HASSE sie …«
So ging es weiter, immer weiter, peinlich und schmerzhaft lange, und Tanya blieb nichts anderes übrig, als der Stimme voller Grauen zuzuhören, dieser unheimlichen Stimme, die sich aus dem Tagebuch ergoss und das Niedergeschriebene Seite um Seite genauso wütend, frustriert und hoffnungslos wiedergab, wie sie sich damals gefühlt hatte.
Die Elfen beobachteten sie unablässig, Raven beherrscht, Federhut und Gredin mit steinernem Gesicht und der Rüsselmops desinteressiert. Er war bereits wieder davon in Anspruch genommen, sich den flohbefallenen Bauch zu kratzen.
»Genug«, sagte Gredin nach einer halben Ewigkeit.
Tanyas Geisterstimme verstummte wie abgeschnitten. Man hörte nur noch das Geräusch der Seiten, die wie von einer unsichtbaren Hand vor- und zurückgeblättert wurden. Vor ihren Augen verblassten die Worte, die sie geschrieben hatte, und verschwanden schließlich ganz, wie Tinte, die von Löschpapier aufgesaugt wurde.
Das Tagebuch fiel aufs Bett und löste sich beim Aufprall in seine Bestandteile auf. Staub flirrte im Mondlicht, das durchs Fenster fiel.
»Damit erreichst du gar nichts«, sagte Raven und deutete auf die Überreste. »Du handelst dir nur immer neue Schwierigkeiten ein.«
»Nicht, wenn eines Tages jemand liest, was ich geschrieben habe«, stieß Tanya bitter hervor. »Und mir glaubt.«
»Die Regeln sind ganz einfach«, sagte Federhut und warf ihr einen herablassenden Blick zu. »Du erzählst keinem etwas von uns. Versuchst du’s weiterhin, werden wir dich weiterhin bestrafen.«
Auf dem Bett glitten die Überreste des Tagebuchs aufeinander zu und erhoben sich glitzernd wie feiner Sand. Sie wirbelten durch das offene Fenster in die Nacht hinaus.
»Verschwunden. Als hätt’s nie existiert. Unterwegs an einen fernen Ort«, sagte Gredin. »Dort, wo der Bach den Berg hinauffließt, wächst wilder Rosmarin. Das ist das Reich der Piskies.«
»Ich glaube nicht an Bäche, die bergauf fließen«, erwiderte Tanya verächtlich. Sie litt noch immer darunter, dass ihre allergeheimsten Gedanken vor allen ausgebreitet worden waren.
»Barbarische Geschöpfe, diese Piskies«, fuhr Gredin unbeeindruckt fort. »Unberechenbar. Gefährlich, behaupten manche. Was immer sie berühren, diese Piskies, es wird entstellt und wandelt sich. Der Rosmarin – sonst dafür gerühmt, dass er die Gedächtnisleistung unterstützt – gedeiht danach nur noch als Giftgewächs. Alle seine Eigenschaften sind ins Gegenteil verkehrt.«
Er schwieg, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Tanya war klug genug, die Effekthascherei zu durchschauen und ihn diesmal nicht zu unterbrechen.
»Nun gibt es Leute, unter den Feen und Elfen als die Wissenden bekannt, die mit den Eigenschaften von Kräutern und Pflanzen wie dem Rosmarin vertraut sind. Denn sogar Rosmarin, der von den Piskies verdorben wurde, hat noch einen Nutzen. In der richtigen Menge verabreicht, wohnt ihm die Macht inne, einem Sterblichen für alle Zeit das Gedächtnis aus dem Gehirn zu reißen, die Erinnerung an eine einstige Liebe beispielsweise. Sehr hilfreich unter gewissen Umständen. Aber sosehr es den Elfen missfällt, überhaupt Beziehungen mit den widerwärtigen Piskies unterhalten zu müssen – auch sie wissen, wie man dieses magische Kraut gebraucht. Besonders nützlich ist es dann, wenn Menschen unerwartet über die Schwelle zum Elfenreich gestolpert kommen und Zeuge von Dingen werden, die sie nichts angehen. Normalerweise bringt eine kleine Dosis alles wieder ins Lot und dem jeweiligen Menschen geht es danach kein bisschen schlechter. Ihm kommt es nur so vor, als würde er aus einem angenehmen Traum erwachen – wenn auch ohne Erinnerung an den Traum selbst. Nichtsdestotrotz aber weiß man, wie gefährlich es ist, eine falsche Menge zu verabreichen. Mehr als ein Gedächtnis wurde völlig ausgelöscht, einfach so.« Gredin schnippte mit den Fingern und Tanya zuckte zusammen.
»Natürlich kommt so etwas selten vor und ist meist unbeabsichtigt, aber manchmal … manchmal ist es eben auch das letzte Mittel, das uns bleibt, die zum Schweigen zu bringen, die sich starrköpfig weigern, den Mund zu halten. Ein höchst unangenehmes Schicksal, wie die meisten wohl zugeben werden. Hinterher kann sich die arme Seele nicht einmal mehr an ihren eigenen Namen erinnern. Verhängnisvoll, aber notwendig. Immerhin – wer sich an nichts erinnert, kann auch nichts ausplaudern.«
Plötzlich hatte Tanya den gallebitteren Geschmack der Angst im Mund.
»Ich werde nichts mehr über euch schreiben.«
»Gut«, sagte Federhut. »Denn du wärst ein Blödkopf, würdest du’s auch nur versuchen.«
»Beantwortet mir wenigstens eine Frage«, sagte Tanya so fordernd, wie sie es wagte. »Ich kann nicht die Einzige sein! Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin.«
Mit einem Blick brachte Gredin sie zum Schweigen.
Jäh und völlig unerwartet stürzte sie in die Tiefe. Tanya reagierte instinktiv, ihre Hand zuckte vor und packte das einzig Greifbare in der Nähe – die Sternenlampe an der Zimmerdecke. Das Stromkabel spannte sich mit einem entsetzlichen Laut und wurde unter ihrem Gewicht aus der Decke gerissen, Drähte zerfetzten, handtellergroße Verputzbrocken schlugen prasselnd auf dem Boden auf. Dann löste sich die Lampe aus ihrer Halterung und Tanya fiel. Die Glühbirne landete in dem Chaos unter ihr und zerplatzte, die Lampe wirbelte ihr aus den Händen, krachte gegen den Kleiderschrank und explodierte in tausend Scherben.
Tanya krümmte sich atemlos zusammen und hörte bereits die hektischen Schritte draußen auf dem Treppenabsatz. Sie musste nicht aufsehen, sie wusste auch so, dass die Elfen verschwunden waren, ins Nirgendwo davongewirbelt wie Laub unter einem heftigen Windstoß. Dann stürzte auch schon ihre Mutter ins Zimmer und zog sie an den Schultern hoch. Es tat weh und sie schrie auf. Auch ihre Mutter stieß einen Schrei aus, ihrer jedoch klang eher empört. Natürlich hatte sie das Trümmerfeld inzwischen gesehen.
»Mum«, krächzte Tanya. »Es – es war ein Albtraum! Es tut mir leid …«
Selbst im fahlen Licht des Mondes konnte Tanya den resignierten Ausdruck sehen, der plötzlich auf dem Gesicht ihrer Mutter lag. Langsam lockerte sie den Griff um Tanyas Arm und sank aufs Bett. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten und presste sie gegen die Augen.
»Mum?«, flüsterte Tanya. Sie streckte die Hand aus und berührte ihre Mutter am Arm.
»Ich bin müde«, sagte ihre Mutter leise. »Ich bin todmüde. Ich weiß nicht mehr, was ich mit dir anstellen soll. Ich komme mit all dem nicht mehr klar … wie du ständig Aufmerksamkeit beanspruchst. Ich komme mit dir nicht mehr klar.«
»Sag das nicht. Ich werde mich bessern. Bestimmt. Ich gebe mir Mühe. Ich versprech’s.«
Ihre Mutter lächelte schwach. »Das sagst du jedes Mal. Und ich will dir ja auch glauben … dir helfen. Aber ich kann es nicht. Nicht, wenn du nicht mit mir redest – oder mit einem Arzt.«
»Ich brauche keinen Arzt. Und du würdest es nicht verstehen!«
»Nein. Wahrscheinlich nicht, Liebes. Aber eins habe ich verstanden: dass ich mit meiner Geduld am Ende bin.« Sie starrte schweigend auf das Chaos hinab. »Bis morgen früh sieht es hier wieder ordentlich aus. Du räumst das alles weg. Alles. Und den Schaden zahlst du mit deinem Taschengeld ab, egal, wie lange es dauert. Ich lasse dir das nicht mehr durchgehen. Ich habe es satt.«
Tanya betrachtete geflissentlich ihre Zehenspitzen. Ihre Mutter saß barfuß neben ihr; eine Glasscherbe glitzerte in ihrer Fußsohle. Sie kniete sich hin und zupfte sie behutsam heraus. Ein dunkler Blutstropfen bildete sich, doch ihre Mutter reagierte nicht. Sie stand nur auf und tappte zur Tür, die Schultern wie unter einer unsichtbaren Last gebeugt. Unter ihren Füßen knirschten Glassplitter, aber sie beachtete es gar nicht.
»Mum?«
Die Schlafzimmertür wurde geschlossen und Tanya blieb allein im Dunkeln zurück. Sie ließ sich rücklings auf ihr Bett fallen und war noch immer viel zu schockiert, um auch nur weinen zu können. Dieser Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Mutter … Er hatte alles gesagt: Wie oft habe ich dich gewarnt? Wie oft habe ich dir Vorträge darüber gehalten, dass das Fass irgendwann überlaufen wird? Jetzt, während Tanya dem leisen Schluchzen aus dem Zimmer auf der anderen Seite des Gangs lauschte, wusste sie, dass für ihre Mutter in dieser Nacht wirklich der allerletzte Tropfen in das Fass gefallen war. Und es zum Überlaufen gebracht hatte.
2
anyas Mutter fuhr langsam, obwohl ihnen seit einer halben Stunde kein Auto entgegengekommen war. Die Landstraße schlängelte sich unter einem undurchdringlichen, Schatten spendenden Baldachin aus Baumkronen dahin, links und rechts davon erstreckten sich im hellen Julisonnenschein schier endlose, goldgelb wogende Felder bis zum Horizont. Gelegentlich tauchte in der Ferne ein Farmhaus oder eine Tierkoppel auf, aber ansonsten gab es nicht viel zu sehen, denn das hier war das Herz der Grafschaft Essex. Londons eng bebaute Vororte waren schon lange hinter ihnen verschwunden.
Tanya saß hinten und starrte frostig den Hinterkopf ihrer Mutter an. »Ich verstehe noch immer nicht, warum ich ausgerechnet zu ihr muss. Ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen?«
»Nein, weil es keine bessere Lösung gibt«, antwortete ihre Mutter. Durch den Schlafmangel und ohne Make-up war ihr Gesicht ungewöhnlich blass. »Wir haben das jetzt schon hundertmal besprochen.«
»Warum kann ich nicht einfach zu Dad?«, fragte Tanya, obwohl ihr klar war, dass es nichts nutzen würde.
»Das weißt du genau. Er hat viel Arbeit und ist ständig unterwegs. Ich will nicht, dass du ganz allein in einem leeren Haus wohnst.«
»Ich kann’s nicht glauben. Gerade mal eine lausige Woche Sommerferien vorbei und jetzt muss ich den Rest davon bei ihr verbringen«, sagte Tanya. »Zu Grandma Ivy wäre ich gerne gefahren!«
»Ja, aber Ivy ist seit drei Jahren tot und jetzt würde es dir nicht schaden, wenn du dir mit der Großmutter, die dir noch geblieben ist, ein bisschen mehr Mühe gibst.«
»Ja, klar, weil sie sich ja auch mit mir so richtig Mühe gibt. Es ist schon schlimm genug, ein paar Tage in diesem spinnwebverkleisterten Haus festzusitzen – und jetzt soll ich wochenlang da bleiben! Außerdem erlaubt sie es nur, weil du ihr keine Wahl gelassen hast!«
»Das ist nicht wahr.«
»Doch, ist es! Sie will mich genauso wenig dort haben, wie ich dort sein will, und das wissen wir beide! Nenn mir nur ein einziges Beispiel, wann sie mich von sich aus eingeladen hat«, sagte Tanya herausfordernd.
Ihre Mutter blieb stumm.
Tanya schürzte die Lippen. »Eben.«
»Jetzt reicht es! Du bist selbst dran schuld oder hast du schon vergessen, was du dir heute Nacht geleistet hast? Von den letzten Monaten ganz zu schweigen.« Unvermittelt wurde die Stimme ihrer Mutter weicher. »Ich brauche eine Pause. Ich denke, die brauchen wir beide. Nur ein paar Wochen, mehr nicht. Ich bin so fair wie möglich – ich lasse dich sogar Oberon mitnehmen. Und wenn du wieder heimkommst, dann reden wir über alles.«
Tanya erwiderte nichts; sie hatte Mühe, gegen den schrecklichen Kloß in ihrer Kehle anzukämpfen. Sie schwiegen sich eine Weile an, dann schaltete ihre Mutter den CD-Player ein. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Diskussion beendet war.
Als wolle er gegen den Musikgeschmack ihrer Mutter protestieren, bewegte sich der ein wenig übergewichtige braune Dobermann, der eingeklemmt zwischen Tanya und ihrer großen Reisetasche hockte, und gab ein kehliges Winseln von sich. Sie legte ihm die Hand auf den Hinterkopf, kraulte ihn beruhigend hinter den seidigen Ohren und schaute aus dem Fenster. Ihre Unschuldsbeteuerungen hatten nicht das Geringste bewirkt. Das Resultat war dasselbe geblieben. Sie würde bis auf Weiteres bei ihrer Großmutter bleiben müssen.
In dieser Stimmung fuhren sie weiter. Vorn auf dem Fahrersitz blickte ihre Mutter starr auf die Straße. Tanya saß mit verschränkten Armen hinten, starrte finster den Kopf ihrer Mutter an und schmollte mit aller Macht.
»Da sind wir.«
Tanya spähte in die Richtung, in die ihre Mutter gezeigt hatte, und sah gar nichts, zumindest nichts außer dicht an dicht stehenden Bäumen und Hecken.
»Es ist ein bisschen mehr zugewachsen als früher.«
»Es war schon immer total überwuchert«, schnappte Tanya. »Noch ein bisschen schlimmer und wir wären dran vorbeigefahren.«
Mittlerweile säumten so viele Bäume die schmale Straße, dass es unmöglich war, festzustellen, wo sie endete. Äste und Zweige scharrten an den Wagenseiten entlang und zahllose Feen und Elfen flatterten verärgert über die Störung aus den Baumkronen. Eine kauerte sich an der Scheibe neben Tanya nieder, starrte neugierig zu ihr herein und musterte sie, während sie sich unablässig mit einem schmutzigen Finger in der Nase bohrte. Zu Tanyas Erleichterung wurde ihr die Sache nach knapp einer Minute zu langweilig und so schwirrte sie wieder zu den Bäumen zurück.
Tanya seufzte. Das war erst der Anfang gewesen. Irgendwie wussten die Elfen immer, dass Tanya sie sehen konnte, und das schien sie wie ein Magnet anzuziehen, selbst wenn sie noch sosehr tat, als seien sie gar nicht da.
Die Straße schlängelte sich weiter und weiter und Tanya wurde das Gefühl nicht los, dass sie Teil eines Labyrinths war, aus dem sie nie wieder hinausfinden würden. Schließlich aber lichteten sich die Bäume, über der Straße wurde es heller und nach einer letzten Linkskurve bremste ihre Mutter vor einem gewaltigen, mit einem mächtigen Vorhängeschloss gesicherten doppelflügligen Tor ab. In den wunderschön geschmiedeten eisernen Rahmen waren zwei Worte eingearbeitet: Elvesden Manor. Auf den steinernen Pfeilern links und rechts des Tores fletschten Wasserspeier warnend die Zähne. Ihre Mutter drückte ein paarmal auf die Hupe und warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett.
»Warum haben sie das Tor nicht einfach aufgemacht? Ich habe ihnen doch gesagt, dass wir gegen zehn Uhr da sind.« Sie hupte wieder, ärgerlicher diesmal.
Minutenlang geschah gar nichts; keine Menschenseele ließ sich blicken. Tanya wandte die Augen von den abweisenden Fratzen der Wasserspeier ab. Über die hohe Mauerkrone hinweg konnte sie gerade noch das Dach des Hauses sehen.
»Wir können uns genauso gut schon mal die Füße vertreten«, schlug ihre Mutter vor, stieß die Wagentür auf und stieg aus. Auch Tanya war froh, aus dem stickigen Auto herauszukommen. Oberon ließ sich ohnehin kein zweites Mal bitten, sondern jagte bereits zu den Bäumen hinüber, schnüffelte daran und markierte sein neues Reich.
»Die frische Landluft wird dir richtig guttun.«
Tanya warf ihrer Mutter einen giftigen Blick zu, dann starrte sie finster in den Wald. Ein kleines Stück entfernt läuteten Glocken und erinnerten sie an die winzige Kirche ganz in der Nähe. Abgesehen davon gab es hier nur das Haus ihrer Großmutter, und obwohl die Fahrt gerade ein paar Stunden gedauert hatte, kam es ihr vor, als sei sie mitten im Nirgendwo gelandet, abgeschnitten vom Rest der Welt. Tanya schirmte die Augen gegen die Sonne ab, um besser sehen zu können. Eine dunkle Gestalt kam mit zügigen Schritten auf sie zu.
»Es ist Warwick«, sagte ihre Mutter und es hörte sich ziemlich erleichtert an.
Tanya sah zu Boden und kickte ein Steinchen davon. Sie mochte den Verwalter von Elvesden Manor nicht besonders. Vor vielen Jahren, als ihre Mutter selbst noch ein Kind gewesen und hier aufgewachsen war, hatte Warwicks Vater Amos diese Stellung innegehabt. Nun war Amos im Ruhestand und der Posten war auf den Sohn übergegangen. Die beiden wohnten zusammen mit Warwicks Sohn Fabian ebenfalls im Haus von Tanyas Großmutter Florence. Tanyas Mutter hielt Fabian für einen »abscheulichen kleinen Bastard«, und obwohl diese Darstellung nicht ganz aus der Luft gegriffen war, tat Fabian Tanya beinahe ein wenig leid. Seine Mutter war gestorben, als er gerade einmal fünf Jahre alt gewesen war. Wenn man bedachte, wie wenig sich sein Vater um seine Erziehung kümmerte, überraschte es nicht, dass er eine Plage war.
Warwick kam näher. Er trug einen langen Mantel, der viel zu warm war für dieses Wetter, und hatte die schmutzigen Hosenbeine in seine ebenso schmutzigen Stiefel gestopft. In seiner nachlässig zurückgestrichenen, widerspenstigen dunklen Haarmähne schimmerten erste graue Strähnen und seine Haut war braun gebrannt und ledrig, ein Beweis dafür, dass er den Großteil seiner Zeit im Freien verbrachte. Ein mürrisches Nicken war sein ganzer Gruß.
Er stapfte an ihnen vorbei, öffnete das Vorhängeschloss, stieß die Torflügel auf und bedeutete Tanya und ihrer Mutter mit einem Kopfrucken, wieder in den Wagen zu steigen. Tanya bemerkte das Luftgewehr, das über seiner Schulter hing, und verzog angewidert das Gesicht. Das Tor schwang quietschend auf und dann trat er zur Seite und ließ den Wagen an sich vorbei.
Wie immer weiteten sich Tanyas Augen beim Anblick des Hauses. Nach seiner Fertigstellung im späten 18.Jahrhundert musste es ein beeindruckendes Gebäude gewesen sein. Es hatte – die Unterkünfte der Bediensteten nicht mitgerechnet – ziemlich genau zwanzig Schlafzimmer und fast ebenso viele Salons und Wohnzimmer, die früher allesamt in verschwenderischer Pracht eingerichtet gewesen waren. Hätte man es ordentlich instand gehalten, wäre es vermutlich noch heute wunderschön gewesen.
Stattdessen waren die von Rissen durchzogenen Wände dicht mit fleischigem Efeu überwachsen, der Jahr für Jahr ungezügelter wucherte und sich mittlerweile wie ein bizarrer Blätterschleier auch über die Fenster ergoss. Heutzutage blieben die meisten Zimmer entweder verschlossen oder befanden sich in verschiedenen Stadien des Verfalls und der weite, einst so hingebungsvoll gepflegte Park ringsum präsentierte sich als Wildnis. Der Hof vor dem Haus war ein wogendes Unkrautmeer; nur ein paar Bäume und ein verwitterter Springbrunnen, der längst trockengelegt war, verliehen ihm noch ein wenig Charme. Tanya konnte sich nicht erinnern, dass der Springbrunnen je funktioniert hatte.
Ihre Mutter parkte direkt vor der Haustür. Gemeinsam warteten sie auf Warwick. Er kam mit schweren Schritten über den gekiesten Hof heran, stieg die Stufen zu der gewaltigen Tür empor und ließ sie wortlos eintreten. Oberon blieb brav draußen und warf sich hechelnd in den Schatten.
Drinnen roch es wie eh und je – klamm und muffig, das Ganze unterlegt mit einem Hauch von Florence’ Parfüm. Die Türen auf beiden Seiten des dämmrigen Korridors waren abgeschlossen, wie Tanya aus Erfahrung wusste. Nur wenige Zimmer des Hauses wurden noch benutzt.
Nach einigen Metern weitete sich der Korridor zu einer Halle, von der weitere Türen abgingen. Von hier aus führte auch die Haupttreppe nach oben, zuerst zu einem kleinen Absatz, wo sie sich nach links und rechts teilte, und dann weiter in den ersten und zweiten Stock. Auf der obersten Etage lagen die alten Dienstbotenquartiere, aber dort hatte außer Amos niemand mehr etwas zu suchen. Tanya konnte sich nur allzu lebhaft daran erinnern, wie sie sich ein einziges Mal hinaufgewagt hatte – und knapp drei Minuten später die Treppe kreischend wieder hinabgestürmt war, weil Fabian behauptete, einen Geist gesehen zu haben.
»Hier lang.« Warwick hatte sich letzten Endes doch noch dazu durchgerungen, etwas zu sagen – wie üblich schroff und kurz angebunden.
Tanya betrachtete kopfschüttelnd die verblichenen Tapeten, die sich an vielen Stellen lösten. Zum hundertsten Mal fragte sie sich, warum ihre Großmutter immer noch in diesem riesigen Haus wohnte, wenn sie sich doch nicht mehr darum kümmern konnte – oder wollte.
Die Standuhr auf dem Treppenabsatz funktionierte nach wie vor nicht, obwohl sie immer und immer wieder repariert worden war. Tanya wusste ziemlich genau, warum das so war – seit Jahren schon hausten Elfen darin. Das war ein weiterer Grund, weshalb sie diesen Ort hasste: Hier wimmelte es von Elfen und Feen. Sie trottete hinter Warwick die Treppe hinauf und drehte sich auch dann nicht um, als sie bemerkte, dass ihre Mutter am Fuß der Treppe stehen geblieben war. Aus den Tiefen der Standuhr konnte sie eine abfällige Stimme hören.
»Passt bloß auf die Kleine auf. Die ist verschlagen.«
Tanya ignorierte es und brachte die letzten Stufen hinter sich. Oben angekommen, erstarrte sie. Eine Spur aus farbenprächtigen Federn führte zu einer wackeligen Kommode, auf der ein fetter, einäugiger roter Kater saß und sich das flaumverklebte Maul putzte.
»Hat nicht mehr gelebt, war ausgestopft«, kommentierte Warwick beiläufig.
Aber da hatte Tanya den zerfledderten Fasan rechts neben der Kommode schon gesehen. Sein Kopf und ein Großteil seines Gefieders fehlten. In einer seltsamen Mischung aus Erleichterung und Abscheu atmete sie durch.
»Spitfire, alter Drache! Du machst deinem Namen wirklich alle Ehre! Los, verschwinde!«, herrschte Warwick ihn an.
Spitfire starrte ihn mit seinem verbliebenen Auge an und putzte unbeeindruckt weiter. Warwick ging wütend an ihm vorbei und blieb gleich darauf vor der ersten Tür links stehen.
»Dein Zimmer.«
Tanya nickte wortlos. Sie wohnte immer in diesem Zimmer, also brauchte sie wirklich niemanden, der sie hierherführte. Ihr fielen nur zwei Gründe für Warwicks Verhalten ein: Entweder wollte er zumindest so tun, als sei er höflich, oder er wollte verhindern, dass sie in anderen Zimmern herumschnüffelte. Nach dem, was sie von ihm wusste, kam nur der zweite Grund infrage.
Wie die meisten Zimmer in diesem Haus war auch ihres geräumig, aber nur spärlich möbliert. Der Teppich war abgetreten und die lavendelfarbene Tapete an den Wänden hatte sich an manchen Stellen abgelöst. In der Ecke standen ein kleiner Tisch und ein Stuhl. Die Mitte des Raumes nahm ein frisch bezogenes Bett ein; eine dünne scharlachrote Decke lag ordentlich gefaltet am Fußende. Die Bügelfalten in den gestärkten weißen Kissenbezügen sahen aus wie mit dem Lineal gezogen. Neben dem großen offenen Kamin an der Wand gegenüber führte eine Tür in das kleine Bad, das sie ganz für sich allein hatte. Theoretisch jedenfalls. Unglücklicherweise wurde dieses Bad nämlich von einem schmierigen, lurchartigen Elf bewohnt, der eine Vorliebe für alles hatte, was glitzerte und glänzte. Tanya hatte schon mehr als eine Uhr und unzählige Schmuckstücke an diesen diebischen Gesellen verloren – nur um später Zeuge zu werden, wie ein verblüffter Warwick alle möglichen Dinge aus dem verstopften Abflussrohr holte.
Über dem Kamin hing ein Gemälde von Echo und Narziss. Der schöne Jüngling hatte nur Augen für sein Spiegelbild, das in einem Waldsee schimmerte, während die Bergnymphe traurig zu Boden blickte. Tanya hatte sich nie so richtig entscheiden können, ob sie das Bild nun mochte oder nicht.
Sie stellte ihre Tasche auf dem Bett ab und räumte ihre Sachen ordentlich weg. Es überraschte sie nicht, dass das Zimmer hinterher noch genauso leer aussah wie zuvor. Sie schob ihre Hausschuhe unter das Bett. Dabei fiel ihr ein, dass Spitfire vor Jahren einmal einen Rattenschwanz in ihrem Schuh versteckt hatte. Allerdings standen die Chancen dafür, dass sich das heutzutage wiederholte, eher schlecht. Mit sechzehn war Spitfire nach Katzenjahren praktisch ein Fossil. Außer dem ausgestopften Wild im Flur erbeutete er allerhöchstens noch die eine oder andere Spinne oder Schmeißfliege, und auch das nur mit viel Glück.
Sie schlenderte zur Fensterbank, strich mit den Fingerspitzen darüber und hinterließ dünne Linien in der allgegenwärtigen Staubschicht. Jetzt erst blickte sie nach rechts in den Garten an der Schmalseite des Hauses hinaus, auf die Heckenrosen und die wenigen Bäume. Jenseits der Gartenmauer konnte sie die Kirche sehen und den winzigen Friedhof, der sie umgab. Dahinter wiederum erstreckte sich kilometerweit ein Waldgebiet, das Tanya unter dem Namen Henkerswald kannte. Sie riss sich davon los und sah zu, wie ihre Mutter unten im Hof ins Auto stieg, um die Rückfahrt anzutreten. Plötzlich war Tanya froh, dass sie sich nicht von ihr verabschiedet hatte. Bestenfalls wären ihr die Tränen gekommen – und schlimmstenfalls hätten sie sich wieder gestritten.
Tanya ging zu ihrem Bett zurück und ließ sich langsam darauf nieder. In dem gesprungenen Glas der Frisierkommode sah sie ihr zweigeteiltes Spiegelbild. Zwillingsgesichter mit braunen Augen und dunklen Haaren starrten sie an. Tanya wandte den Blick ab. Noch nie hatte sie sich einsamer gefühlt.
3
er alte Wohnwagen stand tief im Herzen des Henkerswaldes, halb versteckt im dichten Blattwerk und kühlen Schatten hoher Bäume. Er war in einem hellen Osterglockengelb gestrichen, aber trotz seiner leuchtenden Farbe blieb er unbemerkt, denn dies war ein Teil des Waldes, in den sich nur selten Menschen wagten. Die meisten hätte diese Umgebung zermürbt, der alten Zigeunerin jedoch, die in diesem Wohnwagen zu Hause war, gewährte der Wald jene Abgeschiedenheit, nach der es sie verlangte. Hier verbrachte sie ihre Tage, hier lebte sie ein einfaches Leben und mied die Städter und ihre Blicke, neugierig die einen, andere feindselig und wieder andere furchtsam.
Seit Langem hielt sich das Gerücht, die Zigeunerin habe Hexenkräfte. Dank ihrem umfassenden Wissen von den Pflanzen, Wurzeln und Kräutern, die hier im Wald wild gediehen, konnte sie manch ein Leiden heilen, doch da sie meist für sich blieb, teilte sie ihre Heilmittel nur, wenn sie darum gebeten wurde – und auch dann hatten sie ihren Preis. Davon abgesehen gab es noch etwas, das die alte Zigeunerin für die Stadtmenschen interessant machte, etwas, das nicht auf ihre Pflanzen, Kräuter oder dergleichen zurückgeführt werden konnte. Es war ihre Fähigkeit, in die Vergangenheit oder Zukunft zu sehen. Diejenigen, deren Furcht sie nicht davon abhielt, kamen zu ihr und baten sie, ihnen dieses oder jenes zu sagen, und stets kam sie ihren Wünschen nach und nahm ihr Geld im Tausch für ihre Mühe. Manchmal jedoch – und in letzter Zeit häufiger – ließen ihre Fähigkeiten sie im Stich und sie musste ihre Besucher ohne Antwort auf ihre Fragen fortschicken. Bei anderen Gelegenheiten wiederum sah sie Dinge, die sie gar nicht wissen wollten, und schwieg. Das Zweite Gesicht nannte sie diese Gabe, ein anderer Name dafür war ihr nie in den Sinn gekommen, wie schon ihrer Mutter und Großmutter vor ihr. In früheren Jahren waren die Gesichte gekommen, ohne dass sie sich darum bemüht hatte, oft in Träumen. Später lauerten sie am Rande ihrer bewussten Wahrnehmung und mussten erst heraufbeschworen werden.
Sie rief sie nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Gerade lauschte die alte Frau bei offenem Fenster dem Gesang der Waldvögel. Die stumpfen Haare hatte sie sich aus dem von Wind und Wetter zerfurchten Gesicht zurückgestrichen und zu einem schlichten Zopf geflochten. Trotz ihres Alters strahlten ihre Augen in leuchtendem Kornblumenblau; wachsam wie die eines Vogels blickten sie in die Welt und waren von Freundlichkeit und Güte erfüllt.
Ganz plötzlich spürte die Frau das vertraute Pochen und wie es stärker und stärker wurde. Sie presste sich die knorrige Hand an die Schläfe. Sie stand auf und schlurfte in den Küchenbereich. Dabei huschte ihr Blick zu der Pfütze, die sich unter dem undichten Wasserhahn in der Spüle gesammelt hatte. Düstere, verzerrte Gestalten wirbelten in dem Wasser umher. Sie schloss das Fenster und zog die Vorhänge zu; Dunkelheit kam über das Wohnwageninnere. Sie öffnete den kleinen Geschirrschrank, griff an zahlreichen Krügen und Flaschen vorbei und nahm eine hölzerne Schale und mehrere Kerzen heraus. Sie füllte die Schüssel mit Wasser, stellte sie auf den Tisch und zündete mit zittriger Hand die Kerzen an.
Die alte Frau setzte sich an den Tisch und beugte sich über das Wasser. Das Flackerlicht der Kerzen betonte die Furchen, die ihr das Leben ins Gesicht gegraben hatte. Das Pochen in ihrer Schläfe schwoll an, grelle Schmerzstiche durchfuhren ihren Schädel. Stockend murmelte sie einen Zauberspruch und wartete darauf, dass der Schmerz verebbte. Er ließ sie still und reglos auf dem Stuhl zurück.
Die Temperatur im Wohnwagen sank und die Kerzenflammen glühten nun blau. Schaudernd zog sich die alte Frau ihr Umhängetuch fester um die zerbrechlichen Schultern und starrte in die hölzerne Schale. Das Wasser trübte sich; dann wurde es ganz klar. Undeutliche Gestalten wogten. Dunkle Farben verschmolzen miteinander und trennten sich wieder. Ihre Finger zuckten krampfartig, elektrische Energien prickelten auf ihrer Haut. Dann – eine Reihe dunstiger Bilder, die wie ein Stummfilm vor ihr abliefen.
Eine Uhr schlug Mitternacht. Durch das Fenster eines Kinderzimmers beschien der Mond ein schlafendes Kind in seiner Wiege, dann verschwand er hinter einer einzelnen Wolke. Als er wieder zum Vorschein kam, war das Bettchen leer; nur ein kleiner Bär lag noch darin. Aus seinem aufgeschlitzten Bauch quoll ein Büschel Füllmaterial und die ursprünglich so saubere weiße Bettwäsche war mit winzigen erdigen Fußabdrücken übersät. Die alte Frau runzelte die Stirn und versuchte, einen Sinn darin zu sehen. Viel zu schnell wurde das Wasser wieder hell und klar und einen Moment lang glaubte sie schon, die Vision sei vorüber, aber dann erschien strudelnd ein weiteres Bild.
Das Wasser zeigte ihr ein blasses, zwölf- oder dreizehnjähriges Mädchen mit kastanienbraunen Haaren und dunklen, ausdrucksstarken Augen. Die Zigeunerin wusste weder, wer das Mädchen war, noch woher es stammte, wo es wohnte oder wie es hieß. Sie wusste nur, dass das Mädchen etwas Besonderes war.
Das Mädchen im Wasser sah traurig aus. Traurig, weil niemand begriff und niemand zuhörte. Aber das Wasser kündete auch davon, dass sie nicht allein war, dass es um sie herum huschte und raunte und wisperte und zischte. Das Wasser zeigte alles, was rings um sie vorging. Denn das Mädchen im Wasser konnte sehen, was andere nicht zu sehen vermochten. Das Mädchen hatte zweifelsohne das Zweite Gesicht; doch war das ihre gänzlich anders, als die alte Frau es kannte. Sie ahnte, welche Last das Mädchen trug.
Sie rieb sich noch fröstelnd die Hände, als es im Wohnwagen längst wieder warm geworden war. Zu leicht kroch ihr in diesen Tagen die Kälte bis ins Mark. Als die Nachmittagssonne den Wohnwagen mit ihrem beruhigenden Leuchten erfüllte, saß sie immer noch bewegungslos auf dem Stuhl und starrte die Schüssel an. Die Bilder im Wasser waren schon lange auseinandergetrieben und vergangen. Geblieben waren nur die Fragen.
Schließlich erhob sie sich und räumte die Schüssel und die Kerzen gedankenverloren weg. Ihre betagten Hände bebten. Sie zwang sich zur Ruhe. Sie wusste genug, um sich darüber im Klaren zu sein, dass die Fäden des Schicksals längst gesponnen waren. Der Weg des Mädchens und der ihre, sie würden sich kreuzen. Bald.
4
hre Mutter war längst fort, als Tanya zum Mittagessen nach unten ging. Sie war immer noch traurig. Die Vorstellung, ab jetzt wochenlang in dem alten Herrenhaus mit seinen Spinnweben und verschlossenen Türen in der Falle zu sitzen, erfüllte sie mit unbeschreiblichem Grauen.
Florence war in ihrem alten Volvo vom Einkaufen zurückgekommen. Nach einer stocksteifen Begrüßung half Tanya ihr, die Taschen voller Lebensmittel ins Haus zu tragen. Schon von Weitem bemerkte sie die tote Elfe auf der Windschutzscheibe. Im ersten Moment dachte sie noch, es sei eine übergroße Fliege, aber als sie genauer hinsah, bestätigte sich, dass es wirklich eine Elfe war, wie sie noch nie eine zu sehen bekommen hatte. Sie war winzig, kleiner als die kleinste Elfe, die ihr je begegnet war. Die Händchen waren flach gegen das Glas gepresst und nur einer ihrer Flügel hatte den Aufprall unversehrt überstanden. Der andere war quer über die Windschutzscheibe verschmiert.
Tanya atmete durch und wandte sich ab. Sie hatte einmal eine überfahrene tote Katze gesehen und ein paar kleinere Tiere, die Spitfire umgebracht hatte. Aber eine tote Elfe … Das war etwas anderes.
Danach war ihr der Appetit vergangen. Tanya rührte mit dem Löffel lustlos in ihrer Suppe und fühlte sich miserabel. Ständig musste sie an den zerschmetterten, leblosen Körper auf der Windschutzscheibe denken. Aber sosehr sie die Elfen auch verabscheute, sie brachte es einfach nicht übers Herz, das kleine Wesen wie ein zerquetschtes Insekt an der Scheibe kleben zu lassen. Kurz entschlossen entschied sie, den Winzling ordentlich zu beerdigen, sobald sich eine Gelegenheit dazu bot.
Das Mittagessen wurde an dem Eichentisch in der Küche eingenommen, die nicht so vernachlässigt worden war wie viele andere Räume. Die Betriebsamkeit hier und die Wärme hatten einen streitsüchtigen alten Wichtel angelockt, der meistens in der Teebüchse schlief, sowie eine scheue kleine Herdfee, die den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Teller warm zu halten und sicherzustellen, dass nichts überkochte. Tanya war es noch kein einziges Mal gelungen, sie deutlich zu sehen, denn sie bewegte sich schnell wie der Blitz und huschte von einer dunklen Ecke zur nächsten. Viel mehr als lange, spindeldürre Finger hatte Tanya nie erkennen können, dazu ein Kleid aus einem fleckigen, zerrissenen Geschirrtuch und einen Vorhang rotbrauner Haare, hinter dem sie sich versteckte. Im Herbst und Winter, wenn das Feuer brannte, wärmte sie sich am Kamin hinter dem Kohleneimer. In den Sommermonaten suchte sie sich andere warme Plätzchen – ausgenommen die Mikrowelle; die schien ihr Angst einzujagen.
Eine Besonderheit der Küche, die Tanya schon immer gefallen hatte, war die Wendeltreppe. Die untersten Stufen dieser Treppe wurden, bevor sie sich in einem engen Treppenschacht in den ersten und zweiten Stock hinaufschraubten, direkt neben dem offenen Kamin von einem Alkoven überwölbt. Früher hatten die Dienstboten sie benutzt, um Speisen und Getränke möglichst schnell in das Esszimmer der Herrschaft zu bringen und zu servieren. Vor einiger Zeit allerdings war die Treppe gleich nach der ersten Biegung zugemauert worden, was Tanya jammerschade fand. Zu gern hätte sie diesen Aufgang einmal erkundet. Heute erinnerte nur noch ein kleines Fenster in der Mauer an den Dienstbotenaufgang; die noch vorhandenen Stufen dienten nun als Ablagefläche für Küchengeschirr. An langen Winterabenden, wenn im Kamin die Kohlen glühten, war der Alkoven von einem geisterhaften Widerschein erfüllt. Aber jetzt, im hellen Sonnenlicht? Jetzt konnte nicht einmal der geheimnisvolle Treppenschacht Tanyas Stimmung heben.
»Keinen Hunger?«
Tanya sah hoch. Ihre Großmutter betrachtete sie aufmerksam. Ihr schmales Gesicht wurde von den weißen Haaren, die sie zu einem strengen Knoten gesteckt hatte, noch mehr betont.
»Bin ein bisschen müde«, schwindelte Tanya und erhaschte einen Blick auf spinnbeindünne Fingerchen, die sich an dem buchstäblich kochend heißen Teekessel wärmten. »Wo steckt Fabian?«
»Der ist noch unterwegs. Seit letzter Woche hat er Schulferien, also dürfte es euch beiden nicht allzu langweilig werden.«
Tanyas Stimmung sank auf ein neues Rekordtief. Dass Fabian Ferien hatte, verhieß nichts Gutes – sooft sie hier zu Besuch war, hing er wie eine Klette an ihr und folgte ihr auf Schritt und Tritt. Er schien ein Einzelgänger zu sein, zumindest brachte er nie Freunde mit nach Hause, und er nahm so gut wie keine Rücksicht auf anderer Leute Privatsphäre. In kleinen Dosen konnte sie ihn ja noch ertragen – aber zwei Wochen am Stück, das war etwas anderes. Sie sackte in sich zusammen und schob ihren Teller weg. Alles wurde immer nur noch schlimmer.
Nach dem Mittagessen half Tanya beim Geschirrabräumen und nutzte die Gelegenheit, sich ein paar Sachen zu stibitzen, die sie für die Beerdigung der Elfe gebrauchen konnte. Als ihre Großmutter ihr den Rücken zuwandte, riss sie ein Stück von der Müsliverpackung ab und ließ es in ihrer Tasche verschwinden; dann leerte sie ein Streichholzschächtelchen in eine Schale und steckte es ebenfalls ein.
Der Wagen ihrer Großmutter stand an der Schmalseite des Hauses unter jeder Menge Fenster, die allerdings überwiegend zu leer stehenden Zimmern gehörten, sodass die Chancen gut standen, nicht beobachtet zu werden. Die einzige Bedrohung war Warwick. Er hatte auf dieser Seite des Hauses einen winzigen Schuppen, in dem er Werkzeuge und Gartengerätschaften aufbewahrte, und man wusste nie, wann er etwas davon benötigte. Momentan jedenfalls war er weit und breit nirgends zu sehen, also beschloss Tanya, das Risiko einzugehen.
Mit dem Müslikarton kratzte sie die Elfe behutsam von der Scheibe und ließ sie in die Streichholzschachtel gleiten, wobei sie versuchte, nicht allzu viele Einzelheiten zu sehen – und grandios scheiterte. Denn natürlich sah sie die Einzelheiten: das getrocknete Blutrinnsal, das sich aus der Nase des kleinen Wesens bis zum Kinn hinabzog; den grauenvollen Winkel, in dem das Köpfchen hin und her schlenkerte. Sie versuchte, auch den zerfetzten Flügel in das Schächtelchen zu bugsieren, aber das erwies sich als so gut wie unmöglich und so gab sie es schließlich auf. Die Elfe würde ohne diesen Flügel beerdigt werden müssen.