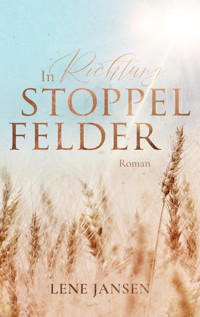4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern. Drei Leben. Ein Schweigen, das schützen soll – die Frage ist nur: wen? Ella ist geblieben. In der alten Pension am Deich, bei der demenzkranken Mutter, bei den Dingen, die repariert werden müssen. Sie hält den Alltag zusammen, flickt Mauern und verdrängt konsequent jene eine Nacht, in der der Sturm kam – und der Vater ging. Eine Entscheidung von damals verfolgt sie bis heute. Und Ella schweigt. Doch plötzlich lässt sich nichts mehr aufschieben: Rechnungen stapeln sich auf dem Schreibtisch, die Pension soll wieder Gäste empfangen – und ausgerechnet jetzt tritt ein Mann in ihr Leben, der mehr in ihr sieht, als sie selbst sich erlaubt. Zwischen To-do-Listen, Dating-Apps und hartnäckigem Stolz beginnt Ellas sorgfältig kontrolliertes Leben zu bröckeln. Denn um endlich frei zu sein, müsste sie den größten Fehler ihres Lebens eingestehen. Gerade jetzt, wo ihre Schwestern ihr näher sind als je zuvor. Was, wenn die Wahrheit alles zerstört? Oder ist sie der einzige Weg zurück ins Leben? Ein Roman über Schuld, Schwesternschaft und den Mut, sich selbst nicht länger zu übergehen. Über das Bleiben, das Festhalten – und das Loslassen, das alles verändert. Band 2 der berührenden Zweieinhalb-Schwestern-Reihe. Emotional, lebensnah und voller leiser Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Ella – Sprünge über Schatten
Zweieinhalb Schwestern Reihe
(Band 2)
Lene Jansen
Content Note: Dieses Buch behandelt sensible Themen, die für manche Menschen belastend sein können. Hinten im Buch befindet sich eine ausführliche Triggerwarnung.
Prolog
Hamburg Airport, Gate B17/6:37 Uhr
Drei helle Töne.
»Letzter Aufruf für Flug AY1483 nach Helsinki mit Weiterflug nach Bangkok. Gate B17 schließt in wenigen Minuten.«
Die knarzende Stimme aus dem Lautsprecher klingt wie eine höfliche Erinnerung daran, dass ich es eh nicht schaffen werde.
Und sehr wahrscheinlich hat sie recht.
Denn ich hocke noch immer in dem Café, in das ich mich vor anderthalb Stunden gesetzt habe. Meine Schultern angespannt, mein Nacken verkrampft. Ich sitze neben kobaltblauen Wandfliesen und starre vorbei an ebenso kobaltblauen Keramikvasen gefüllt mit irgendwelchen Gräsern in den heller werdenden Morgen.
Draußen zieht ein Flugzeug vorbei. Langsam, fast bedächtig. Das Blinklicht auf der Tragfläche leuchtet stoisch gegen das Frühgrau an.
Wenn ich mich zur Seite drehe, sehe ich Menschen, die ihre Koffern an mir vorbeirollen. Einige ausgerüstet mit Flipflops und Strohhüten, andere in dicken Outdoorjacken. Aber fast alle mit diesem Ausdruck im Gesicht, den Menschen nur haben, wenn sie auf dem Weg zu etwas sind, auf das sie sich freuen.
Falls Vorfreude ansteckend ist, bin ich eindeutig immun. Total immun.
Auf dem Tisch vor mir liegt neben einer halbvollen Tasse mit längst kaltem Kaffee die Bordkarte, die Jonna extra für mich hat umschreiben lassen. Wieso ist so etwas in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich? Wie sehr hatte ich gehofft, dass es nicht klappt, dass es einfach an so einem dämlichen technischen Problem hapert. Ich hätte die Augen verdrehen können über Jonnas völlig naive Wir-tauschen-unsere-Leben-Idee und wäre heile und mit erhobenem Kopf aus der Nummer herausgekommen.
Und jetzt?
Jetzt ist da dieser merkwürdige, unangenehme Druck in meiner Brust, der sich nicht wegatmen lässt, obwohl ich es jahrelang trainiert habe. Dieses Nichtfühlen ist doch eine meiner Paradedisziplinen. Nur seit ein paar Tagen fällt es mir verdammt schwer.
Wenn es nicht so absurd wäre, könnte man fast darüber lachen: Ich bin hier, mitten auf einem der größten Flughäfen Deutschlands, mein Gepäck ist garantiert im Bauch des Flugzeuges am Abfluggate verstaut, mein Ticket und mein Reisepass wären mit zwei Handgriffen zu erreichen. Herrgott, ich habe sogar eine vollständige Reiseapotheke mit Kohletabletten, Antihistamin für Insektenstiche, AfterSun und Rescue-Tropfen besorgt und eingepackt. Mit Mitte zwanzig hätte ich Zahnbürste und Reisepass gebraucht. Ich bin so was von bereit für die große weite Welt. Es wären nur ein paar Meter. Ein paar Schritte bis zu meinem Fensterplatz, ein paar tausend Meilen auf Reiseflughöhe und schon wäre ich in Thailand.
»Frau Ella Niehaus, bitte begeben Sie sich umgehend zu Gate B17. Flug AY1483 ist abflugbereit.«
Ich ignoriere die Durchsage. Von meinem Platz aus kann ich das Abfluggate erkennen, muss nur meinen Kopf ein wenig weiterdrehen. Sehe dort das Personal an dem Bildschirm neben der Gangway, das nur auf mich zu warten scheint. Und trotz alledem oder auch gerade deswegen bin ich wie gelähmt und schaue nur zu.
Bescheuert.
Vielleicht wäre es leichter für mich, einzuchecken, wenn ich wütender wäre.
Auf Jonna, die plötzlich aufgetaucht ist, und die einigermaßen gut verdrängte Vergangenheit mir nichts dir nichts mitgebracht hat.
Oder auf Mama, die immer weniger wird. Die stillschweigend verschwindet und trotzdem noch da ist. Natürlich weiß ich, dass es unfair wäre, auf sie sauer zu sein. Aber das würde auch keinen Unterschied mehr machen, ich und mein Leben, wir haben eh keinen Fair-Play-Award verdient.
Und ja ich bin wütend, aber es reicht nicht. Die Wut ist zu schwach. Kommt nicht gegen dieses Gefühl in mir an, das mir kontinuierlich Sätze und Fragen zuwirft: Du schaffst das eh nicht. Du kannst das nicht. Du hast keine Auszeit verdient und schon gar keine Zeit dafür. Was ist, wenn deine Mutter noch stärker abbaut, wenn ihr etwas zustößt? Dann liegst du cocktailtrinkend am anderen Ende der Welt?
Ein Seufzer. Mein Blick kehrt zurück zur Fensterscheibe neben mir, in der sich mein Gesicht spiegelt.
Blass. Müde.
Die halblangen blonden Haare stumpf und wie immer zu einem Pferdeschwanz gebunden, fast kein Make-up, nur ein Hauch Schwarz auf den hellen Wimpern, die sonst unsichtbar wären. Meine Augenränder noch tiefer als gewöhnlich.
Ich könnte versuchen, mir einzureden, es läge an der Uhrzeit, aber ich könnte es auch lassen.
Nochmals dröhnen drei elektronische Signaltöne durch die Lautsprecher, gefolgt von einer Durchsage: »Letzter Aufruf für Frau Ella Niehaus, Flug AY1483 nach Helsinki. Bitte begeben Sie sich umgehend zu Gate B17.«
Mein Name klingt falsch neben dem Wort Helsinki. Wie ein Tippfehler in einem fremden Leben.
Ich atme tief ein und langsam wieder aus. Greife nicht zu meiner Jacke, stehe nicht eilig auf, mache mich nicht auf den Weg. Bleibe sitzen. Und ja, eventuell sollte ich für immer hierbleiben. Genau hier in der Abflughalle. In diesem Niemandsland zwischen den Welten. Weder hier noch dort. Weder angekommen noch abgeflogen. Wie Tom Hanks in dem Film damals. Nur ohne Sprachbarriere, dafür mit meinem XXL-Rucksack voller Schuldgefühle.
Ich hebe den Blick erneut und sehe in aller Seelenruhe zu, wie das Gate geschlossen wird.
Wie die Maschine startbereit gemacht wird.
Beobachte, wie sie sich aufs Rollfeld verabschiedet. Schaue ihr hinterher, bis ich sie aus meinem Blickfeld verliere.
Und erstaunlicherweise ist da nicht mal ein klitzekleiner Stich in meiner Brust. Kein Schmerz, kein Bedauern. Stattdessen ein Hauch Erleichterung, halb überdeckt von einem schlechten Gewissen, denn ich ahne: Jonna wird mich dafür hassen.
Es würde ihr schon schwerfallen, mir zu verzeihen, den Flug verpasst zu haben.
Aber das habe ich nicht.
Ich habe meinen Hintern nicht vom Fleck bewegt, habe die Chance nicht ergriffen.
Und das macht es schlimmer.
Ich nehme mein Handy aus der Tasche, überlege für einen Moment, ob ich Jonna anrufe. Ihr schreibe. Mich entschuldige.
Doch stecke das Telefon dann wieder weg. Natürlich.
Sie würde mich nicht verstehen. Schafft sie nie, aber heute bekomme ich es selbst ja nicht mal hin. Also werde ich schweigen. Warten, bis mir die Wahrheit auf die Füße fällt. Das kann ich. Tue ich schließlich schon über zwei Jahrzehnte.
Nur dass die andere, die große, die üble Wahrheit so lange und konsequent von mir verschwiegen wurde, dass der Platz vor meinen Füßen nicht mehr ausreichen wird. Wenn sie fällt, dann falle ich, dann fallen wir. Dann wird alles unter ihr begraben.
Deshalb kann ich nicht zurück auf die Insel, kann Jonna nicht ständig gegenübertreten, ihr in die Augen sehen, auf ihre Fragen antworten. Keine Chance, ich muss erst einen Ausweg finden.
Langsam, fast lautlos, stehe ich auf.
Nicht dramatisch. Kein Filmmoment. Völlig unspektakulär.
Ich nehme die Bordkarte, falte sie einmal quer und einmal längs. Mit fast gemächlichen Schritten gehe ich auf den Mülleimer zu – und lasse das Stück Papier hineinfallen. Mein Gutschein zur Selbstfindung rutscht neben ein zerdrücktes Franzbrötchen, einen leeren Pappbecher und ein Snickerspapier.
Kein Abflug. Keine Ankunft.
Alles beim Alten. Und doch gleichzeitig nichts.
Ich straffe meine Schultern, versuche es zumindest. Nur der Erfolg lässt zu wünschen übrig. Dann entferne ich mich Schritt für Schritt vom Café, vom Gate, vom Mutigsein.
Und wieder wird mir klar: Bleiben ist nicht unbedingt leichter als Gehen.
Kapitel 1
Ausgesprochen unausgesprochen
Das Taxi rast die Inselstraße entlang. Am liebsten würde ich dem Fahrer sagen, dass hier siebzig ist und nicht neunzig. Fast rutscht es mir raus, dann entscheide mich aber für ein stilles Augenrollen.
Warum in aller Welt fährt ein Taxi nur an den Tagen schnell, an denen man es am wenigsten eilig hat? Wo sind die roten Ampeln, wenn man sie mal braucht? Eine Straßensperrung, ein platter Reifen, ein kaputtes Radlager – irgendetwas, das die Ankunft verzögert.
Stattdessen rauschen zu grüne Birken an mir vorbei. Ich bräuchte sie nicht einmal zu sehen, um zu wissen, dass sie ausgeschlagen haben. Mein Hals kratzt, meine Augen brennen.
»Willkommen zu Hause«, murmle ich leise und sarkastisch in mich rein. Kurz darauf muss ich niesen. Da hilft es mir auch nichts, dass die Pollen auf der Insel schneller weggeweht werden. Die Birkenallee ist und bleibt zur Blütezeit nervig.
Sofort reicht Hanna mir ein Taschentuch. »Gesundheit, die Vierte«, sagt sie mit einem Grinsen, das mir zu sonnig für diesen Tag ist.
Als Antwort folgt ein knappes Nicken, ein stummes Danke, und eine hochgezogene Augenbraue. »Sei du mal froh, dass Papa dir den Mist nicht vererbt hat. In Kiel wäre das die Hölle.«
Ihr Lächeln bleibt. Aber irgendetwas scheint sich minimal zu ändern. Schiebt sich etwa eine kleine Wolke vor das sonnig? Bevor ich den Minimalstimmungswechsel allerdings greifen kann, ist er bereits verschwunden. Hanna ist zurück zur guten Laune, trotzdem fühlt es sich an, als hätte mein Satz einen Nerv getroffen. Ist es, weil ich Papa erwähnt habe?
»Heuschnupfen wird nicht wirklich klassisch vererbt. Höchstens die Neigung des Immunsystems zur Überreaktion auf harmlose Substanzen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, mehr nicht.« Ihr Ton ist sachlich. Merkwürdig sachlich.
»Sagt die Biologin«, kontere ich. Und obwohl es eine Retourkutsche sein soll, klingt es eher müde.
»Ganz genau, das sagt die Biologin«, wiederholt Hanna bestätigend. Dann sieht sie aus dem Fenster. Weicht meinem Blick aus?
Unser Taxi biegt um die Ecke in den Innenhof zwischen der Pension und dem alten Haus.
In den vergangenen Tagen muss es ordentlich gestürmt haben. Es fällt mir direkt auf. Der Garten wirkt zerzaust, wie einmal durchgeschüttelt. Mein Blick wandert zum Dach der Pension, keine neuen Schäden, dafür erste Reparaturarbeiten. Der Dachdecker war anscheinend zum vereinbarten Termin da und hat angefangen, die alten, maroden Stellen auszubessern. Gut. Manche Dinge scheinen auch in meiner Abwesenheit zu funktionieren. Eine Erkenntnis, bei der ich noch nicht weiß, ob ich sie gut oder schlecht finden soll.
Dann erst nehme ich Jonna wahr. Sie steht vor der Haustür, die Hände in den Hosentaschen, der Blick fest in unsere Richtung.
Ich schlucke, spüre, wie Hanna neben mir ganz kribbelig wird. Sie ist voller Vorfreude. Liegt mir seit Tagen in den Ohren, dass sie sich darauf freut, dass wir endlich wieder zu dritt sind. Schwesternzeit.
Dabei könnte ich auf die Konfrontation verzichten. Genau deshalb habe ich vorhin am Telefon Nein gesagt, als Jonna gefragt hat, ob sie uns abholen soll. Die paar Minuten Aufschub habe ich mir – ich werfe einen Blick aufs Taxameter – für 18,20 Euro plus Trinkgeld erkauft.
Kaum kommt der Wagen zum Stehen, reißt Hanna die Tür auf, ruft »Jonna!«, springt raus und fällt ihr um den Hals.
Jonna erwidert die Umarmung.
Ein schönes Bild. Und doch eines, das mir einen Stich versetzt, obwohl ich weiß, dass es das nicht sollte. Hanna und ich können das auch. Eventuell etwas weniger emotional, trotzdem können wir innig. Aber dieses Schwestern funktioniert immer nur in der Zweierkombination mit ihr, mit Hanna. Nie in der Dreierkombi. Hanna versucht es immer wieder, bringt uns zusammen und wir halten uns aus. Mehr eigentlich nie. Und ich brauche nicht mal darüber nachzudenken, wer die Schuld daran trägt.
Den Kopf leicht schüttelnd ziehe ich mein Portemonnaie aus der Tasche. Heinrich, der Fahrer, tippt freundlich lächelnd auf den Fahrpreis, den ich schon kenne.
Mit einem knappen »Passt so« halte ich ihm einen Zwanziger und zwei Euro in Münzen entgegen.
»Die Firma dankt.« Er nickt freundlich und steckt das Geld in eine wuchtige schwarze Lederbörse. Dann hebt er den Blick. »Schön, dass du wieder da bist, Ella. Ohne dich ist’s hier auch komisch.«
Der Satz macht irgendetwas mit mir, irgendetwas Gutes. Und trotzdem schnaufe ich. »Als ob du gemerkt hättest, dass ich weg war.«
»Doch, doch. Ich krieg auf der Insel alles mit, weißt du doch.« Ein Grinsen schiebt sich auf sein Gesicht. »Auch das, was der Dachdecker so über die verlorene Schwester erzählt.«
DerDachdecker? Über dieverlorene Schwester? Über Jonna? »Ähm, worüber redest du?«
Er antwortet mit einem abwinkendem »Nichts, nichts«, doch seine Augenbrauen erzählen eine andere Geschichte.
Nicht ungewöhnlich für ihn. Hauptberuflich fährt Heinrich Taxi, nebenberuflich verwaltet er gemeinsam mit seiner Frau, der das lokale Fußpflegestudio gehört, die Gerüchte auf der Insel.
Egal, ich frage nicht weiter nach. Es geht mich nichts an. Also verabschiede ich mich kurz. »Mach’s gut und grüß die Familie«.
»Ebenso. Und denk mal über Vorhänge in der Pension nach. Privatsphäre und so.«
Was zur Hölle redet er?
Ich ignoriere den Kommentar und diesen zweideutigen Unterton, steige aus und werfe die Tür zu. Ein kurzer Atemzug, dann drehe ich mich zu meinen Schwestern, während Heinrich einen Bogen fährt und mitsamt seinem Taxi verschwindet.
Ich schlucke, sogar das fällt mir schwer. Verzweifelt suche ich nach einem Satz – einem Einstieg, irgendetwas.
Und finde nicht mehr als ein: »Na?«
Nicht mal ein Wort, eher ein Laut. Selbst in meinem Kopf klingt es falsch.
Neun Tage war ich bei Hanna. Zuerst sogar ohne Zahnbürste, ohne Kleidung, ohne Plan. Weil all das entweder im Gepäckraum eines Fliegers oder am Flughafen liegen geblieben war.
Ich stand vor ihrer Tür und habe mich gefühlt wie eine Verliererin.
Aber Hanna hat mich in den Arm genommen und reingebeten.
Wir haben geschwiegen, gekocht, Wein getrunken. Serien geschaut, geredet. Nicht zu viel, aber von allem ein wenig. Es hat sich richtig angefühlt. Wie Familie. Wie Schwestern. Wie früher.
Nicht nur das, vor meiner Abreise von der Insel Richtung Nicht-Thailand habe ich selbst mit Jonna mehr Interaktion hinbekommen. Ein Gespräch, eine Abmachung, ein Abschied am Fähranleger.
Und jetzt? Nur dieses verdammte »Na?«.
Jonna nickt kurz. »Seid ihr gut durchgekommen?« Small Talk. Aber was soll sie auch antworten?
Hanna scheint die Schwingungen zu bemerken, übernimmt – wie so oft. »Ja, easy. Nicht mal vier Stunden von Tür zu Tür.«
Vier Stunden, und mir ging es trotzdem zu schnell.
Ich sage nichts. Spüre, wie der Hals kratzt und die Augen brennen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Pollen dafür die gesamte Schuld in die Schuhe schieben kann.
»Schön«, sagt Jonna noch immer auf dem Treppenstein vor der Eingangstür stehend. »Kommt rein. Wollt ihr was frühstücken?«
Ich hebe die Augenbrauen. Kann nichts dagegen tun. Aber mal ehrlich. Jonna bittet mich in mein Haus. In das Haus, in dem ich mein gesamtes Leben verbracht habe. Ich bin schließlich die, die geblieben ist. Sie ist gegangen. Sie ist zu Besuch. Nicht ich. Und sowieso, wer frühstückt denn bitte noch um diese Uhrzeit?
»Um elf Uhr?« Die Worte kommen einfach so aus meinem Mund, obwohl ich weiß, dass ich es lassen sollte. Kein Sticheln. Unsere Begegnung eskaliert eh, das ist vorprogrammiert. Ich brauche keinen Brandbeschleuniger. Nur ist es halt auch mein Schutzpanzer. Angriff ist die beste Verteidigung. »Ich nehme wohl eher einen Kaffee.« Damit gehe ich an Jonna vorbei durch die Haustür, sehe aber noch ihr Augenrollen. Die erste echte Reaktion seit meiner Rückkehr. Eine, mit der ich etwas anfangen kann. Eine, die zu erwarten war … und trotzdem wehtut.
Ihr leicht genervtes »Kaffee steht natürlich auch in der Küche« erwischt mich schon auf halben Weg durch den Flur ins Wohnzimmer.
Warum sind wir beide so? Warum müssen wir jede noch so kleine Chance nutzen, gegeneinander zu sein? Und warum in aller Welt, kann ich mich nicht mal runterregulieren?
Minuten später sitzen wir am Küchentisch. Mein Brötchen ist und bleibt unangetastet. Ich nippe am Kaffee, der mir zu dünn ist. So wie früher, als Mama ihn noch gemacht hat. Damals, bevor die Zahlen in ihrem Kopf aus der Reihe tanzten. Bevor erst die Rezepte verschwanden, dann die Namen zu den Gesichtern – und immer mehr sie selbst.
Meine Finger zittern leicht. Krampfhaft verstärke ich den Griff um die Tasse. Will nicht, dass Jonna oder Hanna es bemerken. Ich komme klar.
Alles ist in Ordnung. Ich bin nur etwas müde. Geschafft von der Anreise. Von den letzten Tagen. Und von allem, was unausgesprochen zwischen uns in der Luft liegt. Nur müde, mehr nicht. Wenn ich zurück in den Alltag finde, dann wird es schnell besser. Routinen helfen. Strukturen schaffen Sicherheiten. Funktionieren kann ich. Eigentlich.
Um den Blickkontakt zu vermeiden, scanne ich den Raum. »Die Fenster müssten geputzt werden«, sage ich – und hasse mich im selben Moment für den Satz.
Nicht der Worte wegen. Obwohl schon auch. Aber vielmehr aufgrund des Tons, weil er genauso klingt, wie es von mir zu erwarten war: nach Kontrolle. Nach Kritik.
Jonna seufzt. Extra laut. Extra deutlich. Zu Recht. »Ist das dein Ernst? Bei allem, was wir uns zu sagen hätten, ist es das, was du unbedingt direkt zu Beginn loswerden willst?«
Ich hebe abwehrend die Hände inklusive Kaffeetasse. »Entschuldige bitte, es ist mir halt aufgefallen.«
Gelogen ist es nicht wirklich. Aber es ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Denn eigentlich sind die dreckigen Fenster ein Notnagel. Fokus verschieben auf die greifbaren Dinge. Auf etwas, was man bewältigen kann.
Hanna sagt irgendetwas Beschwichtigendes. Wie immer. Sätze über Wolken und Fenster und darüber, dass die Sonne hier eh nie lange scheint.
Ich höre ihr zu. Und auch wieder nicht. Ich nehme alles gleichzeitig wahr und nichts so richtig. Wieder ein Grund, mich selbst zu ohrfeigen.
Mein Blick wandert zurück zur Kaffeetasse. Ich halte mich daran fest. Aber es hilft nichts.
Denn Jonna sitzt mir gegenüber.
In ihrem Blick liegt etwas, das mich trifft. Nicht wie ein Vorwurf. Eher wie ein bohrendes, stilles, aber unüberhörbares »Warum?«.
Und damit meint sie sicherlich nicht nur Thailand, sondern mein Verhalten, meine Reaktionen … ach, vermutlich mein gesamtes Leben. Alles … abgesehen von dem einen Warum, das sie mich wirklich fragen müsste, von dem sie aber nichts ahnt. Seit verfluchten zwanzig Jahren nichts ahnt.
Ich kann die Vergangenheit, diese eine Nacht, nahezu komplett aus meinem Kopf verdrängen, wenn Jonna weit genug weg ist. Wenn ich sie nicht sehe, nur über Hanna von ihr höre. Aber nicht, wenn sie hier sitzt, mitten in meiner Küche, mitten auf unserer Insel. Wenn sie mir mit jedem Schuldeingeständnis ihrerseits den größten Fehler meines Lebens auf dem Silbertablett präsentiert.
Und diese Stille in diesem Augenblick macht es schlimmer. Jedes Klimpern des Teelöffels in ihrer Tasse. Jeder Bissen von Hanna. Es ist nicht auszuhalten, und deshalb entscheide ich mich, wenigstens ein Warum aus dem Weg zu räumen. Selbst das schaffe ich nur ohne Blickkontakt.
Ich fokussiere einen der Eierbecher. Serviere mein Geständnis zwischen Zwiebelmett und Mehrkornbrötchen. »Übrigens … ich war nicht in Thailand.«
Herrgott noch eins. Hätte ich mal für einen Sekundenbruchteil darüber nachdenken können, wie ich es sage? Definitiv nicht so. So beiläufig und trotzdem brutal ungeschönt. Peinlich berührt lasse ich meine Augen den Aufschnittteller scannen und warte.
Das Schweigen meiner Schwestern ist laut, aber glücklicherweise nicht lang.
»Ja. Hab ich gemerkt.« Jonnas Stimme ist neutral, klingt fast desinteressiert.
Sofort spüre ich, wie mir die Hitze in den Nacken steigt. Nicht, weil Jonna wütend ist. Sondern, weil sie es nicht ist. Ihre Gelassenheit ist es, die mich dazu bringt, den Kopf anzuheben.
Unsere Blicke treffen sich, und da ist sie wieder, diese tonnenschwere Schuld. So gern möchte ich sie endlich loswerden, würde mich gern entschuldigen. Aber es kommen nur zwei dünne Sätze über meine Lippen: »War so nicht geplant. War keine Absicht.« Zu wenig, zu schwammig. Dabei hatte ich doch Gründe. Ich konnte nicht, auch wegen Mama, ich war halt … nicht bereit.
Ein Aufflackern in Jonnas Blick, ein minimales Zögern. Dann ein »Passt schon«. Mehr nicht.
Kurz. Abgehackt. Emotionslos. So, wie man eine Kiste zuschlägt, die man nicht öffnen will. Und vielleicht tun wir beide gerade genau das.
Doch als ich denke, dass eben dieses Kiste zu, Affe tot ein möglicher Weg für uns sein könnte, damit umzugehen, knallt Hanna ihr Buttermesser auf den Tisch. Ich zucke zusammen.
»Das war’s jetzt?«, ruft sie. Ungewohnt laut, ungewohnt genervt. Ungewohnt für Hanna. »Ihr beide seid echt solche Dickschädel.« Sie sieht mich an. »Das war die Entschuldigung, vor der du Angst hattest?«
Ich will sagen: Ja.
Ich will sagen: Verkapselt, aber immerhin war es irgendwie eine.
Aber ich sage nichts. Gar nichts.
Sie wartet auf keine Antwort, dreht sich stattdessen schwungvoll zu Jonna. »Und du nimmst sie einfach so hin, nach all dem? Heulst mir die Ohren voll und jetzt sagst du: Passt schon?«
Ich höre Jonna Luft holen, dann ausatmen. Auch sie schweigt.
Mit einem quietschenden Ton, der im Hinterkopf schmerzt, schiebt Hanna beim Aufspringen den Stuhl zurück. »Mein Gott, sprecht doch mal miteinander. Aber nein … Warum auch?«
Sie geht. Dabei ist sie doch die, die bei jedem Streit bleibt. Die, die immer vermittelt. Die jedes Gespräch rettet, bevor es ganz kippt. Jetzt geht sie. Schnurstracks Richtung Terrassentür. Einfach weg. Einfach so.
Zurückbleiben Jonna und ich. In der Küche. Allein. Ausgesprochen unausgesprochen.
Kapitel 2
Zwischen den Zeilen
Als würde es irgendetwas an der Situation ändern, stehen Jonna und ich ebenfalls von unseren Stühlen auf. Nicht synchron, aber beinahe.
Ein Moment einvernehmliches Starren und Schweigen. Nebeneinander positioniert wie zwei Achtklässlerinnen, die beim heimlichen Rauchen auf der Toilette erwischt worden sind. Nur dass die Lehrerin, die uns die Leviten lesen sollte, bereits das Klassenzimmer verlassen hat.
Mein Hals ist eng, meine Brust auch. Alles, die ganze Küche. Und es ist verdammt schwer, das zu ignorieren.
»Was war das denn?« Jonnas Stimme ist leiser als normalerweise. Mehr noch, weil sie nicht direkt mit mir spricht, sondern in Richtung Garten, in Richtung Hanna, die allerdings längst aus unserer Sichtweite verschwunden ist.
»Das ist neu.« Meine Worte wollen locker rüberkommen, aber der Tonfall lässt sich nicht dirigieren. Er klingt zu überrascht.
Unsere kleine Schwester wird nicht laut. Sie geht nicht. Sie verarztet, überklebt, flickt, vermittelt. Immer.
Jonnas und mein Blick treffen sich. Es ist kein langer Moment, aber einer, der reicht.
»Ich glaub, wir haben es dieses Mal echt übertrieben«, sage ich und schlucke. Wundere mich selbst über meine Worte, denn auch wenn ich das Wir nutze anstatt das Ich, ist es ein Fehler, den ich zugebe, eine Art Eingeständnis. Und davon gab es in letzter Zeit nicht viele.
In Jonnas Augen blitzt etwas auf. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Verwunderung oder Zustimmung ist. Vielleicht ist es sogar von beidem ein wenig. Oder es ist nicht mehr als die Reflexion von Licht, das durch das ungeputzte Küchenfenster fällt. Wie auch immer: Jonna nickt wortlos, und diese Geste gibt mir den kleinen Schubs, den ich brauche, um weiterzureden.
»Dann noch mal in vernünftig«, setze ich an, knete meine Hände. Ich möchte dieses eine Wort sagen. Das Wort, das mir so schwer über die Lippen kommt. So schwer, dass ich es lieber jedes Mal mehr oder weniger elegant übergehe. In diesem Moment zwinge ich mich dazu. Weil wir sonst wieder zurückfallen. Ich will aber nicht zurück, ich will weiter. »Entschuldigung.« Vierzehn Buchstaben und jeder tonnenschwer. Vielleicht purzeln die anderen deshalb hinterher. Weil der Weg endlich frei ist. »Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht nach Thailand geflogen bin und dein Sabbatical damit verpufft ist. Das kam vorhin vermutlich nicht so rüber. Das Geld bekommst du natürlich zurück. Ich stottere es ab.« Ich senke den Blick, warte nicht auf eine Antwort. Alles in mir versucht, sich kleinzumachen, würde am liebsten verschwinden. Weil ich meine Entschuldigung nur auf die Kosten reduziert habe. Warum ist es so viel leichter für mich, Verantwortung zu übernehmen, wenn es ums Finanzielle geht? Und so viel schwerer, wenn es sich um Emotionen dreht? Geld kann ich. Zahlen, Termine, Rücküberweisungen. Emotionen dagegen sind wie IKEA-Aufbauanleitungen. Ich bin nie sicher, ob ich es wirklich richtig mache, und am Ende sind Schrauben über.
Sekunden vergehen. Jede einzelne zieht sich. Erst dann höre ich ein Räuspern von Jonna und eine Antwort.
»Es ist wirklich okay. Für mich war es gut, hierzubleiben. Du hattest recht – und das sage ich nicht gerne, das weißt du.«
Ja, Jonna. Weiß ich, weiß ich sehr gut. Geht mir ebenso.
Doch meine Schwester ist noch nicht fertig, redet weiter. »Es stimmt: Ich habe jede Menge Steine umgedreht, manche absichtlich, über andere bin ich quasi gestolpert. Und ja, es hat mir geholfen. Mehr, als Thailand das je gekonnt hätte. Ich habe ein Stück mehr zu mir gefunden. Aber …« Sie macht eine Pause. Einen Atemzug lang nur, und doch ist es ausreichend, um dem Aber genug Zeit zu geben, seine Ellenbogen auszufahren und sich ruppig zwischen uns zu platzieren.
Schnell baue ich den inneren Schutzwall wieder auf. Ich bereite mich vor. Auf das, was kommt. Auf den Vorwurf. Obwohl irgendetwas anders ist als sonst. Jonna wirkt weicher, kleiner, irgendwie jünger. Sie demonstriert keine klare Angriffshaltung. Keine drohenden verbalen Fäuste. Im Gegenteil, sie scheint überfordert und … traurig?
»Nur reicht es trotzdem noch nicht.« Ihre Stimme ist ein Flüstern. Und mir zieht es das Herz zusammen. Keine Kritik, sondern Verletzlichkeit. Einfach so, nicht mal versteckt.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Stattdessen handle ich. Instinktiv. Tue, was mein Körper tun will, und nehme sie in den Arm. Richtig. Nicht auf eine distanzierte Art, nicht aus Höflichkeit. Nicht diese stocksteife Geste, die wir uns in den letzten Jahren hin und wieder abgerungen haben, sondern so, wie ich es damals getan habe. An dem Tag, den ich am liebsten aus meinem Gedächtnis löschen würde. Der sich aber Detail für Detail eingebrannt hat. Wie all die Tage um Papas Tod.
Warum in aller Welt haben wir keine Kontrolle über unsere Erinnerungen, warum sind wir ihnen so oft schutzlos ausgeliefert?
Wir waren neunzehn und siebzehn. Es war Papas Beerdigung. Draußen Nieselregen. Drinnen Beileidsbekundungen, die alles nur schlimmer machten, nichts besser. Umschläge mit Geld, die uns teils wortlos zugesteckt worden waren, und die Überforderung einiger Trauergäste damit in unsere Taschen wandern ließ. Schwere Luft, vollgestopft mit Trauer, Mitleid, Streuselkuchen, geschmierten Käsebrötchenhälften und der Suche nach den richtigen Worten. So voll damit, dass es kaum möglich war, zu atmen.
Jonna stand da, versuchte, all das auszuhalten. Die Blicke, die Worte, die Handschläge, die Schulterklopfer. Sie wirkte so unfassbar verloren in ihren schwarzen Jeans, den Chucks und einem viel zu großen Pullover von Papa, den sie die letzten Tage bei jeder Gelegenheit trug. Sie ging darin unter. In all dem.
Und ich doch genauso. Wir funktionierten auf eine merkwürdige Weise und auf eine andere Art überhaupt nicht.
Auch damals hatte ich den gleichen Impuls und habe ihm nachgegeben. Habe Jonna gepackt und weggezogen von den Gästen, die zu viele waren, zu laut und gleichzeitig zu leise. Die zu traurig waren, obwohl es ihnen nicht zustand, und gleichermaßen nicht traurig genug.
Abseits der Menge im Nebenraum der Gaststätte habe ich Jonna in den Arm genommen und gehalten. Erst da hat sie gezittert und geweint. Richtig geweint. Von außen betrachtet sah es bestimmt so aus, als sei ich ihr Rettungsring. Doch eigentlich war sie ebenso meiner. Ich habe sie nicht nur gehalten, ich habe mich auch festgehalten.
Damals dachte ich, das würde reichen. Dass wir drei Schwestern und Mama uns reichen werden, dass wir das gemeinsam überleben.
Und ja, überlebt haben wir – alle vier.
Nur halt nicht gemeinsam.
Trotzdem fühlt sich unsere Umarmung mitten in der Küche für einen Augenblick wieder so an wie damals. Wie Nähe, wie Familie, wie richtig. Aber es ist eben nicht mehr als ein Augenblick. Ein fast vergessener Akkord, der kurz erklingt und danach verstummt. Denn sogar in dieser Umarmung bleibt so vieles falsch. Obwohl eigentlich bin nur ich es.
Ich bin falsch. Es ist so glasklar, dass ich es mir nicht schönreden kann: Ich hätte es ihr längst sagen müssen, damals schon. In der Nacht seines Todes, auf der Beerdigung, in all den Wochen, Monaten danach, in denen sie fast an der Schuld zerbrochen ist. Müsste es spätestens jetzt aussprechen. Alles. All das, was ich verschwiegen habe. Die Wahrheit und den Grund, warum ich so geworden bin, wie ich bin.
Ich habe die Pflicht, zu reden.
Und weiß gleichzeitig, dass ich es nicht tun werde.
Weil es alles schlimmer macht.
Also halte ich Jonna noch einen Moment länger fest. Und als ich mich löse, habe ich das Gefühl, dass sie ebenfalls gerade in der Vergangenheit war, dass wir uns für ein paar Sekunden gemeinsam auf der Beerdigung unseres Papas in den Armen gelegen haben.
Ich sehe meiner Schwester in die Augen, schicke ihr so viel, wie ohne Worte möglich ist, und sage nichts mehr als: »Wenn du dieses Sich-selbst-finden hinbekommen hast, sag mir bitte, wie.« Mein Tonfall ist ehrlich. Kein Zynismus. Keine Ironie. Ich, schutzlos ohne meine Rüstung, so schutzlos und offen wie seit einer Ewigkeit nicht mehr. Für ein paar Atemzüge könnte man fast meinen, wir beide wären Schwestern. So richtig echt und heil … nicht so ätzend kaputt.
Kapitel 3
Jetzt oder nie
Das Geräusch der sich schließenden Terrassentür klingt in meinem Kopf nach wie ein Echo. Jonna ist raus, Hanna hinterher. Zwei Schwestern gehen – und eine bleibt zurück. Ich bin die Dritte. Schon wieder. Manche Dinge sind halt, wie sie sind.
Die Küche wirkt plötzlich leerer, als sie es normalerweise tut. Obwohl normalerweise der völlig falsche Ausdruck ist, denn es ist noch immer alles andere als normal, dass Mama nicht mehr hier wohnt.
Kann man sich an das Alleinsein gewöhnen? Ist es so wie mit dem Magen, der sich je nach Volumen der Nahrung verkleinert oder vergrößert … mehr oder weniger braucht? Ist es mit dem Bereich im Gehirn, der für diesen ganzen sozialen Kram zuständig ist, auch so? Braucht der irgendwann weniger? Reichen kurze Gespräche beim Bäcker oder mit den Gästen der Pension? Wird es sich irgendwann weniger einsam anfühlen?
Ich könnte Hanna mit ihrem umfangreichen Biologiewissen fragen, wenn es nicht eine so unfassbar traurige Frage wäre. Eine Frage, die dazu führen würde, dass sie sich Gedanken macht. Und ich bin niemand, um den man sich sorgen braucht. Nie. Punkt.
Seufzend schiebe ich nacheinander die Ärmel meines dünnen Pullis hoch. Mit einer routinierten Handbewegung öffne ich den Wasserhahn, lasse das Spülbecken volllaufen und gebe einen Spritzer Spülmittel dazu. Ein normalisierter Ablauf, der keinen Platz für Abweichungen lässt.
Ich trage das Geschirr zusammen, stelle es auf die Arbeitsfläche, schließe den Wasserhahn und tauche die Hände in Spülwasser, das zu heiß ist, um angenehm zu sein, aber nicht heiß genug, um mich davon abzulenken, was tief in mir arbeitet.
Ich habe Jonna losgeschickt, um Hanna zu suchen. Weil sie einfach besser in diesen Gefühlsdingen ist. Jonna tut oft, was sie fühlt, ich hingegen … Zu selten. Weil es nicht gut ist, weil Emotionen nur dazu führen, dass …
Ich schlucke, stelle die gespülte, noch nasse Kaffeetasse mit einem zu harten Klack auf die Ablage. Denn plötzlich bin ich wieder dort. In jener Nacht. Damals.
Der Regen war angekündigt, aber nicht der Wind. Nicht dieses extreme Wüten der Natur. Nicht das, was danach kam.
Ich erinnere mich, wie ich am Fenster meines Zimmers lehnte. Wie ich in den wolkenverhangenen Himmel gestarrt habe. Neben mir das Buch, das ich versucht hatte, zu lesen, in dessen Seiten ich mich fliehen wollte, um den lautstarken Streit meiner Eltern auszublenden. Sakrileg stand in weißen Lettern auf dem roten Cover. Alle haben es damals gelesen. Also las ich es auch. Nur funktionierte das Versinken in die Seiten nicht. Keine versteckten Codes, kein Geheimbund, keine Offenbarung, die mich retten konnte. Papas und Mamas Worte flogen wie Pfeile durch die Wände, dieselben Vorwürfe, dieselbe Müdigkeit wie so oft.
Ich wollte sie nicht mehr hören. Nicht zum hundertsten Mal.
Ich starrte in die dunklen Wolkenberge am Horizont. Hoffte, dass sie weiterzogen, dass alles weiterzog.
Dann bewegte sich etwas in meinem Blickfeld. Unten auf dem Hof.
Jonna.
Trotz Hausarrest schlich sie sich heimlich davon. In ihren nagelneuen Turnschuhen. Mit ihrer Kapuze tief im Gesicht. Als würde sie meinen Blick auf sich spüren, drehte sie sich um.
Ich im Obergeschoss, das Licht hinter mir, sie im Dunkel des Hofs, aber wir sahen uns.
Ihre Augen fanden meine.
Ich war so wütend. Meine Fäuste ballten sich.
Der Streit unter mir wurde lauter. Mamas Stimme, schrill, genervt. Papas dumpfes Murmeln.
Und Jonna? Ging einfach.
Wie immer.
Ich hob die Hände, eine stumme Frage: Du haust jetzt wirklich ab? Schon wieder? Dazu eine Drohung mit den Augen. Ein klares Tu das nicht!.
Als Antwort? Nur ein Zucken mit den Schultern. Dieses typische Jonna-Zucken, dazu ein entschuldigendes Lächeln.
Natürlich verstand ich. Es sollte mir zeigen, dass sie nicht anders konnte. Und spätestens da wusste ich es: Sie würde gehen. Egal, was ich machte, egal, ob ich zurücklächelte, wovon ich nicht weiter entfernt hätte sein können. Aber es spielte keine Rolle.
Wie egoistisch war das bitte? Als ob sie nicht anders konnte? Man hatte immer eine Wahl.
Hanna und ich standen es schließlich auch durch. Hanna und ich hielten uns an Regeln. Hanna und ich versuchten, die Familie zusammenzuhalten. Aber auch das war Jonna egal … Wir waren ihr egal.
Die Wut stieg mir in die Kehle. Ich wollte das Fenster aufreißen, ihr nachschreien.
Aber ich tat es nicht.
Stattdessen stand ich nur da. Sah zu, wie sie über den Hof schlich, wie sie an der Ecke verschwand.
Dieses Mal würde ich sie nicht decken. Sollte Papa sie doch erwischen. Sollte er endlich mal sauer sein auf seine Lieblingstochter.
Ich drehte mich weg vom Fenster, weg von Jonna.
Ohne zu wissen, dass ich sie nie wieder so sehen würde.
Lebendig. Trotzig. Mit Papas Lächeln im Gesicht.
Ohne zu wissen, dass sich alles verändern würde.
Ein Teller rutscht mir beinahe aus der Hand. Ich fange ihn zwar gerade noch, doch das Porzellan klirrt gegen die Ablage.
Ich atme aus. Zwinge mich ins Jetzt zurück.
Dahin, wo mein Herz rast.
Mechanisch trockne ich meine Hände ab. Stehe da, das Geschirrtuch zwischen den Fingern.
Die Erinnerung hallt nach. Die Wut. Die Schuld. Alles.
Und plötzlich ist der Gedanke da: Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ich muss mit ihnen sprechen. Mit beiden.
Jetzt. Oder nie.
Ordentlich schiebe ich das nasse Handtuch über den Griff des Ofens, streiche ein letztes Mal den karierten Stoff glatt und gehe dann zur Terrassentür, raus in den Garten. Atme tief ein und mache mich auf den Weg runter zum Strand.
Der Wind hat aufgefrischt, trägt den Geruch von Salz, Tang und kaltem Wasser mit sich.
Das Rauschen der Wellen wird lauter, je näher ich komme. Ein tiefes Grollen, das gegen die Küste schlägt, zögert, zurückweicht – und doch immer wieder kommt.
Von der Düne aus sehe ich meine Schwestern. Sie sitzen im Sand, Seite an Seite, doch mit einem kleinen Zwischenraum, der mir genug Informationen über den Stand des Gespräches liefert. Scheint nicht sonderlich gut zu laufen.
Ich trete näher, langsam. Verlasse den festen, von Dünengras durchzogenen Boden und stapfe weiter in den weichen Sand. Mit jedem Schritt sinke ich ein Stück tiefer.
Einmal durchatmen.
Kurz hinter den beiden bleibe ich stehen, Sie haben mich noch nicht entdeckt. Eben noch haben sie sich angesehen, jetzt geht ihr Blick wieder aufs Meer.