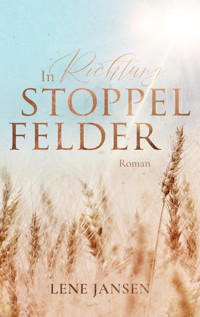4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal sind es kleine Entscheidungen, die Großes verändern können. Und manchmal trifft man genau diese Entscheidungen mit Anfang vierzig, nach einem Klassentreffen, im ersten Licht des Tages, auf dem Dach der alten Schule. Gemeinsam mit jemandem, dem man zuvor nie richtig zugehört hat. So geht es Lena, die bis zum Hals im Alltag versunken ist und Phil, der seine Freiheit über alles stellt. Zwei Menschen, denen nur zwei Nächte und zwei Tage bleiben, um zu verstehen, wo im Leben sie eigentlich stehen. Ein Hoch auf die Liebe, ob alt oder neu, ein Hoch auf das Leben und die Freundschaft, auf heute, morgen und übermorgen und auf Amsterdam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Und dazwischen wir
Lene Jansen
Für Ben,
weil du mein Amsterdam bist,
weil Husum keine Insel ist
und weil es Papageientaucher
eben doch gibt.
Prolog
Sonntag: 8:45 Uhr
Lena
Bei der Macht von Grayskull – ist mir schlecht.
Und nicht nur das.
Mit kleinen Augen, aber umso größeren Magenproblemen schiebe ich den Saum des Oversize-Shirts mit dem She-Ra-Aufdruck über meine angezogenen Knie, während mir die Kühle der Wandfliesen in den Körper kriecht.
Neben der Übelkeit, die alle paar Minuten in Wellen über mich schwappt, habe ich tierische Kopfschmerzen. In der vorderen Kopfhälfte, direkt hinter der Stirn, dröhnt es. Oder ist es ein Stechen? Ein Pochen? Was weiß ich.
Ich atme ein und seufze leise. Alles ist anstrengend. Allein das Sitzen lässt meinen Körper an seine Grenzen stoßen. Wie gern würde ich mich hinlegen, hier, mitten in dieses Badezimmer. Einfach auf den Boden. Allerdings geht es mir in der Waagerechten noch elender. Ein Teufelskreis.
Durch das schmale Sprossenfenster fällt mein Blick auf einen wolkenfreien, strahlend blauen Himmel über dieser mittlerweile nicht mehr ganz so fremden Stadt. Würde das grelle Sonnenlicht mir nicht beinahe den Schädel sprengen, müsste ich dieses Wetter, diese Aussicht eigentlich feiern.
Obwohl … wenn mir nach etwas nicht zumute ist, dann nach Feiern. Allein das Wort löst eine Flut von Bildern aus, die stroboskopartig in meinem benebelten Kopf aufblitzen: Türsteher, Gedränge, Longdrinks, schräger Typ an der Bar, Lichteffekte, Tanzfläche, Rotwein und noch einige Cocktails. Hastig schließe ich die Augen, massiere meine Schläfen. Stroboskop ist gar nicht gut.
Mein Körper scheint mir die gestrige Nacht mehr als übel zu nehmen. Zu Recht! Wie viel habe ich eigentlich getrunken? Und warum?
Okay, warum weiß ich.
Ein zweiter, längerer Seufzer entfährt mir … und der liegt nicht nur in den Kopfschmerzen und der Übelkeit begründet.
Bevor ich mich in Gedanken im Warum verlieren kann, krampft mein Magen erneut. Ich versuche, die Situation mit Atemübungen zu retten. Einatmen – ausatmen – konzentrieren.
Ein, zwei Minuten vergehen, und die Übelkeit ebbt ab. Bis vor einer knappen Stunde hatte ich völlig verdrängt, wie heftig sich so ein Kater anfühlt. Kein Wunder, der letzte ist Jahrzehnte her.
Ob sich der rebellierende Magen auf einen Schluck Wasser mitsamt Tablette einlässt? Behutsam drehe ich mein Gesicht nach rechts, versuche, mich in Zeitlupe zu bewegen, langsamer als das Dröhnen im Kopf. Doch es funktioniert nicht. Weiterhin spüre ich jeden einzelnen Herzschlag direkt als Schmerz in meinem Schädel … und irgendwie schlägt dieses leicht verwirrte Herz seit einigen Stunden erstaunlich oft.
Ich schiebe den Gedanken beiseite. Immerhin blicke ich jetzt Richtung Waschbecken. Mit der Zunge fahre ich über meine trockenen Lippen. Allerdings macht mir die Entfernung zwischen meinem Sitzplatz neben der Toilette und dem Wasserhahn am anderen Ende des Raums einen Strich durch die Rechnung. Hinüberzulaufen ist nicht machbar. Das sind mindestens zwei Meter. Schaff ich nicht.
Wenn ich doch nur nicht so einen Durst hätte! Ein Königreich für ein Glas Wasser … und einen Kaugummi.
Mein Blick wandert durch das Badezimmer. Wieder fällt mir auf, wie aufgeräumt alles ist. Die Handtücher akkurat gefaltet, die in Echtholz eingefassten Spiegel mit den schicken Edelstahlspots ganz ohne Fingerabdrücke oder Flecken. Selbst Zahnbürste, Seife und Rasierer stehen perfekt, ohne platziert zu wirken. Nichts liegt oder steht am falschen Platz.
Nichts … außer mir.
Ich bin nicht stimmig, nicht akkurat und definitiv alles andere als sortiert. Ich gehöre hier nicht hin. All das hätte nicht passieren dürfen.
In Büchern? – Okay.
In Filmen? – Klar.
Im echten Leben? – Von mir aus.
Aber doch nicht in meinem!
Ich bin über vierzig und damit auf jeden Fall zu alt für den Scheiß.
Wie zur Bestätigung überrollt mich die nächste Welle Übelkeit. Reflexartig halte ich mir den Unterarm vor den Bauch. Und dieses Mal hilft keine Konzentration und auch keine Atemübung …
Kurz darauf hocke ich wieder bewegungslos an den kühlen Wandfliesen, wünsche mir umso dringender ein Glas Wasser und bin mir selbst unendlich peinlich. Zum Glück sieht mich niemand, und es wird auch niemals irgendjemand irgendetwas darüber erfahren, weder über heute noch über gestern. Basta.
Keine Minute später klopft es an der Schiebetür.
Okay. Es wird niemand erfahren – mit Ausnahme von ihm.
Während ich noch in meiner Schockstarre verharre, klopft es ein zweites Mal.
»Hey, Lena.« Er klingt zaghaft, nicht so, als wolle er sich lustig machen. »Wie ich höre, geht es dir nicht sonderlich gut.«
Bitte nicht! Nicht drüber reden.
Obwohl weder er mich noch ich ihn sehen kann, wechselt meine Gesichtsfarbe in Sekundenbruchteilen von kreidebleich zu granatapfelrot. Zumindest fühlt es sich so an. Ich glühe. Am liebsten würde ich vor Scham im Boden versinken, irgendwo zwischen den Fliesen durch die Fugen verschwinden. Einfach weg, bloß nicht die letzten Stunden Revue passieren lassen. Die Tatsache, dass mein Kopf sich sogar in seinem jetzigen Zustand detailgetreu ausmalt, wie er da vor der Tür steht – sehr wahrscheinlich mit nichts bekleidet außer seinen Boxershorts –, macht es meiner Gesichtsfarbe nicht leicht, wieder auf kalkweiß umzuschalten.
Sag was, Lena. Sag einfach irgendwas.
»Äh, ja … Sorry, ist mir echt unangenehm.« Mehr Worte bekomme ich nicht über die Lippen.
»Ich finde es eigentlich ziemlich witzig.«
Sein Grinsen dringt mit jeder Silbe dieses Satzes problemlos durch die geschlossene Tür. Mein Kopf produziert dazu Bilder, ganze 3D-Modelle. So, als stünde er direkt vor mir, als gäbe es die paar Zentimeter Sperrholz zwischen uns nicht. Dabei bin ich heilfroh, dass sie da ist – diese Tür, dass sie uns trennt. Ich hätte gern noch mehr zwischen ihm und mir, einen Haufen Vorhängeschlösser, Querbalken innen und außen, Absperrband oder einfach wieder hunderte Kilometer und eine Landesgrenze.
»Dir scheint es ja auch gut zu gehen«, entgegne ich kraftlos.
»Ich sag nur Training und gute Gene … Also, ich schmeiß mir ein paar Klamotten über und bin mal eben für drei Stunden weg. Sorry, ich habe eine blöde Deadline. Abgabe morgen früh. Und du weißt ja, wer feiern kann, der kann auch arbeiten.«
»Definitiv nicht!« Etwas zu lautstark atme ich aus, lehne meinen Hinterkopf gegen die Wand. »Ich bin der vor sich hinvegetierende Beweis dafür, dass dieser Satz nichts als eine reine Lüge ist.« Bevor ich mich daran erinnern kann, wann ich den Satz zum letzten Mal gehört habe, klingt seine Stimme wieder durch die Tür.
»Du hast all mein Mitleid. Aber dadurch, dass ich jetzt ins Büro verschwinde, hast du wenigstens etwas Zeit, dich wiederherzustellen.« Es sind nur ein paar Sekunden, und doch bemerke ich das Zögern, bevor er weiterspricht. »Aber Lee, komm nicht auf die Idee, abzuhauen. Denk dran, ein paar Stunden sind noch übrig.«
Einige der Worte in diesen Sätzen könnten mich stutzig machen. Trotzdem bleibt mein Kopf bei einem hängen. »Lee?«, wiederhole ich. Der Ton meiner Einwortfrage sagt hoffentlich alles.
»Gestern hast du den Namen noch lustig gefunden.«
»So, wie ich mich fühle, fand ich gestern vermutlich alles und jeden witzig«, antworte ich augenrollend und gleichzeitig entsetzt über die kleine Erinnerungslücke in meiner Version der vergangenen Nacht. Wie viele gibt es noch?
Hinter der Tür ertönt ein Lachen. »Das stimmt allerdings.« Und wieder etwas zeitversetzt fügt er an: »Bis gleich, Lena?«
Eine Frage, kein Aussagesatz.
»Ja, bis gleich.« Mehr kommt mir nicht über die Lippen. Jedes meiner Worte klingt fehl am Platz, und jedes seiner Worte wummert in meinem Kopf. Dabei weiß ich noch nicht mal, ob meine Antwort der Wahrheit entspricht. Wie lang bleibe ich … noch?
»Perfekt. Ich bring dann Frühstück mit.«
Falsches Thema. Beim Gedanken an Essen zieht sich mein Magen erneut zusammen. Ich schließe die Augen, schlucke, kämpfe gegen die Übelkeit an … und bekomme sie in den Griff, ohne mich nochmals zu blamieren.
Ein paar Minuten später höre ich, wie die Wohnungstür klickend ins Schloss fällt. Meine Schultern sacken ein Stück in sich zusammen, mein Körper entspannt sich. Wenigstens muss ich mich fürs Erste nicht mehr beherrschen.
Ungelenk befreie ich mich aus seinem Shirt und meinem Slip und schleppe mich unter die Dusche. Die Unterarme gegen die gläserne Duschwand gestützt, lasse ich mir heißes Wasser über den Rücken laufen. Ich will nur dastehen, nichts tun, nichts denken, nichts entscheiden und vor allem nicht diese eine Frage beantworten, die sich wieder und wieder zwischen all den Kopfschmerzen in den Vordergrund drängelt. »Warum in aller Welt bin ich hier?«
Kapitel 1
Zwei Tage zuvor
Freitag: 16:55 Uhr
Lena
»Tobi, es reicht. Ich bin nur drei Tage weg. Nicht mal ganze drei Tage, wenn man es genau nimmt. Die Kinder sind dreizehn und elf. Das ist dir schon klar, oder? Du musst sie weder wickeln noch ihnen Fläschchen geben. Solange das WLAN läuft, ist alles gut.«
Am anderen Ende der Leitung ist es still. Als ich beginne auf Tobis Einsicht zu hoffen, legt er wieder los. »Du hättest wenigstens vorkochen können.«
Ich presse meine Zähne aufeinander. Bei solchen Sätzen entspannt zu bleiben, fällt mir schwer. Zu schwer.
»Weißt du was? Es ist mir tatsächlich ziemlich egal, was ihr in diesen drei Tagen esst. Der Tiefkühlschrank ist voll, die Nummer der Pizzeria hängt an der Pinnwand und der Dönermann ist um die Ecke. Ach, und wenn es ganz eng wird, dann ruf doch …«
»Lena! Fang jetzt nicht damit an.«
»Nein, kein Lena. Und richtig, ich fange mit überhaupt nichts an. Ich höre eher mit etwas auf, und zwar mit diesem Telefonat. Sonntag bin ich wieder da. Könnte allerdings spät werden.« Die Sätze poltern ohne mein Zutun aus mir heraus wie eine Gerölllawine, ausgelöst durch eine kleine, aber zielgenaue Sprengung. »Was rede ich? Nicht es könnte spät werden, es wird definitiv spät. Plan mich bloß für nichts ein. All-Weekend-Daddy-Time.«
Das kann doch echt nicht sein Ernst sein. Wo ist denn bitte das Problem, sich ein Wochenende Zeit zu nehmen? Es ist die absolute Ausnahme, dass ich mal allein unterwegs bin. Gleichzeitig – und das nervt mich gewaltig – will ich das Telefonat nicht so enden lassen. Denn selbstverständlich ist mir nicht egal, was er und die Kinder am Wochenende essen, und außerdem kann ich meine aufbrausende Art grad selbst nicht leiden. Kann es nicht einfach harmonisch laufen? Kann Tobi mir nicht schlichtweg viel Spaß wünschen?
Auf eine friedliche Verabschiedung hoffend, versuche ich, die Wortlawine auszubremsen, bevor jemand unter ihr begraben wird. »Komm schon, ihr werdet es überleben. Alle drei.«
Tobias antwortet nicht.
Anstatt aufzulegen, schiebe ich ein mildes »Okay?« hinterher. Fast scheint es, als brauche das kleine Wort ein wenig Zeit, um sich zuzutrauen, bis zum anderen Ende der Leitung zu kriechen. Zu Recht, denn kurz darauf schallt mir aus zweihundertfünfzig Kilometer Entfernung ein kurzes, aber knallhartes »Okay!« entgegen.
Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich ein und dasselbe Wort klingen kann. Während mein Okay ein Schulterklopfen sein wollte, schlägt mir sein Okay mitten ins Gesicht. Ein Vorwurf aus vier Buchstaben, den er mir entgegenschleudert, genau in dem Augenblick, in dem ich meine Deckung für einen Sekundenbruchteil freigegeben hatte. Der Schlag kommt überraschend und bringt mich ins Taumeln. Trotzdem bleibe ich stehen. Kein Knockout, nicht in dieser Runde. Aber für heute ist es an der Zeit, den Ring zu verlassen.
Ohne ein weiteres Wort beende ich das Gespräch und lasse mich neben meine Reisetasche auf das Bett fallen. Staub wirbelt hoch. Und da liege ich, starre bewegungslos in die Luft und sehe den kleinen Teilchen dabei zu, wie sie schwerelos im einfallenden Sonnenlicht durch das Zimmer tanzen. In der Stimmung, in der ich noch vor einer halben Stunde war, hätte ich dem Bild eine spezielle Schönheit abgewinnen können. Gerade kann ich nur daran denken, dass es sich bei Staub um ein Sammelsurium aus Fasern der durchgelegenen Matratze, Abrieb des schäbigen Kurzfloorteppichs, Fragmenten toter Milben und Hautschuppen längst abgereister Gäste handelt. Ekelhaft!
Ich drehe mein Gesicht zur Seite und blicke auf den Nachttisch mitsamt einer achtziger Jahre Kugellampe aus Milchglas, einem Radiowecker neben dem laminierten Zettel, auf dem handschriftlich das WLAN-Passwort 1234 notiert wurde, und einer Flasche Mineralwasser. Anderthalb Liter, PET. Ich stöhne leise auf. Warum bitte habe ich mir kein nettes Hotel gebucht? Klar, Staub gibt es überall. Doch zumindest würde ich dann die Partikel eines Kingsize-Bettes, die Fasern eines kuscheligen Bademantels und die Körperteile von Deluxe-Hausstaubmilben einatmen.
Aber nee, nullachtfünfzehn: diese Pension, dieses Zimmer … irgendwie sogar mein Leben.
Ich schließe die Augen. Wie kann ein einziges Telefonat mich so dermaßen runterziehen? Dabei will ich zurück zur guten Laune und mich nicht ärgern. Schon gar nicht über ein Hotelzimmer.
In ungefähr einer Stunde treffe ich die Mädels, und dann geht es auf direktem Weg zu unserer alten Schule. Zwanzigjähriges Abi-Jubiläum. Unfassbar, wie die Jahre vergehen! Standen wir nicht erst gestern noch auf dem Schulhof? Wie auch immer. Irgendwann heute Nacht werde ich todmüde in dieses neunzig Zentimeter schmale Bett fallen, und in diesem Moment werden mir die Einrichtung des Zimmers und der Staub hundertprozentig völlig egal sein. Ausschlafen, duschen und ab zu meinen Eltern.
Ich brauche keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu wissen, dass meine Mutter für Samstag bereits einen Haufen Termine und einen großen Topf Gulasch gemacht hat. So ist das, wenn ich zu Besuch komme. Immer, denn Beständigkeit wird bei meinen Eltern großgeschrieben. Dinge sollten sich nicht ändern, am besten nie, und wenn es doch unbedingt sein muss, dann bitte mit angemessener Vorankündigung. Ergo: Gulasch. Im Anschluss ans Mittagessen wird nach striktem Zeitplan die Verwandtschaft besucht, Unmengen an Kaffee getrunken und Geschichten über dies und das erzählt.
So weit, so gut. Wenn da vor ein paar Tagen nicht die Ankündigung der Abendplanung gewesen wäre. Ich habe Mamas O-Ton noch in den Ohren. »Und am Samstagabend können wir uns ganz in Ruhe bei einem Glas Rotwein über all das unterhalten, was uns so auf der Seele liegt.«
Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nichts Falsches zu antworten. Ihre Einladung klang nur im ersten Moment nett. Wenn man meine Mutter kennt und ihren Geheimcode bereits als Kind entschlüsselt hat, wirkt der Satz nahezu bedrohlich. Denn mit uns bin unter Garantie ich gemeint. Obwohl nicht ausschließlich, sehr wahrscheinlich sind Tobi und ich gemeint. Und was uns auf der Seele liegt und vor allem, wie man das möglichst schnell wieder loswird, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt, soll morgen in jedem Detail ausdiskutiert werden.
Schon beim Gedanken daran muss ich schlucken. Mich wird höchstwahrscheinlich ein Vortrag über den Bund fürs Leben mit all seinen Höhen und Tiefen erwarten. Weisheiten wie Eine Ehe ist nun mal kein Zuckerschlecken oder Wenn die Durststrecke erst mal überwunden ist, dann ist sie schnell vergessen werden garantiert fallen, kombiniert mit Feststellungen wie Eine Trennung ist aber doch keine Option. Zwischen Oliven und Käsewürfeln werde ich nicken, an passenden Stellen ein zustimmendes Mh-hmm einwerfen und hin und wieder an meinem Wein nippen. Widerspruch macht angreifbar, Nicken ist mein Schutzschild, und das kann ich in Perfektion.
Mama ist allerdings der Endgegner. Ich werde den Wintergarten meiner Eltern nicht verlassen können, bevor sie nicht weiß, dass ihre Ratschläge angekommen sind, ich ihre Tipps umsetzen werde, der Teller mit den Käsewürfeln leer ist und ich mehrfach wiederholt erklärt habe, dass ich nur in der Pension schlafe, um nicht zu stören. Am Ende werde ich heilfroh darüber sein, vom Kreuzverhör in das schäbige Hotel fliehen zu dürfen, in dem ich jetzt liege.
Deswegen: Schluss jetzt – Schluss mit der Lethargie!
Sofort!
Entschlossen drücke ich mich von der durchgelegenen Matratze in eine aufrechte Sitzposition. Noch immer trudeln die kleinen Staubpartikel planlos im Sonnenlicht umher. Ich stehe auf, gehe die drei Schritte zum Fenster, öffne es und flute den Raum mit frischer, aber warmer Sommerluft.
Dieser Tag gehört mir. Meine Problemchen werde ich für ein paar Stunden in diesem Hotelzimmer zurücklassen, sie kurz wegschließen, denn eigentlich passen sie ganz hervorragend zu den Wollmäusen unter dem Bett, die ebenso im besten Fall unentdeckt bleiben. Morgen früh werde ich dann jedes der Probleme wieder sorgsam zusammenlegen und akkurat zur Weiterreise in meiner Handtasche verstauen. Der heutige Abend wird allerdings ein Ausflug mit leichtem Gepäck.
Wochenlang habe ich mich auf das Treffen gefreut. Auf die alten Klassenkameraden, die Geschichten von früher, die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, aufs Lachen, Feiern und Tanzen.
Ich bin gespannt, wie die anderen aussehen. Einige habe ich zwanzig Jahre nicht zu Gesicht bekommen. Ob mich alle erkennen werden? Bestimmt – ich streiche eine meiner Strähnen hinters Ohr –, dafür reichen schon allein die roten Locken. Aber werde ich auch jeden ehemaligen Mitschüler zuordnen können? O nein, hoffentlich fallen mir alle Vornamen wieder ein. Nichts ist peinlicher als der Moment, in dem dein Gegenüber dir deinen Namen aus dem Stegreif entgegenruft, du dich aber nicht mal daran erinnerst, ob derjenige die gleiche Jahrgangsstufe besucht hat.
Mein Blick fällt auf meine Reisetasche. Ob ich die Liste auf dem Rücken des alten Abi-Shirts zur Sicherheit durchgehen sollte? Nur einmal schnell draufschauen? Ich greife zu dem hellblauen Poloshirt, das ich daheim aus den Untiefen meines Kellerschranks gezogen habe, dabei berühren meine Finger den schwarzen Print auf Brusthöhe – Abi 99 – Let's fly away – und die zwei Schwalben. Nahezu ehrfürchtig drehe ich das Shirt um, sehe die Liste aller Mitschüler und lese Zeile für Zeile. Mit jedem Namen kommen Erinnerungen in dieses kleine Hotelzimmer geflogen. Und plötzlich ist sie wieder da, die gute Laune … wächst und wächst, weil es einfach eine großartige Zeit war, weil ich grundlos nervös bin und weil ich gleich meine Mädels von damals wiedertreffen werde – alle fünf! Das allein reicht schon für einen fantastischen Abend. Ich lege das Poloshirt aus der Hand und widme mich meiner Reisetasche. Mehrere Tage habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich heute zum Jahrgangstreffen anziehen soll. Habe vor dem Kleiderschrank gestanden und bin sämtliche Kombinationen durchgegangen. Mein Plan war es, umwerfend auszusehen und dabei zu wirken, als hätte ich einfach nur gedankenlos in den Schrank gegriffen. So, als hätte ich weder Zeit noch Gedanken an mein Aussehen verschwendet. So, als wäre ich inzwischen vollständig im Einklang mit mir selbst, ganz egal, was ich trage. Bin ich nur leider nicht. Und deshalb liegen nun drei verschiedene Abendoutfits in der Tasche vor mir: ein dunkelblaues Kleid, eine Jeans und ein schwarzes Oberteil sowie ein Rock mit passender Bluse. Gesteuert von der guten Laune, greife ich entschlossen zu der blauen Skinnyjeans und dem schwarzen Oberteil in Wickeloptik, mit dem V-Ausschnitt und der Spitze an den Ärmeln. Perfekt!
Ein kurzer Blick auf die roten Leuchtziffern des Radioweckers zu meiner Linken lässt mich überrascht die Augenbrauen hochziehen. Viertel nach fünf. Höchste Zeit, unter die Dusche zu springen, mich umzuziehen und startklar zu machen. Aber noch viel dringender muss ich die vorlaute Göre in meinem Hinterkopf zum Schweigen bringen, die mit dem Finger schnipst und behauptet, dass man bei diesem Level an Vorfreude nur enttäuscht werden kann. Blödsinn!
Um die innere Stimme zu übertönen, schnappe ich mir mein Handy und schalte zur Einstimmung eine Neunziger-Jahre-Playlist an. Vom ersten Lied erklingen nur ein paar Töne, dann lässt mein Finger es überspringen. Beim zweiten Songwippt zwar mein Fuß, aber das reicht nicht. Ich brauche mehr. Erst bei Lied Nummer drei packt es mich. Jede Textzeile sitzt. Und schon kurz darauf tanze ich in Unterwäsche Seite an Seite mit den Staubpartikeln zu Tubthumpingvon Chumbawamba quer durch das Zimmer in Richtung Duschvorhang.
Kapitel 2
Freitag: 19:03 Uhr
Phil
Vier Stunden. Verdammte vier Stunden!
Ich löse den Blick vom Ziffernblatt meiner Armbanduhr und schnaube leise, während die Regionalbahn weiter an Geschwindigkeit verliert. Es ist absurd, dass sie noch langsamer fahren kann, als sie es ohnehin schon tut.
Jeglicher Funken Euphorie, der möglicherweise in Bezug auf das Klassentreffen in mir aufflackern könnte, wird allein durch diese äußerst nervige Anreise erstickt. Zweimal umsteigen, das obligatorische Rennen von einem Gleis zum nächsten. ICE, Regionalexpress mit über zwanzig Minuten Verspätung und nun diese lahmarschige Rhein-Ruhr-Bahn. Entschleunigung im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei will ich nicht entschleunigt werden, wollte ich damals schon nicht.
Jetzt überholt uns sogar ein Radfahrer. Unfassbar!
Wir schleichen vorbei an rotverklinkerten Einfamilienhäusern mit schwarzen Dächern und großen Gärten voll monströser Trampoline. Eingezäunter Familienfrieden trifft auf unbeschrankte Bahnübergänge und drumherum jede Menge Landschaft, deutlich mehr als nötig. Je näher wir dem Ziel kommen, desto mehr erinnert mich an früher – dabei könnte ich echt darauf verzichten.
Wie lang ist es her, dass ich zum letzten Mal zu Besuch war? Sechzehn oder siebzehn Jahre? Mindestens.
Vor meinem Zugfenster erstreckt sich der große Wald. In Kindertagen waren die Bäume und Sträucher mein zweites Zuhause. Ich schaue über meine Schulter, um weiter sehen zu können. Dahinten steht die große Eiche. Reflexartig greife ich an meinen rechten Unterarm, denke an den glatten Bruch, den ich mir bei einem Sturz aus ihrer Baumkrone zugezogen habe. Konnte man das hölzerne Ding wirklich Baumhaus nennen, was wir in die Äste der Eiche gezimmert haben? Aus heutiger Sicht hätten wir noch mal die Statik prüfen müssen.
Kurz darauf wird der Wald lichter und macht Platz für das Industriegebiet, die Produktions- und Lagerhallen der Gießerei. Ob ich hiergeblieben wäre, mitten in der Provinz, wenn ich auf meine Mutter gehört und dort den Ausbildungsvertrag unterschrieben hätte? Ob es etwas zwischen uns dreien geändert hätte?
Ich drehe mein Gesicht zur anderen Seite, weg von dem Gedanken an meine Eltern hin zur endlos langen Lärmschutzwand. Wie treffend. Schlechtgemachte Graffitis versuchen, sich gegen das Betongrau durchzusetzen. ACAB, Punk‘s not dead und Life is too short to remove your USB drive safely.
Beim letzten Spruch muss ich grinsen. Wo die Kleinstadtrebellen recht haben, haben sie recht. Ich stehe auf, schwinge den Rucksack über die Schulter und versuche auf dem Weg Richtung Ausgang, den Ärger über die Anreise und die Gedanken an meine Familie gekonnt zu verdrängen. Life is too short … Und so!
Der Zug ist mittlerweile fast leer. Drei Leute sitzen noch im Abteil, aber auch die packen langsam ihre Sachen zusammen. Denn weiter als hier fährt die Bahn nicht. Endstation.
Noch vor dem Halt schaue ich aus dem Fenster, vorbei an einem maroden Backsteingebäude hin zum Bahnsteig. Und da steht er. Ich erkenne ihn schon von Weitem. Das liegt zum einem an der übersichtlichen Bahnhofsgröße, zum anderen an seinem knallroten T-Shirt. Und wenn ich mich nicht täusche, dann lächelt er jetzt schon. Zwanzig Minuten Verspätung können seiner hervorragenden Laune nichts anhaben, vermutlich hätten selbst zwei Stunden keine Chance dazu.
Endlich hält die Bahn, ich drücke den roten Knopf und die Tür öffnet sich zischend. Mit einem großen Schritt trete ich auf den verwitterten, bröckeligen Asphalt meiner früheren Heimat. Ein grauer Bahnsteig, ein schäbiges Wartehäuschen mit einem überfüllten Mülleimer und eine defekte Anzeigetafel. Falls sich irgendwer heute auf dem Weg zum Klassentreffen fragt, wo die Jahre geblieben sind? Hier … eindeutig hier.
»Phil! Altes Haus«, ruft Guido mir entgegen, als ich auf ihn zugehe. »Lass dich drücken.« Schon schließt er mich in seine Arme und klopft mir mit der Hand brüderlich auf die Schulter.
Ich klopfe mit und spüre, wie sich auch mein Mund zu einem Lächeln verzieht. Denn ganz plötzlich fühlt sich dieser Moment dann doch ein wenig wie ein Willkommen zu Hause an.
»Schön, dich zu sehen, Guido.« Keine Floskel, ich meine es so. Auf ihn habe ich mich wirklich gefreut.
Er löst seinen Griff. »Danke, dass du heute dabei bist. Ohne dich wäre es einfach nicht das Gleiche. Und glaub mir, du wirst es nicht bereuen … Es wird legendär.«
»Legendär?« Ich kann mir einen leicht ungläubigen Blick nicht verkneifen.
Eins ist klar, hätte Guido nicht so gebettelt, wäre ich nicht hier. Das Abitreffen stand nicht allzu hoch auf meiner Prioritätenliste.
»Megalegendär!« Guido nickt und scheint beinahe vor Stolz zu platzen. Bei seiner Hochstimmung und dem Leuchten in den Augen raunt mein schlechtes Gewissen mir ein Reiß dich zusammen und freu dich gefälligst mit zu. Also atme ich tief ein und gebe mein Bestes.
Es ist ja auch nicht so, als hätte ich gar keine Lust auf diesen Abend. Ein paar Bierchen mit Guido zu trinken, ist immer ein Highlight – egal, wie oft oder selten wir uns treffen. Allerdings wird er heute mit der Organisation des Abends alle Hände voll zu tun haben. Wahrscheinlich werde ich meine Zeit weniger mit ihm und mehr mit den anderen verbringen. Aber freue ich mich auf die Truppe, mit der ich früher so viel Zeit verbracht habe? Oder auf jemanden aus dem Rest der Jahrgangsstufe? Auf einen der Jungs, mit denen ich noch sporadisch Kontakt über eine WhatsApp-Gruppe halte, die selbstverständlich Guido eingerichtet hat, oder auf eines der Mädels, von denen ich einigen auf Instagram folge, oder sie mir, oder wir uns. Ja? Nein? Jein. Irgendetwas in mir interessiert sich tatsächlich dafür, was aus den anderen geworden ist. Aber dieses Etwas ist recht mickrig im Gegensatz zu den massiven Bedenken, die sich erstaunlich sicher sind, dass ein Großteil der Gespräche ebenso verkrampft wie aufgesetzt sein wird. Und mit Sicherheit wird dieses Gestern in den kommenden Stunden dauerhaft in den Himmel gelobt … und das nervt mich bereits, bevor es passiert ist.
Innerlich verdrehe ich die Augen über meinen Pessimismus. Ich sollte mir einen Ruck geben und den Tag schlichtweg auf mich zukommen lassen, mich auf alte Gesichter und alte Geschichten freuen. Genau das wäre allerdings deutlich leichter umzusetzen, wenn ich nicht schon ahnen würde, dass die guten Erinnerungen nur allzu oft Arm in Arm mit anderen Vergangenheitsbruchstücken um die Ecke getorkelt kommen. Mit denen, die man ungern wiedertrifft, mit denen, die – wenn sie ihren Weg erst mal zurück in meinen Kopf gefunden haben – schwer wieder loszuwerden sind.
Guido stößt mir sacht gegen die Schulter. »Alles klar?« Er scheint gemerkt zu haben, wie sehr ich in meine Gedanken versunken bin, und wieder meldet sich mein schlechtes Gewissen.
»Ja, sorry. Bin noch halb im Zug. Die Anfahrt war echt nervig.« Ich lenke ab, dann schwenke ich zurück zum eigentlichen Thema. »Egal. Sag an, wie viele kommen heute? Hast du überhaupt alle erreicht?«
»Phil? Ernsthaft? Du fragst mich, ob ich alle erreicht habe? Whaaat?«
Der Blick. Seine Augenbraue. Die Tonlage.
Ich muss grinsen. »Okaaaay, okay. Ich hätte nicht fragen sollen. Schenk dir die Antwort. Weiter im Text. Was hast du alles vorbereitet?«
»Du hast die Einladung nicht mal gelesen, oder?« Guido zieht seine Augenbraue empört noch einen Zentimeter weiter in die Höhe.
»Doch … schon …« Mein Stammeln erhöht die Glaubwürdigkeit meiner Aussage nicht wirklich. »Das Wichtigste hab ich mir zumindest angeguckt und gemerkt. Ich bin schließlich hier und das noch nahezu pünktlich. Also, wo müssen wir hin?«
Guido gibt sich mit meiner Antwort zufrieden. Oder aber der Zeitdruck bringt ihn dazu, nicht weiter nachzubohren. Wir sind echt spät dran.
Auf dem Weg zum Parkplatz erzählt Guido mir von den drei Foodtrucks, die er für den Schulhof geordert hat, von den Reden, die gehalten werden, und von pensionierten Lehrern, die vorbeikommen werden. Davon, dass wir Glück mit dem Wetter haben, weil wir nicht ins Gebäude dürfen, und von einer Leinwand, auf der alte Fotos in Dauerschleife laufen werden und Videogrüße von Leuten, die es heute leider nicht schaffen.
Ach, Videobotschaft hätte gereicht? Muss ich mir fürs dreißigjährige Treffen merken.
Gemeinsam steigen wir in seinen grauen Altea. Ein Schulterblick auf die Rückbank zeigt ein Kinderparadies auf Rädern. Ich verstaue meinen Rucksack im Beifahrerfußraum, der definitiv am wenigsten Kekskrümel und Lego Duplo Bausteine aufzuweisen hat. Derweilen fährt Guido uns durch die Straßen unseres früheren Heimatstädtchens – nicht ohne ununterbrochen weiterzureden.
»Die Fotos habe ich vorhin noch fix zensiert. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es deutlich zu viele Aufnahmen von Matze gab. Die Anzahl habe ich erst mal auf ein angemessenes Maß zurückgestutzt.«
Ich erinnere mich gut, wie Guido in der Oberstufe so dermaßen auf Matze stand, dass es monatelang kein anderes Thema für ihn gab.
»Hätte er vermutlich gar nicht mitbekommen. So wie damals«, behaupte ich recht zuversichtlich. Als ich mich im nächsten Moment an meine Klamotten von früher erinnere, ergänze ich übereilig ein: »Hauptsache, du hast die Bilder von mir komplett gelöscht.«
Guido schnaubt lachend, so als würde auch er sich gerade erinnern. »Quatsch. Warum? Nur weil du diese furchtbaren wasserstoffblonden Locken hattest? War das damals eigentlich eine Dauerwelle?«
»Wasserwelle. Und es war die Frisur von Sebastian aus Eiskalte Engel.« Ich mache eine Handbewegung, die unterstreicht, wie einleuchtend das für ihn sein müsste.
Guido zieht erneut seine Augenbraue hoch, diesmal allerdings belustigt. »War sie so was von gar kein bisschen.«
Als er meinen gespielt abschätzigen Blick sieht und mein »Du hast einfach keine Ahnung von richtig guten Männerhaarschnitten« hört, muss er laut lachen … und ich auch. Ein paar Minuten mit Guido, und meine Stimmung steigt merklich. Gut so.
An der Schule angekommen, stellt er den Wagen auf dem alten Schülerparkplatz ab, und wir steigen aus. Verändert hat sich hier ebenfalls nicht viel. Mal abgesehen von zwei Ladesäulen für Elektroautos, die neuerdings an der Stelle zu finden sind, an der vor zwanzig Jahren der Zigarettenautomat stand.
Zögerlich drehe ich den Kopf zur Seite, weiß, was ich gleich sehen werde, bin aber unsicher, was der Anblick in mir auslösen wird. Und da steht es, das Mehrfamilienhaus, in dem meine Eltern und ich früher gewohnt haben. Erst jetzt erkenne ich wieder, wie kurz der Schulweg für mich war. Wie bitte habe ich es trotzdem geschafft, ständig zu spät zu kommen?
Ich werfe nur einen flüchtigen Blick auf die weißverputzte Hausfront und möchte damit eigentlich direkt einen inneren Erledigt-Haken an diesen Teil des Heimatbesuchs setzen. Doch es funktioniert nicht. Als ich mich wegdrehen will, fängt mein Kopf an, einen Früher-Heute-Abgleich durchzuführen. Ohne mein Zutun fällt mir das neue Hofpflaster auf und daneben das große Steinbeet, für das der krüppelige Miniahorn wohl hatte weichen müssen. Und in dem Moment, in dem mir die ersten Fehler im Suchbild bewusst werden, muss ich doch genauer hinsehen. Mein Blick klettert die Fassade hoch, vorbei an einer neuen Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder bis zu den bunten Gardinen hinter dem Fenster im ersten Stock, das einmal meins gewesen war. Knapp zwanzig Jahre habe ich in diesem Haus gewohnt, habe durch diese Scheibe nach draußen auf diesen Parkplatz oder die Schule geschaut, bin in dieser Wohnung aufgewachsen, habe dort gespielt, gegessen und geschlafen. Müsste es sich nicht merkwürdig anfühlen, dass mittlerweile jemand Neues eingezogen ist? Eine fremde Familie?
Ich sehe rüber zum nächsten Fenster, dem damaligen Schlafzimmer meiner Eltern, und sofort fühle ich den Knoten in meinem Magen. Hastig richte ich meine Aufmerksamkeit Richtung Schule und mir ist klar: Es muss mich nicht stören, dass inzwischen andere in diesen Räumen leben. Es darf mir egal sein. Auch wenn ein großer Haufen Erinnerungen mit dieser Wohnung verknüpft ist. Oder nein … vermutlich sogar gerade deswegen.
Guido knallt den Kofferraum zu und holt mich damit aus meinen Gedanken zurück ins Jetzt. Endlich! Am liebsten würde ich mich kurz schütteln, um wieder zu hundert Prozent da zu sein.
Bepackt mit einer Kiste voller alter Schülerzeitungen dreht er sich zu mir. »Das Angebot steht übrigens noch. Du kannst gern mit uns bei meinen Eltern übernachten. Alle würden sich freuen.«
»Danke, aber ich will morgen schon früh zurück sein.« Die Antwort schießt aus mir heraus, bevor ich auch nur eine Minute darüber nachdenke. Dabei ist mir nicht mal bewusst, warum ich so kategorisch verneine.
Guidos Eltern sind unglaublich großartige Menschen, genau wie er. Muss in den Genen liegen. Manche haben halt Glück. Seine Mutter und sein Vater waren ein Teil meiner Jugend, irgendwie fast ein Ersatz für meine Eltern. In den letzten Jahren hat Guido sich mit Erik und seinen beiden Töchtern wieder eine so perfekte Familie aufgebaut. Und ja, vielleicht ist es genau das. Vielleicht kann ich so viel Harmonie in einem einzigen Reihenendhaus nicht ertragen.
»Okay, aber du weißt, dass Erik schwer enttäuscht sein wird«, erwidert Guido, während wir Richtung Schule schlendern.
Ich winke ab. »Solange du nach Hause kommst, ist er doch höchst zufrieden.«
»Da hast du selbstverständlich recht.« Er lächelt, und ich kann sehen, wie glücklich er noch immer in seiner Beziehung ist. Schon krass nach all der Zeit, den Kindern, all dem Stress.
Wir betreten den Schulhof und sind plötzlich nicht mehr allein. Es erklingt ein »Guido« nach dem Nächsten und zwischendrin ein »Phil« oder sogar ein »Philip«. Das Lächeln auf Guidos Gesicht wird breiter, als es eh schon ist. Er ist voll und ganz in seinem Element. Ich bin es nicht, aber das ahnt keiner.
Ich scanne die Menge, sehe Leute ihre Hand zum Gruß heben, grüße zurück, sehe sie lächeln und sich freuen. Und ich weiß, sie warten auf den Phil, der einen Spruch nach dem nächsten raushaut, der laut lacht, mit dem man gern gesehen wird. Den Phil, den ich selbst nur allzu gern vorschicke, und deshalb lege ich den Schalter um und gebe die Bühne frei.
Kapitel 3
Freitag: 23:34 Uhr
Lena
»Echt! Ich bin so froh, wenn der Kindergarten für uns ein Ende hat. Auf dem Aushang sind schon wieder Läuse angeschrieben. Nervt total.«
Wir stehen inmitten unserer alten Stammkneipe, alle fünf ehemaligen Schulfreundinnen zusammen. So eng beieinander, dass ich ehrlich gesagt gar nicht wissen will, wessen Kinder momentan Läuseprobleme in den KiTa-Gruppen haben. Die anderen anscheinend schon …
Svenja steigt direkt mit ein. »Jaaa, mich juckt es dann immer gleich. Und zwar überall. Furchtbar. Und dieses Auskämmen. Komm mal mit dem Nissenkamm durch die ewig langen Haare.«
Ich schnaube und kann nur hoffen, dass der Rest der Truppe es als Zustimmung zur allgemeinen Abneigung gegen Läuse interpretiert. Natürlich bin ich kein Freund der Viecher, aber irgendwie hätte ich mir heute Abend andere Themen als Kinderkrankheiten und Parasiten gewünscht. Obwohl ich selbstverständlich mitreden könnte, will ich aber nicht.
Stattdessen sehe ich mich um. Wie der Großteil meiner Mitschüler ist die Nachtschicht ohne große Restaurationen gealtert. Getreu dem Motto Was früher gut war, muss heut nicht schlecht sein ist alles beim Alten geblieben. Oben, unten, links und rechts findet sich Tradition in Eiche rustikal – vertäfelt, gezimmert oder verlegt. Theke, Stehtische, Wände und Boden tauchen den verwinkelten Raum in ein einheitliches Dunkelbraun, das jede Uhrzeit relativ erscheinen lässt. In der Nachtschicht war es nie zu früh beziehungsweise zu spät, um ein Bier zu trinken. Bei einem blieb es allerdings selten.
Mein Blick streift die Decke und damit die zwei alten Kronleuchter mit den Glühbirnen in Kerzenform, von denen schon früher mindestens eine dauerhaft kaputt war. Noch heute ist es ohne das einfallende Tageslicht schwer, jemanden am anderen Ende des Raums zu erkennen. Dabei ist die Kneipe nicht sonderlich groß.
Während ich den letzten Schluck aus meinem abgestandenen Radler trinke, erinnere ich mich daran, wie voll es in den alten Tagen stets war, wie lange es gedauert hat, sich mit randvoll gefüllten Gläsern zurück zum eigenen Tisch zu schieben … und wie dabei mindestens ein Fünftel der Getränke aufs eigene Shirt und ein weiteres auf den Boden schwappte. Das gesamte Parkett klebte spätestens ab dreiundzwanzig Uhr so dermaßen, dass jeder Schritt die doppelte Kraft kostete. Zum Test hebe ich erst meinen rechten Fuß, dann den linken … Wie erwartet geht es ganz leicht, nichts klebt heute. Es ist nur eine der vielen Erinnerungen in Eiche rustikal, die sich für mich in diesem Laden konserviert haben.
Wie oft haben wir an diesem Ort gemeinsam rumgehangen? Laut gelacht und gefeiert, Trennungsschmerz getrotzt, Zukunftspläne gesponnen, geknutscht, gestritten und geheult – und all das gerne an einem einzigen Abend. Bei dem Gedanken lächle ich leicht melancholisch in Richtung unseres alten Stammplatzes, dem Stehtisch hinten in der Ecke.
Die Jahre zwischen sechzehn und dreiundzwanzig haben einfach eine andere Dichte. In dieser Zeit passt so viel mehr in jeden Tag und jede Stunde. Würden Seismographen die Intensität eines Lebens aufzeichnen, dann lägen diese Jahre unmittelbar im Epizentrum. Fast erstaunlich, dass wir es alle überlebt haben.
Und heute? Heute stehen wir bei zu leiser Hintergrundmusik in einem Kreis und hören uns zu, wie wir über Scharlachinfektionen, Läuseshampoo, Milchstau oder den letzten Nordseeurlaub reden.
Verflixt, die Stimme in meinem Hinterkopf hatte anscheinend recht. Zu viel Vorfreude – so was geht nie gut. Und dass diese Besserwisserin derweil angefangen hat, leise Kids von Marteria zu singen, macht es nicht besser.
Jaja, ist mir schon klar. Ich stecke ebenfalls mittendrin … mittendrin in einem Leben voller Frühstücksbrote, Kernarbeitszeiten und Wäschelegen.
Doch genau diese Art von Gesprächen führe ich ständig, heute wollte ich andere. Mal keine Mama sein, sondern einfach nur Lena.
»Läuse, da lach ich drüber«, steigt Danni ein. »Wir hatten letztens Krätze in der Klasse. Wisst ihr, dass das kleine Tiere sind, die unter die Haut kriechen und dort Eier legen? Da wird mir schlecht.«
Mir auch.
Erneut lasse ich meine Augen den Raum überfliegen, verschaffe mir einen Überblick über alle aus unserer Jahrgangsstufe, die noch hier sind. Trotz des schummrigen Lichts erkenne ich die gleichen Grüppchen wie vor zwanzig Jahren. Dahinten die Überflieger, die sich weiterhin regelmäßig zu treffen scheinen. Sie wirken schon den ganzen Abend so vertraut miteinander. Michaela schaut kurz rüber und lächelt. Ich nicke freundlich zurück.
Sofort startet mein Gehirn eine Zeitreise zur feierlichen Zeugnisübergabe. Michaela wurde auf die Bühne gerufen: bestes Abi der Stufe, glatter Eins-Komma-Null-Schnitt. Unglaublich gut und so was von überhaupt keine Überraschung.
Der Jahrgangsbeste bekam alljährlich eine kleine Anerkennung vom Direktor überreicht. In unserem Jahr gepaart mit den Worten »Etwas für das hellste Köpfchen von allen«. Egal, wie viel Zeit zwischen heute und damals liegt, Michaelas Gesichtsausdruck beim Auspacken des Präsents werde ich nie vergessen. Denn unter dem Geschenkpapier kam ein Föhn zum Vorschein. Wem bitte ist dieses Geschenk eingefallen? Michaela wurde ebenso rot wie der bescheuerte Föhn und machte dann schleunigst Platz für die Rede von Guido, unserem Stufensprecher.
In meinem Kopf krame ich nach seinen Worten … finde nicht alle, aber doch erstaunlich viele. Während im Hintergrund unser offizielles Abschlusslied – Fly Away von Lenny Kravitz– lief, stand Guido am Mikro und sprach davon, dass es Zeit wäre, die Flügel auszubreiten, loszufliegen und eine Richtung einzuschlagen. Dass endlich die Zeit gekommen sei, uns in all die großen und kleinen Fehler zu stürzen, die da kommen würden, in der Hoffnung, dass unsere Flügel uns tragen.
Rückwirkend übertrieben viel Pathos, aber mit zwanzig steht einem das durchaus zu. Es sind diese Jahre, in denen selbst Fehler aufregend und vielversprechend klingen. Die Jahre, in denen man so sehr nach vorne drängt, dass man erst rückblickend versteht, wie großartig genau diese Zeit eigentlich war, wie leicht … wie selbstbestimmt.
Ich schüttle den Kopf über die Erkenntnis. Fliegen? Mit offenen Augen einfach planlos aus dem Nest springen und auf die eigenen Flügel vertrauen? Sturzflug? Ich? Nein. Habe ich mich nie getraut. Schritt für Schritt auf sicherem Untergrund geht auch ganz gut. Ich hätte wohl ein anderes Abschlusslied gewählt. Trotzdem denke ich jedes Mal, wenn unser Song im Radio läuft, an die guten alten Zeiten und an die Rede.
Selbstverständlich ist Guido auch der Hauptorganisator des heutigen Abitreffens. Hat er gut umgesetzt, was nicht anders zu erwarten war. Bei der Erinnerung an die Foto-PowerPoint-Präsentation vor zwei Stunden, während der die meisten von uns mehrfach laut gelacht haben, muss ich erneut schmunzeln. Zu sehen gab es viele Nahaufnahmen der blondierten Haarspitzen unserer Jungs, Baggypants, Arme voller Festivalbändchen und G-Shocks. Bei den Mädels erinnerten Blocksträhnchen oder gekreppte Haare, übertrieben hohe Plateauschuhe, bauchfreie Shirts mit Tribal-Prints und superschmale Augenbrauen an glücklicherweise vergangene Modetrends. Sehr lustig … Zumindest bis zu dem unangenehmen Moment, in dem mir das eigene jüngere Ich von der Großleinwand entgegenstrahlte. Kurzhaarfrisur und Jeanskleid. Die Neunziger haben es uns rein optisch wirklich nicht leichtgemacht.
Und wo ist unser ewiger Stufensprecher jetzt? Mein Blick fliegt noch mal über die Anwesenden, ihn sehe ich allerdings nicht. Vermutlich ist er irgendwo im Eingangsbereich oder auf der Außentreppe. Bei denen, die immer schon draußen standen, ob in der Schule oder auf den Partys. Die sogar vor der Tür rumhingen, als in Innenräumen noch geraucht werden durfte. Im Grunde war es völlig egal, wo die Truppe um Matze, Guido, Phil, Natascha und Jessica sich aufhielt, denn jeder Ort wurde durch ihre Anwesenheit zum Dreh- und Angelpunkt des Geschehens.
Und wir? Wir waren schon früher genauso weit entfernt von ihnen wie jetzt. Manche Dinge ändern sich auch nach zwei Jahrzehnten nicht – vermutlich nie. Danni, Inga, Svenja, Melli und ich stehen und standen schon immer im Mittelfeld. Aber genau wie damals stört es uns kein bisschen.
Svenjas lautes Lachen holt mich zurück ins Gespräch. »Ja, wirklich! Da sagst du was. Ich kann noch immer kein Trampolinspringen. Mein Beckenboden ist seit der zweiten Geburt total hinüber, dabei ist Emily schon fast vier.«
Ein Augenverdrehen kann ich mir nicht verkneifen. So wird das heute nichts mehr mit dem Tanzen. Und das nicht nur wegen der Beckenbodenproblematiken. Mutig wage ich einen kleinen Vorstoß. »Bevor ich euch jetzt von Maltes Hodenhochstand erzähle, hol ich erst mal eine Runde Radler. Und dann könnten wir mal Richtung Tanzfläche gehen. Wer ist dabei?«
Die Resonanz ist dürftig. Danni ist schwanger mit Nummer drei, und die Wassereinlagerungen in ihren Beinen sind eindeutig gute Gegenargumente zu meiner Tanzaufforderung. Svenja ist mit dem Auto da und möchte in der nächsten halben Stunde nach Hause, weil sie morgen früh ihren Großen zum Reitturnier fahren muss. Mit weniger als acht Stunden Schlaf ist ihr Tag angeblich schwierig durchzustehen. Bleibt noch Melli, die aber auf keinen Fall die Mitfahrgelegenheit in den Nachbarort verpassen möchte, um so das Geld fürs Taxi zu sparen.
Für ein Getränk würden sie zwar alle noch bleiben, aber dann würde sich der Abend auch dem Ende entgegenneigen. Ein Abstecher auf die Tanzfläche würde sich da nicht mehr lohnen.
Ich beiße mir auf die Zunge, um nichts Falsches zu sagen. Es ist nicht so, dass ich ihre Argumente nicht verstehen kann, aber doch nicht heute … nicht bei einem solchen Wiedersehen. Die Mädels rufen mir ihre Getränkewünsche zu, und bevor ich der Stimme in meinem Kopf endgültig recht gebe, werfe ich noch einen hoffnungsvollen Blick zu Inga, die mit einem lauten »Also, ich bleibe auf jeden Fall noch!« antwortet.
Jawoll, auf Inga ist Verlass.
Das war schon immer so.
Wir waren beste Freundinnen. Zwischen uns passte kein Blatt. Dauernd zusammen, von morgens bis abends. Und falls wir uns ausnahmsweise nicht im gleichen Raum befanden, haben wir zum Leidwesen unserer Eltern telefoniert. Stundenlang haben wir im Flur auf dem Boden gehockt, uns an den Türrahmen gelehnt und dabei den Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Ich kann Ingas Festnetznummer bis heute auswendig, inklusive Vorwahl. Dabei weiß ich gar nicht, ob es den Anschluss noch gibt.
Bevor ich weiter darüber nachdenken kann, warum ich unsere Freundschaft gedanklich in die Vergangenheitsform gesetzt habe, tippt sie mir auf die Schulter.
»Dann lass uns mal zur Theke gehen, ich komm mit und helfe dir tragen. Vielleicht gönnen wir uns noch schnell ein Likörchen, bevor wir das stille Wasser, den Tee und die Cola bei den Mädels abliefern.«
Ich stimme freudig zu. »Sehr gut! Das klingt nach einem Plan. Aber ernsthaft – Tee? Ich glaube, es hat sich noch niemand getraut, in der Nachtschicht Tee zu bestellen. Die haben doch nicht mal einen Wasserkocher, oder?«
»Hundertpro nicht! Hoffentlich wird bei so einer Bestellung kein Hausverbot erteilt.«
Mit einem nahezu synchronen Prusten machen wir uns auf den Weg. Es sind nur ein paar Meter bis zur Theke, die sich durch drei Viertel des Raums erstreckt, und da weder die Klebrigkeit des Bodens noch eine horrende Anzahl von Menschen uns den Weg erschwert, sind wir schnell angekommen. Wir ordern die Getränke und unterhalten uns über Kalle, den ehemaligen Besitzer der Nachtschicht, der den Laden vor ein paar Jahren verkauft hat.
Keine Minute später stellt der Barmann uns die bestellten Getränke vor die Nase. Anstatt des gewünschten Heißgetränks schiebt er ein zweites stilles Wasser daneben und ergänzt ein schnodderiges »Mehr Richtung Tee geht nicht«.
Er erntet unser verständnisvolles Nicken. In dieser Kneipe trinkt man keinen Tee. Nicht schwanger und auch nicht mit vierzig.
Begleitet von einem lautstarken »Na denn!« trinken wir einen Apfelkorn, ganz wie früher. Und genau wie damals frage ich mich, warum niemand das Zeug vernünftig kalt stellt.
Während ich noch die Gänsehaut wegschüttle, die sich auf meinen Unterarmen gebildet hat, legt Inga mir die Hand auf die Schulter und zeigt mit ihrem Kopf nach rechts.
»Sieh mal, wer da im Anmarsch ist!«
Als ich erkenne, wen sie meint, würde ich mich gern weiterschütteln. Es ist mein Ex-Freund. Björn.
Inga stößt mir in die Seite. »Sorry, aber da musst du allein durch. Ich nehme die Getränke schon mal mit. Bis später.«
Auch mein flehender Augenaufschlag hilft nicht, um Inga umzustimmen. Von ihren Lippen lese ich ein stummes »Du schaffst das schon« ab. Dann klemmt sie sich die Wassergläser unter den Arm und macht sich mit dem Radler und der Cola auf den Rückzug.
Ich seufze und nehme einen Schluck von meinem Getränk. Natürlich war mir schon seit der Einladung zum Abitreffen klar, dass ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Björn treffen würde, dennoch würde ich mich jetzt am liebsten umdrehen und abhauen. Einfach weg. Leider begegnen sich in diesem Moment unsere Blicke, und fast zeitgleich dazu hebt Björn seine Hand zum Gruß. Jetzt kann ich schlecht so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen. Zögerlich nehme ich auch meinen Arm ein kleines Stück hoch, grüße vorsichtig zurück und bereite mich gedanklich auf das zähe Gespräch vor, das mich sicherlich erwartet.
Für einen Moment verzögert sich Björns Ankunft. Während ich mich mit dem Oberarm gegen die Theke lehne, um etwas entspannter zu wirken, bleibt er kurz bei Miriam stehen, flüstert etwas in ihr Ohr und zeigt dabei zu mir. Sie hebt den Kopf, mustert mich von oben bis unten und schickt dann ein Lächeln hinterher, das sie sich auch hätte sparen können.
Miriam und Björn – diese Kombination führt zu einer Ansammlung von Fragezeichen in meinem Kopf. Natürlich könnten mir die beiden völlig egal sein … sind sie auch irgendwie, aber trotzdem. Wenn Miriam Yin ist, bin ich Yang. Wenn ich Kopf bin, ist sie … ich grinse kurz.
Miriam ist schwarzhaarig – ich bin rothaarig. Sie ist mindestens ein Meter achtzig – ich bin ein Meter fünfundsechzig. Sie ist einfach doppelt so viel wie ich, überall. Wir waren schon früher zwei Welten, also ich eine halbe und sie anderthalb. Miriam spielte Tennis – ich war Schwimmerin. Sie ging ausschließlich auf Konzerte der Kelly Family – ich wäre zu jedem x-beliebigen Rockfestival gefahren, wenn meine Eltern mich gelassen hätten. Miriam und ihre Freundinnen grüßten sich mit »Hey, Süße«, gaben sich Küsschen links, Küsschen rechts – mir wird bis heute bei solch einer Begrüßung schlecht.
Mehr Gegensatz geht nicht. Und trotzdem sind Björn und Miriam seit über zehn Jahren verheiratet. Nun ja, es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen.
Björn kommt die restlichen Schritte auf mich zu.
»Hey, Lena!« Er nimmt mich in den Arm, drückt mich, sodass ich seinen Bauch an meinem Oberkörper spüre.
In den letzten Jahren hat Björn ordentlich an Körperumfang zugelegt, an Haardichte allerdings nicht. Sein blau-weiß kariertes Hemd ist fein säuberlich gebügelt.
»Hey, Björn«, entgegne ich, trete einen Schritt zurück und sorge damit umgehend für etwas Abstand zwischen uns. Dann schiebe ich ein geheucheltes »Schön, dich zu sehen« hinterher.
»Ja, total! Alter Falter, ist das lang her.«
Alter Falter?
»Allerdings. Lass mich raten? Zwanzig Jahre?« Ich zwinkere Björn zu, versuche es auf eine lockere Art. Er lacht. Etwas zu laut, etwas zu hoch, etwas zu gekünstelt.
Was folgt, ist beiderseitiges Schweigen, das unangenehm zeigt, was ich befürchtet habe: Wir haben uns überhaupt nichts zu sagen.
Wie lang muss so ein Gespräch mit dem ersten richtigen Freund bei einem spontanen Aufeinandertreffen anstandshalber dauern? Sagt der Knigge etwas dazu? Reichen die paar Sätze vielleicht schon? Könnte ich unsere zähe Unterhaltung bereits mit einer Abschiedsfloskel beenden? Zu Alter Falter würde doch See you later, Alligator oder ein Tschüssikowsky hervorragend passen. Aber nein, ich weiß, für eine Verabschiedung ist es noch zu früh. Wir waren knapp zwei Jahre zusammen, da sollte ich fünf Minuten Small Talk aushalten.
»Hast du das Foto von uns vorhin gesehen?«, schiebt Björn lächelnd in die Stille zwischen uns und vergräbt zeitgleich beide Hände in seinen Gesäßtaschen.
Ich nicke. Alle haben es gesehen, und es wäre mir deutlich wohler, wenn dem nicht so wäre. Mühevoll unterdrücke ich ein peinlich berührtes Stöhnen. Versuche, das Pärchenbild aus der elften Klasse schleunigst aus meinem Kopf zu verdrängen. Björn mit schulterlangen Haaren und zu großer Brille, ich mit Meg-Ryan-Frisur und fettem Knutschfleck am Hals.
»Vielleicht werde ich mir den Haarschnitt wieder zulegen. Stand mir hervorragend«, sage ich selbstironisch, um das Gespräch am Laufen zu halten. Obwohl laufen die Übertreibung des Jahrhunderts ist. Wenn diese Unterhaltung sich überhaupt in einer Vorwärtsbewegung befindet, dann stolpert sie maximal ungeschickt vor sich hin. »Und sonst so?«
Super Frage, Lena. So heben wir das Niveau sicher nicht.
»Ja, viel los«, antwortet Björn. »Vier Mädels daheim, da habe ich nichts zu melden.« Er lächelt noch immer, und ich suche in diesem Lächeln nach etwas, das mich erkennen lässt, warum ich so verknallt in ihn war, ihm seitenweise Liebesbriefe geschrieben habe, sein Passbild in meinem Portemonnaie immer griffbereit hatte.