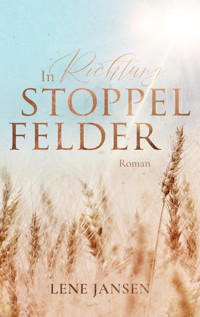
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich verschwendete Zeit, die wir nicht hatten, indem ich den verlorenen Tagen hinterhertrauerte, bevor sie vorbei waren.“ Auf dem Weg zur Beerdigung ihrer besten Freundin trifft Jule im Zug völlig unerwartet auf Hannes – ihre erste große Liebe. Zehn Jahre sind vergangen, seit ihre Wege sich trennten. Zehn Jahre, in denen Jule versucht hat, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch nun sitzen sie sich auf einer siebenstündigen Zugfahrt gegenüber – getrennt durch nur anderthalb Meter, aber verbunden durch eine Geschichte voller Schmerz, Sehnsucht und unausgesprochener Worte. Mit jedem Kilometer kehren die Erinnerungen zurück, und eine Frage wird immer lauter: Gibt es eine zweite Chance für die Liebe, die sie verloren glaubten? Oder haben das Leben und die Zeit sie für immer verändert? Und dann ist da noch dieser Brief in Jules Tasche – ein Brief, den sie bislang nicht zu öffnen gewagt hat. Ein tief emotionaler Roman über die Macht der ersten großen Liebe, verpasste Chancen und den Mut, sich dem Unbekannten zu stellen. Für Frauen, die Geschichten voller Gefühl und Tiefe lieben, die das Herz berühren und die Seele bewegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
In Richtung Stoppelfelder
Lene Jansen
Impressum
1. Auflage
Alle Texte dieses Buches sind urheberrechtlich geschütztes Material und ohne explizite Erlaubnis des Urhebers, Rechtinhabers und Herausgebers für Dritte nicht nutzbar.
© 2021 Lene Jansen alle Rechte vorbehalten.
Lene Jansen
c/o Wirfinden.Es
Kirchgasse 19
65817 Eppstein
Lektorat: Elja Janus (www.elja-janus.de)
Korrektorat: Mila Marten (www.milamarten.de)
Covergestaltung: Emily Bähr (www.emilybaehr.de)
Die Handlung und alle handelnden Protagonisten sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.
Hometown,
this one is for you!
Triggerwarnung
Dieser Roman enthält Inhalte, die einige Leserinnen und Leser beunruhigend finden könnten, darunter Tod, Trauer, Krebserkrankung und Angstzustände.
PROLOG
Damals - Sommer 1998
Wir sitzen abseits des Lagerfeuers, abseits der anderen. Der heiße Sommertag ist in eine laue Nacht übergegangen. Hannes hält mich im Arm. Mein Kopf ruht auf seiner Schulter, unser Blick auf dem dunklen Badesee, der den Nachthimmel stillschweigend verdoppelt.
»Schon komisch, dass es für uns aussieht, als würde der Mond leuchten, obwohl er nichts tut, außer die Sonne zu reflektieren«, sagt Hannes leise.
Wenn er spricht, vibriert seine Schulter. Das sanfte Brummen setzt sich in meinem Körper fort, erreicht jeden noch so kleinen Winkel. Dieses Gefühl kenne ich erst seit ein paar Wochen und will es nie mehr hergeben. Er könnte Stunden reden, und ich würde ihm jede einzelne Minute davon zuhören.
»Ohne die Sonne würden wir vermutlich nicht mal wissen, dass er da oben rumhängt.«
Wieder spüre ich jedes seiner Worte, wende ihm mein Gesicht zu und sehe ihn an. Der Vollmond spendet ausreichend Licht, um sein Profil zu erkennen und den Blick, der sich im Dunkel verliert. Vorsichtig lege ich Zeige- und Mittelfinger an sein Kinn, drehe seinen Kopf. Er lächelt, beugt sich zu mir, legt seine Lippen behutsam auf meine … und schon vergesse ich die Welt um mich herum, den Mond, den Badesee, das Lagerfeuer, die anderen.
Im nächsten Moment trifft mich ein Volleyball unsanft am Rücken. Nicht hart, aber doch ausreichend, um uns aus dem Kuss zu reißen.
»Nehmt euch ein Zimmer! Das kann sich ja keiner mitangucken.«
Es ist Suses Stimme und gleichzeitig ihr Lachen. Obwohl ich laut schnaube und übertrieben die Augen rolle, hat sie mich sofort mit ihrem derben Lachen – immer. Auch Hannes grinst, weil er weiß, wie Suse es meint. Nur Sekunden später packt sie meine Hand und zieht mich hoch. Dabei dreht sie sich zu Hannes. »Sorry, aber jetzt bin ich mal dran. Ist ja schlimm mit euch! Ich leih mir Jule kurz aus.«
Nur ein paar Meter weiter zieht Suse sich den Pulli über den Kopf und ruft übermütig: »Wettschwimmen bis zum Steg. Die Verliererin zahlt den nächsten Kinobesuch. Auf geht’s!«
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, springe förmlich aus meinen Shorts und meinem Shirt. In Unterwäsche rennen wir lachend durch das flache Wasser in den See. Mitten im Lauf werfe ich einen kurzen Blick zurück zum Strand. Hannes sitzt im Sand und schaut uns hinterher. Hastig wende ich mich wieder nach vorn, sprinte weiter, dann der Kopfsprung. Suse eine Armlänge vor mir. Verflixt, das wird knapp. Und sie ist auch noch die bessere Schwimmerin. Wir geben alles, kraulen in Höchstgeschwindigkeit dem Ziel entgegen.
Kurze Zeit später schlage ich mit dem Arm am Holzsteg an. Ein Blick nach oben und ich weiß, dass Suse gewonnen hat. Auf dem Steg sitzend, um Luft ringend, aber trotzdem möglichst lässig flachst sie: »Ach, Frau Harbeck, auch schon da?«
Ich drücke mich aus dem Wasser auf die Holzbohlen neben sie. »Respekt! Wie machst du das nur? Du bist so unglaublich schnell.«
Wir lassen uns beide auf den Rücken fallen und schauen in den sternenklaren Himmel.
»Tja, vielleicht bin ich konzentrierter, nicht so abgelenkt.« Suse stupst mir mit dem Ellenbogen in die Seite.
Ja, denke ich. Hannes lässt meine Gedanken nicht los, nicht mal in diesem Moment.
Behutsam spricht Suse weiter. »Es hat dich übel erwischt, oder?«
»Ja, ziemlich«, antworte ich zögerlich. »So derbe, dass es mir manchmal sogar ein wenig Angst macht.«
Suse sieht mich fragend an. »Angst?«
»Klingt total bescheuert, oder? Ich dachte echt, ich wäre schon mal verliebt gewesen. Aber jetzt weiß ich hundertprozentig, dass es nicht so war. Denn dieses Mal ist es mehr, rund um die Uhr, überall, ständig und ganz nebenbei ziemlich großartig. Aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hab ich Schiss, mich zu verrennen.«
Kurze Stille – doch bevor Suse zu Wort kommt, rede ich weiter. »Nicht nur wegen Hannes, auch irgendwie deinetwegen.«
Suse sieht mir direkt in die Augen, und da steckt so viel in ihrem Blick, so viel von ihr und gleichzeitig von mir. Manchmal denke ich, wir sind eine Person in zwei Körpern.
»Juliane Harbeck, nun ist aber mal gut. Du bist halt über beide Ohren verknallt. Vielleicht nimmt dieser Platzhirsch momentan äußerst viel Raum in deinem Kopf und Herzen ein, aber irgendwo da bin trotzdem auch ich. Merkst du doch gerade. Du hängst irgendwo auf Wolke sieben und doch machst du dir Sorgen um mich. Jule, es ist okay. Mehr noch, ich gönne es euch, freu mich für dich. Und ich weiß, dass dir zurzeit andere Dinge wichtiger sind als ein Kinobesuch mit mir. Kein Problem, echt nicht. Solang ich mir nicht mit euch beiden zusammen einen Film ansehen muss, ist alles gut. Das hält ja keiner aus, dieses Rumgeknutsche.« Suse schlägt mir sanft gegen die Schulter, bevor sie weiterspricht. »Irgendwann ist dann auch wieder mehr Platz für mich. Da bin ich mir sicher. Und so lange warte ich halt und hoffe, dass du mir wie immer alles erzählst.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich jedes Detail wissen willst.« Mein Grinsen ist breiter, als es sein sollte.
»Und ob!«, antwortet Suse mit einem Zwinkern.
Mein Blick wandert zurück zum Himmel - zum Mond. »Und was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn er wieder aus meinem Leben verschwindet?«
Ihre Finger umschließen meine.
»Quatsch, Jule. Und selbst wenn, was für eine Frage. Wenn der abhaut, hat er dich nicht verdient. Und dann bin ich da und nehme dich in den Arm. So wie du jedes Mal, wenn bei mir was schiefläuft. Weißt du doch.«
Ich drücke die Hand meiner Freundin, als sie weiterspricht. »Aber hast du mal bemerkt, wie er dich ansieht? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du den wieder loswirst. Dass dem der Speichel nicht vom Kinn tropft, ist auch alles.«
Da ist es wieder, Suses Lachen – ein Pflaster für jedes kleine oder große Problem und so dermaßen ansteckend, dass ich unmittelbar infiziert bin. So liegen wir da, Hand in Hand auf diesem Holzsteg am See und lachen der Nacht entgegen.
Später sitzen wir zusammen mit den anderen am Lagerfeuer. Hannes hat mir seinen Kapuzenpullover gegeben. Halb darin versunken und mit nassen Haaren lehne ich an seiner Brust. Rechts neben mir sitzt Suse. Aus zu kleinen Walkman-Boxen dröhnt Ghetto Supastar. Maik erzählt von seiner Führerscheinprüfung, Mira bekommt die Krise, weil sie dieses Jahr zwei Wochen mit ihren Eltern an die Ostsee fahren muss, und Hille klopft einen blöden Spruch nach dem anderen. Das Feuer prasselt, und wir stoßen mit billigem Dosenbier auf die Nacht an, auf uns und auf alles, was da noch kommen mag.
Es ist diese Zeit im Leben, in der man glaubt, unsterblich zu sein.
München HBF – 15:29 Uhr
Heute – Herbst 2019
Zischend schließen sich die Türen des Zuges. Egal wie oft ich schon mit diesem ICE nach Hause gefahren bin – heute ist alles anders. Noch nie hat sich der Beginn einer Fahrt so trostlos, so aussichtslos, so nach Ende angefühlt.
Behäbig setzt sich der Zug in Bewegung. Während irgendein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gelangweilt eine Begrüßungsansage durch die Lautsprecher nuschelt, überprüfe ich die Sitzplatzreservierung auf dem E-Ticket.
Wagennummer 26, Sitzplatz 85.
Mein Blick fällt auf die LCD-Informationstafel, von der mir die 24 entgegenleuchtet.
Scheiße, falscher Wagen. Ich blähe die Wangen auf und presse die Luft durch die geschlossenen Lippen.
Momentan reichen diese Kleinigkeiten, diese Bagatellen, um die Trauer beiseitezuschieben und der meist leisen, unterschwelligen Wut in mir ein Megafon in die Hand zu drücken. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Wut, nicht mitten in diesem Zug.
Ich stecke das Handy in die Manteltasche und kralle meine Finger darum. Es bleibt mir nichts, als mich mit dem Gepäck durch den Mittelgang des recht vollen ICEs zu drängeln.
Immer wieder werde ich gezwungen, stehen zu bleiben, weil Leute ihre Koffer verstauen oder jemand höflich aufsteht, um künftige Sitznachbarn zum Fensterplatz durchzulassen. Innerlich verfluche ich diese Zugfahrt schon jetzt, dabei haben wir den Bahnhof gerade erst verlassen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreiche ich den richtigen Wagen und öffne die Schiebetür zum separaten Sechserabteil. In der Hoffnung mich in ein paar Sekunden endlich auf meinen Sitz fallen zu lassen, trete ich ein. Mein Blick fliegt für einen Moment durch das Abteil, vorbei an den anderen drei Fahrgästen, zum freien Sessel mit der Nummer 85. Ohne genauer hinzusehen, gehe Richtung Fensterplatz, schiebe mich vorbei an einem Mann, der in einer Reisetasche auf der Gepäckablage gegenüber kramt. Da! Plötzlich blitzt etwas in meinem Kopf auf. Grell, undefinierbar. Doch bevor ich es greifen kann, ist es wieder verschwunden. Zurück bleibt ein merkwürdiges Bauchgefühl, ein leises Donnergrollen, als braue sich etwas zusammen. Mit letzter Kraft wuchte ich den Trolley auf die Ablage.
»Jule?«
Mein Magen krampft. Ich wirble herum. Mir direkt gegenüber steht der Mann, der gerade noch mit seinem Gepäck beschäftigt war. Unsere Blicke treffen sich. Ich zucke zusammen, als meine Augen bestätigen, was meine Ohren schon angekündigt hatten.
Hannes.
Sein überraschter Gesichtsausdruck weicht einem milden Lächeln. Erneut krampft mein Magen. Ich sage nichts, starre ihn nur an, starre in sein Gesicht, bleibe hängen bei diesem Lächeln, das heute mehr denn je fehl am Platz ist.
Er ist es.
Da steht er wie selbstverständlich mitten in diesem, mitten in meinem Abteil und grinst nun sogar. Bevor ich die Chance habe, die einzelnen Teile dieser absurden Situation in mir zusammenzupuzzeln, wirft er mir ein freundliches »Hey, wie geht es dir?« entgegen.
Dieser kurze Satz trifft mich wie ein Fausthieb mitten ins Gesicht. Verflucht gern würde ich die Worte schweigend an mir abprallen und auf den Boden fallen lassen. Sie dann beiläufig mit dem Fuß unter den Sitz kicken, um sie dort liegen zu lassen und zu vergessen. Aber es funktioniert nicht.
Schon am Bahnhof war mir alles zu viel – schon seit Tagen ist es das, seit Wochen, seit Monaten. Aber jetzt bricht bei dieser salopp dahingesagten Frage zusammen mit diesem bescheuerten Grinsen alles über und unter mir zusammen. Die Wut bahnt sich ihren Weg, und ich habe nicht mehr die Kraft, sie aufzuhalten. So lange habe ich mich zusammengerissen, aber jetzt ist Schluss damit.
»Wie es mir geht?«, stoße ich ungläubig hervor. »Das ist nicht dein Ernst, oder? Eine beschissenere Frage ist dir auf die Schnelle nicht eingefallen?«
Mein Puls auf hundertachtzig, mein Kopf knallrot, meine Stimme zu laut.
»Du weißt doch genau, warum ich in diesem Zug sitze. Oder willst du mir erzählen, dass du zufällig hier bist?«
Ich sehe ihn abschätzig an. Sein Lächeln ist verschwunden, er senkt den Blick, weicht meinem aus.
»Na also! Wenn ich zur verfluchten Beerdigung meiner besten Freundin fahre, dann ist diese Frage einfach nur dämlich. Dass gerade du sie mir stellst, ist die Krönung. Danke für diesen äußerst durchdachten Gesprächsbeginn. Ich hoffe, du wünschst dir wenigstens, nicht gefragt zu haben.«
Uns trennt kein halber Meter und doch so viel mehr. Hannes schaut betreten auf seine Füße und nestelt an seinen Händen herum. Wie ein Schuljunge, der vor seinem Lehrer steht und genau weiß, warum er da gelandet ist und dass er aus der Nummer nicht mehr herauskommt. Diese alberne Reaktion macht mich noch eine Nuance wütender, viel Platz nach oben ist definitiv nicht mehr. Meine Stimme überschlägt sich. »Nur falls du dir tatsächlich immer noch den Kopf über meinen Gemütszustand zerbrichst, kommt nun die völlig überraschende Antwort: Mir geht es so scheiße wie noch nie in meinem Leben, und da ist alles, was mit uns zu tun hat, schon inkludiert! Danke, Johannes Brenner – danke der Nachfrage.«
Stille – bis auf das stetige Rattern des Zuges über die Schienen. Regungslosigkeit im Abteil, nur die Bahn in konstanter Vorwärtsbewegung. Der Rest stagniert. Standbild – Sekunden verrinnen. Diese Ruhe steht im Kontrast zu all dem, was in meinem Inneren passiert: Mein Blut rauscht. Mein Herz rast. Und mein Kopf ruft so laut Arschloch, dass ich denke, auch die anderen im Abteil müssten es hören.
Hannes hebt seinen Blick, und ich ahne, dass er zu einer Antwort ansetzt. Allein sein Einatmen bringt mich erneut zur Explosion. Meine Wangen glühen. Warnend hebe ich den rechten Zeigefinger, und bevor er die Chance hat, irgendetwas zu entgegnen, reiße ich das Gespräch wieder an mich.
»Und ehe du auf die Idee kommst, einen weiteren komplett unangebrachten Kommunikationsversuch zu starten, folgt eine kurze Info: Ich will nicht mit dir reden! Weder will ich, dass du dich entschuldigst oder mir tröstende Floskeln entgegensäuselst noch, dass du in den Untiefen unserer Jugend nach Erinnerungsfetzen suchst und mir sepiafarbene Bilder von Suse in den Kopf setzt. Ach ja, und besonders wichtig: Bitte, bitte kotz mir nicht irgendwelche Brocken unserer gemeinsamen Vergangenheit vor die Füße. Die letzten Wochen waren so übel, dass mir noch nicht mal in den Sinn gekommen ist, dass eine Chance besteht, dich auf dieser Beerdigung zu treffen. Der absolute Oberkracher ist natürlich dein selbstverständlicher Auftritt in genau diesem Zug, in genau diesem Abteil. Danke, Schicksal, danke! Alles zuvor hätte mir tatsächlich schon gereicht – aber warum nicht noch eine Schippe obendrauf packen?«
Hannes zieht die Luft scharf durch die geschlossenen Zähne, hebt beschwichtigend die Hände und nickt stumm. Hastig steckt er die weißen Kopfhörer in seine Ohren, setzt sich und scheint in dem blauen Bezug des Sessels Nummer 83 im Wagen 26 verschwinden zu wollen.
In dem Moment, in dem ich mich auf meinen Platz am Fenster fallen lasse, wird mir die Anwesenheit der weiteren Fahrgäste erst so wirklich bewusst. Peinlich! Was ein unangenehmer Auftritt. Übertrieben beschäftigt starrt der mir am Tisch gegenübersitzende Typ auf seinen Laptop, während der Mann zwei Plätze links von mir sich hinter einer Zeitung versteckt. Ich bin mir sicher, dass sich in diesem Moment vier von vier Menschen aus dem Abteil an irgendeinen anderen Ort im Universum wünschen. Da wäre sogar das Wartezimmer einer Zahnarztpraxis eine bessere Alternative. Hauptsache weg. Und trotzdem sitzen wir weiterhin gemeinsam im Intercity-Express 512 von München nach Münster.
Vorerst traut sich keiner, mich auch nur anzusehen. Das hilft. Dieser Frontalzusammenstoß mit Hannes, seine dämliche Frage, diese Zugfahrt in Richtung Heimat, all das löst einen Wirbelsturm an Erinnerungen aus. Suse, Suse, Suse. Die Bilder rotieren in meinem Kopf. So viele von uns – so viele von ihr …
Suse war die Konstante in meinem Leben. Wir trafen aufeinander, als die Welt für uns beide noch aus Hell-Dunkel-Kontrasten bestand, und wir nicht ahnten, dass unsere winzigen Ärmchen und Beinchen sich auch kontrolliert bewegen ließen. Schon im Alter von ein paar Wochen lagen wir nebeneinander auf Krabbeldecken, während unsere Mütter Kaffee tranken oder Tupperpartys feierten. Sobald wir gelernt hatten, unser Gegenüber zu fokussieren, erkannten wir ineinander die Freundin fürs Leben. Wir waren wie Zwillinge, immer im Doppelpack. Es gab nicht Suse oder Jule, es gab jahrelang nur Suse und Jule. Einer allein war nicht … nein … ist nicht funktionsfähig.
Ich beiße die Zähne aufeinander, so stark, dass der Druck unerträglich wird. Aber die Ablenkung, der Schmerz im Kiefergelenk hilft nur kurz. Die dreihundert Stundenkilometer dieses verfluchten ICEs scheinen mit ihrer gesamten Wucht gegen meinen Brustkorb zu drücken. Ich kann kaum atmen. Das Abteil wird von Minute zu Minute enger, und weniger Platz heißt weniger Sauerstoff. Eine Welle der Panik schlägt über mir zusammen. Die Hände beginnen zu zittern. Ich spüre das Pulsieren meiner Halsschlagader.
Luft. Warum ist hier keine Luft?
Am liebsten würde ich dieses Fenster aufreißen, den Kopf hinausstrecken, die Lungen mit kühler Herbstluft fluten und dann schreien! All diese Wut rausschreien, die Trauer, den Schmerz, die Angst, die Ungerechtigkeit und die Panik. Nicht schluchzen, nicht vor mich hin jammern, nicht die Tränen unterdrücken, sondern aus voller Kraft brüllen und damit Platz schaffen – Platz für mehr Luft, zum Atmen. Aber es geht nicht, es sind keine Fenster … nur Attrappen.
Heute sind es Mauern aus Verbundglas, die mich abhalten. Irgendetwas ist immer im Weg.
Der Schweiß tritt mir auf die Stirn. Sekunden fühlen sich an wie Stunden. Panik hat eine andere Abspielgeschwindigkeit.
Einatmen … ausatmen.
Ich will nicht, dass irgendwer in diesem Abteil die Attacke mitbekommt, mich ansieht, mich anspricht. Am wenigsten Hannes.
Einatmen! Ich darf mich der Panik nicht ausliefern. Ausatmen! Nicht abdriften – muss mich konzentrieren.
Mit jedem Atemzug, den ich kontrolliere, schaltet mein Körper einen Gang zurück. Die Frequenz meines Herzschlags verlangsamt, normalisiert sich. Und endlich zieht sich die Angst zurück. Das Zittern der Hände nimmt ab, Stück für Stück komme ich zur Ruhe.
Wie ich diese Attacken hasse. Seit ein paar Monaten weiß ich nie, wann und wo die Angst ihren nächsten großen Auftritt plant. Mal liegen Tage dazwischen, mal nur Minuten, wenn ich Glück habe, Wochen. Natürlich hängt es mit meiner besten Freundin zusammen, für diesen Befund brauche ich kein Expertenteam. Um zu lernen, damit umzugehen, vermutlich aber schon.
Ach Suse, wo auch immer du in diesem Moment steckst. Gäbe es eine zweite Chance für dein letztes Jahr, würde ich sie nicht so vergeigen. Tja, jetzt fällst du mir wenigstens nicht mehr ins Wort. Trotzdem bilde ich mir ein, dich sagen zu hören, ich solle nicht so hart mit mir ins Gericht gehen.
Doch, genau das muss ich. Dieses Mal kannst du mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, all das wäre für mich auch nicht leicht gewesen. Vielleicht war es das nicht, aber im Vergleich zu der Last auf deinen Schultern lag bei mir nicht mehr als ein Staubkorn. Du hättest das Recht, dich maßlos aufzuregen und rumzubrüllen. Ich wäre tatsächlich froh, wenn du mich als Konsequenz aus deinem Leben streichen und mich für die kommenden Jahre ignorieren würdest. Ehrlich, wenn es so wäre, würde mir ein Stein vom Herzen fallen, denn dann würdest du noch leben. Aber du kannst nicht. Irgendjemand hat entschieden, dass dein Weg hier endet.
Ich verstehe es nicht. Wir sind kurz davor, Menschen in Hightech-Raketen zu stecken und Millionen von Kilometer zum Mars fliegen zu lassen. Wir haben Atomwaffen erfunden, mit der eine einzige Person auf Knopfdruck die Welt zerstören könnte. Wir klonen Schafe und was weiß ich noch. Alles geht irgendwie. Aber beim Versuch, dich von einem Gehirntumor zu heilen, da scheitern die Experten, da scheitert die Menschheit … Da scheitere ich.
Und nun kommt deine Beerdigung, auf der ich wieder durch die Schleifen unserer Vergangenheit fliegen werde, aber diesmal vor Publikum. Zwischen Beileidsbekundungen, Orgelmusik und Streuselkuchen werde ich Rotz und Wasser heulen. Und all das soll mir helfen, Abschied zu nehmen und deinen Tod zu realisieren?
Abschied? Als ob ich dich gehen lassen möchte, dich gehen lassen könnte. Du bleibst, dahinten in meinem Kopf. Bekommst ein kleines Zimmer nur für dich mit Erinnerungen, Lieblingsmomenten, dem Soundtrack unseres Lebens, Lachern, aber auch Streitigkeiten, Tränen und Schmerzen. Wohnrecht auf Lebenszeit, meiner Lebenszeit. Doch der Schlüssel für die Tür bleibt bei mir. Ich kann nicht noch jemanden brauchen, der in ungünstigen Situationen ungefragt hereinstürzt. Die Angst wohnt ja schließlich schon hier und die lässt sich nicht einsperren. Sorry, Suse – aber ich komm dich oft besuchen. Versprochen!
Und deinen Tod realisieren? Durch einen Pfarrer, der Worte sagt, die dich die Augen verdrehen lassen würden? Ernsthaft? Dein Tod realisiert sich jeden Abend, wenn mein Handy nicht klingelt, bei jedem Blick auf unsere Fotos an meiner Pinnwand und immer und immer wieder, wenn ich irgendetwas sehe oder tue, das mich an dich erinnert. Also eigentlich ständig. Dein Tod ist so real, dass ich mir in diesem Moment wieder in den Arm kneifen muss, um diesen anderen permanenten Schmerz zu ertragen.
Ich brauche keine Beweise.
Ich habe es längst verstanden.
Verdammt, Suse, ich will nicht zu dieser Beerdigung, denn, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das ohne dich, ohne deine aufmunternden Worte schaffe.
Deine Worte …
Hektisch suche ich nach dem Reißverschluss meiner Handtasche, öffne ihn mit zittrigen Fingern, möchte nur einen schnellen Blick hineinwerfen. Kurz sichergehen.
Mehr nicht.
Mein Blick fällt ohne Umschweife auf das weiße Kuvert, das sich vom dunkelgrauen Innenfutter der Tasche abhebt. Natürlich ist es da. Wo sollte es auch sonst sein? Vorsichtig streiche ich mit dem Zeigefinger über die Oberkante des Briefes – unversehrt, ungeöffnet, ungelesen. Dann schließe ich die Tasche wieder und wünschte, mein schlechtes Gewissen würde sich ebenso leicht verstauen lassen.
Ich muss mich ablenken, weg von den Gedanken, weg von den Erinnerungen – zurück in dieses Abteil. Schweres Atmen dringt durch das Rattern der Bahn zu mir herüber. Es kommt von dem Typen neben mir und klingt definitiv nicht gesund, fast ein wenig beängstigend. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er sein Gesicht noch immer halb hinter seiner Zeitung versteckt. Daran dürfte meine dramatische Eröffnungsrede nicht ganz unschuldig sein. Er hat lichtes blondes Haar und einige Kilo zu viel. Auf dem leeren Sitz zwischen uns liegt, vergraben unter einem ganzen Stapel Zeitungen und Zeitschriften, seine Jacke.
Erst bei dem Anblick bemerke ich, dass ich meinen Mantel noch trage. Etwas umständlich, ohne aufzustehen, ziehe ich ihn aus und lege ihn auf meinen Schoß. Dabei fällt mein Blick auf den Tisch vor mir, auf den Laptop. Ich höre das eilige Klackern der Tastatur, bin fast dankbar für den Rhythmus, auf den ich mich konzentrieren kann. Die Geschwindigkeit der Anschläge meines Gegenübers ist schwindelerregend. Wenn er die Finger von den Tasten nimmt, dann, um in den kurzen Pausen getrieben auf sein Smartphone zu schauen oder die schwarze Hornbrille zu richten. Kein Wunder, dass sie ständig verrutscht, sie ist zu groß für sein Gesicht. Er hat dichte dunkelbraune Haare, einen Vollbart und trägt ein graues Hemd. Ich würde ihn auf Ende Vierzig, Anfang fünfzig schätzen. Sein Aussehen, seine Bewegungen … An irgendwen erinnert er mich, ich suche nach einem Bild in meinem Kopf – aber ich komme nicht drauf.
Ist auch egal. Ich schaue auf meine Armbanduhr. 15:55 Uhr. Der nächste Blick gilt dem Fahrplan auf dem Handy. Ankunft in Münster um 22:32 Uhr. Das sind noch verdammte sechseinhalb Stunden. Wie bitte soll ich das durchstehen?
Ich muss endlich mit diesem Grübeln aufhören. Die beste Option wäre einzuschlafen – Zeit wegzuschlafen –, im Idealfall die nächsten drei Tage. Also stecke auch ich mir die Kopfhörer in die Ohren und versuche, mich in der Musik aufzulösen.
AUGSBURG HBF – 16:04 Uhr
Keine Chance! Ich rieche Hannes. Sein Geruch kriecht hin und wieder zu mir herüber und überdeckt dann für einen Moment dieses unangenehme Zug-Aroma. Angeblich hat die Deutsche Bahn zur Steigerung der Kundenzufriedenheit über einen längeren Zeitraum hinweg eine Duftmischung aus Jasmin, Melone, Veilchen und Rosenholz in ihren Zügen getestet. Das Konzept muss gescheitert sein, denn hier und heute handelt es sich um eine Komposition aus Polyester-Sitzpolster, Zugtoilette, Bremsabrieb und nassen Schuhen. Oder was weiß ich, wie sich das Gemisch zusammensetzt.
Bei meinem Ex-Freund kenne ich hingegen jede Komponente: Boss Bottled unterlegt mit Dove Men Duschgel, Uppercut Haargel, dann eine Portion Testosteron und der unverwechselbare Hauch Hannes Brenner obendrauf. Eine schmerzend vertraute Mischung. Dieser Geruch war lange Teil meines Lebens, um genau zu sein, über neun Jahre mein steter Begleiter.
Wieder schwappt ein Hauch Hannes auf meine Seite des Abteils. Mir fällt ein Treffen mit einer guten Freundin ein, die mich etwa einen Monat nach dem Ende der Jule-Hannes-Ära besuchte. Vorher war sie regelmäßig bei uns gewesen, mindestens einmal wöchentlich zum Spielen, Quatschen und Weinchen trinken. Sie trat in den Flur, schlenderte zur Garderobe, um ihre Jacke aufzuhängen, und stockte. Nach ein paar Sekunden drehte sie sich zu mir und schien sich auf etwas zu konzentrieren. Dann sagte sie wie aus dem Nichts: »Deine Wohnung riecht jetzt irgendwie anders. Nicht schlechter – aber ungewohnt.«
Sobald sie gegangen war, stellte ich mich mitten in den Flur. Zwischen Bad, Küche und Garderobe zog ich immer wieder Luft durch die Nase, mal tief in die Lungen, mal stoßweise kleinere Atemzüge, nur um zu riechen, was sie gerochen hatte.
Jede Wohnung hat ihren typischen Grundgeruch. Eine Mischung vieler Nuancen, die sich zu einem großen Ganzen formieren. Man könnte fast sagen, jedes Zuhause trägt sein individuelles Parfüm. Das Problem ist, dass für einen selbst nur die Wohnungen anderer Menschen einen speziellen Duft haben, die eigene scheint geruchsneutral. Ich habe darüber mal einen Zeitungsartikel gelesen. Es handelt sich um ein psychologisches Phänomen.
Grundsätzlich atmen wir tagtäglich Milliarden unsichtbarer Duftmoleküle ein, die um uns herum durch die Luft wabern. In dem Moment, in dem sie auf unsere Nasenschleimhaut treffen, wird eine Art elektrischer Impuls ausgelöst und ans Hirn weitergeleitet. Dort oben wird das Ganze dann erst wirklich wahrgenommen und verknüpft. Uns steigt beispielsweise der Duft von Vanillepudding in die Nase und wir denken an unsere Oma. Tritt ein bestimmter Geruch immer und immer wieder auf, speichert das Gehirn den Reiz irgendwann als Normalität ab. Eine Rückmeldung wäre demnach pure Zeitverschwendung und bleibt genau deshalb nach einer gewissen Zeit vollständig aus. Nennt sich Habituation oder so ähnlich.
Erstaunlicherweise gilt das auch, wenn der Geruch kurz verschwindet und man ihn dann wieder wahrnimmt. Verlässt man beispielsweise die eigene Wohnung zum Einkaufen, wird man beim Zurückkommen nicht von einem Geruchseindruck überrascht. Wir kommen nach Hause, schließen die Tür auf und alles ist völlig normal. Warum sollte das Hirn Energie damit verschwenden, uns eine Wahrnehmung um die Ohren zu hauen? Da kann es uns doch genauso gut direkt die Einkaufstüten auspacken lassen.
Also stand ich damals – nach dem Besuch meiner Freundin – minutenlang im Flur und versuchte, diesen angeblich neuen Grundgeruch aufzunehmen, zu analysieren und mich gleichzeitig an den alten zu erinnern. Knapp eine halbe Stunde später gab ich auf. Es klappte nicht. Ich konnte nicht riechen, dass Hannes weg war. Ein Teil meines Gehirns hatte diese Einsamkeit, dieses Nur-ich anscheinend schon als normal abgespeichert – jede andere Faser meines Körpers allerdings ganz und gar nicht.
In diesem Moment rieche ich dafür umso deutlicher, dass er wieder da ist. Die Vertrautheit dieses Geruchs überrascht mich. Was damals Normalität war, löst gerade so viel mehr als nur einen kleinen elektrischen Impuls in meinem Hirn aus. Um mich vor all den Erinnerungen zu ducken, die hin und wieder mit der Luft zu mir herübergetragen werden, beginne ich, durch den Mund zu atmen. Außerdem nehme ich meine Kopfhörer aus den Ohren. Musik geht auch nicht. Jedes Lied erinnert an etwas, bringt Bilder mit oder Emotionen, lenkt meine Gedanken in eine Richtung. Mal links, mal rechts – aber irgendwie ist jede Richtung die falsche.
Ich brauche einen Plan. Wie entkomme ich dieser Situation? Könnte ich mir einen anderen Platz suchen? Nein, es ist Freitagnachmittag, das heißt Feierabendverkehr, Wochenendausflügler und Pendler. Auch an unserer Abteiltür steht, dass alle Sitze für irgendwelche Teilstrecken reserviert sind. Entschärfen wird sich die Lage erst im Rheinland. Düsseldorf sollten wir bei der Hälfte des Weges erreichen. In drei Stunden könnte ich also vermutlich erfolgreich den Platz wechseln.
Aber schaffe ich es, eine Halbzeit durchzustehen? Ohne Ausraster? Ohne Panik? Ohne Tränen? Schwierig!
Könnte ich jemanden fragen, ob er seinen Platz mit mir tauscht? Aber wie? »Entschuldigung, könnten Sie sich eventuell zu meinem Ex-Freund setzen? Der ist eigentlich ganz nett, wenn man noch nix mit dem hatte.« Oder: »Sorry, ich würde gern den Platz tauschen. Den Grund dafür möchte ich Ihnen nicht nennen.« Wohl eher nicht!
Oder setze ich mich einfach auf einen Platz, solang er noch frei ist, und warte, bis mich irgendwer mit einer Sitzplatzreservierung wedelnd vertreibt? Und dann? Ich will meine Ruhe, aber stundenlang blöd im Gang herumzustehen ist keine Option. Und völlig unangemessen, wenn sich Hannes währenddessen den Hintern platt sitzt.
Soll er doch seine Klamotten zusammenraffen und sich einen Stehplatz suchen. Verschwinden, Abhauen, Weggehen … das sind schließlich seine Paradedisziplinen. Und im Gegensatz zu damals hätte ich heute nicht im Geringsten etwas dagegen. Aber in diesem Moment tut er nichts dergleichen, sitzt einfach nur da. Maximal anderthalb Meter entfernt, schräg gegenüber neben der Tür.
Und obwohl ich krampfhaft wegsehe, muss ich hinsehen. Wenn der Zug durch einen Tunnel fährt, mit wenig Abstand an Gebäuden oder Schallschutzmauern vorbeirast, dann sehe ich sein Spiegelbild in der Fensterscheibe, immer nur kurz, aber dafür immer wieder. Es ist wie dieses Trash-TV auf RTL2, es fällt so unglaublich schwer, wegzusehen. Ich frage mich, wie viele Sinne mein Körper noch überlisten muss, um Hannes Brenner endlich ignorieren zu können?
Da sitzt er in seinem schwarzen Strickpulli. Mit der rechten Hand wickelt er einen Teil des Kopfhörerkabels um den linken Zeigefinger, nur um es anschließend andersrum abzuwickeln und dann von vorn loszulegen. Sein rechter Fuß liegt auf dem Knie des anderen Beins. Er trägt noch immer diese Adidas Samba Sneaker, die schwarzen mit den weißen Streifen, und lockere blaue Jeans. Sein Gesicht lässt sich im Fenster nicht genau erkennen, dafür sitzt er zu weit weg. Sehen kann ich seine schwarzen Locken, kaum zu bändigen, die Ohren halb verdeckend, tief in die Stirn fallend, fast bis zu den dichten, dunklen Augenbrauen. Dass ich daran denken muss, wie widerspenstig diese Haare sich winden, wenn man durch sie hindurchfährt, lässt mich leise schnauben. Im Spiegelbild erkenne ich die markante breite Nase, und obwohl ich es nicht sehen kann, denke ich mit einem Mal an das kleine Muttermal oben auf der rechten Wange. Alles in allem hat er sich kaum verändert. Nur da, wo sein kantiges Kinn sein sollte – und irgendwie auch überall im ganzen unteren Gesichtsdrittel – wächst mittlerweile ein Vollbart.
Klar, ist ja Trend. Haare im Gesicht muss Mann jetzt haben, auch wenn es nicht zu ihm passt. Und genau das ist der Fall. Bei Hannes sieht dieser Bart scheiße aus, richtig scheiße! Vermutlich soll es verwegen wirken. Tut es aber nicht. Das Ding lässt ihn älter und ungepflegt aussehen. Wenn man seine Locken schon nicht im Griff hat, dann sollte man sich erst recht keinen Vollbart zulegen. Aber bitte, ist ja so was von nicht mein Problem – jeder, wie er will. Es lebe die Freiheit.
Endlich habe ich etwas Unverfängliches gefunden, worüber ich mich aufregen kann, um Energie loszuwerden. Ein Überdruckventil. Aber es lenkt nicht davon ab, dass auf dem Platz gegenüber mein Ex-Freund sitzt. Und es lässt mich auch nicht vergessen, dass dieser Typ, abgesehen von diesem bescheuerten Bart, noch immer genauso gut aussieht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Wenn das Schicksal sich diese Konfrontation schon rausnimmt, dann hätte es mir das Recht zur Gehässigkeit zusprechen können. Nichts Krasses, keine Entstellungen, aber durchaus handtellergroße Geheimratsecken oder eine lichte Stelle am Hinterkopf – nur Kleinigkeiten zur Wiedergutmachung.
Schon türmt sich in mir wieder die Wut auf. Sein wippendes Bein nervt, die dichten Locken nerven, sein Geruch nervt und dieses Kabelumdenfingergewickel nervt sogar gewaltig.
Ich will durch das Fenster sehen, nach draußen, und nicht auf diese dreckige Scheibe glotzen. Möchte in der Landschaft versinken, mich ablenken, sein Spiegelbild vergessen. Doch der nächste Tunnel nimmt mir jede Chance. Fast wie auf einem Flachbildfernseher erscheint unser Sechserabteil in 2D. Meine Augen suchen einen anderen Winkel, einen Ausschnitt ohne Hannes, und treffen dabei auf mich. Und mit einem Mal wird mir klar, was mich wirklich nervt.
An mir sind die letzten Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Fetter und älter sitze ich einer Wachsfigur unserer gemeinsamen Vergangenheit gegenüber. Am allermeisten aber kotzt mich an, dass ich mir seinetwegen Gedanken darüber mache. Ich ertappe mich dabei, selbst beim krampfhaften Wegschauen möglichst gut aussehen zu wollen. Es macht mich wütend, dass ich automatisch die schulterlangen Haare über meine etwas zu großen Ohren lege und mich dabei über die ersten grauen Strähnchen ärgere. Und dass ich mein Oberteil zurechtzupfe, damit er die Speckfalte nicht sieht, die es wie immer auf die falsche Seite des Gürtels geschafft hat. Ich will mit diesem Quatsch aufhören, aber es geht nicht. Dann werde ich auch noch rot, weil ich mir selbst peinlich bin.
Und er? Er ignoriert mich – völlig! Ich atme tief ein, zu tief, und rieche ihn. Schon wieder.
Meine Fresse, es kann doch nicht so schwer sein, nichts zu tun und nichts zu denken! Was er kann, werde ich wohl auch irgendwie hinkriegen. Ich werde weiter durch den Mund atmen und an irgendetwas Belangloses denken, das nicht in seinem Gesicht hängt.
Entschlossen lege ich die Stirn an die kühle Scheibe und verfolge die Regentropfen, die sich am Fenster kurze Rennen liefern. Das entführt mich auf die Rückbank unseres alten, rostroten VW Jetta, mit dem meine Eltern und ich an verregneten Herbsttagen wie heute in die Berge gefahren sind. Ein guter, sicherer Ort für Gedanken. Jetzt muss ich nur noch aufhören, meinen Bauch einzuziehen.
ULM HBF – 16:49 Uhr
Der Bahnsteig ist voll, Menschen steigen aus und ein.





























