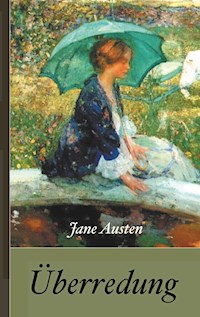Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die kluge, selbstbewusste aber auch verwöhnte junge Emma Woodhouse lebt ein Leben ohne finanzielle Nöte. Um sich die Langeweile auf dem elterlichen Besitz zu vertreiben, versucht sie sich - mal recht, mal schlecht - als Arrangeurin zwischenmenschlicher Beziehungen. Nicht selten intrigant und gegen die Opfer ihrer Bemühungen handelnd, erkennt sie ihr sinnloses Unterfangen, als sie selbst für den wahren Gentleman Mr. Knightley entflammt. Wie dumm, dass sie diesen ursprünglich für die schöne Harriet Smith vorgesehen hatte. Jane Austens Werk gilt als richtungweisend für die englische Literatur, sowohl stilistisch als auch inhaltlich. »Ich werde eine Heldin schaffen, die keiner außer mir besonders mögen wird.« [Jane Austen] Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jane Austen
Emma
Vollständige Fassung
Jane Austen
Emma
Vollständige Fassung
(Emma: A Novel)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 3. Auflage, ISBN 978-3-954183-79-1
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Autorin und Werk
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Siebenundvierzigstes Kapitel
Achtundvierzigstes Kapitel
Neunundvierzigstes Kapitel
Fünfzigstes Kapitel
Einundfünfzigstes Kapitel
Zweiundfünfzigstes Kapitel
Dreiundfünfzigstes Kapitel
Vierundfünfzigstes Kapitel
Fünfundfünfzigstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zum Buch
Die kluge, selbstbewusste aber auch verwöhnte junge Emma Woodhouse lebt ein Leben ohne finanzielle Nöte. Um sich die Langeweile auf dem elterlichen Besitz zu vertreiben, versucht sie sich - mal recht, mal schlecht – als Arrangeurin zwischenmenschlicher Beziehungen. Nicht selten intrigant und gegen die Opfer ihrer Bemühungen handelnd, erkennt sie ihr sinnloses Unterfangen, als sie selbst für den wahren Gentleman Mr. Knightley entflammt. Wie dumm, dass sie diesen ursprünglich für die schöne Harriet Smith vorgesehen hatte.
Jane Austens Werk gilt als richtungweisend für die englische Literatur, sowohl stilistisch als auch inhaltlich.
»Ich werde eine Heldin schaffen, die keiner außer mir besonders mögen wird.« (Jane Austen)
Autorin und Werk
Steventon in Hampshire, eine gute Woche vor dem Weihnachtsfest des Jahres 1775: Fußstapfen führen über den verschneiten Rasen zum zweistöckigen Pfarrhaus der Ortschaft. Dort leben William George Austen, seine Frau Cassandra und die sechs Kinder. Die Brüder werfen Schneebälle in die frostglitzernden Baumkronen vor dem Haus. Kommen die Kinder fröhlich und verfroren zur Tür herein, empfängt sie der Duft des Holzfeuers – aber heute müssen sie still sein. Vater William kann sich nicht auf seine Gedanken zur Weihnachtspredigt konzentrieren, denn Mutter Cassandra liegt in den Wehen.
Angebliches Porträt Jane Austens von Ozias Humphry
Becoming Jane
Jane Austen wird am 16. Dezember 1775 geboren, als siebentes Kind der Pfarrersfamilie. Sie ist das zweite Mädchen und wird ihrer Schwester Cassandra lebenslang eng verbunden sein. Leider vernichtet Cassandra die meisten Briefe ihrer jüngeren Schwester nach deren frühem Tod, weshalb über die große Dame der englischen Literatur nicht allzu viel bekannt ist.
Die Eltern legen viel Wert auf Bildung; das Haus beherbergt eine große Bibliothek, die ständig erweitert wird und den Kindern zugänglich ist. Jane ist bereits recht belesen, als sie im Alter von zwölf Jahren selbst zu schreiben beginnt. Die junge Dame verfasst bevorzugt scharfzüngige Kurzromane und Theaterstücke, lässt einige Arbeiten jedoch unvollendet oder wird sie später wieder aufgreifen. Thematisch ist sie von Beginn an ihrer Sache sicher: Das England des Regency mit seinen sozialen Sitten, insbesondere mit der abhängigen Stellung der Frau, wird von ihr satirisch kritisiert.
Nach dem Umzug nach Bath, wo die Familie bis 1805 lebt, entstehen wenige Werke – zumindest wird das angenommen. Als der Vater verstorben ist, lassen sich Mutter Austen und die beiden Schwestern in Southampton nieder, bevor sie 1809 nach Chawton ziehen. In dem dortigen Landhaus wohnt Jane Austen, gemeinsam mit ihrer Schwester und einer Freundin, bis zu ihrem Tod.
Belegt ist, dass Jane im Jahr 1802 einen Heiratsantrag ablehnt; ob ihr weitere Avancen gemacht werden, ist unbekannt. Möglicherweise ist es ihre bewusste Entscheidung, unverheiratet zu bleiben. Dass sie ihre ganz eigene Sichtweise bezüglich dieser Frage hat, belegen ihre Romane, in denen die Protagonistinnen zwar letztendlich die Ehe eingehen, sich den Entschluss jedoch niemals leicht machen. Die Herausforderung ist in der Abhängigkeit begründet, worin Frauen entweder durch einen Ehegatten versorgt werden oder lebenslang auf wohlmeinende Verwandte angewiesen sind. Jane und ihre Schwester, die ebenfalls unverheiratet ist, erfahren das selbst, als sie nach Chawton ziehen. Ihr dortiges Wohnhaus gehört einem ihrer Brüder. Für geachtete Bürgerinnen aus wohlhabendem Hause ist es zu jener Zeit undenkbar, den eigenen Lebensunterhalt zu erarbeiten – Janes Existenz als Schriftstellerin befindet sich in einer Grauzone und ist tendenziell anrüchig.
By a Lady
Insofern nimmt es nicht Wunder, dass ihre Romane unter dem Pseudonym »by a Lady« (»von einer Dame«) erscheinen, wenngleich mit wachsender Anerkennung die wahre Identität der Autorin bekannt wird. Jane Austen hätte ein individuelles, vielleicht männliches, Pseudonym wählen können. Dass sie sich dafür entscheidet, Geschlecht und ungefähre Standeszugehörigkeit mitzuteilen, darf wohl als Stellungnahme verstanden werden, passend zum Inhalt ihrer Werke. Obwohl sie sich darin als klarsichtige Beobachterin erweist, menschliche Schwächen humorvoll beleuchtet und vor Gesellschaftskritik keineswegs zurückschreckt, werden vor allem die späten Romane positiv aufgenommen. Dass der allseits geachtete Walter Scott ihr größte Achtung zollt, wird dabei nicht ohne Wirkung geblieben sein.
Jane Austens Werk gilt als richtungweisend für die englische Literatur, sowohl stilistisch als auch inhaltlich. Die darin geübte Kritik befasst sich mit der Lage lediger Frauen des gehobenen Bürgertums, in sacht-ironischem Stil. Der Liebesroman, in dessen Zentrum eine unverheiratete Frau steht, dient der Autorin stets als Rahmen sozialer Betrachtungen. Spätere Romane, die zum Teil aus frühen Entwürfen entstehen, sind ebenso genau beobachtet, jedoch erzählerischer verfasst. So beschäftigt sich Jane Austen 1809 mit dem bereits 1796 entstandenen »Elinor and Marianne«, das schließlich 1811 unter dem Titel »Sense and Sensibility« (Verstand und Gefühl) erscheint. In demselben Jahr überarbeitet sie »First Impressions«, das 1813 als »Pride and Prejudice« (Stolz und Vorurteil) veröffentlicht wird.
Ihr zurückgezogenes Leben in Chawton verbringt Jane Austen schreibend. Während dieser Zeit entstehen »Mansfield Park«, »Emma« und »Persuasion«, das später in der deutschen Übersetzung unter den Titeln »Überredung« und »Anne Elliot« publiziert wird.
Im Mai 1817 begibt sich Jane Austen, gemeinsam mit ihrer Schwester, zur ärztlichen Behandlung nach Winchester, wo sie am 18. Juli des Jahres stirbt. Ihre Grabstätte befindet sich in der Kathedrale von Winchester.
Jane Austen bei Null Papier: www.null-papier.de/austen
Erstes Kapitel
Emma Woodhouse, hübsch, klug und reich, im Besitz eines gemütlichen Heims sowie einer glücklichen Veranlagung, vereinigte sichtlich einige der besten Gaben des Lebens auf sich. Sie war schon fast einundzwanzig Jahre auf der Welt, ohne je wirklich Schweres oder Beunruhigendes erlebt zu haben.
Sie war die jüngere der beiden Töchter eines sehr liebevollen und äußerst nachsichtigen Vaters. Schon lange, seit der Verheiratung ihrer Schwester, war sie die Frau des Hauses. Ihre Mutter war schon zu lange tot, als dass sie sich ihrer Zärtlichkeiten noch hätte erinnern können. An deren Stelle war eine vortreffliche Frau als Erzieherin getreten, die eine beinah mütterliche Zuneigung für sie empfand.
Miss Taylor gehörte nun schon seit sechzehn Jahren zu Mr. Woodhouses Familie, sie war weniger Erzieherin als Freundin, hing sehr an beiden Töchtern, besonders aber an Emma. Zwischen ihnen bestand eine eher schwesterliche Vertrautheit. Schon als Miss Taylor noch als Erzieherin wirkte, hatte sie es mit ihrem sanften Temperament selten gewagt, Verbote auszusprechen, aus der Respektsperson war längst eine Freundin geworden. Trotz der großen gegenseitigen Zuneigung tat Emma stets, was sie gerade wollte. Sie schätzte Miss Taylors Meinung zwar sehr, setzte aber meistens doch ihre eigene durch. Es war für Emma keineswegs von Vorteil, dass man ihr zu viel Handlungsfreiheit ließ. Außerdem neigte sie dazu, sich selbst zu überschätzen; negative Eigenschaften, die die Gefahr in sich bargen, sich ungünstig für sie auszuwirken. Gegenwärtig war diese Gefahr indessen noch so gering, dass man ihrer kaum gewahr wurde.
Eines bereitete ihr jetzt Kummer – wenn auch sozusagen positiver Natur – Miss Taylor heiratete. Dieser Verlust verursachte ihr die erste Betrübnis ihres Lebens. Am Hochzeitstag der geliebten Freundin saß Emma in traurige Gedanken versunken da und dachte darüber nach, wie es nun weitergehen solle. Nachdem die Hochzeit vorbei war und das Brautpaar sie verlassen hatte, waren Emma und ihr Vater allein zurückgeblieben, um gemeinsam zu speisen, ohne einen Dritten zu erwarten, der den Abend etwas unterhaltsamer gestaltet hätte. Ihr Vater zog sich wie üblich zu seinem Verdauungsschläfchen zurück, und sie konnte nichts weiter tun, als dasitzen und über ihren Verlust nachdenken.
Die Heirat bot ihrer Freundin die denkbar besten Möglichkeiten, denn Mr. Weston war nicht nur ein Mann von vortrefflichem Charakter, der außerdem das passende Alter und angenehme Manieren hatte und es war für sie eine innere Befriedigung, diese Verbindung in selbstloser und großzügiger Freundschaft herbeigewünscht und gefördert zu haben, aber es hatte sie viel Mühe gekostet. Sie würde Miss Taylors Abwesenheit jederzeit schmerzlich empfinden. Sie erinnerte sich ihrer Güte in früheren Tagen, der Liebe und Zuneigung von sechzehn Jahren, wie sie sie seit ihrem fünften Lebensjahr unterrichtet und mit ihr gespielt hatte, wie sie stets all ihre Kraft eingesetzt, um sie in gesunden Tagen für sich zu gewinnen und sie zu unterhalten und wie sie sie während ihrer verschiedenen Kinderkrankheiten gepflegt hatte. Sie war ihr dafür zu großem Dank verpflichtet, aber die Vertraulichkeit der letzten sieben Jahre, die Gleichstellung und völlige Offenheit, die sich nach Isabellas Heirat einstellte, nachdem sie sich selbst überlassen waren, enthielt für sie angenehme Erinnerungen, die ihr noch teurer waren. Sie war eine Freundin und Kameradin gewesen, wie es wenige gab, intelligent, gebildet, nützlich und sanft, sie kannte alle Gewohnheiten der Familie, nahm an all ihren Sorgen Anteil, besonders an den ihren, ebenso an ihren Vergnügungen, ihren Plänen, sie war ein Mensch, mit dem man immer offen sprechen konnte, wenn einen etwas bedrückte, und ihre Zuneigung war so blind, dass sie nie etwas zu tadeln fand.
Wie sollte sie diesen Wechsel ertragen? Sicherlich, ihre Freundin zog nur eine halbe Meile von ihnen weg, aber es war Emma klar, dass zwischen einer Mrs. Weston, die eine halbe Meile entfernt wohnte, und einer Miss Taylor im Hause ein großer Unterschied bestand; und Emma war trotz ihrer natürlichen und häuslichen Tugenden jetzt in großer Gefahr, geistig zu vereinsamen. Sie liebte ihren Vater zwar sehr, aber er war kein guter Kamerad. Er war ihr weder in ernster noch in leichter Unterhaltung gewachsen.
Der Nachteil des großen Altersunterschieds (Mr. Woodhouse hatte sehr spät geheiratet) wurde durch seine Konstitution und seine Gewohnheiten noch vergrößert; da er zeit seines Lebens ein Hypochonder ohne jede körperliche und geistige Aktivität gewesen war, wirkte er dadurch viel älter, als er eigentlich war. Obwohl er allgemein wegen seiner Herzensfreundlichkeit und seines liebenswürdigen Naturells beliebt war, hätten diese Eigenschaften doch nicht ausgereicht, um die Menschen für ihn einzunehmen.
Obwohl ihre Schwester nach ihrer Verheiratung sich relativ nah in London, in einer Entfernung von sechzehn Meilen, niedergelassen hatte, war sie doch nicht täglich erreichbar; und man musste auf Hartfield manch langweiligen Oktober- und Novembertag totschlagen, ehe Isabella an Weihnachten mit Mann und Kindern zu Besuch kam, die das Haus mit Leben erfüllten und Emma eine angenehme Gesellschaft waren.
Highbury, der große und belebte Ort, war schon beinah eine Stadt, trotz eigenem Namen, eigener Rasenflächen und Sträucher gehörte Hartfield eigentlich dazu, aber es bot ihr niemand Gleichgesinnten. Gesellschaftlich stand Familie Woodhouse dort an erster Stelle. Alle schauten zu ihr auf. Sie hatten im Ort zwar viele Bekannte, da ihr Vater zu allen höflich war, aber sie hätte nicht eine davon auch nur für einen Tag an Miss Taylors Stelle sehen mögen. Es war ein betrüblicher Wandel, und Emma blieb nichts weiter übrig, als zu seufzen und in müßigen Träumen zu schwelgen, bis ihr Vater wieder aufwachte, sie würde sich dann Mühe geben müssen, heiter und gelöst zu erscheinen.
Sie musste versuchen, seine Stimmung zu heben. Er war ein nervöser und häufig deprimierter Mensch, der alle mochte, an die er gewöhnt war, und von denen er sich ungern trennte, da er jede Art von Veränderung ablehnte. Er empfand es stets als lästig, wenn eine Eheschließung eine solche Veränderung nach sich zog und hatte sich noch keineswegs mit der Heirat seiner eigenen Tochter abgefunden, konnte von ihr nicht ohne Mitgefühl sprechen, obwohl es eine ausgesprochene Liebesheirat gewesen war; nun wollte man ihn auch noch zwingen, sich von Miss Taylor und seinen sanft egoistischen Gewohnheiten zu trennen. Da er nie imstande gewesen war, sich in die Denkweise und Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen, neigte er sehr zu der Ansicht, Miss Taylor habe sich selbst und ihnen etwas Unverzeihliches angetan, und dass sie viel glücklicher geworden wäre, hätte sie den Rest ihres Lebens auf Hartfield verbracht. Um ihn von solch trübsinnigen Gedanken abzulenken, plauderte und lächelte Emma so unbefangen wie möglich, aber als der Tee serviert wurde, konnte er es nicht lassen, genau dasselbe wie während des Dinners zu sagen.
»Arme Miss Taylor – ich wünschte, sie wäre wieder hier. Schade, dass Mr. Weston je auf sie verfallen ist!«
»Sie wissen, Papa, dass ich Ihnen nicht zustimmen kann. Mr. Weston ist solch ein gutgelaunter, angenehmer und vortrefflicher Mann, der eine gute Frau durchaus verdient. Sie hätten Miss Taylor doch nicht ewig hier festhalten können und meinen exzentrischen Launen aussetzen, wenn sie ein eigenes Haus haben kann?«
»Ein eigenes Haus! – Worin besteht denn der Vorteil eines eigenen Hauses? Unseres ist dreimal so groß; – außerdem hast du niemals exzentrische Launen, meine Liebe.«
»Wie oft werden wir sie besuchen und sie werden zu uns kommen! – Wir werden uns immer wieder treffen! Wir müssen damit den Anfang machen, indem wir bald hingehen und ihnen einen Hochzeitsbesuch abstatten.«
»Meine Liebe, wie soll ich denn dorthin gelangen? Randalls ist so weit entfernt. Ich könnte nicht halb so weit gehen.«
»Wer redet denn davon, dass Sie zu Fuß gehen sollen, Papa. Wir werden natürlich den Wagen nehmen.«
»Den Wagen! Aber James wird den Wagen nicht gern für solch eine kurze Fahrt einspannen wollen; – und wo sollen die armen Pferde bleiben, während wir unseren Besuch machen?«
»Natürlich in Mr. Westons Stall, Papa. Sie wissen doch, dass wir das alles schon arrangiert haben. Wir haben es gestern Abend mit ihm besprochen. Was James betrifft, geht er bestimmt immer gern nach Randalls, seit seine Tochter dort Hausmädchen ist. Ich bezweifle nur, dass er uns gern irgendwo anders hinfahren würde. Daran sind Sie schuld, Papa. Sie haben Hannah die gute Stellung verschafft. Niemand wäre auf sie gekommen, wenn Sie nicht ihren Namen genannt hätten. – James ist Ihnen sehr zu Dank verpflichtet!«
»Ich bin froh, dass ich an sie dachte. Es war ein Glück, denn es wäre mir unangenehm gewesen, wenn James sich von mir übergangen gefühlt hätte; und ich bin sicher, sie gibt eine gute Dienerin ab, sie ist ein höfliches Mädchen und weiß sich gut auszudrücken, ich halte viel von ihr. Wann immer ich sie sehe, macht sie stets einen anmutigen Knicks und erkundigt sich nach meinem Befinden, und wenn du sie zu Näharbeiten hier hast, stelle ich fest, dass sie die Tür vorsichtig schließt und nie zuknallt. Sie wird sicher eine ausgezeichnete Dienerin und die arme Miss Taylor wird froh sein, jemand um sich zu haben, an den sie gewöhnt ist. Weißt du, wann immer James hinübergeht, um seine Tochter zu besuchen, wird sie Neues über uns erfahren. Er wird ihr erzählen, wie es uns allen geht.«
Emma gab sich alle Mühe, ihn in dieser erfreulichen Stimmung zu halten und hoffte dabei, dass das Puffspiel ihren Vater leidlich über den Abend hinwegbringen und er sie nicht mehr mit seinen Kümmernissen behelligen werde. Der Tisch für das Puffspiel wurde zwar aufgestellt, aber da kurz darauf Besuch kam, wurde er nicht gebraucht.
Mr. Knightley, ein verständiger Mann von sieben- oder achtunddreißig Jahren, war nicht nur ein alter und vertrauter Freund der Familie, als älterer Bruder von Isabellas Mann fühlte er sich mit ihnen besonders verbunden. Er wohnte ungefähr eine Meile von Highbury entfernt und war ein häufiger, stets willkommener Besucher. Diesmal war er ihnen noch willkommener, da er direkt von ihren gemeinsamen Verwandten aus London kam. Er war nach einer Abwesenheit von einigen Tagen zu einem späten Dinner zurückgekehrt und anschließend nach Hartfield herübergekommen, um zu berichten, dass in Brunswick Square alles wohlauf sei. Es waren erfreuliche Nachrichten, die Mr. Woodhouse zunächst sehr anregten. Mr. Knightley hatte ein heiteres Wesen, das wohltuend auf ihn wirkte, und die Antworten auf seine Fragen nach der »armen Isabella« stellten ihn außerordentlich zufrieden. Mr. Woodhouse bemerkte darauf dankbar, »Es ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Knightley, uns noch zu solch später Stunde aufzusuchen. Ich befürchte, Sie hatten nicht gerade einen angenehmen Spaziergang.«
»Nichts weniger als das, Sir, es ist eine wundervolle Mondnacht und so mild, dass ich von Ihrem starken Feuer wegrücken muss.«
»Aber ist es nicht draußen sehr feucht und schmutzig? Hoffentlich erkälten Sie sich nicht.«
»Schmutzig, Sir! Schauen Sie sich meine Schuhe an, sie sind ganz sauber und trocken.«
»Nun, das wundert mich, denn wir hatten hier einen starken Regen, der eine halbe Stunde lang mit großer Heftigkeit niederging, während wir beim Frühstück saßen. Ich wollte schon vorschlagen, die Hochzeit zu verschieben.«
»Übrigens, ich habe Ihnen ja noch gar nicht gratuliert. Mir war nämlich klar, dass Sie es für sich durchaus nicht nur als Glück empfinden, weswegen ich mich mit meinen Glückwünschen nicht allzusehr beeilt habe. Hoffentlich ist alles soweit zufriedenstellend abgelaufen. Wie habt ihr euch alle benommen? Wer hat denn am meisten geweint?«
»Ach, natürlich die arme Miss Taylor! Sʹist eine traurige Angelegenheit.«
»Armer Mr. und arme Miss Woodhouse, bitte sehr, aber ich kann unmöglich ›arme Miss Taylor‹ sagen. Ich habe zwar vor Ihnen und Emma große Achtung, aber hier geht es um die Alternative: Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Es ist auf alle Fälle viel leichter, nur einen Menschen anstatt deren zwei zufriedenstellen zu müssen.«
»Besonders, wenn einer dieser beiden ein derart launisches und unerträgliches Geschöpf ist!« warf Emma fröhlich ein. »Ich weiß, dass es das ist, woran Sie denken und auch unverblümt aussprechen würden, wäre mein Vater nicht anwesend.«
»Meine Liebe, ich glaube, das trifft tatsächlich zu«, sagte Mr. Woodhouse seufzend. »Ich fürchte, ich bin manchmal wirklich sehr launenhaft und unerträglich.«
»Mein liebster Papa, Sie nehmen doch nicht etwa an, dass ich Sie damit gemeint habe, oder Mr. Knightley dies glauben machen wollte. Was für ein schrecklicher Gedanke! Oh nein, ich dachte dabei ausschließlich an mich selbst. Mr. Knightley hat, wie Sie wissen, an mir oft etwas auszusetzen, wenn auch nur im Scherz. Wir sagen einander immer, was uns gerade so einfällt.«
Mr. Knightley war tatsächlich einer der wenigen Menschen, die an Emma Woodhouse Fehler entdeckten, und auch der einzige, der mit ihr darüber sprach, und obwohl es für Emma selbst nicht gerade angenehm war, wusste sie genau, dass es ihren Vater noch härter treffen würde, hätte er eine Ahnung davon, dass sie durchaus nicht von allen für vollkommen gehalten wurde.
»Emma weiß, dass ich ihr nie schmeichle«, sagte Mr. Knightley, »aber ich wollte niemand Unrecht tun. Miss Taylor war daran gewöhnt, zwei Menschen zufriedenstellen zu müssen, während es jetzt nur noch einer ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie schon dadurch besser dran ist.«
»Nun«, sagte Emma, gewillt, es durchgehen zu lassen, »Sie möchten doch sicher etwas über die Hochzeit erfahren und ich werde Ihnen gern darüber berichten. Wir haben uns alle charmant benommen. Alle waren pünktlich zur Stelle, alle sahen vorteilhaft aus, es gab keine Tränen und keine langen Gesichter. Oh nein, wir wussten ja, dass wir nur eine halbe Meile voneinander entfernt leben würden und uns jeden Tag sehen könnten.«
»Meine gute Emma erträgt alles mit Fassung«, sagte ihr Vater. »Aber, Mr. Knightley, es ist ihr doch sehr schmerzlich, die arme Miss Taylor zu verlieren, und sie wird sie in Zukunft sicherlich noch mehr vermissen, als ihr jetzt klar ist.«
Emma wandte das Gesicht ab und schwankte zwischen Lachen und Weinen.
»Es wäre undenkbar, dass Emma solch eine Gefährtin nicht missen sollte«, sagte Mr. Knightley. »Wir hätten sie nicht so gern, Sir, wenn wir dies annehmen müssten, aber sie versteht auch, wie willkommen ein eigenes Heim für Miss Taylor in ihrem Alter sein muss und wie wichtig eine ausreichende Versorgung für sie ist, Miss Taylor kann es sich infolgedessen nicht leisten, mehr Kummer als Freude zu empfinden. Alle ihre Freunde müssen sich darüber freuen, sie so glücklich verheiratet zu sehen.«
»Sie haben noch etwas vergessen, was für mich ein Grund zur Freude ist«, sagte Emma, »noch dazu ein sehr wichtiger – nämlich der, dass ich die Verbindung zustande gebracht habe. Sie müssen wissen, ich habe diese schon vor vier Jahren angebahnt und ihr Zustandekommen beweist, wie recht ich hatte, während noch viele Leute sagten, Mr. Weston würde nie wieder heiraten, das tröstet mich über alle Unannehmlichkeiten hinweg.«
Mr. Knightley konnte nur den Kopf schütteln. Ihr Vater erwiderte zärtlich: »Ach, meine Liebe, ich würde es vorziehen, du würdest keine Ehen stiften und Ereignisse vorhersagen, denn leider trifft das, was du sagst, immer zu. Bitte stifte keine weiteren Ehen.«
»Ich verspreche Ihnen, Papa, keine für mich selbst zu stiften, werde es aber stets gern für andere tun. Es bereitet so viel Vergnügen. Und dann noch nach diesem Erfolg, wissen Sie! Wo alle behaupteten, Mr. Weston würde nie wieder heiraten. Du liebe Zeit, nein! Mr. Weston, der schon so lange Witwer war und sich unbeweibt völlig wohl zu fühlen schien, der sich dauernd um seine Geschäfte in der Stadt oder seine Freunde kümmerte, der überall, wo er auch hinkam, gern gesehen und stets guter Laune war – Mr. Weston hätte es nicht nötig gehabt, auch nur einen einzigen Abend allein zu verbringen, wenn er es nicht gewollt hätte. Oh nein, Mr. Weston würde bestimmt nicht wieder heiraten. Einzelne erwähnten sogar ein Versprechen, das er seiner Frau am Sterbebett gegeben habe, und andere sprachen davon, sein Sohn und der Onkel würden es nicht zulassen. Manch höherer Unsinn wurde in der Sache geäußert, aber ich hielt nichts davon. Ich hatte an jenem Tag (vor etwa vier Jahren), als Miss Taylor und ich ihn in Broadway Lane trafen, und als er, da es zu nieseln angefangen hatte, so galant davonstürzte und sich von Farmer Mitchell für uns zwei Schirme auslieh, bereits meinen Entschluss gefasst. Von da an plante ich die Verbindung, und da ich in diesem Fall so erfolgreich war, können Sie, lieber Papa, nicht von mir erwarten, dass ich das Ehestiften aufgebe.«
»Ich begreife nicht recht, was Sie unter ›Erfolg‹ verstehen«, sagte Mr. Knightley. »Erfolg setzt Anstrengung voraus. Sie haben Ihre Zeit zweckmäßig und taktvoll angewendet, wenn Sie sich in den vergangenen vier Jahren um diese Eheschließung bemüht haben. Durchaus eine Beschäftigung, die dem Geist einer jungen Dame angemessen ist. Wenn aber, wie ich es sehe, ihre sogenannte Ehestiftung darin besteht, dass Sie dieselbe lediglich planten, indem Sie sich eines müßigen Tages einredeten, ›ich glaube, es wäre für Miss Taylor vorteilhaft, wenn Mr. Weston sie heiraten würde‹, und Sie es sich immer wieder suggerierten – wieso sprechen Sie da von Erfolg? Worin besteht Ihr Verdienst? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie hatten eine glückliche Vorahnung, das ist alles.«
»Und haben Sie nie erlebt, wie viel Freude und Genugtuung einem eine glückliche Vorahnung bereiten kann? Dann kann ich Sie nur bedauern. Ich hätte Sie für intelligenter gehalten. Sie können mir glauben, eine glückliche Vorahnung beruht nicht nur auf Glück. Es kommt immer auch etwas Begabung hinzu.
Was mein unangebrachtes Wort ›Erfolg‹ betrifft, an dem Sie Anstoß zu nehmen scheinen, wüsste ich nicht, warum ich es für mich nicht beanspruchen sollte. Sie haben zwei nette Deutungen gegeben, aber ich glaube, da ist noch eine dritte – ein Zwischending von Alles-Tun und Garnichts-Tun. Hätte ich Mr. Westons Besuche hier im Hause nicht begünstigt, ihn ermutigt und kleine Schwierigkeiten ausgebügelt, dann wäre vielleicht trotzdem nichts dabei herausgekommen. Ich nehme an, Sie kennen Hartfield gut genug, um zu verstehen, was ich meine.«
»Man hätte es einem freimütigen, offenherzigen Mann wie Mr. Weston, und einer vernünftigen, natürlichen Frau wie Miss Taylor durchaus überlassen können, mit ihren eigenen Angelegenheiten fertig zu werden. Sie haben sich durch Ihre Einmischung möglicherweise mehr geschadet als ihnen genützt.«
»Emma denkt nie an sich selbst, wenn sie anderen nützlich sein kann«, erwiderte Mr. Woodhouse, der alles nur halb mitbekommen hatte. »Aber stifte bitte keine weiteren Ehen, meine Liebe, es sind überflüssige Dinge, die nur das Familienleben beeinträchtigen.«
»Nur noch eine, Papa; die von Mr. Elton. Du hast ihn doch gern; ich muss unbedingt eine Frau für ihn finden. Ich wüsste hier in Highbury keine, die zu ihm passen würde – er ist schon ein ganzes Jahr hier und hat sein Haus behaglich eingerichtet, es wäre doch schade, wenn er noch länger ledig bliebe, und als er heute ihre Hände ineinander legte, kam es mir so vor, als hätte er mit Blicken sagen wollen, er wäre gern an ihrer Stelle! Ich halte viel von Mr. Elton, und dies wäre die einzige Möglichkeit, ihm zu helfen.«
»Mr. Elton ist bestimmt ein sehr hübscher und anständiger junger Mann, und ich habe große Achtung vor ihm. Aber wenn du ihm eine Aufmerksamkeit erweisen willst, meine Liebe, dann lade ihn doch einmal ein, mit uns zu speisen. Das wäre das richtige. Ich nehme an, Mr. Knightley wird so freundlich sein, ihn abzuholen.«
»Jederzeit, Sir, mit dem größten Vergnügen«, sagte Mr. Knightley lachend. »Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass dies der bessere Weg wäre. Laden Sie ihn zum Dinner ein, Emma, und setzen Sie ihm vom Fisch und Fleisch die besten Stücke vor, aber überlassen Sie es ihn, sich die passende Frau zu suchen. Verlassen Sie sich drauf, ein Mann von sechs- oder siebenundzwanzig Jahren kommt auch allein zurecht.«
Zweites Kapitel
Mr. Weston stammte aus Highbury, er war in einer angesehenen Familie geboren, die während der letzten zwei oder drei Generationen zu Rang und Besitz gekommen war. Er hatte eine gute Erziehung genossen, aber da es ihm schon früh im Leben gelungen war, zu einer bescheidenen Unabhängigkeit zu kommen, lagen ihm die einfacheren Berufe nicht mehr, denen seine Brüder nachgingen und es war für seinen aktiven, lebhaften Geist genau das richtige gewesen, in die neugegründete Bürgerwehr der Grafschaft einzutreten.
Captain Weston war allgemein beliebt; und als die Wechselfälle seines Militärlebens ihn mit Miss Churchill, aus bedeutender Yorkshire-Familie, zusammenführten und diese sich in ihn verliebte, wunderte sich niemand darüber, außer ihrem Bruder und dessen Frau, die ihn nie gesehen hatten und so von Stolz und Wichtigtuerei erfüllt waren, dass sie die Verbindung übelnahmen.
Miss Churchill indessen, volljährig und im uneingeschränkten Besitz ihres Vermögens – obwohl dieses zu dem Familienbesitz in keinem Verhältnis stand – ließ sich von dieser Eheschließung nicht abbringen und die Hochzeit fand zur unendlichen Kränkung von Mr. und Mrs. Churchill statt, die sie mit angemessenem Anstand verstießen. Es war eine unpassende Verbindung, die nicht viel Glück brachte. Mrs. Weston hätte eigentlich mehr darin finden können, denn sie hatte einen Ehemann, dessen warmes Herz und freundliche Veranlagung ihn denken ließ, dass ihr für die große Gefälligkeit, in ihn verliebt zu sein, alles zustehe, aber obwohl sie irgendwie Geist hatte, war es nicht gerade der richtige. Sie hatte genügend Entschlusskraft bewiesen, ihren eigenen Willen gegen den ihres Bruders durchzusetzen, aber wiederum nicht genug, ihr unvernünftiges Bedauern ob ihres Bruders ebenso unvernünftigen Zorn zu unterdrücken oder den Luxus ihres früheren Heims zu vermissen. Sie lebten über ihre Verhältnisse, trotzdem war alles mit Enscombe nicht zu vergleichen; sie liebte ihren Mann zwar noch immer, aber sie wollte gleichzeitig Captain Westons Frau und Miss Churchill auf Enscombe sein.
Es erwies sich für Captain Weston, von dem alle, besonders die Churchills, annahmen, er sei eine hervorragende Verbindung eingegangen, dass er bei diesem Handel am allerschlechtesten weggekommen war; denn als seine Frau nach dreijähriger Ehe starb, war er eher ärmer als vorher und hatte noch für ein Kind zu sorgen. Man nahm ihm indessen diese Ausgaben bald ab. Der Junge war, mit dem zusätzlich mildernden Anspruch der langen Krankheit seiner Mutter, das Mittel zu einer Art von Versöhnung geworden; und da Mr. und Mrs. Churchill keine eigenen Kinder noch irgendein anderes junges Wesen hatten, für das sie hätten sorgen müssen, machten sie kurz nach dem Tode von Mrs. Weston das Angebot, den kleinen Frank ganz in ihre Obhut zu nehmen. Der verwitwete Vater mag vielleicht einige Skrupel gehabt und einiges Widerstreben empfunden haben, aber andere Erwägungen ließen ihn diese überwinden und das Kind wurde der Obhut und dem Reichtum der Churchills übergeben; er selbst brauchte sich nur noch um sein eigenes Wohlergehen zu kümmern und danach zu trachten, seine Lage zu verbessern, so gut es ging.
Eine völlige Lebensumstellung wurde wünschenswert. Er trat aus der Bürgerwehr aus und beschäftigte sich mit Handel, da er Brüder hatte, die darin in London schon gut etabliert waren, was ihm einen vorteilhaften Start ermöglichte. Es war ein Unternehmen, das ihm gerade genug Arbeit brachte. Er hatte noch immer ein kleines Haus in Highbury, wo er fast alle seine freien Tage verbrachte; und so gingen die nächsten achtzehn oder zwanzig Jahre seines Lebens zwischen nützlicher Beschäftigung und den Zerstreuungen der Gesellschaft angenehm dahin. Er hatte in der Zwischenzeit genügend Vermögen erworben – ausreichend, um sich den Kauf eines kleinen Besitzes nahe Highbury zu ermöglichen, den er sich immer gewünscht hatte. Ausreichend, um selbst eine Frau wie Miss Taylor zu heiraten, die keine Aussteuer besaß und ganz nach den Neigungen seiner freundlichen und geselligen Veranlagung zu leben.
Es war jetzt schon einige Zeit her, seit Miss Taylor begonnen hatte, seine Pläne zu beeinflussen, aber es war nicht der tyrannische Einfluss, den Jugend auf Jugend ausübt, sein Entschluss, sich nicht niederzulassen, ehe er Randalls kaufen könne, war nicht erschüttert worden, und er hatte dem Verkauf dieses Besitzes lange entgegengesehen, aber er hatte mit diesem Objekt in Aussicht ständig weitergemacht, bis alles verwirklicht war. Er hatte ein Vermögen erworben, sein Haus gekauft, eine Frau gefunden und einen neuen Lebensabschnitt begonnen, der alle Möglichkeiten größeren Glücks barg, als jener, der hinter ihm lag. Er war nie unglücklich gewesen, selbst in seiner ersten Ehe hatte sein eigenes Temperament ihn davor bewahrt, aber erst die zweite sollte ihm zeigen, wie wunderbar eine urteilsfähige und wahrhaft liebende Frau sein kann und ihm den erfreulichsten Beweis dafür liefern, dass es wesentlich besser sei zu wählen, anstatt gewählt zu werden, Dankbarkeit zu erwecken anstatt sie zu empfinden.
Er brauchte nur eine ihm genehme Wahl zu treffen, sein Vermögen gehörte ausschließlich ihm, denn was Frank betraf, war dieser stillschweigend als Erbe seines Onkels erzogen worden; es war eine offen anerkannte Adoption, und Frank sollte, wenn er mündig würde, den Namen Churchill annehmen. Es war infolgedessen höchst unwahrscheinlich, dass er je die Unterstützung seines Vaters benötigen würde. Dieser machte sich deswegen auch keine Sorgen. Die Tante war eine launische Frau und beherrschte ihren Mann völlig; aber es lag nicht in Mr. Westons Naturell, sich vorzustellen, dass eine Laune stark genug sein könnte, um jemand, der so geliebt wurde und der, wie er annahm, auch verdiente, geliebt zu werden, zu beeinflussen. Er sah seinen Sohn jedes Jahr in London und war stolz auf ihn; und diese liebevolle Beschreibung von ihm als einem ausgezeichneten jungen Mann ließ auch Highbury irgendwie stolz auf ihn sein. Er wurde als genügend zum Ort gehörig betrachtet, um seine Eigenschaften und Aussichten zu einer Sache von allgemeiner Anteilnahme zu machen.
Mr. Frank Churchill war der Stolz von Highbury, und alle waren außerordentlich neugierig darauf, ihn zu sehen, obwohl das Kompliment so wenig erwidert wurde, dass er in seinem ganzen Leben noch nie dort gewesen war. Man sprach zwar oft davon, dass er kommen und seinen Vater besuchen würde, aber es wurde nie Wirklichkeit.
Jetzt, nach der Heirat seines Vaters, nahm man allgemein an, der Besuch solle als gebührende Aufmerksamkeit stattfinden. Es gab in der ganzen Stadt darüber keine abweichende Meinung, weder als Mrs. Perry mit Mrs. und Miss Bates Tee trank, noch als diese den Besuch erwiderten. Nun war es für Frank Churchill an der Zeit, sich bei ihnen sehen zu lassen, und die Hoffnung nahm zu, als man hörte, er habe seiner neuen Mutter in der Angelegenheit geschrieben. Für ein paar Tage wurde der nette Brief, den Mrs. Weston erhalten hatte, in jeder Vormittagsvisite erwähnt. »Ich nehme an, Sie haben von dem netten Brief gehört, den Mr. Frank Churchill an Mrs. Weston geschrieben hat? Ich glaube, es war wirklich ein netter Brief. Mr. Woodhouse erzählte mir davon. Er hat den Brief gesehen und er sagt, er habe nie in seinem Leben einen netteren Brief gesehen.«
Es war wirklich ein höchst geschätzter Brief. Mrs. Weston hatte sich natürlich von dem jungen Mann sehr vorteilhafte Vorstellungen gemacht; und solch freundliche Aufmerksamkeit war ein unwiderleglicher Beweis für seinen ausgeprägten gesunden Menschenverstand und ein höchstwillkommener Beitrag zu all den Glückwunschäußerungen, die ihre Heirat ihr schon beschert hatte. Sie hatte das Gefühl, eine sehr glückliche Frau zu sein, und sie lebte schon lange genug, um zu wissen, dass man sie mit Recht glücklich schätzen könne. Ihr einziger Kummer war die teilweise Trennung von Freunden, deren Freundschaft für sie sich nie abgekühlt hatte und für die es nicht leicht gewesen war, sich von ihr trennen zu müssen.
Sie wusste, dass man sie zuweilen vermisste, und konnte nicht ohne Schmerz daran denken, Emma könnte auch nur ein einziges Vergnügen versäumen oder sich auch nur eine Stunde langweilen, weil ihre Gesellschaft ihr abging; aber die gute Emma hatte keinen schwachen Charakter und war der Lage besser gewachsen, als die meisten Mädchen es gewesen wären. Sie hatte gesunden Menschenverstand, Energie und Auftrieb, weshalb man hoffen konnte, dass sie gut und glücklich über die kleinen Schwierigkeiten und Entbehrungen hinwegkommen würde. Und dann lag auch eine Beruhigung in der geringen Entfernung Randalls von Hartfield, bequem selbst für allein spazierengehende weibliche Wesen und in Mr. Westons Charakter und Verhältnissen, wo auch die herannahende Jahreszeit kein Hindernis sein würde, die Hälfte der Abende in der Woche gemeinsam zu verbringen.
Mrs. Weston betrachtete ihre ganze Lebenssituation mit Dankbarkeit, die nur für Augenblicke Bedauern aufkommen ließ. Ihre Zufriedenheit – eine Zufriedenheit, die das übliche Maß überstieg – die Freude über ihren Besitz war so offenbar, dass Emma, obwohl sie ihren Vater zu kennen glaubte, sich manchmal darüber wunderte, dass er die »arme Miss Taylor« noch immer bedauerte, wenn sie sie auf Randalls inmitten jeglichen häuslichen Komforts verließen, oder wenn sie sie am Abend weggehen sahen, von einem aufmerksamen Ehemann zur eigenen Kutsche geleitet. Aber sie ging niemals, ohne dass Mr. Woodhouse leise seufzte und sagte:
»Ach, die arme Miss Taylor! Sie wäre so froh, wenn sie bleiben könnte.«
Sie würden weder Miss Taylor zurückgewinnen, noch bestand Aussicht, dass das Bemitleiden aufhören würde; aber einige Wochen brachten Mr. Woodhouse doch eine gewisse Erleichterung. Die Glückwünsche der Nachbarn hatten aufgehört, er wurde nicht mehr länger mit Gratulationen zu diesem traurigen Ereignis belästigt; und der Hochzeitskuchen, der ihm so viele Qualen bereitet hatte, war gänzlich verzehrt worden. Sein eigener Magen konnte nichts Schweres vertragen, und er vermochte sich nie vorzustellen, dass andere Leute anders seien als er. Was ihm nicht bekam, das betrachtete er auch für andere als ungeeignet; und er hatte ihnen deshalb ernsthaft ausreden wollen, überhaupt von dem Hochzeitskuchen zu nehmen; und als sich dies als vergeblich erwies, ebenso ernsthaft versucht zu verhindern, dass jemand davon aß. Er hatte sich sogar die Mühe gemacht, Mr. Perry, den Apotheker, deshalb zu konsultieren. Mr. Perry war ein intelligenter Mann von guter Erziehung, und seine Besuche waren eine der Annehmlichkeiten in Mr. Woodhouses Leben; als er gefragt wurde, musste er (allerdings, so schien es, sehr gegen seine innere Neigung) bestätigen, dass Hochzeitskuchen sicherlich vielen nicht bekomme – vielleicht den allermeisten, wenn man ihn nicht mit Maß genieße. Mit dieser Meinung, die seine eigene bestätigte, hoffte Mr. Woodhouse jeden Besucher des jungverheirateten Paares beeinflussen zu können; aber der Kuchen wurde dennoch gegessen und es gab für seine wohlwollenden Nerven keine Ruhe, ehe er nicht verschwunden war.
Es ging ein Gerücht in Highbury um, man habe all die kleinen Perrys mit einem Stück von Mrs. Westons Hochzeitskuchen in der Hand gesehen; aber Mr. Woodhouse wollte es nicht glauben.
Drittes Kapitel
Mr. Woodhouse hatte auf seine Art gern Gesellschaft. Er liebte es, wenn seine Freunde ihn besuchen kamen; und er konnte aus verschiedenen Gründen, wegen seiner langen Anwesenheit in Hartfield, seiner Gutmütigkeit, seinem Vermögen und seiner Tochter, die Besuche seines kleinen Freundeskreises weitgehend so steuern, wie es ihm passte. Er hatte mit Familien außerhalb dieses Kreises wenig Verkehr; sein Grauen vor langem Aufbleiben und großen Dinner-Einladungen ließen nur solche Bekanntschaften zu, die ihn entsprechend seinen eigenen Bedingungen besuchten. Glücklicherweise wohnten viele von ihnen in Highbury, das Randalls im gleichen Pfarrbezirk und Donwell Abbey, den Sitz Mr. Knightleys im angrenzenden Pfarrbezirk einschloss. Manchmal, wenn Emma ihn dazu überreden konnte, hatte er einige der Auserwählten und Besten zum Dinner bei sich; aber im Allgemeinen zog er Abendeinladungen vor; und wenn er sich nicht gerade für Gesellschaft ungeeignet fühlte, gab es in der Woche kaum einen Abend, an dem Emma nicht den Kartentisch für ihn aufstellen konnte.
Echte Freundschaft von langer Dauer brachte die Westons und Mr. Knightley ins Haus und bei Mr. Elton, einem Junggesellen wider Willen, bestand kaum die Gefahr, dass er das Vorrecht verschmähte, einen trostlosen, einsam verbrachten Abend gegen die Eleganz und Gesellschaft des Woodhouseschen Empfangszimmers und das Lächeln der hübschen Tochter einzutauschen.
Nach diesen Gästen kam eine zweite Garnitur; von denen Mrs. und Miss Bates sowie Mrs. Goddard am leichtesten erreichbar waren; drei Damen, die zu einem Besuch in Hartfield jederzeit bereit waren, die so oft abgeholt und wieder nach Hause gebracht wurden, wie Mr. Woodhouse glaubte, es den Pferden und James zumuten zu können. Es wäre indessen eine Kränkung gewesen, wenn dies nur einmal im Jahr stattgefunden hätte.
Mrs. Bates, die Witwe eines früheren Vikars von Highbury, war eine sehr alte Dame, die außer über Teetrinken und ein Spiel Quadrille über alles hinaus war. Sie lebte mit ihrer einzigen Tochter in äußerst bescheidenen Verhältnissen, sie wurde mit all der Rücksicht und dem Respekt behandelt, den eine harmlose alte Dame deren Lebensumstände ungünstig sind, erwarten konnte. Für eine Frau, die weder jung, noch hübsch, noch reich, noch verheiratet war, erfreute sich ihre Tochter einer außerordentlichen Beliebtheit. Dadurch, dass sie so hoch in der öffentlichen Gunst stand, befand sich Miss Bates in denkbar misslicher Lage; und sie besaß nicht die geistige Überlegenheit, mit sich selbst fertig zu werden, oder denen, die sie nicht mochten, wenigstens äußerlich Respekt abzunötigen. Sie hatte sich nie der Schönheit oder Klugheit rühmen können. Ihre Jugend war unauffällig verlaufen und ihre mittleren Lebensjahre waren der Pflege einer kränkelnden Mutter und dem Bestreben gewidmet, ihr kleines Einkommen so weit als möglich zu strecken. Dennoch war sie eine glückliche Frau, von der noch dazu niemand ohne Wohlwollen sprach. Dieses Wunder wurde durch ihre allumfassende Freundlichkeit und ihr zufriedenes Gemüt bewirkt. Jedermann hatte sie gern, sie war an jedermanns Glück interessiert, erkannte schnell die Vorzüge eines Menschen, hielt sich selbst für das glücklichste Geschöpf, das von den Wohltaten des Lebens, wie einer vortrefflichen Mutter und vielen guten Nachbarn und Freunden umgeben war, sie besaß ein Heim, in dem es an nichts fehlte. Die Einfachheit und Fröhlichkeit ihres Naturells ließen sie jedermann angenehm erscheinen und waren für sie eine Quelle des Glücks. Sie konnte auch über kleine Dinge viel erzählen, was für Mr. Woodhouse genau das Richtige war, und sie war stets voll trivialer Gedanken und harmlosen Klatsches.
Mrs. Goddard war Leiterin einer Schule – nicht eines Seminars oder einer Anstalt oder sonst etwas, das in langen Sätzen gehobenen Unsinns behauptete, fortschrittliche Errungenschaften mit eleganter Tugendhaftigkeit, mit neuen Grundsätzen und neuen Systemen zu verbinden – wo junge Damen für horrende Summen aus der Gesundheit in die Eitelkeit gedrängt werden –; sondern eines richtigen, ehrlichen, altmodischen Internats, wo vernünftige Leistungen zu einem ebensolchen Preis geboten werden und wohin man Mädchen schickt, damit sie aus dem Wege sind und sich ein bisschen Bildung zusammenkratzen, ohne Gefahr zu laufen, als Wunderkinder nach Hause zurückzukehren. Mrs. Goddards Schule hatte den besten Ruf und verdiente ihn auch; denn Highbury galt als besonders gesunder Ort; sie besaß ein weiträumiges Haus mit Garten, gab den Kindern reichlich und nahrhaft zu essen, ließ sie im Sommer viel herumlaufen und behandelte im Winter eigenhändig ihre Frostbeulen. Es war deshalb kein Wunder, dass jetzt ein Gefolge von zwanzig jungen Mädchenpaaren ihr zur Kirche folgte. Sie war eine schlichte, mütterliche Frau, die in ihrer Jugend hart gearbeitet hatte und die deshalb jetzt ein Recht darauf zu haben glaubte, sich bei einer gelegentlichen Teevisite zu erholen, und da sie von früher Mr. Woodhouses Freundlichkeit viel schuldete, fühlte sie sich dazu verpflichtet, ihr gepflegtes, ringsum mit feinen Handarbeiten garniertes Wohnzimmer verlassen zu müssen, um am Kamin einige Sixpence-Stücke zu gewinnen oder zu verlieren.
Es waren diese Damen, die Emma am leichtesten zusammenbringen konnte, und sie freute sich für ihren Vater, dass dies in ihrer Macht stand, obwohl es für sie selbst kein Gegenmittel für die Abwesenheit Mrs. Westons war. Sie war entzückt, wenn ihr Vater zufrieden aussah, und freute sich, derartiges so gut arrangieren zu können, aber das langweilige Geschwätz dieser drei Frauen ließ sie empfinden, jeder so verbrachte Abend sei genau das, was sie voll Furcht vorausgeahnt hatte.
Als sie eines Morgens wieder einmal so da saß und voraussah, dass auch dieser Tag genauso enden würde, brachte man ihr eine Nachricht von Mrs. Goddard, die respektvoll anfragte, ob man ihr gestatten würde, Miss Smith mitzubringen; eine hochwillkommene Anfrage, denn Miss Smith war ein siebzehnjähriges Mädchen, das Emma vom Sehen gut kannte und für das sie schon lange seiner Schönheit wegen Interesse empfand. Eine freundliche Einladung ging zurück und die schöne Herrin des Hauses brauchte vor dem Abend keine Angst mehr zu haben.
Harriet Smith war die natürliche Tochter von irgendjemand. Irgendjemand hatte sie vor ein paar Jahren in Mrs. Goddards Schule untergebracht und hatte sie unlängst zum Rang einer bevorzugten Schülerin erhoben, die bei der Schulleiterin wohnt. Das war alles, was über ihre Vergangenheit allgemein bekannt war. Sie hatte offensichtlich außer denen, die sie in Highbury kennengelernt hatte, keine Freunde und war gerade von einem langen Besuch bei einigen jungen Damen auf dem Land zurückgekehrt, die dort mit ihr zur Schule gegangen waren.
Sie war ein sehr hübsches Mädchen und stellte zufällig den Schönheitstyp dar, den Emma besonders bewunderte. Sie war klein, wohlgerundet und hellhäutig, mit blühendem Teint, blauen Augen, hellem Haar, regelmäßigen Zügen und einem Ausdruck großer Sanftheit; und noch ehe der Abend zu Ende ging, war Emma von ihrer Person und ihrem Benehmen gleichermaßen entzückt und fest entschlossen, die Bekanntschaft fortzusetzen.
Ihr fiel zwar an Miss Smiths Unterhaltung nichts besonders Kluges auf, aber sie fand sie im ganzen sehr gewinnend, nicht unkonventionell schüchtern, nicht abgeneigt zu plaudern, und dennoch weit davon entfernt, aufdringlich zu sein, sie zeigte angemessene und schickliche Zurückhaltung, schien erfreut und dankbar zu sein, dass man sie nach Hartfield eingeladen hatte, und so natürlich davon beeindruckt, dass alles einen viel schöneren Stil aufwies, als sie gewöhnt war, sie schien gesunden Menschenverstand zu besitzen und Ermutigung zu verdienen. Diese sanften blauen Augen und all die natürliche Anmut sollten nicht an die zweitklassige Gesellschaft von Highbury und deren Bekanntenkreis verschwendet werden. Ihre bisherigen Bekanntschaften waren ihrer natürlich unwürdig. Die Freunde, die sie erst vor kurzem verlassen hatte, mussten ihr schaden, obwohl sie bestimmt sehr anständige Menschen waren. Es handelte sich um eine Familie namens Martin, die Emma vom Hörensagen kannte, sie hatte von Mr. Knightley einen großen Hof gepachtet und wohnte im Pfarrbezirk von Donwell – wahrscheinlich sehr achtbar, da Mr. Knightley viel von ihr hielt; aber sie war sicherlich grob und ungebildet und als intime Freunde eines Mädchens völlig ungeeignet, dem nur noch einige Kenntnisse und Eleganz fehlten, um vollkommen zu sein. Sie würde sie überwachen; sie veredeln, sie von ihren unpassenden Bekanntschaften absondern und sie in die gute Gesellschaft einführen, auch ihre Meinung und ihre Manieren bilden. Es wäre ein interessantes und bestimmt gutgemeintes Unterfangen, das ihrer eigenen Lebenssituation, ihrer Muße und ihren Kräften wohl anstehen würde.
Sie war so eingehend damit beschäftigt, diese sanften blauen Augen zu bewundern, zu plaudern und zuzuhören und nebenbei Pläne zu schmieden, dass der Abend ungewöhnlich schnell verging und das Supper, das stets solche Einladungen abschloss und vor dem sie meist nur herumsaß und die richtige Zeit abwartete, war fertig und in der Nähe des Feuers angerichtet, ehe sie es bemerkte. Mit einer größeren Bereitwilligkeit und größerem Eifer als sonst, dennoch dankbar für die Anerkennung, alles richtig zu machen, mit einem guten Willen und viel Freude über die eigenen Ideen tat sie alles, was dem Mahl zur Ehre gereichte, half bei der Bedienung und empfahl mit Nachdruck die überbackenen Austern, weil sie wusste, sie würde dem frühen Zubettgehen und den höflichen Skrupeln ihrer Gäste damit entgegenkommen.
Bei solchen Gelegenheiten kämpften in Mr. Woodhouse die widersprüchlichsten Gefühle miteinander. Er hatte es gern, wenn das Tischtuch aufgelegt wurde, da dies in seiner Jugend üblich gewesen war; aber er bedauerte aus der Überzeugung, Abendmahlzeiten seien ungesund, dass etwas darauf serviert wurde; und während er seinen Besuchern in seiner Gastfreundlichkeit eigentlich alles gönnte, war er um ihre Gesundheit in Sorge, da sie trotzdem essen würden.
Das einzige, was er mit eigener Zustimmung empfehlen konnte, war ein kleines Schälchen dünnen Haferschleims, wie er es aß; und obwohl er sich zusammennahm, während die Damen mit Behagen angenehmere Dinge verspeisten, konnte er es nicht unterlassen zu sagen:
»Mrs. Bates, ich möchte Ihnen vorschlagen, es mit einem dieser Eier zu versuchen. Ein sehr weichgekochtes Ei ist nicht ungesund. Serle versteht am besten, ein Ei zu kochen. Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, wenn jemand anderer es gekocht hätte – aber sie brauchen nichts zu befürchten, wie sie sehen, sind sie sehr klein – eines unserer kleinen Eier wird Ihnen nicht schaden. Miss Bates, lassen Sie sich von Emma ein kleines Stück Torte vorlegen – nur ein sehr kleines. Es gibt bei uns ausschließlich Apfeltorte. Sie brauchen keine Angst vor ungesunden Konserven zu haben. Ich rate indessen nicht zu dem Rahmpudding. Mrs. Goddard, wie wäre es mit einem halben Glas Wein? Ein kleines halbes Glas, mit Wasser vermischt? Ich glaube nicht, dass es Ihnen schlecht bekommen würde.«
Emma ließ ihren Vater reden, während sie die Gäste zufriedenstellend versorgte; und es machte ihr besonderes Vergnügen, sie gerade an diesem Abend befriedigt nach Hause zu schicken. Miss Smiths Glückseligkeit entsprach ganz ihren Absichten, denn Miss Woodhouse war in Highbury solch eine bedeutende Persönlichkeit, dass die Aussicht, ihr vorgestellt zu werden, ebensoviel Bestürzung wie Freude ausgelöst hatte; aber das bescheidene, dankbare kleine Mädchen verabschiedete sich im Gefühl größter Dankbarkeit, entzückt über die Freundlichkeit, mit der Miss Woodhouse es während des ganzen Abends behandelt und ihm beim Abschied auch noch tatsächlich die Hand geschüttelt hatte.
Viertes Kapitel
Harriets Smiths Vertrautheit mit Hartfield wurde bald zur Gewohnheit. In ihrer rasch entschlossenen Art hatte Emma keine Zeit verloren, sie einzuladen, zu ermutigen und sie gebeten, recht oft zu Besuch zu kommen, und je mehr ihre Bekanntschaft sich vertiefte, umso besser wurde auch ihr gegenseitiges Einvernehmen.
Emma hatte bald erkannt, wie nützlich Harriet als Begleiterin bei ihren Spaziergängen sein würde. In dieser Hinsicht war Mrs. Westons Verlust besonders schmerzlich gewesen; da ihr Vater nie über das Gehölz hinausging, wo zwei Begrenzungen des Grundstücks ihm je nach Jahreszeit für seinen langen oder kurzen Spaziergang genügten; und durch Mrs. Westons Heirat waren ihre Bewegungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt worden.
Sie war einmal allein nach Randalls gegangen, aber es war kein Vergnügen gewesen; und eine Harriet Smith, die man jederzeit zu einem Spaziergang einladen konnte, war deshalb als zusätzliche Annehmlichkeit willkommen. Je öfter sie sie sah, umso besser gefiel sie ihr in jeder Hinsicht und wurde dadurch in ihren freundlichen Absichten bestärkt.
Harriet war bestimmt nicht klug, aber von Natur sanft, gefügig und dankbar; gänzlich frei von Einbildung und nur von dem Wunsch beseelt, von einem Menschen angeleitet zu werden, zu dem sie aufschauen konnte. Emma fand es sehr liebenswert, dass sie sich so schnell an sie angeschlossen hatte und ihre Neigung zu guter Gesellschaft sowie die Fähigkeit zu erkennen, was elegant und hübsch ist, zeigte, dass sie auch Geschmack besaß, obwohl man keinen hohen Intelligenzgrad bei ihr erwarten konnte. Emma war völlig davon überzeugt, dass Harriet Smith genau die junge Freundin sei, die sie brauchte und die ihr zu Hause fehlte. Solch eine Freundin wie Mrs. Weston gab es nicht noch einmal. Das Schicksal würde einem nie zwei von dieser Art zubilligen, was sie sich auch gar nicht wünschte. Es war etwas völlig anderes – ein ausgeprägtes und ganz anders geartetes Gefühl. Die Zuneigung zu Mrs. Weston beruhte auf Dankbarkeit und Achtung. Harriet sollte wie eine Freundin geliebt werden, der man nützlich sein kann. Für Mrs. Weston konnte man nichts mehr tun; für Harriet alles.
Ihre ersten Versuche behilflich zu sein, bestanden darin, herauszufinden, wer ihre Eltern waren; aber Harriet konnte ihr keinerlei Auskunft geben. Sie erzählte bereitwillig alles, was in ihrer Macht stand, aber alle diesbezüglichen Fragen waren vergebens. Emma konnte annehmen, was sie wollte; vermochte sich aber keineswegs vorzustellen, dass sie in der gleichen Lage nicht die Wahrheit herausgefunden hätte. Harriet hatte nicht genügend Scharfsinn. Sie gab sich damit zufrieden, zu hören und zu glauben, was Mrs. Goddard ihr zu erzählen für richtig hielt, und forschte nicht weiter nach.
Mrs. Goddard, die Lehrerinnen und die Mädchen, sowie die Schulangelegenheiten im Allgemeinen, nahmen natürlich in ihrer Unterhaltung einen breiten Raum ein – und das schien, abgesehen von ihrer Bekanntschaft mit den Martins von der Abbey-Mill-Farm, alles zu sein. Die Martins nahmen ihre Gedanken weitgehend ein; sie hatte zwei äußerst glückliche Monate bei ihnen verbracht; und sie erzählte nun gern, wie viel Spaß ihr der Besuch gemacht habe. Sie schilderte die vielen Annehmlichkeiten und Wunder des Anwesens. Da Emma die Schilderung einer anderen Gesellschaftsschicht amüsierte, ermutigte sie Harriets Geschwätzigkeit und genoss die jugendliche Schlichtheit, die mit so viel Entzücken davon sprechen konnte, »dass Mrs. Martin zwei Wohnzimmer besitze, zwei wirklich sehr schöne: und eines davon sei fast genauso groß wie Mrs. Goddards Empfangszimmer, und auch noch eine zweite Magd, die schon fünfundzwanzig Jahre bei ihr sei; und sie besäßen acht Kühe, zwei davon Alderneys, sowie eine kleine Welsh-Kuh, und da sie diese so gern hatte, habe Mrs. Martin gesagt, man könne sie ihre Kuh nennen, und im Garten stünde ein sehr hübsches Sommerhäuschen, wo sie im kommenden Jahr einmal alle Tee trinken würden – ein sehr hübsches Sommerhäuschen, das groß genug sei, um ein Dutzend Personen aufzunehmen«.
Sie fand es zunächst amüsant, ohne über die tieferen Gründe nachzudenken, aber als sie die Familienverhältnisse allmählich besser kennenlernte, wurde das Amüsement von anderen Gefühlen verdrängt. Sie hatte sich insofern eine falsche Vorstellung gemacht, als sie sich einbildete, es handle sich um Mutter und Tochter sowie einen Sohn und dessen Frau, die alle zusammenlebten; aber als herauskam, dass Mr. Martin, der in ihrer Schilderung einen wichtigen Platz einnahm und der häufig wegen seiner außerordentlichen Gutmütigkeit anerkennend erwähnt wurde, mit der er dies oder jenes getan hatte, ledig war; dass es also in diesem Fall keine junge Mrs. Martin, keine Ehefrau gab – da sah sie in all dieser Gastlichkeit und Güte eine Gefahr für ihre arme kleine Freundin, und wenn man sich ihrer nicht annähme, müsse sie notgedrungen für immer gesellschaftlich absinken.
Als Folge dieser einleuchtenden Idee wurden ihre Fragen zahlreicher und bedeutsamer; besonders nachdem sie Harriet soweit gebracht hatte, noch mehr von Mr. Martin zu erzählen, was diese offenbar gern tat. Harriet sprach mit großer Bereitwilligkeit von dem Anteil, den er an ihren Spaziergängen im Mondenschein und ihren fröhlichen abendlichen Spielen gehabt hatte; und sie wurde nicht müde zu betonen, wie gutmütig und aufmerksam er sei. »Er habe eines Tages einen Weg von drei Meilen zurückgelegt, nur um ihr einige Walnüsse zu bringen, weil sie gesagt hatte, wie gern sie diese möge – und er sei auch sonst sehr aufmerksam. Er lud eines Abends den Sohn seines Schäfers zum Vorsingen ins Wohnzimmer ein. Sie singe sehr gern und er täte es auch. Sie hielte ihn für sehr klug und verständig. Er besitze eine schöne Schafherde und in der Zeit, als sie bei ihnen weilte, habe man ihm für seine Wolle ein besseres Angebot gemacht als anderen in der Gegend. Sie glaube, jedermann spreche von ihm mit Anerkennung. Seine Mutter und Schwestern hätten ihn sehr gern. Mrs. Martin habe eines Tages zu ihr gesagt (und sie errötete, als sie es sagte), es gäbe keinen besseren Sohn als ihn und sie sei deshalb sicher, er würde ein guter Ehemann werden, wen und wann immer er auch heirate. Nicht dass sie wünsche, er solle sich schon jetzt verheiraten. Es eile damit keineswegs.«
›Gut gemacht, Mrs. Martin!‹ dachte Emma. ›Sie wissen, was Sie wollen.‹
»Und als sie von dort wegging, war Mrs. Martin so nett, Mrs. Goddard eine schöne Gans zu schicken, die schönste, die Mrs. Goddard je zu Gesicht bekommen hat. Mrs. Goddard hatte diese am Sonntag zubereitet und ihre drei Lehrerinnen, Miss Nash, Miss Prince und Miss Richardson zum Supper eingeladen.«
»Vermutlich ist Mr. Martin nicht an Dingen interessiert, die über seine Geschäftsinteressen hinausgehen. Er liest wahrscheinlich nicht?«
»Oh ja! – Das heißt, nein – ich weiß nicht recht – aber ich glaube, er hat schon viel gelesen – wenn auch nicht das, was Sie interessieren würde. Er liest zwar die Agrar-Berichte und einige andere Bücher, die in einer der Fensterbänke aufbewahrt werden, aber die liest er nicht vor. Manchmal las er uns am Abend, bevor wir zum Kartenspiel übergingen, aus den Eleganten Auszügen vor, was ich sehr unterhaltsam fand. Außerdem weiß ich, dass er den Vikar von Wakefield gelesen hat. Die Romantik des Waldes oder die Kinder der Abtei hat er indessen noch nie gelesen. Ehe ich sie erwähnte, hatte er von diesen Büchern nie etwas gehört; aber er will sie jetzt erwerben, sobald er dazu kommt.« Die nächste Frage war:
»Wie sieht Mr. Martin aus?«
»Oh! Nicht hübsch – keineswegs hübsch. Ich fand ihn zunächst beinah hässlich, aber jetzt nicht mehr. Nach einiger Zeit, wissen Sie, gewöhnt man sich an sein Aussehen. Haben Sie ihn denn noch nie gesehen? Er ist hie und da in Highbury und reitet bestimmt jede Woche auf dem Weg nach Kingston hier durch. Er ist schon oft an Ihnen vorbeigekommen.«
»Durchaus möglich, ich könnte ihn vielleicht schon fünfzigmal gesehen haben, ohne zu wissen, wer er ist. Ein junger Farmer, ob zu Pferd oder zu Fuß, wäre der letzte Mensch, der meine Neugier erregt. Die kleinen Grundbesitzer gehören einer Menschenklasse an, die mich schon rein gefühlsmäßig nichts angeht. Jemand, der eine oder zwei Stufen tiefer steht und ein achtbares Aussehen hat, könnte mich interessieren, da ich dann mit Recht annehmen dürfte, ihren Familien irgendwie nützlich sein zu können. Aber da ein Farmer meine Hilfe bestimmt nicht braucht, nehme ich aus diesem Grunde keine Notiz von ihm, andererseits beachte ich ihn deshalb nicht, weil er gesellschaftlich unter mir steht.«
»Sicherlich. Oh ja, es ist unwahrscheinlich, dass er Ihnen aufgefallen sein sollte, aber er kennt Sie vom Sehen sehr gut.«
»Ich bezweifle nicht, dass er ein sehr anständiger junger Mann ist. Ich weiß es sogar genau; und wünsche ihm alles Gute. Wie alt ist er eigentlich?«
»Er wurde am B. Juni vierundzwanzig, und mein Geburtstag ist am 23., nur ein Unterschied von fünfzehn Tagen, was ich sehr merkwürdig finde.«
»Erst vierundzwanzig. Das ist zum Heiraten zu jung. Seine Mutter hat ganz recht, dass es damit keine Eile hat. Sie scheinen soweit ganz wohlhabend zu sein, und wenn sie sich schon jetzt darum bemühen würden, ihn zu verheiraten, müssten sie es vielleicht später bereuen. Wenn er in etwa sechs Jahren eine passende junge Frau seiner eigenen Gesellschaftsschicht finden könnte, die auch etwas Geld hat, wäre dies durchaus wünschenswert.«
»Erst in sechs Jahren! Liebe Miss Woodhouse, dann wäre er ja schon dreißig Jahre alt.«
»Nun, das ist gerade der Zeitpunkt, wo die meisten Männer, die nicht finanziell unabhängig sind, es sich leisten können, zu heiraten. Ich nehme an, dass Mr. Martin erst sein Glück machen muss, man kann in dieser Welt nichts vorwegnehmen. Wie viel Geld er beim Tod seines Vaters auch geerbt haben mag, was immer sein Anteil am Familienbesitz, es ist, glaube ich, noch nicht greifbar, alles in seinen Beständen usw. angelegt; und obwohl er mit Geschick und ein bisschen Glück eines Tages reich sein könnte, ist es unwahrscheinlich, dass er schon viel Gewinn erzielt haben kann!«
»Bestimmt ist es so. Aber sie leben sehr komfortabel. Sie haben zwar keinen Hausdiener – vielleicht brauchen sie noch keinen; und Mrs. Martin spricht davon, später einmal einen Boy zu engagieren.«
»Ich hoffe, es bringt dich nicht in Verlegenheit, Harriet, wenn er einmal heiratet; – ich meine, falls du seine Frau kennenlernen solltest; denn wenn auch gegen seine Schwestern wegen ihrer höheren Bildung nichts einzuwenden ist, braucht man daraus noch lange nicht zu schließen, dass er eine Frau heiratet, die deiner Beachtung wert ist. Das Unglück deiner Geburt sollte dich, was deinen Umgang betrifft, besonders vorsichtig sein lassen. Du bist zweifellos die Tochter eines Gentleman und musst deinen Anspruch auf diese Lebensstellung nach besten Kräften unterstützen, sonst würden viele Menschen sich ein Vergnügen daraus machen, dich zu erniedrigen.«
»Ja, vermutlich gibt es solche. Aber während ich auf Hartfield zu Besuch bin und Sie so freundlich zu mir sind, Miss Woodhouse, habe ich keine Angst davor, was jemand mir antun könnte.«
»Du verstehst sehr gut, wie wichtig Einfluss ist, Harriet, aber ich möchte dich in der guten Gesellschaft so gut etabliert wissen, dass du auch von Hartfield und Miss Woodhouse unabhängig bist. Ich möchte dich in dauerhaften guten Beziehungen sehen – und zu diesem Zweck wäre es ratsam, möglichst keine unpassenden Bekanntschaften zu haben. Ich wünsche deshalb, sollte Mr. Martin heiraten, während du noch in der Gegend bist, dass niemand deine Vertrautheit mit seinen Schwestern dazu heranziehen möge, um dich seiner Frau vorzustellen, die möglicherweise nur eine ungebildete Farmerstochter ist.«
»Sicherlich, ja. Obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass Mr. Martin jemand heiraten würde, der nicht wenigstens etwas Bildung hat und gut erzogen ist. Ich will Ihnen jedoch nicht widersprechen und ich würde bestimmt keinen Wert darauf legen, seine Frau kennenzulernen. Ich werde aber vor den Misses Martin stets große Achtung haben, besonders vor Elisabeth, und es täte mir leid, wenn ich diese Freundschaft aufgeben müsste, denn sie sind beinah so gut erzogen wie ich. Aber sollte er eine gewöhnliche, unwissende Frau heiraten, würde ich sie bestimmt nicht besuchen, wenn ich es vermeiden könnte.«
Emma beobachtete sie durch das Auf und Ab dieser Rede, konnte aber keine alarmierenden Symptome von Verliebtheit entdecken. Der junge Mann war ihr erster Verehrer gewesen und sie vertraute darauf, dass auch keine anderweitige Bindung bestand und Harriet aus diesem Grunde keine ernsthaften Schwierigkeiten machen und sich irgendwelchen freundschaftlichen Vereinbarungen von ihrer Seite widersetzen würde.
Sie trafen Mr. Martin gleich am nächsten Tag, als sie auf der Straße nach Donwell spazierengingen. Er war zu Fuß, und nachdem er sie äußerst respektvoll gemustert hatte, schaute er ihre Begleiterin mit unverhohlenem Wohlgefallen an. Emma kam eine solche Beobachtungsmöglichkeit sehr zustatten, sie ging, während die beiden miteinander sprachen, einige Schritte weiter, wobei sie Mr. Martin mit einem schnellen Seitenblick abschätzen konnte. Er sah sehr gepflegt aus, wirkte wie ein vernünftiger junger Mann, aber sein Äußeres wies keine anderen Vorzüge auf; und wenn man ihn mit einem Gentleman verglich, dann, so dachte sie, müsse er notgedrungen alles an Boden verlieren, was er in Harriets Neigung gewonnen hatte. Harriet war für gute Manieren durchaus empfänglich, sie hatte von sich aus die ruhige Freundlichkeit von Emmas Vater teils mit Bewunderung, teils mit Verwunderung wahrgenommen. Mr. Martin wirkte so, als ob ihm Manieren gänzlich unbekannt seien.
Sie blieben nur wenige Minuten beisammen, man durfte eine Miss Woodhouse doch nicht warten lassen; und Harriet kam dann mit lächelndem Gesicht und verwirrtem Gemüt auf sie zugelaufen, das sich, wie Miss Woodhouse hoffte, bald beruhigen würde.
»Dass wir ihn gerade hier treffen mussten! Er sagte, es sei reiner Zufall gewesen, dass er nicht den Weg über Randalls genommen hat. Er hatte nicht angenommen, dass wir diesen Weg einschlagen würden. Er hatte geglaubt, wir gingen meist in Richtung Randalls. Er ist bis jetzt noch nicht dazugekommen, sich die Romantik des Waldes




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)