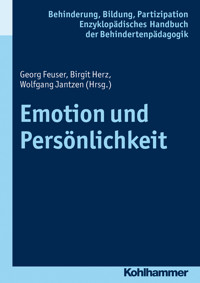
Emotion und Persönlichkeit E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit den beiden Begriffen der "Emotion" und "Persönlichkeit" im Zentrum eröffnet der Band einen vielschichtigen Zugang zu den einfachsten Formen psychischen Erlebens, aber auch Einblicke in die komplexen Strukturen der Persönlichkeit. Affekte und Emotionen bilden die Grundlage, wie wir unsere Bedürfnisse und Motivationen beurteilen, und steuern auch unsere Handlungsmöglichkeiten innerhalb der gegebenen Umfeldbedingungen. An Emotionen gekoppelte Prozesse der Sinnbildung sind zusammen mit Bindung und Dialog entscheidende Komponenten der Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch die Kehrseite, nämlich entwicklungspathologisch zu gewichtende Prozesse, lassen sich vor diesem Hintergrund beleuchten - ebenso wie das Verhältnis von Resilienz zu Vulnerabilität. Der Band wirft ein neues Licht auf das komplexe Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren und ermöglicht darüber ein neues Verständnis unterschiedlichster Entwicklungspfade. Dadurch finden nicht nur die Fragen der Krisenintervention neue Antworten; sichtbar werden darüber auch die Möglichkeiten und Perspektiven einer Umgestaltung des Gesundheits- und Bildungssystems im Zeichen und mit der Zielperspektive der Inklusion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 911
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Behinderung, Bildung, Partizipation
Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik
Herausgegeben von
Iris Beck, Georg Feuser, Wolfgang Jantzen, Peter Wachtel
Gesamtherausgeber:
Wolfgang Jantzen
Band 10
Georg Feuser/Birgit Herz/Wolfgang Jantzen (Hrsg.)
Emotion und Persönlichkeit
Verlag W. Kohlhammer
Wissenschaftliche Redaktion: Karen Ling
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-019639-1
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-026934-7
epub: ISBN 978-3-17-026935-4
mobi: ISBN 978-3-17-026936-1
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort der Gesamtherausgeber
Das Enzyklopädische Handbuch der Behindertenpädagogik „Behinderung, Bildung, Partizipation“ ist ein Lexikon in Stichwörtern, die jedoch nicht alphabetisch, sondern thematisch in 10 Bänden strukturiert wurden. Insgesamt wurden ca. 20 Haupt-, 100 mittlere und 300 kleine Stichwörter erarbeitet. Sie suchen zum einen in ihrer Gesamtheit einen Zusammenhang des Fachwissens herzustellen, in dem jedes Stichwort und zugleich jeder Band verortet ist. Zum anderen aber bilden die Einzelbände aufeinander bezogene thematische Einheiten. Somit ist das Gesamtwerk in zwei Richtungen lesbar und muss zugleich auch so gelesen werden: als Bestand aufeinander verweisender zentraler Begriffe des Fachs zum einen und als thematischer Zusammenhang in den Einzelbänden zum anderen, der aber jeweils auf die weiteren Bände verweist und mit ihnen in engstem Zusammenhang steht. Dementsprechend wurden Verweise sowohl innerhalb der Einzelbände als auch zwischen den Bänden vorgenommen, wobei einzelne Überschneidungen unvermeidbar waren.
Der Anspruch, das Gesamtgebiet der Behindertenpädagogik darzustellen, kann angesichts der Differenzierung und Spezialisierung der Einzelgebiete und ihrer schon je komplexen Wissensbestände nicht ohne Einschränkung vorgenommen werden. So ging es uns nicht darum, diese Komplexität aller Theorien, Methoden, Handlungsansätze und Einzelprobleme in Theorie und Praxis einzufangen, sondern den Wirklichkeits- als Gegenstandsbereich der wissenschaftlichen Behindertenpädagogik hinsichtlich seiner konstitutiven Begriffe, Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen. Dabei sollte der grundlegende, auf aktuellen Wissensbeständen beruhende und der zugleich erwartbar zukunftsträchtige nationale und internationale Forschungs- und Entwicklungstand im Sinne einer synthetischen Human- und Sozialwissenschaft berücksichtigt werden. Reflexives Wissen bereit zu stellen ist also die wesentliche Intention. Dies gelingt nur, wenn aus anderen Wissenschaften resultierende Forschungsstände und Erkenntnisse möglichst breit und grundlegend verfügbar gemacht werden. Aufgrund der komplexen biopsychosozialen Zusammenhänge sowohl von Behinderung als auch von Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation müssen das gesamte humanwissenschaftliche Spektrum Berücksichtigung finden und insbesondere Philosophie, Psychologie und Soziologie, aber auch Medizin und Neurowissenschaften einbezogen werden. Gerade der neurowissenschaftliche Bezug, der selbstverständlich äußerst kritisch betrachtet wird, ist notwendig, um gegen neue Formen der Biologisierung die entsprechenden Argumente für Vielfalt und Differenz auf jeder Wissenschaftsebene, also auch auf der neurowissenschaftlichen, in die Debatte führen zu können. Vorrangig mit Blick auf die disziplinäre Verortung ist jedoch die Erziehungswissenschaft, Behindertenpädagogik ist eines ihrer Teilgebiete.
Für die Konzeption ist ein Bildungsverständnis tragend, das Bildung als Möglichkeit zur selbst bestimmten Lebensführung, zur umfassenden Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlichen Teilhabe betrachtet; mit Wolfgang Klafki: Entwicklung der Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität, entwicklungspsychologisch mit Wolfgang Stegemann als Entwicklung auf höheres und auf höherem Niveau. Die erziehungswissenschaftliche Begründung von Bildungs- und Erziehungszielen muss über gesellschaftliche Erwartungen, wie sie sich in Forderungen nach einem Wissenskanon als Zurüstung auf die berufliche Eingliederung niederschlagen können, notwendigerweise hinausreichen und die Lebensbewältigung insgesamt umfassen. Bildung und Erziehung eröffnen Optionen für die Lebensgestaltung, und das bedeutet, die eigene Identität nicht nur schicksalhaft oder einzig von außen determiniert zu erleben, sondern auch über Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und der Auswahl von Handlungsmöglichkeiten zu verfügen, Zwänge und Grenzen ebenso wie Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten erkennen und nutzen zu können. Nicht in jedem Fall, in dem diese Möglichkeiten nicht per se aufscheinen, ist diese Problematik begrifflich quasi automatisch mit Behinderung zu fassen. Umgekehrt heißt Bildung aber auch, solche Strukturen und Prozesse zu gestalten, die „Bildung für alle, im Medium des Allgemeinen“, unabhängig von Kriterien, ermöglichen. Behinderungen im pädagogischen Sinn liegen dort vor, wo die Teilhabe an Bildung und Erziehung gefährdet oder erschwert ist oder wo Ausgrenzungsprozesse drohen oder erfolgt sind, und zwar aufgrund eines Wechselspiels individueller, sozialer und ökonomischer Bedingungen. Hier tritt die Frage der Ermöglichung von Partizipation in den Vordergrund. „Wo Menschen aus ihren Lebenszusammenhängen herausgestoßen werden, da wird lernender und wissender Umgang mit bedrohter und gebrochener Identität zur Lebensfrage“ (Oskar Negt) und ebenso die Ermöglichung von Lebenschancen. Damit werden zugleich eine Abgrenzung zu sozial- oder bildungsrechtlichen Definitionen und eine weite Begriffsbestimmung von Behinderung vorgenommen, im Bewusstsein der Problematik, die diese mit sich bringt. Doch fasst auch der schulrechtliche Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs, der wiederum nur partiell deckungsgleich mit dem sozialrechtlichen Behinderungsbegriff ist, äußerst heterogene, darunter auch rein sozial bedingte Benachteiligungsprozesse zusammen. Pädagogik heißt für uns somit auch nicht einseitige und ständige Förderung. Emil E. Kobi hat dies in der Gegenüberstellung einer ‚Pädagogik des Bewerkstelligens‘, der es immer um den Fortschritt geht, die sich nur auf den Defekt richtet und das So-Sein nicht anzuerkennen in der Lage ist, und einer ‚Pädagogik der Daseinsgestaltung‘ beschrieben, die anerkannte Lebensbedingungen zwischen gleichberechtigten und als gleichwertig anerkannten Subjekten und eine befriedigende Lebensführung auch bei fortbestehenden Beeinträchtigungen zu schaffen vermag. In diesem pädagogischen Verständnis von Behinderung liegt eine Begründung für die Beibehaltung des Begriffes der Behindertenpädagogik. Wir respektieren Benennungen wie Förder-, Rehabilitations-, Sonder-, Heil-, Integrations- und Inklusionspädagogik; der Begriff der Behinderung hebt jedoch wie kein anderer nicht nur die intransitive Sicht des behindert Seins, sondern auch die transitive Sicht des behindert Werdens hervor und lässt sich pädagogisch sinnvoll begründen. Ebenso entgeht er Verengungen mit Blick auf den Gegenstandsbereich; behindertenpädagogisches Handeln greift weit über den Bereich der institutionalisierten Erziehung und Bildung hinaus und findet lebensphasen- und lebensbereichsübergreifend statt; auch innerhalb des schulischen Bereiches ist das Handeln weitaus vielfältiger als allein unterrichtsbezogene Tätigkeiten; gleichwohl bleiben diese prominente Aufgaben. Behindertenpädagogik, in diesem weiten Sinne intransitiv verstanden, ist zwar einerseits Teilgebiet der Erziehungswissenschaft, andererseits trägt sie in transitiver Hinsicht zu deren Grundlagen bei. Denn behindert werden und eingeschränkt zu sein sind alltäglich und schlagen sich keineswegs nur in der sozialen Zuschreibung von Behinderung nieder. Entgegen der noch vorfindbaren Gliederung nach Arten von Beeinträchtigungen bzw. schulischen Förderschwerpunkten und einer institutionellen Orientierung ist für uns ein an den Lebenslagen und an der Lebenswirklichkeit der Adressaten von Bildungs- und Erziehungsangeboten orientiertes Verständnis pädagogischen Handelns leitend. Diese Perspektive auf den individuellen Bedarf an Unterstützung für eine möglichst selbst bestimmte Lebensführung ist der Bezugspunkt der personalen Orientierung, aber dieser Bedarf impliziert immer auch den Bedarf an Überwindung der sozialen Folgen, also der behindernden Bedingungen des Umfeldes. Traditionell wird der Lebenslauf- und Lebenslagenbezug der Pädagogik durch die Gegenstandsbezeichnungen der einzelnen Teildisziplinen angezeigt (Pädagogik, Andragogik, Geragogik einerseits; Sozial-, Berufs-, Freizeitpädagogik usw. andererseits). Hiermit können aber auch Abgrenzungen und Abschottungen einhergehen, so dass der Bezug zur Lebenslage als Ganzer und zum Lebenslauf in seiner biographischen Gewordenheit verloren geht. Lebenslagen- und Lebenslauforientierung stellen demgegenüber die notwendige Gesamtsicht her, die allerdings in ihrer Bezugnahme auf die Chancen und Grenzen selbstbestimmter Lebensführung einer Pädagogisierung im Sinne der andauernden intentionalen Erziehung entgehen muss. Sie hebt die spezifischen Gegenstandsbestimmungen und Handlungskonzepte der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen nicht auf, sondern wird als konzeptionelle und methodische Leitperspektive tragend. Ebenso hat jedes Verständnis von individueller Teilhabe- und Bildungsplanung die Deutungshoheit der auf Unterstützung und pädagogisches Handeln angewiesenen Menschen zu respektieren und zentral von politischer Mitwirkung und der Gewährleistung der Menschenund Bürgerrechte auszugehen. Dies verlangt die Demokratisierung und Humanisierung der Handlungsprozesse und Strukturen in Theorie und Praxis sowie die Auseinandersetzung mit Ethik, Moral und Professionalität.
Die aus diesem Verständnis von Bildung, Behinderung und Partizipation resultierenden Fragen lassen sich zusammenfassen in die nach dem Verhältnis von Ausschluss und Anerkennung, Vielfalt und Differenz, Individuum und Gesellschaft, Entwicklung und Sozialisation, System und Lebenswelt, Institution und Organisation, über die Lebensspanne hinweg und immer bezogen auf die Grundfrage nach Bildung und Partizipation angesichts behindernder Bedingungen.
Von diesen Grundgedanken ausgehend wurde die Konzeption und Anlage der Stichwörter von Iris Beck und Wolfgang Jantzen erarbeitet und dann durch das Team der Bandherausgeber kritisch überprüft und ergänzt. Es ergibt sich folgende Gesamtanlage: Die Bände 1 und 2 dienen der wissenschaftlichen Konstitutionsproblematik mit Blick auf die wissenschaftstheoretische Begründung des Fachs einschließlich der erziehungswissenschaftlichen Verortung und dem Verhältnis von Behinderung und Anerkennung. Die Bände 3 bis 6 repräsentieren Aufgaben und Probleme der Bildung und Erziehung im Lebenslauf mit den Kernfragen nach Bildung, Erziehung, Didaktik und Unterricht zum einen, Lebensbewältigung und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gemeinde zum anderen. Die Bände 7 bis 10 behandeln Entwicklung und Lernen, Sprache und Kommunikation, Sinne, Körper und Bewegung sowie Emotion und Persönlichkeit. Sie stellen grundlegende pädagogische Auseinandersetzungen über Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation angesichts behindernder und benachteiligender Bedingungen dar, und zwar in übergreifender Sicht, die zugleich die notwendigen speziellen und spezifischen Aspekte zur Geltung bringt. Allgemeines und Besonderes sind insgesamt, über alle Bände hinweg, vielfach aufeinander bezogen und haben gleichsam ihre Bewegung aneinander. Dort, wo sich gemeinsame Probleme quer zu speziellen Gebieten stellen, sind diese auch allgemein und mit der Absicht der Grundlegung behandelt, auch um Redundanzen zu vermeiden. Dort, wo ohne Spezifizierung zu grobe Verallgemeinerungen und damit unzulässige Reduktionen erfolgt wären, sind die Besonderheiten aufgenommen. Angesichts der zahlreichen Publikationen, die spezielle und spezifische Fragen en detail und mit Blick auf Einzelprobleme behandeln, ist diese Entscheidung auch vor dem Hintergrund einer ansonsten nicht zu gewährleistenden Systematik getroffen worden.
Wir sind uns bewusst, dass dieser Versuch der Systematik nicht ohne Lücken, Widersprüche und Redundanzen auskommt. Die allfällige Kritik hieran verstehen wir im Sinne des „Runden Tisches“, als den wir die Zusammenarbeit unter den Herausgebern und Autoren verstehen, als Motivation zu neuen Fragen und neuer Forschung.
Wir danken allen Bandherausgebern und Autoren für ihre konstruktive Arbeit, die in Zeiten der Arbeitsverdichtung und Effizienzsteigerung nicht mehr selbstverständlich erwartet werden kann.
Iris Beck
Georg Feuser
Wolfgang Jantzen
Peter Wachtel
Vorwort
Der vorliegende Band 10 des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik befasst sich mit der Thematik von Emotion und Persönlichkeit. Dies steckt ein weites humanwissenschaftliches Feld ab, dessen Bearbeitung vielschichtige interdisziplinäre und transdisziplinäre Verknüpfungen erfordert. In dreifacher Hinsicht ist der gesamte Bereich der Humanwissenschaften und deren Forschungs- und Erkenntnislage tangiert. Die Bearbeitung der mit den beiden zentralen Begriffen verbundenen Felder und Thematiken erfordert (1) integrative Forschungsansätze. Diese beziehen sich (2) auf das gesamte Feld der Zusammenhänge von Theoriebildung und Praxis, in deren Zentrum die Behindertenpädagogik steht. Und es sind (3) entsprechend der Vielschichtigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Einbettung des Menschen in den Kultur- und Sprachraum, in die je vorgefundenen gesellschaftlichen Verhältnisse zunehmend universelle, vereinheitlichende Denkprinzipien verlangt, d. h. eine systematische theoretische inter- und transdisziplinäre Weiterentwicklung.
Dies steht in ersichtlichem Widerspruch zu defektorientierten, biologistisch-psychiatrischen Normen und Zuschreibungen und Handlungsweisen. Immer noch werden derartig zugeschriebene Eigenschaften als inhärente Quellen eines abweichenden Verhaltens verstanden. Sie liefern auch heute noch zentrale Orientierungen in erheblichen Teilen der Heil- und Sonderpädagogik, wenn auch abgeschwächt und verbal neutralisiert.
Im Gegensatz dazu soll hier Behindertenpädagogik als synthetische Humanwissenschaft verstanden werden. Epistemologisch ist sie neben der Zentrierung auf Behinderung als sozialer Tatbestand (entsprechend der Behindertenrechtskonvention) zugleich auf eine außerhalb ihres unmittelbaren Bereichs erfolgende Forschungstätigkeit und Ergebnislage angewiesen, um der Falle einer essentialistischen Sichtweise von Behinderung zu entgehen. Dies erfordert eine grundlegende dialektische Orientierung in der gesamten Spanne der biologischen, psychologisch-pädagogischen und sozialen Wissenschaften.
Doch dieser Aspekt ist nicht nur theoretischer Natur. In Anbetracht der Abhängigkeit jeder menschlichen Existenz von einem permanenten Austausch mit der dinglichen und personalen Umwelt ist die Reflexion dieses Tatbestandes ein zentrales Moment jeglicher emanzipatorischer pädagogischen Praxis. Die Qualität dieser Praxis selbst wird zudem im (dialogischen, kommunikativ-kooperativen) Subjekt-Objekt/Subjekt-Verhältnis durch emotionale Nuancierungen des Erlebens widergespiegelt, die Teil der Reflexivität als solcher sind (Übertragung/Gegenübertragung). So zu denken, steht in Widerspruch zu einem cartesianischen Dualismus, der seinerseits die hier erforderlichen einheitlichen Denkprinzipien de principio negiert. Die strikte Trennung von Natur und Geist, ausgedehnter und erkennender Substanz, [→ I Leib-Seele-Problem] hat bis heute zu vielfältigen Belastungen wissenschaftlicher Erkenntnis geführt, die trotz vieler Bewältigungsversuche andauern. Die zeigt sich insbesondere in der Theorie der Emotionen, aber auch in der Theorie der Persönlichkeit. Je schwerer die Behinderung, desto häufiger wird einerseits zu bloßer Verhaltenstechnologie gegriffen, als ob die Genesis der Persönlichkeit durch Manipulation und nicht durch resonanzförmige Bindungsprozesse befördert würde und Emotionen und Erleben erst eine späte Zutat der Entwicklung seien. Auf der anderen Seite gilt in großen Teilen des Faches eine solide Befassung mit neurowissenschaftlichen Grundlagen nach wie vor als obsolet. (Dies gilt im Übrigen auch für die Befassung mit kritischer sozialwissenschaftlicher Theorie.) Und genau solche Prozesse verunmöglichen es trotz prinzipieller Anerkennung von Autonomie, Erlebensfähigkeit, Emotionalität nur allzu oft Spuren der Entwicklung auch bei schwerer Behinderung nachzuspüren: nicht in Form von Biologisierung, sondern in Form von Rehistorisierung und Syndromanalyse. [→ III Rehistorisierende Diagnostik]
Derartige Negationen führen zurück in die der traditionellen Heil- und Sonderpädagogik eigenen Denkstile, am naturalistischen ebenso wie am spiritualistischen Pol. Im Gegensatz hierzu ist ‚Behindertenpädagogik‘ als synthetische Humanwissenschaft eher als ein postcartesianischer, spinozanischer Zugang zu den mit dem Begriff der ‚Behinderung‘ etikettierten Dimensionen menschlicher Persönlichkeitsentwicklung zu begreifen (insbesondere in der Psychoanalyse, in der kulturhistorischen und Tätigkeitstheorie und in der Phänomenologie, aber keineswegs nur dort). Dieser Sachverhalt wurde im Fach selbst noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen. An die Stelle notwendig erweiterter Reflexion treten nur allzu oft unreflektierter Empirismus und technologiebezogener Praktizismus.
Der vorliegende Band fokussiert mit den Begriffen von Emotion und Persönlichkeit erkenntnistheoretisch fundierte Zugänge zu Fragen basaler psychischer Strukturen und Funktionen des Menschen: von einfachsten Formen psychischen Erlebens bis hin zur komplexen Persönlichkeit, ihrer Wahrnehmung der Welt, ihres Denkens und Handelns. Emanzipatorische Praxis im realen Umgang mit realen Menschen verlangt zwingend, deren Lern- und Entwicklungsgeschichte ebenso wie ihre aktuelle Daseinsweise zu begreifen, diese Geschichte angemessen analysieren zu können, die Menschen als Personen in der je konkreten sozialen Entwicklungssituation anzuerkennen und zu respektieren, um auf dieser Basis die Bedingungen der Möglichkeit von Veränderung zu schaffen. Eine solche zielt, entsprechend der Behindertenrechtskonvention, auf die Herausbildung eines Sinns der eigenen Würde und der sozialen Zugehörigkeit. Nur auf dieser Basis ist eine zukunftsorientierte Entwicklung der Persönlichkeit in außerinstitutionellen und institutionellen Zusammenhängen denkbar – insbesondere bezogen auf Fragen von psychischer Gesundheit und Bildung.
Affekte und Emotionen sind die je konkrete Beurteilungsbasis zwischen der subjektiven Bedürfnis- und Motivationslage einerseits, bezogen auf die Möglichkeiten der eigenen Handlungsfähigkeit innerhalb der gegebenen Umfeldbedingungen andererseits. Sie sind nicht nur von grundlegender Bedeutung, um die eigenen Bedürfnisse befriedigen und Ziele motivationsadäquat realisieren zu können. Darüber hinaus sind sie soziale Attraktoren, die durch strukturelle, dialogische Koppelung an andere Menschen Resonanz geben und intersubjektiv Resonanz vermitteln. Sie sind Grundlage der Selbststrukturierung des ‚psychischen Systems‘ in der Entwicklung des Erlebens und dessen funktionaler Austauschverhältnisse im ‚sozialen System‘ seiner auf Sinn und emotionale Resonanz verwiesenen Welt-Mensch-Beziehungen – für die gesamte Lebensspanne. Zu erkennen sind drei große Dimensionen dieses Zusammenhangs:
Im Gesamt des Bedingungsgefüges der Persönlichkeitsentwicklung konturieren sich Emotionen intrauterin schon wenige Lebenswochen nach der Zeugung und in der extrauterinen Lebensphase in besonderer Weise durch die Art, den Umfang, die Dauer und Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen, an die sie gebunden sind und durch die sie vermittelt werden.
So sind erstens Bindung und Dialog und die ihrerseits an die Emotionen gekoppelten Prozesse der Sinnbildung tragende Komponenten der Persönlichkeitsentwicklung. Sinn wäre zu verstehen als die emotionale, motivationale, persönliche und soziale Hülle, die in der Form des sozialen Sinns von Berger und Luckmann als das ‚schützende Dach über unseren Köpfen‘ verstanden wird. Sinn entsteht durch das Leben und bedarf der Bedeutungen, um sich auszudrücken, so Alexej N. Leont’ev. Sinnbildung verlangt nach Aneignung und schöpferischem Aufbau von individuellen, subjektiven Bedeutungen in Auseinandersetzung mit den in der Welt vorhandenen kulturellen, sozial-historischen Bedeutungen. Diese Dialektik des sinn- und systemhaften Aufbaus der psychischen Prozesse verweist auf die Dimensionen des Verhältnisses von Lernen und Entwicklung, wie sie im Band 7 dieses Handbuches untersucht werden, zu welchem dieser Band 10 in einem besonderen Verhältnis dialektischer Spannung steht (und darüber hinaus vor allem auch mit Bildung und Erziehung [Band 3] sowie Didaktik und Unterricht [Band 4]). Das Grundverhältnis von Bindung und Dialog verantwortet aber auch weitgehend das Verhältnis von Resilienz und Vulnerabilität, dessen Reflexion zu den Standards pädagogischer und therapeutischer Arbeitsverhältnisse gehört, vor allem dann, wenn spezifische therapeutische Interventionen erforderlich sind.
Zweitens entwickelt dieser Band das Verhältnis von Isolation und Entwicklungspsychopathologie. Hier bricht das Verhältnis von Normalität und Abweichung auf, stellt sich die Frage nach einem angemessenen Verständnis tiefgreifender Entwicklungsstörungen, nach dem Verhältnis von Stress und Stressbewältigung, aber auch von als auto-kompensatorisch zu begreifenden Handlungen in der Spanne von Stereotypien, selbstverletzenden, destruktiven und aggressiven bzw. auch als kriminell zu wertenden Handlungen. Ein ebenso allgemeiner wie zugleich höchst differentiell zu betrachtender Hintergrund sind Traumatisierungen, was zugleich die Frage nach entwicklungsadäquaten und/oder pathologischen Dissoziationen aufwirft. Pathologisch in dem Sinne, dass sie die Individuen in die Falle sozialer Exklusion führen. Vor allem kompensatorisch herausfordernde Handlungsweisen und Schulverweigerung kennzeichnen Einschnitte in die Bildungslaufbahn und führen möglicherweise auf Gleise der Psychiatrisierung. Der zentrale Begriff, der dieses Driften einer Persönlichkeitsentwicklung als Bedingung der Realisierung von Beziehungs- und Bindungsphänomenen und des Dialogs zu beschreiben vermag, ist der von Jantzen in den 1970er Jahren im Kontext der Konzeption der ‚Behindertenpädagogik‘ in das Fach eingeführte Begriff der Isolation.
Ist aber schließlich drittens, wie Spitz es einmal formuliert, der Dialog entgleist, stehen nicht nur Fragen der Krisenintervention an. Das gesamte System institutioneller Gesundheits-, Bildungs- und Integrations- bzw. Inklusionsmaßnahmen wäre zu hinterfragen auf Grundlage seiner notwendigen Umgestaltung. Im Zentrum hätte eine der individuellen Biographie gerecht werdende Zusammenarbeit von Professionellen und Klienten zu stehen – ohne Ausgrenzung der Betroffenen aus ihren regulären Lebens- und Bildungsbezügen oder der Rückkehr in institutionell verwahrende Einrichtungen, seien es Heime, Psychiatrien oder Anstalten. Entsprechend sind reformpädagogische Konzeptionen ebenso wie psychoanalytische Ansätze, aber auch systemische und verhaltenstherapeutische Konzeptionen im Kontext professionellen Handelns – in der Spanne von Erziehungsberatung bis hin zur Heimerziehung – kritisch zu gewichten, neu zu konzeptionieren und in Arbeitsbündnissen in anerkennungsbasierter Gleichberechtigung umzusetzen. Dies verlangt, vor allem in der unmittelbaren Begegnung auch das Verhältnis von Übertragung und Gegenübertragung zu berücksichtigen, ebenso wie die prekären, oft mit Gewalt gegen die Betroffenen verbundenen Lebenssituationen, ihre Unterdrückung und ihre Exklusion, ihre Entbindung aus dem Dialog kritisch zu analysieren und konzeptionell zu fokussieren.
Die Hauptstichwörter dieses Bandes umspannen den großen Rahmen der hier skizzierten Problemstellungen. Die mittleren Stichwörter thematisieren einzelne Dimensionen derselben, und die kleinen Stichwörter konstituieren in besonderer Weise den Zusammenhang von Theoriebildung und Praxis in einem komplexen Feld.
Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes haben sich der schwierigen Aufgabe einer theorie- und erkenntnisgeleiteten Bearbeitung vieler Bereiche des thematischen Rahmens gestellt. Ihnen gilt der Dank der Herausgeber dieses Bandes, verbunden mit dem Wunsch, dass dieser, nun die Reihe des Enzyklopädischen Handbuchs der Behindertenpädagogik abschließende, Band eine zahlreiche, kritisch-analysierende und reflexive Leserschaft findet.
Georg Feuser
Birgit Herz
Wolfgang Jantzen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Gesamtherausgeber
Vorwort
Teil I Grundlegung
Emotion und Persönlichkeit
(Birgit Herz)
Isolation und Entwicklungspsychopathologie
(Wolfgang Jantzen & Dagmar Meyer)
Bindung und Dialog
(Georg Feuser & Wolfgang Jantzen)
Autismus
(Georg Feuser)
Teil II Zentrale Fragestellungen
Sinn- und systemhafter Aufbau der psychischen Prozesse
(Manfred Jödecke)
Person und Persönlichkeit
(Michael Fingerle & Peter Heinrich)
Persönlichkeit und sozialer Sinn
(Wolfgang Jantzen)
Psychische Gesundheit und Resilienz
(Günther Opp)
Normalität und Abweichung
(Birgit Herz)
Übertragung/Gegenübertragung und die gesellschaftliche Institution der ‚Verhaltensstörung‘
(Manfred Gerspach)
Traumatisierung
(Birgit Herz)
Aggression und Vernunft
(Willehad Lanwer)
Die Inklusion herausfordernder Kinder: Eine Angelegenheit sozialer Gerechtigkeit
(John Visser)
Teil III Einzelprobleme
Neuropsychologie der Persönlichkeit
(Wolfgang Jantzen)
Gefühle und persönlicher Sinn
(Martin Herz)
Dissoziation
(Wolfgang Jantzen)
Stress und Stressbewältigung
(Olav von dem Knesebeck)
Herausfordernde Handlungsweisen
(Norbert Störmer)
Neuropsychologie der Gewalt
(Daniel Strüber)
Selbstverletzungen
(Willehad Lanwer)
Symbiose/Symbiotische Beziehungen
(Ann-Kathrin Godt)
Sucht
(Heino Stöver)
Kriminalität/Delinquenz, Devianz
(Joachim Walter)
Soziale Ungleichheit und Gesundheit
(Wolfgang Hien)
Schulverweigerung
(Birgit Herz)
Demenz
(Barbara Romero)
Kinder- und Jugendpsychiatrie
(Ernst Berger)
Psychiatrische Nosologie
(Ernst Berger)
Psychiatrie und Bevölkerungspolitik
(Ernst Berger)
Transkulturelle Psychiatrie – zur psychischen Problematik von Migrantenkindern
(Hubertus Adam)
Reformpsychiatrie und Institutionskritik
(Lorenzo Toresini)
Grenzmanagements in Psychiatrie, Jugendhilfe, Behindertenhilfe
(Ulrich Rüth)
Psychosen
(Andreas Hilbrecht)
Psychoanalytische Pädagogik bei abweichendem Verhalten
(Wilfried Datler & Michael Wininger)
Reformpädagogische Konzeptionen
(Harald Eichelberger)
Pädagogik der Unterdrückten
(Fernanda Liberali & Elaine Mateus)
Heimerziehung
(Jürgen Blandow)
Erziehungsberatung
(Wilfried Datler & Johannes Gstach)
Systemische Therapie(n)
(Winfried Palmowski)
Verhaltenstherapeutische Konzeptionen
(Franz Petermann)
Krisenintervention
(Lorenzo Toresini)
Netzwerkbildung und Kooperation
(Norbert Störmer)
Professionelles Handeln
(Andrea Dlugosch)
Stichwortverzeichnis
Die Autoren
Teil I Grundlegung
Emotion und Persönlichkeit
Birgit Herz
1 Definitionen
Der Begriff Emotion setzt sich aus den beiden lateinischen Worten ex (heraus) und motio (Bewegung, Erregung) zusammen. Eine Auseinandersetzung mit Emotionen finden wir bereits im Altertum. Für Epikur (341–270 v. Chr.) war z. B. Lust bzw. Freude/Vergnügen ein zentrales Element des Fühlens. Agnes Heller, eine Soziologin und Philosophin, schreibt in ihrer ‚Theorie der Gefühle‘, dass in der Antike das Gefühl primär als ein moralisches Problem gesehen wurde, d. h. die Gefühle wurden immer der Analyse der Tugenden untergeordnet. Im Mittelalter entwickelte sich der Dualismus von Leib und Seele (Geist) (Heller 1980, 11). „In der Antike und im Mittelalter sprach man von ‚Gemütsbewegungen‘ und ‚Gemütszuständen‘“ (Hermsen 1990, 665). In der höfischen Kultur des Mittelalters zeigt sich eine zunehmende Kontrolle und Verregelung von Affekten und Gefühlen (Althoff 2000). Schon im 17. Jahrhundert gab es Versuche einer Klassifikation für „eine Grammatik der Leidenschaften“ (Röcke 2000, 112 f.). Bis ins 20. Jahrhundert prägend war der Dualismus von René Descartes (1596–1650) zwischen Denken und Fühlen. Turner & Stets schreiben: „Historically, in Western thought, emotion and reason were considered opposing forces with emotion and irrationality at the one pole and cognition and rationality at the other pole“ (2005, 21).
Obwohl bereits Baruch Spinoza (1632–1672) in seiner ‚Ethik‘ die besondere Bedeutung der Gefühle für Denken schlechthin herausgearbeitet hatte, wurde seine Position in der damals vorherrschenden Gelehrtenkultur weitgehend ignoriert. Diese Ignoranz war maßgeblich dem klerikalen Druck geschuldet. In diesem Zusammenhang sei auf die Studie des Kulturwissenschaftlers Hartmut Böhme verwiesen, der die Bedeutung von Himmel und Hölle als Gefühlsraum sowie die kirchliche Deutungsmacht über Emotionen analysierte (2000, 60 ff.). ‚Gefühlsverwaltung‘ erreichte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert. In der gleichen Zeit erlangte das Theater als öffentlicher Ort für die Alphabetisierung der Gefühle – und insbesondere der Leidenschaften – eine hohe Bedeutung (Schmitz 2000). Im 19. Jahrhundert beherrschte die bürgerliche Gesellschaft das Ideal der romantischen Liebe: „Love became a virtually religious ideal, involving self-abnegation and worshipful devotion to the other […]. Jealousy was redefined in this process as a largely female emotion and a contradiction of proper selflessness in love; […] Grief gained new attention and vast new symbolic expression in Victorian funeral practices […]“ (Stearns 2004, 22). Stearns argumentiert, dass Neid als eine der dominanten Emotionen im 19. Jahrhundert eng im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Konsumkultur im aufstrebenden Kapitalismus stand (a. a. O., 23).
Mit der Etablierung der Psychologie als Fachwissenschaft am Ausgang des 19. Jahrhunderts erhielt die Erforschung der Gefühle und Emotionen eine neue Wende. Der Psychologe Wilhelm Wundt (1832–1920) stellte in seinem ‚Grundriss der Psychologie‘ (zuerst 1896 erschienen) eine erste Systematik der Gefühle dar. Für ihn existieren „die reinen Empfindungen“, die „einfachen Gefühle“, die „zusammengesetzten Gefühle“ und die „Affekte“. In Amerika beeinflussten die Arbeiten des Psychologen und Philosophen William James (1842–1910) die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gefühlen. Er stellte 1884 in der Fachzeitschrift Mind als Erster die Frage: „What is an Emotion?“. Erst die Psychoanalyse war jedoch in der Lage, die Bedeutung der kindlichen Entwicklung für Emotionen und Gefühle präzise herauszuarbeiten. Sigmund Freuds (1856–1939) Schriften beeinflussten maßgeblich die Mitte des 20. Jahrhunderts von England ausgehende Bindungsforschung. [→ Bindung und Dialog; VII Bindung und Sicherheit] „Sigmund Freud war von allen neueren Denkern sicherlich derjenige, der die Gefühle am meisten ernst genommen hat“ (Bundschuh 2003, 48). Die zeitgenössische amerikanische Philosophin Martha C. Nussbaum schreibt in Upheavels of thought: the intelligence of emotion: Die Gefühle von Erwachsenen können nicht verstanden werden, ohne ihre Geschichte in der Kindheit zu verstehen (2001, 178; eigene Übersetzung). [→ I Psychoanalyse]
Die zunehmende Bedeutung, die der Forschung über Gefühle beigemessen wurde, wird auch an der Thematik folgender internationaler Tagungen deutlich: 1927 fand an der Universität Massachusetts das Wittenberg Symposium statt, 1948 wurde an der Universität Chicago das Moosheart Symposium über Feelings and Emotions ausgerichtet, 1969 ebendort das Loyla Symposium über Feelings and Emotions, und 2001 organisierte die Universität Amsterdam das Amsterdam Symposium über Feelings and Emotions (Manstead et al. 2004a, b).
„The importance of managing emotions through talking out rather than active expression has become a dominant theme […]“ (Stearns 2004, 29). Zum beherrschenden öffentlichen Diskurs wurden Emotionen insbesondere durch den Psychoboom der 1970er Jahre; er erschien als eine hoffnungsvolle individuelle Alternative, die politische Emanzipation und Autonomie im Privatleben zu verwirklichen (Warzecha 1997).
Hinter dem Begriff Emotion verbergen sich so viele verschiedene Themen, wie es Autoren gibt, stellt Wollheim fest (Wollheim 2001, 13). „In den philosophischen und fachwissenschaftlichen Publikationen finden erhebliche Auseinandersetzungen darüber statt, eine allgemein anerkannte Definition von ‚E.‘ [Emotionen; B. H.] zu finden“ (Hermsen 1990, 662). Emotionen sind Widerspiegelungen der objektiven Realität an der subjektiven Befindlichkeit (a. a. O., 674). Emotionen haben folgende Funktionen:
• bedürfnis- und situationsgerechte Auswahl von Verhaltensweisen,
• Regulierung der Intensität und Ausdauer verschiedener Verhaltensweisen und
• Lernen und Abspeichern solcher Verhaltensweisen, die unter bestimmten situativen Umständen erfolgreich waren, und solcher, die zu Misserfolg führten (Schneider 1992).
Jon Elster, Soziologe an der Columbia Universität, beschreibt fünf Elemente, die eine Emotion kennzeichnen:
1. Physiologische Erregung
2. Psychologischer Ausdruck
3. Kognitive Vorwegnahme
4. Intentionales Objekt
5. Handlungstendenzen, beispielsweise bei Scham in den Boden versinken oder bei Furcht Mobilisierung von Flucht und Kampfbereitschaft (vgl. 2004, 38).
Die physiologische Erregung aktiviert das sympathische Nervensystem, d. h. es kommt zu
• einem Anstieg des Blutdrucks und der Pulsfrequenz,
• einer Beschleunigung der Atmung,
• Pupillenerweiterung,
• verstärkter Transpiration bei gleichzeitig versiegender Sekretion von Speichel und Schleim,
• einem Anstieg des Blutzuckerspiegels, um mehr Energie bereit zu halten.
• Des Weiteren gerinnt im Falle einer Verletzung das Blut schneller,
• wird das Blut aus dem Magen und den Eingeweiden in das Gehirn und die Skelettmuskulatur umgeleitet,
• sträuben sich die Körperhaare (Gänsehaut) (Grabowski & van der Meer 2001, 183 f.).
Emotionen sind psychische Zustände (Gefühle); in der Forschung besteht weitgehend Konsens darüber, dass Furcht, Traurigkeit, Ärger und Freude zu den universellen Emotionen zählen (Turner & Stets 2005).
Gefühle bezeichnen das subjektive Erleben der Emotion; sie werden sozial und kulturell geprägt. „[…] Emotions are socially constructed in the sense that what people feel is conditioned by socialisation into culture and by participation in social structures“ (a. a. O., 2). Ohne Gefühle gibt es keine Bewertung einer Situation. „Gefühle sind nicht kognitivistisch zu reduzieren (etwa auf Verstandesdeutungen körperlicher Erregungszustände), sondern sind eigenständige Verarbeitungsformen der sozialen Wahrnehmung, zugleich aber mit der Verstandestätigkeit derart verflochten, dass Gefühle ohne Vernunft (Intentionalität, Analysieren, Schlussfolgern) unmöglich sind, wie Vernunft ohne Gefühle (Wertungen, Entscheidungen)“ (Schmidt Noerr 2003, 48).
Affekte sind die in Handlung übersetzten Emotionen. „Der Begriff ‚Affekt‘ betont das Reflexhafte, Unkontrollierbare der Emotion, wenn eine Person von einer Emotion überwältigt wird“ (Wertfein 2006, 19; siehe hierzu auch Schimmack & Crites 2006).
Stimmungen unterscheiden sich hiervon durch eine geringere Intensität, aber länger anhaltende Gefühlselemente. Frijda (1993) differenziert Gefühle und Stimmungen folgendermaßen: „[…] emotions are object-related, intentional states, whereas moods do not have an object“ (zit. n. Schimmack & Crites 2005, 401). „Moods are not characterized by distinct facial expressions and moods are not linked to appraisal dimension“ (Ekmann & Davidson 1994, zit. n. Schimmack & Crites 2005, 404). Stimmungen beschreiben eher länger andauernde Zustände, die nicht zwingend eine Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis darstellen, sondern beispielsweise durch wiederkehrende Gefühle oder Gedanken hervorgerufen werden (siehe Wertfein 2006, 19).
Der Begriff Person gründet auf dem lateinischen Wort persona und bedeutet soviel wie Rolle, Maske, Charakter. Umgangssprachlich bezeichnet Persönlichkeit ein Individuum, „[…] das aus dem Alltäglichen durch seine gesellschaftliche Bedeutung oder Originalität herausragt“ (Sève 1990, 651). Die Persönlichkeit des Menschen umfasst ein individuelles Gesamtsystem aus Fühlen, Denken und Verhalten. Dieses Gesamtsystem entwickelt sich im Kontext der vorherrschenden kulturellen, sozialen und ökonomischen Determinanten. „Die Basis der Persönlichkeit ist die Gesamtstruktur ihrer Aktivitäten, in der sich das Wesen der existierenden gesellschaftlichen Struktur bricht und deren relative Stabilität die Widersprüche, Krisen und Veränderungen einschließt“ (Sève 1990, 654 f.). Klaus Bruder schreibt: „Das antike Konzept der persona mit dem der Einzelexistenz Rechnung getragen wurde, war gebunden an den gesellschaftlichen Status, der wiederum bestimmte gesellschaftliche Verpflichtungen beinhaltete. […] Das Christentum stattete diese moralische persona mit zusätzlichen metaphysischen Attributen aus: mit einer unsterblichen Seele, deren Wohlbefinden vom Verhalten des Handelnden abhängig gedacht wurde. Erst im Gefolge der Reformation wurde diese Form der Individuation ausdrücklich mit einem Gewissen verbunden und wurde Selbstbewusstsein zum Grund der moralischen Existenz des Individuums, eng verbunden mit einer unmittelbaren Beziehung zu Gott – eine Beziehung, die auf das Gebet als einen Dialog gegründet war, sowie auf die Introspektion und Erforschung des Gewissens“ (1993, 38 f.).
Heute wird Persönlichkeit grundsätzlich als eine Einheit verstanden, wobei Einheit eher als Prozess denn als Zustand aufgefasst wird (Kegan 1994, 24). Persönlichkeit ist ein Charakteristikum des Menschen, das eng mit den Emotionen verknüpft ist, die wiederum durch Umweltdeterminanten bestimmt werden. Nach Jantzen (1992) widerspiegelt die Persönlichkeit die objektiv-reale, d. h. gesellschaftliche Welt auf menschlichem Niveau. [→ Person und Persönlichkeit; Persönlichkeit und sozialer Sinn]
2 Theoriegeschichte, Probleme, Ergebnisse
2.1 Persönlichkeitstheorien
Insbesondere die Psychologie hat eine große Bandbreite an Persönlichkeitstheorien entwickelt. Mroczek und Little schreiben in ihrer Einleitung des 2006 publizierten ‚Handbook for Personality Development‘, dass mit den Forschungsarbeiten Sigmund Freuds Persönlichkeitsentwicklung auf die empirische Forschungsagenda gesetzt wurde (3). Bis heute bleibt die psychoanalytische Darstellung der Persönlichkeit die umfassendste und einflussreichste Persönlichkeitstheorie, die jemals entwickelt wurde (vgl. Grabowski & van der Meer 2001, 445). „Freud was the first to theorize on how personality developed over time, and during the early decades of the 20th century his view was the only game in town“ (Mroczek & Little 2006, 3).
Die psychoanalytische Theorie misst der Rolle der frühen Lebensereignisse für die Persönlichkeitsentwicklung eine enorme Bedeutung zu. Aus ihrer Sicht ist vieles im Erwachsenenleben eine Wiederholung von Themen früher Entwicklungsphasen (vgl. Pervien et al. 2005, 150). [→ I Psychoanalyse] Um zu einem naturwissenschaftlich begründeten empirischen Verständnis des Unbewussten zu gelangen, wurden projektive Persönlichkeitstests entwickelt, z. B. der Rorschach-Test und der Thematische Apperzeptionstest. Hermann Rorschach, ein Schweizer Psychiater, experimentierte mit Tintenklecksen bei verschiedenen psychiatrischen Gruppen und kam so zu einer Testbatterie mit zehn Karten. Die Probanden sollen im Testverfahren berichten, was sie auf den Karten sehen. Die inhaltliche Auswertung soll Hypothesen über die Persönlichkeit erlauben. Der thematische Apperzeptionstest der amerikanischen Psychoanalytiker Henry Murray und Christina Morgan besteht aus Bildtafeln, zu denen Probanden eine Geschichte erzählen. Ziel ist die Aufdeckung unbewusster Lebensthemen.
Phänomenologische Persönlichkeitstheorien betonen den Prozesscharakter der Persönlichkeitsentwicklung, weil sich Persönlichkeitsstrukturen im Laufe des Lebens ständig verändern können. Zentraler Vertreter dieses Persönlichkeitsmodells ist der Begründer der klientenzentrierten Psychotherapie, Carl Rogers (1902–1987). Bei ihm steht das Selbst des Menschen im Mittelpunkt. Indem das Individuum äußere Objekte und Erfahrungen wahrnimmt und ihnen eine Bedeutung zumisst, entsteht ein phänomenales Feld; die Teile des phänomenalen Feldes, die vom Individuum als ‚selbst‘, ‚mein‘ oder ‚ich‘ gesehen werden, stellen das Selbst dar (vgl. Pervien et al. 2005, 220ff.). Rogers betont, dass grundsätzlich jedes Individuum über Wachstumskräfte verfügt, so dass die Therapie deren Selbstaktualisierung zu unterstützen habe.
Die Theorie der Persönlichkeitswesenszüge (traits) wurde von Gordon W. Allport (1897–1967) und Hans Eysenck (1916–1997) entwickelt. Als Persönlichkeitspsychologen vertraten sie die Notwendigkeit präziser Mess- und Untersuchungsverfahren und begründeten die statistische Technik der Faktorenanalyse. Die streng empirisch ausgerichtete Psychologie argumentierte mit den Vorteilen des Faktorenkonzepts, es sei präzise hinsichtlich der Begriffe, die Messmethoden seien exakt und die daraus gewonnenen Persönlichkeitsmodelle eindeutig (Roth 1977, 67). Ziel dieser Persönlichkeitsforschung war die Entwicklung einer Theorie, die es ermöglichen sollte, Bedingungen individuellen Verhaltens aufzuweisen, Unterschiede zwischen den Individuen festzustellen und mögliche Prognosen in Bezug auf zukünftiges Verhalten aufzustellen (Lüttge 1977, 115 f.). Wesenszüge wurden als grundlegende Einheiten der Persönlichkeit definiert, die sich in objektiven Datenerhebungen miteinander vergleichen ließen. Für diesen Ansatz wurden verschiedene Persönlichkeitsfragebögen entwickelt, bspw. das Eysenck-Persönlichkeitsinventar, der Eysenck-Persönlichkeitsfragebogen u. a. (Pervien et al. 2005, 287 ff.). Nach Eysencks drei Faktorentheorien konstituieren drei Wesenszüge die Persönlichkeit: Psychotizismus, Extraversion und Neurotizismus.
Raymund D. Cattel (1905–1998) nutzte diese faktorenanalytische Technik, um seine hierarchische Theorie über den Aufbau der Persönlichkeit zu entwickeln. Er differenziert nach Fähigkeitswesenszügen, Temperamentswesenszügen und dynamischen Wesenszügen. Sein 16 Personality Factor-Inventory (16 P. F. Questionaire) sollte intra- und inter-individuelle Unterschiede von Wesenszügen erfassen (Pervien et al. 2005, 308 ff.). Die klinische Psychologie setzt diese testgestützte Persönlichkeitsdiagnostik für die Organisationsentwicklung, als Eignungsdiagnostik zur Personalauswahl, aber auch zur Feststellung von Persönlichkeitsstörungen ein. Mit Nissen ist jedoch kritisch festzuhalten, dass solcherart diagnostische Persönlichkeitsstörungen nur im Kontext einer Durchschnittsnorm erhoben werden können (2002, 83; Streeck 2005).
Nach dem Fünf-Faktoren-Modell – auch Big-Five-Modell genannt – von Robert R. McCrae und Paul T. Costa jun. besteht die Persönlichkeit des Menschen aus fünf Wesenszügen/Faktoren: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Liebenswürdigkeit, Gewissenhaftigkeit. Die beiden klinischen Psychologen behaupten, „dass die Faktoren eine biologische Grundlage haben. […] Bei der Entwicklung dieses Modells waren McCrae und Costa in der Tat der Meinung, dass die biologische Grundlage der Faktoren so stark sei, dass die grundlegenden fünf neigungsspezifischen Dispositionen nicht direkt durch die Umwelt beeinflusst werden. […] Sie behaupteten mit großem Nachdruck, dass die geerbte Biologie (Anlage) die Persönlichkeit bestimme und weniger die sozialen Umwelterfahrungen“ (Pervien et al. 2005, 334). Aus Sicht dieser empirisch-naturwissenschaftlich konservativen Persönlichkeitspsychologie können die ‚Big Five‘ als universales Modell der Persönlichkeit aufgefasst werden (Backhaus 2004, 8). Kulturübergreifende Studien betonen jedoch die Fragwürdigkeit dieser Position und kritisieren die Dominanz der englischen Sprache und den damit implizit transportierten westlichen dominanzkulturellen Habitus sowie das biologistische und deterministische Menschenbild (McAdams & Adler 2005).
Der Behaviorismus beinhaltet lerntheoretische Ansätze zur Erklärung von Persönlichkeit. Zentrale Grundannahmen sind dabei, Verhalten vor dem Hintergrund von Umwelteinflüssen zu erklären und ein Verständnis von Menschen mit objektiver wissenschaftlicher Forschung zu begründen, wie z. B. in sorgfältig kontrollierten Experimenten im Labor. „Alles Verhalten, auch das komplexeste, soll verstehbar werden als Reaktion auf Reize, bzw. Reizsituationen“ (Roth 1977, 49). Ivan P. Pawlow (1849–1936) entdeckte die klassische Konditionierung. Hier ist ein ursprünglich neutraler Reiz imstande, eine Reaktion auszulösen, weil er mit einem Reiz assoziiert wird, der automatisch eben diese oder ähnliche Reaktionen hervorruft (Pervien et al. 2005, 439 f.). John D. Watson (1878–1958) griff auf diese Grundlagentheorie Pawlows zurück; er gilt als Begründer des Behaviorismus. Das operante Konditionieren wurde von Burrhus F. Skinner (1904–1994) erforscht. Belohnung oder Bestrafung durch die Umwelt erlauben eine Steuerung des Verhaltens. Dieser lerntheoretische Ansatz begründete sich überwiegend durch eine intensive Laborforschung mit Tieren; dies führte u. a. zu einer übermäßigen Vereinfachung der Persönlichkeitstheorie.
Die sozial-kognitive Persönlichkeitstheorie beinhaltet, dass die Persönlichkeitsentwicklung durch Modell- und Beobachtungslernen bestimmt wird. Nach Albert Bandura hat der Mensch die Fähigkeit, sich Zeit seines Lebens zu entwickeln (Pervien et al. 2005, 515 ff.).
Robert Kegan entwickelte ein Persönlichkeitsmodell auf der Grundlage von Piagets Entwicklungspsychologie unddes Konstruktivismus (1994). Die konstruktivistische Perspektive geht davon aus, dass Personen oder Systeme die Realität als Prozess konstruieren. Insofern ist die Persönlichkeit eines Menschen nicht statisch, sondern dynamisch – seine Psychologik verändert sich (a. a. O., 157). [→ II Person/Persönlichkeit; VII Piagets Theorie der Entwicklung geistiger Operationen]
Seit Sigmund Freud und bis heute haben Psychologen versucht, die menschliche Persönlichkeit zu erforschen und zu untersuchen; sie haben Tests und Theorien entwickelt, um zu zeigen, wie jeder Einzelne Ähnlichkeiten oder Unterschiede aufweist. „With their focus on individual differences, personality psychologists have traditionally sought to spell out how individuals are similar to and different from some other individuals and how they are also unique“ (McAdams & Adler 2006, 470).
In den früheren Persönlichkeitstheorien wurde nicht berücksichtigt, dass der Forscher selbst kultur- und gesellschaftsabhängig seinen Forschungsgegenstand konstruiert. So kritisieren z. B. McAdams & Adler die Persönlichkeitstheorie der Wesenszüge und die Dominanz der faktorenanalytischen Untersuchungen. Sie schreiben: „Trait attributions were little better than stereotyping labels, misleading fictions in the minds of observers, and/or trivial artefacts of the structure of language“ (2006, 472). Auch würden Untersuchungen meist mit westlichen Probanden durchgeführt (McCrae & Costa 2006, 140). Ein weiterer Kritikpunkt an der an den Naturwissenschaften orientierten Persönlichkeitspsychologie ist das Ausblenden gesellschaftlicher Machtstrukturen. „Die Methoden der ‚exakten‘ Naturwissenschaften, die Messung, das Experiment, versprachen diese Entpolitisierung. Nur was im Rahmen experimenteller Vorkehrungen, isoliert vom sozialen, historischen (und damit politischen Kontext) insofern ‚objektiv‘ zu beobachten war, wurde als ‚Daten‘ der Wissenschaft zugelassen. Die Wissenschaft sollte durch Experiment und Statistik die ‚phänomenale‘ Welt reduzieren auf die ‚Prinzipien‘ von ‚Ordnung‘, ‚Gesetz‘, ‚Vorhersagbarkeit‘“ (Bruder 1993, 75).
Überblickt man das weitere Feld der gegenwärtigen Forschung über Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, so lässt sich zunächst mit Mrozek und Little feststellen: „[…] it is clear, that throughout the development of personality, the person is an active agent. The person does not simply unfold in the classic sense of Rousseau or Freud, nor is the individual a puppet that is subject to external circumstances and reinforcers in the sense of Skinner“ (2006, 5). „Persönlichkeit“, so schreiben McAdams & Adler, „ist eine soziale und kulturelle Konstruktion“ (2006, 471). „[…] cultures may directly affect individual differences in dispositions, motives, abilities, and stories through cultural mechanism such as religion, mass communication practices and formal social and political policies“ (Roberts & Wood 2006, 18). Darüber hinaus bestimmen die vier zentralen Lebensphasen – Säugling, Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener – den dynamischen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung (Lang et al. 2006). Aktuelle Theorien der Persönlichkeitsentwicklung betonen zudem die besondere Bedeutung der kindlichen Bindungsentwicklung und persönlichkeitsrelevanten neuronalen Prozesse im menschlichen Gehirn.
2.2 Bindungstheoretische und neurowissenschaftliche Grundlagen für Emotionen und Persönlichkeit
Die von John Bowlby vor allem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelte Bindungstheorie postuliert ein universelles Bedürfnis des Menschen nach affektiven Bindungen (1975; Fonagy et al. 2004, 45 f.). Karin Grossmann und Klaus Grossmann schreiben: „Bindung (attachment) ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es betreuen. Sie ist in den Emotionen verankert und verbindet das Individuum mit anderen, besonderen Personen über Raum und Zeit hinweg“ (2004, 29). [→ II Bindung] Das Bedürfnis nach Nähe und Schutz steuert das Bindungsverhaltenssystem. „[…] alles, was den Menschen de facto zum Menschen macht, also die Informationen, die unser gattungsmäßiges Leben konstituieren, befinden sich zum Zeitpunkt unserer Geburt außerhalb des Organismus: sie sind nämlich in den menschlichen Beziehungen aufzufinden, in die wir hineingeboren werden“ (Heller 1980, 33).
Während der Säugling in den ersten Lebensmonaten durch Signalverhalten wie Weinen, Lächeln, Brabbeln u. v. m. ein aktives Bindungsverhalten zeigt, entwickelt er ein emotional bedeutsames Bindungssystem mit der primären Vertrauens- und Bezugsperson, in unserem Kulturkreis zumeist die leibliche Mutter. Bei Trennung von der Bindungsperson sowie durch innere und äußere Bedrohung und dem Erleben von Angst bei Gefahr kommt es zu einer Aktivierung des Bindungsverhaltenssystems: Aufsuchen der Bindungsperson, Weinen, Nachlaufen und Festklammern an die Bindungsperson. Deren wichtigste Aufgabe besteht in der Gewährleistung von Schutz und Sicherheit für das noch unselbstständige Kind (Brisch 2003). [→ VII Bindung und Sicherheit] „Die wichtigsten Elemente beim Beziehungsaufbau sind die Feinfühligkeit, mit der kindliche Signale beantwortet werden, und die sichere Basis, auf die sich das Kind bei Verunsicherungen verlassen kann“ (Grossmann 1999, 13). Die Bindungsbeziehung beeinflusst darüber hinaus das Sprachlernen. Im Rahmen gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit wird die Sprache gelernt. Die vorsprachliche Kommunikation wird zunehmend in einen sprachlichen Diskurs eingebettet. Mit Hilfe der Bindungsperson erfährt das Kind während Episoden gemeinsam geteilter Aufmerksamkeit eine emotionale und sprachliche Rückmeldung über seine Umwelt und über seine Gefühle (Grossmann & Grossmann 2007, 286).
Mary Ainsworth, die lange Zeit mit Bowlby zusammenarbeitete, analysierte in ihrer berühmt gewordenen Baltimore Studie verschiedene Bindungsbeziehungen bzw. internale Arbeitsmodelle in der sog. Fremden Situation, in der Belastungsepisoden bei Kindern im Alter zwischen zwölf und zwanzig Monaten experimentell hergestellt wurden (Ainsworth et al. 1978). Bei diesen Untersuchungen fanden kurze Trennungen zwischen Mutter und Kind statt, um die Art und Weise, mit der das Kind nach ihrer Rückkehr interagierte, zu analysieren. Unter standardisierten Bedingungen wird in der fremden Laborumgebung beobachtet, inwieweit ein Kind seine Mutter als sichere Basis für die Exploration der Umwelt einsetzt, z. B. wenn ein Fremder den Raum betritt.
Die Explorations-Bindungsbalance, das Verhältnis von Erkundungs- und Bindungsverhalten, erlaubt Aussagen über die Bindungssicherheit eines Kindes. Die Ergebnisse dieser klinischen Studien führten zu einer Differenzierung der kindlichen Bindungsorganisation zunächst in drei internale Arbeitsmodelle:
1. Die sichere Bindung zur primären Bezugsperson; sie ist von der kindlichen Zuversicht in die elterliche Aufmerksamkeit, Zuwendung und Verfügbarkeit gekennzeichnet. Ihre Flexibilität erlaubt dem Kind, unbelastet seine Umwelt zu explorieren.
2. Die unsicher-vermeidende Bindung; das Kind erfährt eine unzureichende Reaktion auf seine Bindungsbedürfnisse, es mangelt an Vertrauen in Unterstützung bei Notsituationen. Diese Kinder erleben Ablehnung und Zurückweisung, sie lernen, ihre Bindungsbedürfnisse nicht mehr zu zeigen.
3. Die unsicher-ambivalente Bindung; die Bezugsperson befriedigt unzuverlässig und diskontinuierlich die Bindungsbedürfnisse des Kleinkindes. Diese zeigen ausgeprägt widersprüchliche oder übertriebene Bindungsverhaltensweisen.
Eine der klinisch bedeutsamsten Entdeckungen der Bindungstheorie stammt von Mary Main u. a., die als viertes Bindungssystem die unsicher-desorganisierte Bindung zu klassifizieren erlaubte (Main & Solomon 1986; Steele 2005, 121; Grossmann & Grossmann 2007, 286 ff.). Bei diesem Bindungsmuster bleibt das Bindungssystem gleichsam permanent aktiviert, weil die Bindungsfigur Angst- und Trostquelle zugleich ist (Steele 2005, 121). Angesichts der dauernden Aktivierung ihres Bindungsverhaltenssystems bleibt diesen Kindern wenig psychische Energie, um ihr Explorationssystem zu mobilisieren, d. h. Lernen schlechthin (Schleiffer 2005, 168). Diese Kinder sind weder in der Lage, Angst und Kummer zu unterdrücken, noch die Nähe der Bezugsperson bei Gefahr aufzusuchen (Julius 2001, 74). Desorganisiertes Bindungsverhalten zeichnet sich ferner durch extreme Widersprüchlichkeit aus, wie etwa Annäherung an die Bindungsfigur mit abgewandtem Kopf, Erstarren auf dem Weg zur Bindungsfigur, stereotype Bewegungen oder Ausdruck deutlicher Angst.
Mary Main u. a. haben darüber hinaus auch die Bindungsrepräsentanz von Eltern mit dem von ihnen entwickelten Adult-Attachment-Interviewuntersucht. Es können zwischen vier Erwachsenenbindungsrepräsentationen unterschieden werden:
1. Typ F (free autonomnous): autonom/sicher
2. Typ E (entangled-enmeshed): verstrickt/ambivalent
3. Typ D (dismissing): distanziert/vermeidend
4. Typ U (unresolved): unbewältigte Trauma/ungelöste Konflikte.
Die Untersuchungen über die Qualität der elterlichen Bindungsrepräsentation zeigen eine hohe Korrelation und damit Vorhersagbarkeit des kindlichen Bindungsverhaltenssystems. Zugleich konnte nachgewiesen werden, dass es sich hierbei nicht um deterministische Kausalbeziehungen handelt; es gab Eltern, die selbst sicher gebunden waren, deren Kinder aber eine unsichere Bindung aufwiesen. Umgekehrt konnten die Kinder unsicher gebundener Eltern durchaus eine sichere Bindung entwickeln (Dornes 2004, 66 ff.). So kann heute auf der Grundlage der bindungstheoretischen Forschungsergebnisse festgehalten werden, dass die Qualität der Bindungsentwicklung ein Risikofaktor ist, sich aber nicht zwangsläufig negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken muss.
In der zweiten Hälfte der Schwangerschaft zeichnet sich die Hirnreifung durch die Neubildung von Hunderttausenden von Nervenzellen pro Minute aus. Das Gehirn eines Neugeborenen umfasst ca. 100 Milliarden Nervenzellen, die nebeneinander angeordnet sind. Die Verbindung dieser Nervenzellen durch das Geflecht der Nervenfasern entsteht im Wesentlichen unter dem Einfluss von Umweltreizen. Dieser Einfluss wurde im Tierexperiment nachgewiesen. So blieb bspw. die Sehrinde von Katzen, die man nach der Geburt in völliger Dunkelheit aufwachsen ließ, unverändert. Da es mangels Umweltreize nicht zur ausreichenden Netzwerkbildung kommen konnte, blieben diese Katzen blind. Erst durch Umweltreize entstehen komplexe neuronale Verknüpfungen, die in ihrer Funktion die Informationsverarbeitung mit der Umwelt ermöglichen. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im Gehirn geschieht unter dem Einfluss der Umweltreize über Nervenfasern. Da jede Nervenzelle über Dendriten mit etwa 50 000 anderen Nervenzellen verbunden ist, kann jede Nervenfaser mit einer Frequenz von 300 Impulsen in der Sekunde feuern, so dass unser Gehirn in jeder Sekunde mit einer Milliarde Impulsreizen überschwemmt wird – der größte Teil bleibt uns allerdings unbewusst. Allgemein gilt: Der grundlegende Schaltplan unseres Gehirns ist genetisch vorgegeben, und auf dieser genetischen Grundlage geschieht der Aufbau des Gehirns (LeDoux & Phelps 2004). Die Synapse ist die Stelle, an der die sendenden und empfangenden Elemente von Neuronen aufeinandertreffen. Neuronen bestehen aus einem Zellkörper und Nerven, die zusammen die Nervenfasern bilden (LeDoux 2006, 60 ff.). Deren ‚interne Kommunikation‘ verläuft über Neurotransmitter. Zu den Neurotransmittern, auch Modulatoren genannt, zählen Aminosäure-Glutamat, Gamma-Aminobuttersäure, Peptide, Hormone oder die Monaminen, wie Serotonin und Dopamin, um nur einige zu nennen (a. a. O., 76 ff.). Die biochemische Umwelt im pränatalen Entwicklungsstadium – vermittelt durch den Körper der Mutter – hat Konsequenzen für die embryonale Gehirnentwicklung (a. a. O., 94) und speziell für die Ausbildung der Neurotransmitter.
Antonio Damasio fand heraus, dass die Regionen, die Emotionen auslösen, eine Anzahl anderer Regionen an anderen Stellen des Gehirns aktivieren, die die Emotionen ausführen (2006, 72 f.). Er schreibt: Emotions „[…] are constituted by a patterned collection of chemical and neural responses that the brain produces when it detects the presence of an emotionally competent stimulus“ (a. a. O., 50). (Das heißt, dass sich Emotionen erst allmählich zu einem ‚Bild‘ fügen – etwa so, wie sich Feilspäne unter Magneteinfluss auf einen Pol hin ausrichten.) „Bei allen Emotionen wirken mehrere Salven neuronaler und chemischer Reaktionen über einen gewissen Zeitraum und in einem bestimmten Muster auf das innere Milieu, die inneren Organe und den Bewegungsapparat ein. […] Die Körperchemie und die inneren Organe wie Herz und Lunge leisten ihren Beitrag“ (a. a. O., 79).
Als emotionsauslösende Hirnregionen kartierte er die Amygdala in den Tiefen des Temporallappens, ein Teil des Frontallappens, der als ventromedialer präfrontaler Kortex bezeichnet wird, sowie ein weiterer Frontallappen im supplementären motorischen Areal und dem Gyrus cinguli (a. a. O., 74 ff.). Über diese hirnphysiologische Verortung der Entstehung von Gefühlsmustern beschreibt Damasio auch, was qualitativ geschieht. Bei positiven Affekten werden nämlich Denkprozesse erleichtert, weil die Dopamin-Rezeptoren aktiviert werden (a. a. O., 54; Frijda 2004, 274). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt seine amerikanische Kollegin Alice Isen von der Cornell University: „[…] frontal brain regions, responsible for processes such as thinking, working memory, and so forth, contain dopamin receptors, this […] also predicts that positive affect should activate those frontal brain areas and thus facilitate processes related to thinking“ (2004, 274).
Die Amygdala ist demnach eine wichtige Schnittstelle zwischen emotional besetzten visuellen und akustischen Reizen und der Auslösung von Emotionen, insbesondere, aber nicht ausschließlich von Furcht und Wut (Damasio 2006, 75). Damasio zufolge beruht alles, was wir fühlen, auf dem Aktivitätsmuster der sensorischen Hirnregionen (a. a. O., 134). Dies ist, nota bene, kein Determinismus; denn was (entwicklungs-)geschichtlich geworden ist oder ‚gebildet‘ wurde, ist eben auch veränderbar. So können diese Prozesse durch chemische Stoffe (bspw. durch Drogen) verändert oder durch Störungen der Signalübertragungen innerhalb der Hirnregionen (z. B. nach einer Kopfverletzung) oder durch körpereigene Stoffe, die zum Zelltod führen, zerstört werden. Beim sog. Urbach-Wiethe Syndrom lagert sich körpereigenes Kalzium an den Gefäßen der Amygdala ab, was dazu führt, dass diese Menschen die Emotion ‚Angst‘ verloren haben. Bei vollständiger Schädigung der Amygdala oder des cingulären Kortex geht die Existenz von Gefühlen vollkommen verloren.
Eine zentrale forschungsmethodische Voraussetzung für derlei Entdeckungen waren die neu entwickelten bildgebenden Verfahren, wie PET oder fMRI: „PET (Positronen-Emmissions-Tomographien) und fMRI (funktionale Magnetresonanz-Tomographien) sind Techniken, die die relative Aktivierung unterschiedlicher Bereiche des Gehirns abbilden, indem sie den Grad der Stoffwechselaktivität (der die Feuerungsrate der Zellen anzeigt) in verschieden Regionen des Gehirns erfassen“ (Solms & Turnbull 2004, 330). Diesen Techniken verdanken wir z. B. Erkenntnisse über ‚sensorische Marker‘ bei der Emotionsentwicklung. Mit den bildgebenden Verfahren kam es zu einem Paradigmenwechsel von der anatomisch statischen und funktionalen zu einer dynamischen Perspektive. Es ist nun technisch möglich, Vorgänge des Wahrnehmens, Fühlens, Denkens und Handelns einer Person als Aktivität in dem jeweiligen Hirnbereich zu beobachten. Insbesondere wurden nun auch Emotionen und Gefühle, die bisher in der Hirnforschung vernachlässigt wurden – eher ein Terrain für Dichter – Gegenstand der Hirnforschung. So wurde es möglich, nachzuweisen, wie emotional bestimmte Beziehungserfahrungen aus der frühen Kindheit im Gehirn verankert werden und in welchem Ausmaße diese die Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen.
Wir können heute mit Hilfe der Neurowissenschaften viel präziser verstehen, wie ein Individuum langfristig beeinträchtigt wird, wenn Stressfaktoren die ersten Lebensjahre über längere Zeiträume dominieren (Green 2005a, 25). Die Dialektik zwischen dem reifenden Organismus und der sich verändernden Umwelt ist eingebettet in die Mutter-Säugling-Beziehung. Das erste Lebensjahr kann als zweite physiologische Schwangerschaft bezeichnet werden. Gefühle als bioregulatorische Reaktionen dienen dem Überleben (Damasio 2004, 50). Die Selbstorganisation des heranreifenden Gehirns ergibt sich im Kontext von Beziehungen zu einem anderen Selbst (Gehirn). Affektive Kommunikation und psychobiologische Transaktionen bilden einen zentralen Aspekt der sozialen Konstruktion des menschlichen Gehirns (Schore 2005, 35 f.). Die bereits in der Schwangerschaft einsetzende DNS-Produktion im Kortex erhöht sich im ersten Lebensjahr signifikant und setzt sich bis ins Alter von 18 bis 24 Monaten fort (a. a. O., 36). Das Großhirn ist bei der Geburt nämlich noch nicht fertig entwickelt. Die prägende Vernetzung von Milliarden Hirnzellen unter dem Einfluss der Interaktionserfahrungen wirkt sich direkt auf die genetischen Systeme aus, auf denen das Gehirnwachstum beruht.
Affektregulierende Bindungserfahrungen strukturieren auch die Reifung der Regulationssysteme des rechten Gehirns (a. a. O., 38). Diese Strukturierungsprozesse betreffen auch das limbische System, d. h. jene Hirnareale, die nicht auf die Verarbeitung von Emotionen, sondern auf die Organisation des Lernens und der Fähigkeit spezialisiert sind, sich an wandelnde Umwelten rasch anzupassen. Folglich sind auch Lernorganisation und Anpassungsfähigkeit von frühen affektiven Interaktionsbeziehungen abhängig. „In den ersten drei Lebensjahren wirken sozio-emotionale Erfahrungen auf die erfahrungsabhängige Reifung der rechten Amygdala ein, im zweiten und dritten Viertel des ersten Jahres auf des rechte anteriore Cingulum und vom letzten Viertel des zweiten Lebensjahres auf die rechten orbito-frontalen Regionen“ (Schore 2005, 51 f.). In den ersten 18 Lebensmonaten erfährt die rechte Hemisphäre einen Wachstumsschub. Sie ist in den ersten drei Lebensjahren dominant (a. a. O., 38f.). Der amerikanische Psychoanalytiker, Psychiater und Bioverhaltenswissenschaftler Allen N. Schore (Universität Los Angeles) konnte nachweisen, dass das limbische System in der nonverbalen rechten Hirnhälfte erweitert ist. „Diese Hemisphäre ist in entscheidendem Maße an der Verarbeitung der physiologischen und kognitiven Emotionskomponente beteiligt […]“ (a. a. O., 38). Sie bleiben unbewusst und sind Bestandteile der emotionalen Kommunikation.
Im Kontext der Bindungstheorie ist der neurowissenschaftliche Zugang also hilfreich: Für eine gelingende Entwicklung in dieser frühen sensiblen Phase ist nämlich eine ‚passgenaue‘ Synchronisation, die der Affektregulierung dient, unerlässlich: „Im Rahmen von affektsynchronisierten Episoden beteiligen sich die Mütter an intuitiven, nicht bewussten mimischen, vokalen, gestischen, präverbalen Kommunikationsformen“ (a. a. O., 43). Nach Colwyn Trewarthen (1993), Psychologe an der Universität Edinburgh, entstehen in der Protokonversation, also durch Blickkontakte, Vokalisationen, taktile Stimuli usw. in den ersten drei Lebensmonaten und aufgrund der damit verbundenen sozio-emotionalen Erfahrungen die Reifeprozesse der rechten Amygdala. Die in der Protokonversation dokumentierten Gefühle an emotionaler Verbundenheit bilden die Matrix, aus der das spätere symbolische Denken entsteht: „Eine der Wurzeln der Symbolfunktion liegt in den emotional getönten Austauschprozessen zwischen Eltern und Kind“ (Dornes 2005, 16). „Die rechte Hemisphäre speichert im impliziten prozeduralen Gedächtnis […] ein inneres Arbeitsmodell der Bindungsbeziehung, das die charakteristische Haltung gegenüber der Affektregulierung determiniert. Beim sicher gebundenen Individuum enkodiert diese Repräsentation die Erwartung, dass homöostatische Unterbrechungen korrigiert werden“ (Schore 2005, 59). Als Konsequenz dieser interaktiven Entwicklungsprozesse sind bei sicher gebundenen Individuen die höchsten Ebenen des rechten Gehirns, das heißt der orbito-frontale Kortex, vor allem daran beteiligt, kognitive Eindrücke zu integrieren und ihnen eine emotional-motivationale Signifikanz zuzuschreiben. Anders formuliert: „Emotionen mit Gedanken und Ideen zu verknüpfen […]“ (a. a. O., 61). Mit anderen Worten: „In our world emotions are needed to provide the developing child with a map of the world“ (Nussbaum 2001, 206).
Dabei dienen die psychobiologischen Einstimmungen der Mutter auf sich verändernde Affektzustände des Säuglings der Affektregulierung. Das Erregungsniveau des Säuglings geht mit Veränderungen in der metabolischen Energie einher. Das macht die enorme Bedeutung der emotionsregulierenden Bezugsperson für den energetischen Zustand des Säuglings verständlich (Schore 2005, 44). Bei längeren Phasen der Fehlabstimmung entstehen gleichsam toxische Prozesse, bzw. die Grammatik der neuronalen Schaltkreise verändert sich. Die aktive Beteiligung der Mutter an der Fehlabstimmung bzw. deren Behebung ist demnach konstitutiv dafür, ob der Säugling lernt, von negativen Affektzuständen, wie übererregter Protest oder mit Untererregung verbundene Verzweiflung, wieder in den Zustand des positiven Affekts zu wechseln. Massive, langanhaltende Fehlabstimmungen führen zu unkontrollierbaren Stressreaktionen. Bei Gerald Hüther, der in Göttingen über neurobiologische Grundlagen forscht, heißt es dazu:
„Wenn eine Belastung auftritt, für die eine Person keine Möglichkeit einer Lösung durch ihr eigenes Handeln sieht, an der sie mit all ihren bisher erworbenen Reaktionen und Strategien scheitert, so kommt es zu einer sogenannten ‚unkontrollierbaren‘ Stressreaktion. Sie ist durch eine lang anhaltende Aktivierung vertikaler und limbischer Strukturen sowie des zentralen und peripheren noradrenergen Systems gekennzeichnet, die sich wechselseitig so weit aufschaukelt, dass es schließlich auch zur Aktivierung des HPA-Systems mit einer massiven und lang anhaltenden Stimulation der Cortisolausschüttung durch die Nebennierenrinde kommt“ (2003, 99).
Solche Notfall- oder Alarmreaktionen finden sich insbesondere bei den unsicher-desorganisiert gebundenen Kindern mit Misshandlungserfahrungen. Als Beleg mag die Untersuchungsgruppe von Allen N. Schore gelten. 80 % der von ihm untersuchten Kinder mit Misshandlungserfahrungen wiesen „higher cortisol level and higher heart rates than all other attachment classifications“ auf (2002, 13).
Traumatische Erfahrungen in der Entwicklung während der ersten beiden Lebensjahre lösen zwei neuronale Reaktionen aus, die sich als zentrale psychische Zustände manifestieren (Zaphiriou Woods 2005, 285 ff.):
• Hyperregung (Angst/Panik) und
• Dissoziation (Abspalten der Körperwahrnehmung).
Aus neurowissenschaftlicher Sicht wird so auch erklärlich, „[…] warum körperliche Schmerzen, die mit dem Trauma – wie etwa körperliche Misshandlung – verbunden sind, nicht wahrgenommen werden“ (Brisch 2003, 114). Solche neuronalen Reaktionsmuster beziehen sich nicht bloß auf Extreme, sie können schon durch geringe Stressoren aktiviert werden (Zaphiriou Woods 2005, 285 f.). Denn: „Der Säugling/das Kleinkind bleibt in einem ‚dauerhaften Angstzustand‘ gefangen, auf nonverbale Hinweise konzentriert, er ist unfähig, zu lernen“ (a. a. O., 286). Selbst wenn man nicht gleich wie Zaphiriou Woods von „unfähig“ reden will, so weist doch die Mentalisierungsfähigkeit von Personen, die in der frühen Kindheit traumatisiert wurden, signifikante Einschränkungen auf (Fonagy 2005, 157). [→ Traumatisierung]
Was nun die ‚Übersetzung‘ solcher Befunde in den Kontext der Persönlichkeits- und Emotionsentwicklung angeht, so richtet sich die Aufmerksamkeit exemplarisch auf das Phänomen der psychogenen Dummheit als extreme Überlebensstrategie bei frühkindlichen Traumata (Rösing 2004, 390 f.). Die psychogene Pseudodebilität ist nicht nur eine unbewusste Lösung bei massiven schmerzhaften Grenzverletzungen (so würde es die Psychoanalyse deuten). Sie korreliert nachweislich mit Veränderungen der neuronalen Schaltkreise. Die Neuropsychoanalytiker Mark Solms und Oliver Turnball belegen, wie die Funktionsfähigkeit des episodischen Gedächtnisses, d. h. die Funktionsfähigkeit des Hippocampus, bei extrem belastenden Erfahrungen, wie etwa bei Misshandlung, beeinträchtigt wird. Solche unkontrollierbaren Stresssituationen bewirken eine Überproduktion der steroiden Hormone in der Nebennierenrinde, die Neuronen zerstören und damit die Gedächtnisfunktion massiv manipulieren, bzw. beeinträchtigen können (2004, 182). „In infancy, aversive dyadic interactions actually have been shown to lead to neuronal cell death in ‚affective centers‘ in the limbic system as a result of the high corticosteroid levels generated, as well as to lead to alterations in opiate, dopamine, noradrenalin, and serotonin receptors […]“ (Fosha 2003, 4).
Ein weiteres Beispiel ist der elektive Mutismus. Auch dieser kann eine Folge von Traumatisierungen sein (Green 2005b, 237 ff.), denn auch hier finden Veränderungen der neuronalen Schaltkreise statt. Überhaupt kommt es bei der so genannten unkontrollierbaren Stressreaktion immer zu einer massiven Stimulation der Cortisolausschüttung durch die Nebennierenrinde (Hüther 2003, 99). Dies kann zum Kollaps, dem Zusammenbruch der neuronalen, endokrinen, immunologischen Regelmechanismen – u. U. zum Tod führen. Dieser Zusammenhang ist empirisch belegt in den Forschungsarbeiten über Hospitalismus von René Spitz (1968). [→ Bindung und Dialog]
2.3 Persönlichkeitsentwicklung und Emotionswissen bei Kindern
Schon früh interessierten sich Pädagogen und Psychologen für das Emotionswissen bei Kindern. Eine vielbeachtete Studie führte z. B. die Psychologin Charlotte Bühler 1930 in Wiener Kinderübernahmestellen durch („The first year of life“). Sie konnte nachweisen, dass fünf Monate alte Babys die Gesichtsausdrücke freundlich und ärgerlich unterscheiden können. Im ersten Lebensjahr korrespondiert der emotionale Gesichtsausdruck der Bezugsperson mit dem der Babys (Harris 2005, 23). „The differentiation of emotions, emerging in the second half year, involves active attention and cognitive efforts as well as deliberate attempts on the part of the infant to manipulate her environment to bring about certain emotional effects“ (Sherman 2004, 443). Bettina Janke konnte nachweisen, dass
• dreimonatige Babys den Ausdruck des Lächelns von dem des Stirnrunzelns unterscheiden,
• vier- bis sechsmonatige Babys den Ausdruck der Freude länger als den des Ärgers oder einen neutralen Ausdruck betrachten,
• ab dem vierten und fünften Monat Säuglinge zwischen verschiedenen Emotionen im Ausdruck zu unterscheiden beginnen,
• die Interpretation eines Emotionsausdruckes ab etwa dem 8. Lebensmonat gelingt (2002, 29).
Im Alter von neun Monaten sind Säuglinge in der Lage, ihre Gefühle (Affekt) mit der Quelle der Gefühle (Ursache) in Verbindung zu bringen. „[…] quite early in the first year of life, babies adjust their social behaviour to the emotion expressed by their caretaker“ (Harris 2005, 23). Die Psychologinnen Carolyn Zahn-Waxler und Marion Radke-Jarrow konnten zeigen, wie Kleinkinder auf Stress bei ihrerBezugsperson reagieren. Bis zum ersten Lebensjahr zeigte ein Drittel keine Reaktion, mehr als die Hälfte zeigte jedoch messbare Anzeichen von Stress. In den folgenden zwölf Monaten bemühen sich die Kleinkinder um aktive Interventionsversuche, sie nähern sich z. B. der Person, berühren sie. Bereits mit 18 Monaten zeigen sie komplexere Reaktionen, sie bringen einen Gegenstand, drücken Sympathie aus oder versuchen zu beschützen. „In the course of their second year, young children begin to try to alleviate distress in other persons; they comfort their parents and siblings at home, and later they comfort other children in the nursery school, particularly if they are hurt“ (a. a. O., 32). Im zweiten und dritten Lebensjahr reagieren sie nicht nur auf die emotionale Verfassung anderer, sondern können bereits mögliche Veränderungen antizipieren. Dabei erhält die Einbindung in Kommunikation über Sprachvermittlung eine ganz zentrale Bedeutung. „Being able to talk about feelings also leads children to participate in the shared cultural concepts of emotion in their particular cultural worlds, which can of course differ widely, and to talk about past emotions“ (Dunn 2004, 307). Die Entwicklung des Emotionsausdrucks und des Emotionswissens ist eng mit der sprachlichen und kognitiven Entwicklung verknüpft (Wertfein 2006, 48). Judy Dunn konnte in ihren Untersuchungen in England nachweisen, dass Kleinkinder, die früh und oft an Gesprächen über Gefühle beteiligt sind, besser in der Lage sind, Gefühle anderer zu verstehen im Vergleich zu Kleinkindern, die diese sprachvermittelte Erfahrung nicht aufwiesen (2004, 307).
Grundlegende Voraussetzung für die Emotionsentwicklung und das Emotionsverständnis ist die sichere Bindung zur primären Bezugsperson (a. a. O., 309). Das Emotionsverständnis und die Emotionsantizipation stehen in direkter Abhängigkeit zu der Bindungsqualität und haben Konsequenzen für die moralischePersönlichkeitsentwicklung.
„The child […] has many emotions: joy at the presence of good things and fear of their absence; anger at the sources of frustration and gratitude for aid and comfort; shame at her inability to control the sources of good; envy of competitors and guilt at their own aggression; disgust at the slimy and the decaying; wonder at the beauty of the world. By now we can see how these emotions support the child’s ability to act, as they mark off patterns of salience and urgency in her surrounding; we also see how they may support generous and beneficent action. But we also see a darker set of connections. The urgent need of infantile dependency can engender a paralyzing shame, accompanied by destructive resentment that put later ethical development at risk“ (Nussbaum 2001, 297).
Emotionale Erfahrungen von Stolz, Scham und Schuld sind in besonderem Maße von Erziehungs- und Sozialisationseinflüssen sowie vermittelten Regeln zur Darbietung bzw. Regulation von Emotionsausdruck geprägt (Wertfein 2006, 54 f.). Eine weitere wichtige Beziehungskonstellation für die Emotions- und Persönlichkeitsentwicklung stellt die Interaktion mit Gleichaltrigen dar. „Die Gruppe der Gleichaltrigen dient dazu, das Individuum zu sozialisieren, dass es neue Verhaltensregeln annimmt, und sorgt für Erfahrungen, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben“ (Pervin et al. 2005, 45). Carolyn Saarni schreibt: „[…] children relish and value their friendships, which represent rich emotional experience. They gain from friendships companionship, support, and validation; given that these interpersonal goals are highly prized, children must learn to modify their behavior, including their emotional responses, so as to maintain these interpersonal rewards“ (2004, 315). In diesem Kontext bedeutet eine zentrale Entwicklungsaufgabe der Kindheit, Fähigkeiten zu entwickeln und aufzubauen, um die eigenen Emotionen willentlich zu kontrollieren (Fingerle 2005, 139; Saarni 2006).
3 Emotionen und Persönlichkeit im gesellschaftlichen und kulturellen Kontext
Die Entwicklung von Emotionen, Gefühlen, Affekten und Stimmungen einer Person findet innerhalb bestimmter kultureller und sozialer Strukturen statt. Die gesellschaftliche Emotionskultur zeigt sich nicht nur in der Sprache, sondern auch in Ritualen, Kunstgebilden oder Religionen (Turner & Stets 2005, 31). Die Psychologen Dieter Ulich und Philipp Mayring schreiben, dass die kulturellen Mitgliedschaftsentwürfe bestimmte Regeln und Erwartungen für das emotionale Erleben enthalten, „wann und in welchen Situationen wem gegenüber welche Gefühle erwünscht oder unangemessen sind“ (2003, 103). Die amerikanische Soziologin Arlie Russel Hochschild führte 1979 das Konzept der emotion norm ein, ein übergreifender Begriff, der von ihr in feeling norms und expressionrules differenziert wird (Thoits 2004, 360). „Just as feelings are linked to rules in a normative context, so feelings are linked to expressions in a context of expressions. Just as we appraise our experience in a context of rules, so do we judge the emotional expressions of others in an expressive context“ (Hochschild 2003, 96). In ihrer Pionier-Studie





























