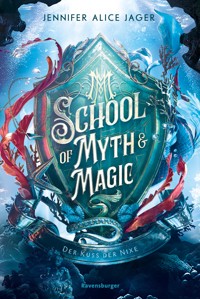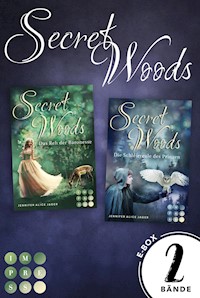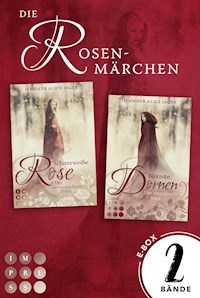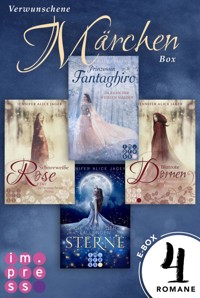Empire of Ink: Alle Bände der Fantasy-Reihe über die Magie der Tinte in einer E-Box! E-Book
Jennifer Alice Jager
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn Fantasie zur Wirklichkeit wird…** Schon immer hatte die Scarlett eine ungewöhnlich lebhafte Fantasie, aber nie hätte sie ihre Tagträume für real gehalten – bis sie dem draufgängerischen Chris Cooper begegnet und von einem Reich erfährt, das durch die Magie der Tinte erschaffen wurde. Eine Macht, die mehr und mehr an Kraft verliert. Doch plötzlich ist nicht nur das Tintenreich mit seinen Drachen, Königen und wahrgewordenen Legenden in Gefahr, sondern auch die Welt der Menschen und mit ihr Scarlett selbst und der Mann, den sie liebt… Märchenhaft erzählt führt die Erfolgsautorin Jennifer Alice Jager ihre Leser in ein Königreich, in dem die Geschichten und Figuren ihrer Lieblingsbücher lebendig werden. Eine magische Welt aus Tinte und Fantasy, die vollkommen begeistert und mit außergewöhnlichen Charakteren und zahlreichen überraschenden Wendungen aufwartet. //Die E-Box zur Fantasy-Reihe über die Magie der Tinte enthält folgende Romane: -- Empire of Ink 1: Die Kraft der Fantasie -- Empire of Ink 2: Die Macht der Tinte// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Im.press Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2017 Text Jennifer Alice Jager, 2017 Coverbild: shutterstock.com / © Phase4Studios / © Wasant / © dizzzdergunov / © gritsalak karalak Covergestaltung: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60366-8 www.carlsen.de
Jennifer Alice Jager
Empire of Ink 1: Die Kraft der Fantasie
**Wenn Tinte Magie birgt, wird Fantasie zur Wirklichkeit …** Die 17-jährige Scarlett hält nicht viel von Schule oder Verpflichtungen. Am liebsten verfolgt sie ihre eigenen Ziele und die bestehen zum größten Teil aus Träumereien. Schon immer hatte sie eine ungewöhnlich lebhafte Fantasie, für die sie oft belächelt wurde und die sie zu verstecken versucht. Bis Scarlett dem draufgängerischen Soldaten Chris Cooper begegnet, der ihr erklärt, dass ihre Fantasien Einblicke in die Wirklichkeit sind. Er erzählt von einem Reich, das durch die Kraft des geschriebenen Wortes erschaffen wurde und dessen Grundpfeiler die Magie der Tinte ist. Eine Macht, die mehr und mehr aus der Welt verschwindet …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Jennifer Alice Jager begann ihre schriftstellerische Laufbahn 2014. Nach ihrem Schulabschluss unterrichtete sie Kunst an Volkshochschulen und gab später Privatunterricht in Japan. Heute ist sie wieder in ihrer Heimat, dem Saarland, und widmet sich dem Schreiben, Zeichnen und ihren Tieren. So findet man nicht selten ihren treuen Husky an ihrer Seite oder einen großen, schwarzen Kater auf ihren Schultern. Ihre Devise ist: mit Worten Bilder malen.
Für euch, die ihr Wunder in den kleinsten Dingen seht.
Ein Friedhof voller Untoter
Oder wie man mit einem aufdringlichen Soldaten fertig wird
Es war einer jener Abende, an denen Schweigen mehr verletzte als jedes gesprochene Wort.
Ich saß an unserem schäbigen Küchentisch und stocherte lieblos in meinen verkochten Spaghetti. Meine Mutter hingegen schlang ihr Essen eilig herunter.
Warum dem so war, wusste ich sehr genau und so wartete ich nur darauf, dass sie den Mund aufmachte und der erdrückenden Ruhe endlich ein Ende setzte.
»Wie war die Schule?«, fragte sie desinteressiert.
»Hm«, antwortete ich und starrte weiter auf meinen Teller.
Nein, es interessierte sie wirklich nicht, was ich in der Schule trieb. Nicht einmal, ob ich wirklich da gewesen war. Es war etwas ganz anderes, was sie mir sagen wollte. Wie immer drückte sie sich davor, offen und ehrlich mit mir zu reden.
Nein, Olivia McLaren war keine dieser Frauen, die geradeheraus sprachen. Nicht einmal mit ihrer eigenen Tochter.
Ich war siebzehn Jahre alt, eine durchschnittliche Schülerin und hatte meinen Traum, Tierärztin zu werden, schon vor Jahren begraben. Aus der niedlichen, Zöpfe tragenden Scarlett war irgendwann das aufmüpfige Mädchen geworden, das ich heute war. Aus Scarlett wurde Scar und aus meinen Träumen und denen meiner Mutter wurde rein gar nichts.
Es war meine eigene Schuld, denn schließlich musste man in der Schule anwesend sein, um gute Noten nach Hause zu bringen. Und ohne gute Noten auch kein Studium. Dass aus meiner Zukunft nichts Vernünftiges werden würde, löste bei mir nur ein Schulterzucken aus. Es schmerzte mehr, zu wissen, dass meine Mutter die Hoffnungen in mich schon lange vor mir aufgegeben hatte.
»Hör zu, wenn du nicht reden willst …«, begann Olivia.
Ich rollte mit den Augen.
»Dann was?«, unterbrach ich sie und warf meine Gabel geräuschvoll in die Tomatensoße.
Es war mal wieder so weit. Sie wagte es nicht, mit der Wahrheit herauszurücken, also provozierte sie einen Streit, um mir die Schuld an allem geben zu können. Typisch.
Olivia rückte mit ihrem Stuhl nach hinten, sah mich voller Enttäuschung an und seufzte schließlich.
»Ich sehe schon, du hast wieder eine deiner trotzigen Phasen. Weißt du was? Geh doch einfach in dein Zimmer, mach deine Aufgaben oder guck fern. Ich treffe mich heute Abend mit Bill.«
»Ach«, meinte ich nur.
Es war mir von vornherein klar gewesen, dass es darauf hinauslief. Sie verbrachte mehr Zeit in seinem Apartment als in unserem. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch nach Hause kam und etwas zu essen auf den Tisch stellte.
Bill war vom selben Schlag wie all die Typen davor und all jene, die noch folgen würden. Erst waren sie lieb und nett zu ihr, trugen sie auf Händen und überschütteten sie mit Geschenken, dann machten sie ihr klar, dass sie mit Kindern nicht so gut konnten, weswegen ich schnell abgeschrieben war, und irgendwann, wenn meine Mom glaubte, nicht mehr ohne sie leben zu können, taten sie ihr weh – seelisch oder körperlich. Oft beides.
Das war das Spiel ihres Lebens. Sie wurde betrogen und belogen und gab sich alleine die Schuld daran. Wie oft schon hatte sie weinend in ihrem Bett gelegen und war tagelang nicht in der Lage gewesen, das Apartment zu verlassen?
Schon als kleines Kind war es meine Aufgabe gewesen, sie zu trösten, ihr Mut zuzusprechen und sie mit Schokolade und heißem Tee wieder aufzubauen.
Wenn ich es recht bedachte, waren das wohl die Zeiten, in denen wir uns am nächsten standen.
Wir waren einfach zu unterschiedlich. So wie sie sich behandeln ließ, würde ich nie zulassen, dass man mit mir umsprang. Es waren ja nicht nur die Männer, auch im Job zog sie immer den Kürzeren. Überstunden, Nachtschichten und Wochenendarbeit waren für sie normal, während ihre Kollegen jeden Tag pünktlich das Büro verließen.
Ich würde denen gehörig die Meinung sagen, wenn ich als alleinerziehende Mutter deren Arbeit übernehmen müsste, während sie ihr Singledasein genossen.
Meine Mutter aber scheute jede Konfrontation. Ich hingegen legte mich auch mal mit Lehrern oder dem Direktor an, wenn es sein musste. So schnell machte mir keiner Vorschriften. Ich traf meine eigenen Entscheidungen und wenn es mal die falsche war, dann stand ich auch dazu und badete den Mist wieder aus.
Vielleicht war auch das eines unserer vielen Probleme. Vielleicht sollte ich diejenige sein, die sich von ihrer Mutter trösten ließ, und nicht umgekehrt.
»Ich weiß, dass du Bill nicht leiden kannst«, seufzte Olivia und rieb sich erschöpft die Schläfen. »Aber könntest du dich nicht einmal für mich freuen?«
Da hätte ich mich eher für die Frau von Donald Trump freuen können. Die jetzt wenigstens in Geld schwamm, während Bill meine Mutter schon mehrmals angepumpt hatte.
»Ich gehe in mein Zimmer«, sagte ich trocken und stand auf.
»Hörst du mir denn überhaupt zu?«, rief Olivia mir nach.
Ich war schon im Begriff die Küche zu verlassen und wirbelte nun doch herum.
»Ja, ich höre dir zu! Ich höre immer zu«, schnaubte ich. »Es ist doch jedes Mal dasselbe: Oh, er ist so toll, oh, er ist so perfekt und lieb und überhaupt! Bill hier, Bill da. Du kennst kein anderes Thema mehr. Aber soll ich dir mal was sagen? Er ist ein Schwein, wie alle anderen davor. Er wird dir wehtun und dann kommst du wieder weinend angekrochen. Es läuft immer auf dasselbe hinaus. Tu, was du nicht lassen kannst, und geh zu deinem heißgeliebten Bill, aber lass mich damit in Ruhe!«
Ich bereute, ihr das an den Kopf geworfen zu haben, kaum dass ich es ausgesprochen hatte. Doch nun war es raus. Es war die Wahrheit und ich würde den Teufel tun, es zurückzunehmen.
»Wie kannst du es wagen?«, zischte sie. Ihre Hände zitterten vor aufgestauter Wut. »Du bist … du bist genau wie …»
»Wie wer?«, knurrte ich. Nun ging es endgültig mit mir durch. »Wie mein Vater?«
Niemals hätte sie es gewagt, das offen auszusprechen, doch gedacht hatte sie es schon oft. Das sah ich ihr jedes Mal an, wenn ihr der Gedanke durch den Kopf schoss.
Mein Vater war nicht nur einer dieser Idioten, er war obendrein noch verrückt und hockte in irgendeiner Irrenanstalt.
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gedacht«, entgegnete ich.
Als darauf nicht gleich eine Antwort kam, ließ ich sie stehen und stapfte in mein Zimmer. Die Wände vibrierten, als ich die Tür mit voller Wucht zuschlug.
Als ob es nicht ausgereicht hätte, dass wir immer wieder in Streit gerieten. Zu allem Übel hielt meine Mutter mich auch noch für verrückt. Dabei lag es schon Jahre zurück, dass ich ihr etwas von meinen Fantasien erzählt hatte.
Es war auch nicht mehr als eine ausgeprägte Fantasie. Schon als kleines Kind malte ich mir die irrwitzigsten Dinge aus. Ich sah zum Himmel und stellte mir vor, dass da Drachen statt Schwalben flogen, blickte in eine Pfütze und sah darin einen Wal schwimmen oder träumte davon, durch ein Loch in einer Mauer in eine andere Welt eintreten zu können. Es waren nichts weiter als Hirngespinste.
Bei einem verrückten Vater und einer hypersensiblen Mutter war es aber keine gute Idee, laut auszusprechen, was einem im Kopf herumspukte. Diese Lektion musste ich schon früh lernen und seitdem behielt ich meine Fantasien für mich.
Ich zog mein iPhone aus der Tasche – ein altes, abgewetztes Ding, das ich günstig auf Ebay erstanden hatte – und rief WhatsApp auf.
Wird nichts mit dem Filmabend mit Mom, tippte ich an Jenny.
War doch klar, dass die es vergisst, antwortete sie. Kino?
Kein Geld, tippte ich.
Bei mir?
Klar. Cu.
Ich warf noch einen kurzen Blick in den Spiegel, bevor ich mir meine Jacke schnappte. Auch wenn ich nicht zu den eitlen Tussis gehörte, die täglich fünf Stunden im Bad verbrachten und in Klamotten herumliefen, in denen sie es auf dem Strich weit bringen würden, war es mir schon wichtig, nicht ganz so heruntergekommen auszusehen, wie es mein Sozialstatus vermuten ließ.
Nicht jeder musste auf den ersten Blick erkennen, dass ich in einem Schuhkarton hauste und mich von Tütensuppen und Spaghetti mit Tomatensoße ernährte.
Der Vorteil an der modernen Gesellschaft war, dass man mit Secondhandklamotten und ein bisschen Fantasie auch als bettelarme Kirchenmaus aussehen konnte, als wäre der heruntergekommene Style gewollt.
Ich zog mir das Gummi aus meinem silbern gefärbten Haar, fuhr mir mit gespreizten Fingern durch die wirre Mähne und tupfte etwas Lipgloss auf. Dann warf ich mir meine abgewetzte Lederjacke über die Schulter und machte mich auf den Weg.
Um meine Mutter musste ich mir keine Gedanken machen. Kaum war ich in meinem Zimmer verschwunden gewesen, hatte ich auch schon die Wohnungstür gehört. Unseren geplanten Filmeabend hatte sie tatsächlich vergessen oder verdrängt und ihr Vorhaben, den Abend bei Bill zu verbringen, war geglückt.
Es würde ihr nicht einmal auffallen, wenn ich die ganze Nacht wegbliebe. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich für ein paar Tage das Weite suchte. Etwas Abstand tat uns beiden immer ganz gut.
***
Ich verpasste meinem Fahrradschloss einen kräftigen Tritt. Das war die beste und einzige Methode, das rostige Ding aufzubekommen.
Wir lebten in einem Viertel, in dem alles geklaut wurde, was nicht niet- und nagelfest war, selbst wenn es sich dabei um ein altes, klappriges Fahrrad handelte. Dass mein Fahrradschloss mehr der Zier diente, wusste ja niemand.
Ich schwang mich in den Sattel und radelte los. Für mich war mein Fahrrad das einzig wahre Fortbewegungsmittel in der Großstadt. Während die Autofahrer stundenlang im Stau standen, sauste ich mit rasender Geschwindigkeit durch die Karawanen, spürte den Wind in den Haaren und nahm Abkürzungen durch enge Gassen und Parks.
Ich stellte mir dann immer vor, dass die kilometerlangen Schlangen auf den überfüllten Straßen aus rostigen, verbeulten Wracks bestanden, die längst von der Natur überwuchert und vereinnahmt worden waren.
Ich sah Efeu, der aus den Motorhauben und den Innenräumen der Autos wuchs, an den Fassaden der Häuser hinaufkletterte und dort zu einem Teil ganzer Urwälder wurde.
Wie Skelette längst verstorbener Giganten sahen die Wolkenkratzer für mich aus. Bäume reckten sich aus ihren geborstenen Fenstern in die Höhe, Affen schwangen sich von Ast zu Ast und huschten über Lianen zwischen den Gebäuden.
Die Tauben auf den Dächern waren goldene Phönixe, die Frau mit den Rastas und dem an der Leine zerrenden Stafford, eine Medusa mit einem Feuer speienden Höllenhund an der Kette.
Mein Fahrrad flog über Risse und von wild wucherndem Unkraut zerfurchten Asphalt, wo andere Menschen nur unbeschadete Straßen sahen. Wo es Schlaglöcher gab, sah ich Tore zur Hölle, Hydranten wurden für mich zu gigantischen Würmern, die gerade aus dem Erdreich brachen und ihre Köpfe gen Himmel reckten.
Die ganze Welt um mich herum war der Spielplatz meiner Fantasie. Dinge, die mir als Kind noch Angst gemacht und Albträume bereitet hatten, waren mittlerweile zu meinem Geheimnis geworden und schreckten mich nicht mehr, sondern waren, ganz im Gegenteil, eine Zuflucht für mich. Die Welt, die ich sah, war wild, bunt und atemberaubend – das genaue Gegenteil zu der tristen, grauen Wirklichkeit.
Ich bog in die Brook Street ab, kreuzte die Straße und sprang mit dem Rad den Bordstein hoch, um schneller in den Park zu gelangen. Es dämmerte bereits und die Wege waren nur spärlich beleuchtet. Die hohen Bäume sorgten zusätzlich für Schatten.
Des Nachts trieben sich im Park gerne mal zwielichtige Gestalten herum, was mich bisher noch nie davon abgehalten hatte, ihn zu durchqueren, um schneller zu Jenny zu gelangen. Blieb ich auf dem Hauptweg und legte ein ordentliches Tempo vor, drohte mir kaum eine Gefahr von irgendwelchen Junkies oder Pennern. Die hatten auch wahrlich ihre eigenen Probleme.
Umso entsetzter war ich, als plötzlich ein Schatten von der Seite auf mich zuschoss und ich vom Rad gerissen wurde. Ehe ich mich versah, landete ich in einer Hecke, begraben unter dem Gewicht eines Mannes.
»Runter von mir!«, schrie ich und wehrte mich mit Händen und Füßen. »Ich warne Sie! Ich kann Karate und Juckjuckzu!«
Der Mann erhob sich nur so weit, dass sein Gewicht mich nicht mehr niederdrückte, ich aber noch immer nicht freikam.
Er war ein heruntergekommener, bärtiger Kerl Mitte fünfzig, mit schmalen, gefährlich wirkenden Augen und sonnengegerbter Haut.
»Juckjuckzu?«, fragte er höhnisch.
Sein filziger Bart kitzelte mir auf der Kehle, während er sprach, und sein Atem stank nach Alkohol und Tabak.
»Jujunkzu?«, korrigierte ich mich skeptisch.
Der Mann lachte, entblößte dabei faulige Zähne und hauchte mir seinen übel riechenden Mundgeruch entgegen.
»Jetzt gehen Sie von mir runter!«, verlangte ich und schlug ihm gegen die Brust.
Tatsächlich rollte er sich krümmend vor Lachen zur Seite, sodass ich endlich wieder frei durchatmen konnte.
»Ju-Jutsu heißt das«, prustete er, stockte aber plötzlich und sah sich hektisch um.
Ganz offensichtlich hatte der Mann einen Dachschaden. So heruntergekommen, wie er aussah, lebte er wohl auch schon seit geraumer Zeit auf der Straße, was zwangsläufig irgendwann zu mentalen Ausfällen führen musste.
Ich klopfte mir den Dreck von der Hose und wollte gerade aufstehen, um nach meinem Fahrrad zu sehen, da packte er mich am Arm. Seine fingerlosen Wollhandschuhe waren klebrig und lösten einen Brechreiz bei mir aus, den ich kaum unterdrücken konnte.
»Wir müssen hier weg«, flüsterte er und sah mich warnend an.
»Ich gehe nirgendwohin«, widersprach ich und versuchte mich loszureißen.
Der Mann zog mich mit einem Ruck zu sich und mir rutschte das Herz in die Hose, als er mir direkt in die Augen sah.
»Sie haben es auf uns abgesehen!«, sagte er in einem so bedrohlichen Tonfall, dass ich ihm fast zustimmen wollte.
Er zog mich noch näher an sich heran.
»Auf uns alle!«, betonte er und sah sich ein weiteres Mal hektisch um.
Mit einem Satz sprang er auf und zog mich einfach mit. Ich versuchte loszukommen, doch der Mann, trotz seiner mageren Statur, war zu stark für mich. Seine Finger schlossen sich wie Handschellen um mein Handgelenk.
»Sie sind doch verrückt«, schrie ich ihm vergebens nach.
Ein ohrenbetäubender Knall ertönte plötzlich hinter mir und ließ mich zusammenzucken. Es war ein lautes, hohl klingendes Fopp, als würde jemand einen gigantischen Tennisball aus einer ebenso gigantischen Ballwurfmaschine abfeuern.
Ich duckte mich instinktiv und riss die Augen auf, als ich ein Netz sah, das sich gleich neben mir um einen Baumstamm wickelte. Seine Enden waren mit Gewichten beschwert, die sich beim Aufprall umeinander gewickelt hatten. Wäre der Stamm ein Mensch, läge er jetzt gefangen am Boden.
Wieder knallte es und diesmal schlug etwas ganz nah bei mir auf.
Das hier entsprang sicher nicht meiner Fantasie. Der Mann wurde tatsächlich verfolgt und mit ihm nun auch ich.
Ich wehrte mich nicht weiter, sondern rannte nur noch schneller. Ob seine Verfolger mich wegen meiner dunklen Kleidung und dem dämmrigen Licht nicht sehen konnten oder es ihnen egal war, dass ihre Beute nun in Begleitung war, wusste ich nicht. Das Risiko, stehen zu bleiben und mal zu schauen, mit wem ich es da zu tun hatte, wollte ich jedenfalls nicht eingehen.
Es fielen keine weiteren Schüsse. Wir hetzten durch den Park, verfolgt von den Schritten und dem Gebrüll mehrerer Männer.
Meine Gedanken rasten. Wurde der Mann von der Drogenmafia verfolgt? Dann wäre ich ein unliebsamer Zeuge, der sich auf ein Paar neue Schuhe freuen konnte. Aus Beton. Im besten Fall erwartete mich ein Zeugenschutzprogramm. Ich würde mir die Haare wieder in ein langweiliges Braun färben müssen und in irgendeinem Kaff leben, wo ich brav zur Schule zu gehen hatte, um nicht aufzufallen. Das passte so gar nicht in meine Vorstellung von einem abenteuerlichen Leben, wie ich es mir für meine Zukunft ausgemalt hatte.
Der Mann packte mich wieder fester am Arm und zog mich hinter eine Mauer.
Völlig aus der Puste, stützte ich mich auf die Knie und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. Der Park war weitläufig und abseits der Wege verbarg sich so manch merkwürdiger Ort. Verlassene Spielplätze, unwegsame Moorgebiete oder heruntergekommene Toilettenhäuschen waren Anlaufstellen für Menschen, die nichts mit der Welt da draußen zu tun haben wollten und bei denen es nicht ratsam war, ihnen im Dunkeln zu begegnen.
Mein Begleiter kannte sich hier scheinbar gut aus, denn er hatte mich zielstrebig zu dieser nebelverhangenen Lichtung geführt, wo die Ruinen alter Imbissbuden uns Schutz boten.
In meiner Fantasie sah ich Grabsteine aus dem dichten Dunst ragen. Ein vergessener Friedhof, den nur noch die Krähen kannten und auf dem, bei Mitternacht, wenn der Mond rund und voll am Himmel stand, so wie heute, die Toten aus ihren Gräbern stiegen, um im bläulichen Schein zu tanzen.
Ich schüttelte diesen Gedanken ab. Das hier war sicher nicht der richtige Zeitpunkt für meine Hirngespinste.
»Wer zum Teufel ist hinter Ihnen her?«, zischte ich.
»Psssst!« Der Mann presste mir seinen Finger auf die Lippen und warf einen Blick über die Mauer. »Sie kommen.«
Er ließ seinen Blick über die Lichtung wandern, dann fand er scheinbar, wonach er gesucht hatte, denn er lief geduckt los und verschwand in den Schatten eines der Gebäude.
Ich zögerte, ihm zu folgen. Seine Verfolger hatten es schließlich nicht auf mich abgesehen und mich womöglich nicht einmal bemerkt. Wenn ich es geschickt anstellte, konnte ich entkommen, während sie weiter dem Mann folgten.
Doch ich konnte nicht. Ich hätte mir dafür in den Hintern beißen können, aber ich wollte diesen verlausten, geistig verwirrten und ungehobelten Penner nicht einfach sich selbst überlassen. Ich würde mich immer fragen, was sie mit ihm angestellt hatten, während ich heimlich entkommen konnte.
Es war wahrscheinlich nicht die klügste Entscheidung meines Lebens, aber sicher auch nicht die dümmste, als ich mich von der Mauer abstieß und dem Mann in die Schatten folgte.
Kaum dass ich um die Ecke gebogen war, wurde ich auch schon gepackt und gegen das Gebäude gestoßen.
»Keine Bewegung!«, brüllte jemand, doch da hatte ich schon mein Knie angezogen und dem Fremden zwischen die Beine gerammt. Erst dann erkannte ich, dass die Männer um mich herum schusssichere Westen und schwarze Uniformen trugen.
Das waren sicher keine Mafiosi. Es sah eher so aus, als würde hier jemand Krieg spielen. Waren das etwa LARPer oder Paintballer?
Ihre Waffen sahen allerdings ziemlich echt aus. Ungefähr so echt wie der Tritt in die Eier des Mannes, der sich vor mir auf die Knie hatte fallen lassen und herzerweichend stöhnte.
Zwei von ihnen hielten den Penner an den Armen gepackt. Seine Hände hatten sie ihm mit Kabelbinder gefesselt.
Er wehrte sich, doch das wirkte ebenso hilflos wie meine Versuche ausgesehen haben mussten, von ihm freizukommen.
»Die hat dich voll erwischt, Cooper!«, höhnte einer der Männer. Die anderen stimmten mit ein.
Cooper mühte sich wieder auf die Beine. Ich hob meine Hände, um mich im Falle der Fälle gegen ihn zu verteidigen, wagte es aber nicht, ihm noch einmal einen Tritt zu verpassen, ehe ich nicht wusste, was hier vor sich ging.
Coopers Blick fixierte mich argwöhnisch. Er strahlte dabei ein Selbstbewusstsein aus, wie es nur jemandem inne sein konnte, der es gewohnt war, in jeder Lebenslage die Oberhand zu behalten. Dass ich ihn soeben zu Fall gebracht hatte, schien kaum daran zu kratzen.
Ein amüsiertes Lächeln huschte ihm über die Lippen. Das Geläster der anderen ignorierte er völlig.
Ich wich zurück, als er seine Hand direkt neben meinem Kopf an die Wand lehnte und unsere beiden Gesichter sich näher kamen.
Er hatte stechend blaue Augen, dunkles, kurz geschnittenes Haar und verwegene Augenbrauen, die sich zu einer geraden Linie zusammenzogen, als er mich ansah.
»Ganz schön wehrhaft, die Kleine«, stellte er fest.
Ich fühlte mich gerade alles andere als wehrhaft. Cooper war einen Kopf größer als ich, muskulös und hatte die Ausstrahlung eines Soldaten. Unbeugsam, furchtlos, zielstrebig. Ich hingegen war verwirrt, erschöpft und verzweifelt.
»Leg dich ja nicht mit ihr an!«, brüllte der Penner, der sich noch immer vergebens, aber aus Leibeskräften gegen die Männer wehrte. »Die Kleine kann Karate!«
»Das ist nicht sehr hilfreich«, knurrte ich durch zusammengebissene Zähne.
Cooper stieß sich von der Wand ab und sah fragend von mir zu dem Mann und wieder zurück.
»Du verstehst, was er sagt, Kleine?«, fragte er.
Ich legte die Stirn in Falten. »Klar, ich bin doch nicht taub. Sag mir lieber, wer ihr seid und was das Ganze hier soll.«
Cooper dachte wohl nicht daran, mich aufzuklären. Stattdessen wandte er sich an seine Leute.
»Schaut euch das an! Uns ist da glatt ein kleiner Madhead ins Netz gegangen.«
Ich öffnete den Mund, um mich über diese herabwürdigende Bezeichnung zu beschweren, ließ es dann aber doch bleiben. Cooper hatte mir seinen Rücken zugekehrt. Ein breiter, muskulöser Rücken, doch das war es nicht, was mir in erster Linie auffiel. Es gab keine Abzeichen auf seiner Kleidung. Da war kein Polizeiwappen oder Sonstiges. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Polizei dazu verpflichtet war, deutlich sichtbare Abzeichen zu tragen oder sich zumindest als Gesetzeshüter zu identifizieren, wenn sie vorhatte, jemanden festzunehmen. Selbiges galt sicher für Eingreiftruppen des Militärs oder irgendeines Geheimdienstes.
Wenn das hier keine Polizisten oder Soldaten waren, dann hatten sie auch kein Recht, mich festzuhalten. Dann war ich vielleicht wirklich dem makabren Scherz irgendwelcher Rollenspieler auf den Leim gegangen.
Länger wollte ich mir das nicht gefallen lassen. Ich nutzte es aus, von Cooper unbeobachtet zu sein, und schlich an der Mauer entlang weg von ihm.
»Stehen geblieben!«, rief einer der Männer.
Ich wollte losrennen, doch schon hatte Cooper mich am Arm gepackt. Er zog mich mit einem Rück zu sich und ergriff auch meinen zweiten Arm.
»Wohin denn so eilig?«, fragte er.
Ich zögerte nicht und trat ihm mit voller Wucht gegen sein Schienbein. Abermals krümmte er sich und stöhnte vor Schmerzen.
»Pass ja auf, Coop, sonst beißt sie dich noch!«, spottete einer der Männer.
Als Cooper aufsah, wirkte er nicht mehr so gelassen wie zuvor.
»Wo ist eigentlich dieser nichtsnutzige Alfie?«, zischte er und warf seinen Männern einen scharfen Blick zu.
Die hoben nur unwissend die Schultern.
»Hier bin ich!«, rief eine helle Stimme aus den Schatten.
Ein dürrer, Brille tragender Kerl in einer schusssicheren Weste, die an ihm aussah, als habe ein Kind die Kleidung seines Vaters anprobiert, kam auf die Lichtung gestolpert.
Er sah sich unsicher um und lief in Schlangenlinien durch den Nebel.
In meiner Vorstellung wich er den Grabsteinen aus, die sich windschief aus dem Dunst erhoben, und schrak zurück, wo knochige Arme aus dem Erdreich brachen und nach ihm griffen.
»Habt ihr ihn geschnappt?«, fragte er mit zittriger Stimme und rückte sich die Brille zurecht.
»Putz dir die Brille, Madhead, dann siehst du es selber«, sagte einer der Männer mit schiefem Grinsen.
Alfie ging zu ihrem Gefangenen und betrachtete den Mann von oben bis unten.
»Kein Zweifel«, stellte er fest und klang dabei wie ein Professor, der seine Thesen hervorbrachte. »Das hier ist der gesuchte Mann.«
Der Penner spuckte ihm ins Gesicht und grinste breit. Die Männer lachten, während Alfie ein Taschentuch hervorzog und sich Brille und Gesicht säuberte.
»Können wir dann gehen?«, bat er. »Ich finde es hier ziemlich gruselig.«
»Ein Problem haben wir noch«, meinte Cooper und zog mich neben sich, sodass ich Alfie gegenüberstand.
»Ein Zivilist?«, fragte der verwirrt.
»Genau das bin ich«, sagte ich, bevor Cooper zu Wort kam. »Und ihr habt kein Recht, mich festzuhalten. Also Finger weg von mir!«
Ich riss mich los, zögerte aber, einen weiteren Fluchtversuch zu starten. Zum einen war Cooper sicher schneller als ich, zum anderen hatte mich nun doch die Neugier gepackt. Was ging hier vor? Wer waren die Männer und war das hier wirklich nur ein Spiel, bei dem der arme Mann vielleicht gar nicht freiwillig mitmachte?
»Oh, wir haben jedes Recht, Kleine«, verbesserte Cooper mich.
»Du bist hier mitten in einen Militäreinsatz gestolpert«, erklärte Alfie.
Irgendwie wollte ich ihm das nicht recht abkaufen. Bevor er aufgetaucht war, hätte das noch glaubwürdig geklungen, doch er sah so gar nicht nach einem Soldaten aus. Wie alt war er? Wohl kaum älter als ich. Beim Militär würde einer wie er es sicher nicht mal durch die Musterung schaffen.
»Der Militäreinsatz ist wohl eher in mich gestolpert«, konterte ich.
»Wie dem auch sei, du hast jedenfalls viel zu viel gesehen, als dass wir dich einfach gehen lassen könnten«, meinte Cooper. »Insbesondere, da du ein Madhead bist.«
Schon wieder diese Beleidigung. Die schien in dieser seltsamen Gruppe ziemlich beliebt zu sein. Wirkte ich auf sie wirklich wie ein Streber, so wie dieser nerdige Alfie, der so gar nichts mit mir gemein hatte? Oder bezeichneten sie einfach jeden so, der kein muskelbepackter Berg war wie ihresgleichen?
»Sie ist …?«, fragte Alfie strahlend. »Wirklich?«
»Ist sie«, bestätigte Cooper.
Nun verstand ich gar nichts mehr.
Alfie räusperte sich, um die Fassung zurückzugewinnen.
»Wir können sie jedenfalls nicht festhalten«, erklärte er und rückte sich ein weiteres Mal die Brille zurecht.
»Lass sie gehen!«, verlangte der Penner. »Sie hat mit der ganzen Sache nichts zu tun.«
»Was sagt er?«, fragte Cooper.
Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Niemals war das hier ein echter Militäreinsatz. Jeder normale Mensch hätte verstanden, was der Penner gesagt hatte, aber die angeblichen Soldaten stellten sich dumm. Also doch Rollenspieler. Ich hatte es mir ja schon gedacht.
»Dass wir sie gehen lassen sollen«, antwortete Alfie.
»Ganz sicher nicht, wir nehmen sie mit.«
»Bestimmt nicht!«, widersprach ich energisch.
»Da hast du nichts mitzureden, Kleine«, meinte Cooper und packte mich wieder am Arm.
Ich sah schon den Artikel in der Morgenzeitung: Mädchen von Bande verrückter Rollenspieler verschleppt.
»Ob nun Madhead oder nicht, wir haben nicht die Befugnis, Zivilisten festzunehmen«, beharrte Alfie.
»Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt«, knurrte Cooper ihn an. »Das hier ist mein Einsatz, also auch meine Entscheidung.«
»Wie du meinst«, sagte Alfie schulterzuckend. »Dann ist es auch dein Ärger, den du bekommst, wenn wir mit einer Zivilistin im Schlepptau in der Basis ankommen. Mein Einspruch war nur fürs Protokoll.«
Cooper seufzte und ließ mich wieder los.
»Gut, du kannst gehen«, erklärte er zu meiner Erleichterung.
»Und was ist mit ihm?«, fragte ich und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung des Penners.
»Willst du nun gehen oder nicht?«, forderte Cooper mich auf zu antworten. »Du kannst auch gerne freiwillig mit uns kommen, wenn dir das lieber ist.«
»Er ist ein illegaler Einwanderer«, erklärte Alfie mir einfühlsam. »Ihm wird nichts geschehen. Wir schicken ihn einfach wieder zurück in seine Heimat. Mehr nicht.«
»Geh schon!«, rief der Penner mir zu. »Hau ab, solange du noch kannst.«
Das hier war ein Spiel. Es musste eines sein. Die Angst und Panik, die ich gehabt hatte, waren völlig unbegründet gewesen.
»Seid ihr LARPer?«, fragte ich unsicher.
Die Männer lachten.
Der Professor, der keiner ist
Oder die Wahrheit über die Tinte
Ganz egal, wem ich erzählt hätte, was mir gerade passiert war, man hätte mir wohl geraten, zur Polizei zu gehen. Aber was sollte das schon bringen? Glauben würden sie mir sicher nicht und spätestens nach einem Gespräch mit meiner Mutter wäre ich als Verrückte abgestempelt worden.
So gesehen musste ich meine Meinung wohl revidieren. Wenn ich es jemandem, der mich kannte, erzählt hätte, wäre derjenige nicht auf den Gedanken gekommen, mich zur Polizei zu schicken. Nein, man hätte mich wohl eingewiesen, denn sie alle wussten um meine ausgeprägte Fantasie. Dass die mir eines Tages noch zum Verhängnis werden würde, war mir schon lange klar gewesen und wenn ich heute etwas anders machen könnte, dann wäre ich als Kind wohl nie mit meinen Tagträumen hausieren gegangen.
Auch wenn ich immer noch fest davon überzeugt war, dass diese Männer Rollenspieler gewesen sein mussten, hatte mir das mit den Satellitenfotos doch soweit Respekt eingeflößt, dass ich auf dem Weg zu Jenny, wo immer es möglich war, unter Dächern, Brücken und durch Gebäude gelaufen war.
Nun saßen wir auf Jennys Bett und ein Blick in ihren Spiegel verriet mir, dass ich noch immer kreidebleich war. Kaum zu glauben, aber es war mittlerweile schon so weit mit mir gekommen, dass ich mehr Angst vor ein paar LARPern hatte als vor den Zombies, die ich mir einbildete.
Der Unterschied war wohl, dass das eine meiner Fantasie entsprang und das andere die Fantasien von ein paar ziemlich muskulösen und unerschrockenen Kerlen waren.
Ich entdeckte einen Ast in meinem Haar, zupfte ihn raus und schnipste ihn auf Jennys knallrosa Langflorteppich.
»Und dir geht's wirklich gut?«, fragte Jenny.
»Klar, alles o. k.«, behauptete ich und ließ mich nach hinten sinken.
Gedankenverloren betrachtete ich den künstlichen Sternenhimmel an der Decke und Jenny tat es mir gleich.
»Du wirkst nur so aufgewühlt«, meinte sie.
»Ich habe einfach kein Bock auf Zuhause.«
»Kann ich verstehen.«
Früher einmal waren Jenny und ich beste Freundinnen gewesen. Für mich war sie das immer noch, aber sie hatte mittlerweile die Schule gewechselt und neue Freundinnen gewonnen, mit denen sie viel Zeit verbrachte.
Als wir noch Kinder waren, hatte meine Fantasie unsere Spiele beflügelt. Jenny hing mir damals immer an den Lippen, wenn ich ihr von all den Dingen erzählte, die ich sah. Wir waren Kriegerprinzessinnen auf silbernen Einhörnern gewesen, doch dann wurden wir älter, begannen uns für Jungs zu interessieren und für meine Tagträume blieb kein Platz mehr in der neuen Welt, die sich vor uns auftat.
Auch bei ihr hatte ich den Fehler gemacht, viel zu spät damit aufzuhören, von meinen Fantasien zu erzählen. Oft hatten wir uns deswegen gestritten und nicht selten fielen da Worte wie »verrückt« und »geisteskrank«.
Aber das war vergessen. Ich behielt meine Gedanken für mich und nur manchmal schien es, als würde Jenny noch daran glauben, dass ich diesen Träumereien nachhing. Sie sprach es nie an, wohl, weil sie nicht wieder streiten wollte. Es war eine stillschweigende Vereinbarung zwischen uns beiden. So behielt ich meine Freundin und sie musste niemandem erklären, warum sie sich mit einer Verrückten abgab.
»Ich kann das total verstehen«, sagte Jenny. »Das ist doch wieder typisch, dass deine Mutter den Filmeabend vergisst.«
»Und das alles wegen diesem blöden Bill«, schnaubte ich.
Es klopfte an der Tür und ich saß sofort wieder aufrecht.
»Was ist?«, stöhnte Jenny genervt.
»Seid ihr nackt?«, fragte ihr kleiner Bruder und schob den Kopf durch die Tür.
Jenny feuerte ihm ein Kissen entgegen.
»Wie kommst du denn auf die blöde Idee?«, knurrte sie.
»Was weiß ich denn, was ihr so treibt«, feixte Josh und streckte seiner großen Schwester die Zunge raus.
»Jetzt hau ab oder ich erzähle Mom, dass du versucht hast, mich nackt zu sehen.«
»Dich will niemand nackt sehen!«, konterte Josh und bedachte mich mit einem schmierigen Lächeln.
Eigentlich war Josh ein wirklich niedlicher kleiner Junge. Ich mochte ihn sehr und hatte so manches Mal schon auf ihn aufgepasst, wenn ihre Eltern abends essen waren und eigentlich Jenny die Aufsicht gehabt hätte.
Mittlerweile war er 12 Jahre alt, bekam seine ersten Pickel und begann sich für Mädchen zu interessieren. Unter anderem schien ich ihm ins Auge gefallen zu sein. Ich nahm das als Kompliment. In der Schule – wenn ich dort denn mal aufkreuzte – galt ich als Sonderling, was bei Jungs für gewöhnlich nicht gut ankam. So verbrachte ich mehr Zeit an meinem Handy oder mit der Nase in einem Buch als mit Flirts und Small Talks. Es war nicht so, dass nicht ab und an mal einer zu mir gekommen wäre, um mich zu einer Party einzuladen, doch mehr als Knutschen und Fummeln unter Alkoholeinfluss war nie daraus geworden. Wer mich erst einmal näher kannte, merkte schnell, dass ich nicht so wie andere Mädchen tickte.
»Komm schon, Josh, was willst du hier?«, jammerte Jenny wehleidig.
»Mama fragt, ob Scar über Nacht bleibt«, erklärte er, sah seine Schwester dabei aber nicht an, sondern blickte immer noch zu mir und machte dabei selbstsame akrobatische Kunststücke mit seinen Augenbrauen. »Sie kann bei mir schlafen, wenn du nicht willst.«
Jenny sprang vom Bett und verpasste ihrem Bruder auf dem Weg nach draußen einen Klaps auf den Hinterkopf.
»Das hättest du wohl gern!«, sagte sie und lief in den Gang. Kaum verschwunden, hörte ich sie schon nach ihrer Mutter rufen.
»Und wir beide, was machen wir jetzt?«, fragte Josh und sprang neben mich aufs Bett.
»Keine Ahnung, Joshi, was willst du denn machen?«, fragte ich und sah ihn herausfordernd an.
Joshs Augen weiteten sich und seine Wangen liefen rot an.
»Ich … Ich …«, stammelte er, als ich ihm ein Stück näher kam.
Ich lachte und zerzauste ihm das Haar.
»Ach, du bist süß, Joshi! Ich wünschte, ich hätte auch so einen Bruder.«
»Wirklich?«, fragte er ganz verlegen.
»Ja, wirklich.« Ich drückte ihm einen Kuss auf die Wange.
Josh starrte ganz verklärt in den Raum und sagte nichts mehr. Als Jenny zurückkam, sprang er auf und rannte davon, ehe sie sich darüber beschweren konnte, dass er auf ihrem Bett gesessen hatte.
»Mom sagt, du darfst bleiben«, erklärte Jenny, die ihrem Bruder verwundert nachsah. Dann wandte sie sich mir zu. »Disneymarathon?«, fragte sie.
Ich nickte lächelnd. Als Kinder hatten wir die Disneymärchen rauf und runter geschaut und uns darum gestritten, Cinderella zu sein.
»Und dazu Kakao mit Marshmallows?«, fragte ich.
Jenny sah mich völlig entgeistert an. »Gibt's da Alternativen?«
Ich grinste schief. »Nutella aus dem Glas?«
»Das eine schließt das andere doch wohl nicht aus«, meinte Jenny und ging zu ihrem Regal, wo ihre Disney Blu-Rays standen.
***
Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich am nächsten Tag wieder unter freiem Himmel stand. Wir hatten uns die Nacht mit Cinderella, Die Schöne und das Biest und Schneewittchen um die Ohren geschlagen, über allmögliches getratscht und viel gelacht. Doch irgendwann musste ich auch wieder heim und mich meiner Mutter stellen.
So wie ich sie kannte, würde sie unseren Streit ignorieren und damit auch die Tatsache, dass sie den gemeinsamen Filmeabend vergessen hatte. Solange sie nicht darauf zu sprechen kam, dass ich heute nicht zur Schule ging, war mir das aber recht. Meine Gedanken drehten sich gerade ohnehin um ganz andere Dinge.
Ich konnte Cooper einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Was steckte wirklich hinter ihm und dem gestrigen Vorfall? Wären wir uns unter anderen Umständen begegnet, hätte ich wegen ihm wohl Herzklopfen bekommen. Doch des Nachts, nach einer nervenaufreibenden Verfolgungsjagd und nachdem auf mich geschossen wurde, hatte mein Herz mir auch so schon bis zum Hals geschlagen.
Zu allem Übel war mein Fahrrad auch nicht mehr dort, wo ich es zuletzt gesehen hatte. Es die ganze Nacht auf dem Weg liegen zu lassen, musste ja mit einem Diebstahl enden.
Mich hätten an dem Abend aber keine hundert Pferde mehr dazu gebracht, zurückzulaufen, nachdem Cooper mich hatte gehen lassen.
Den Weg nach Hause zu Fuß zurückzulegen, kostete mich eine ganze Stunde und bescherte mir schmerzhafte Wadenkrämpfe.
Ich war so erleichtert, als ich endlich vor dem tristen Zementblock stand, in dem mein Zuhause lag, dass ich die schwarze Limousine auf der gegenüberliegenden Straßenseite zuerst gar nicht bemerkte.
Erst als ich nach meinem Schlüssel kramte, fiel mir ihre Reflektion in der verglasten Eingangstür ins Auge. Ich wagte es nicht, mich umzudrehen.
Dieses Viertel war nicht der Ort für solche Autos. Wenn sich hierher mal ein Wagen verirrte, der nicht von Beulen übersät und dessen Lack nicht rostig und verkratzt war, dann nur deswegen, weil der Besitzer sich verfahren hatte.
Ich redete mir ein, dass das sicher nicht im Zusammenhang mit den gestrigen Vorfällen stand. Das hier war schließlich kein Krimi, sondern mein langweiliges, ödes Leben – dem ich zwar entkommen wollte, aber nicht indem ich in das Visier irgendwelcher Geheimorganisationen geriet.
Ich schlüpfte ins Haus und nahm die Treppe. Der Fahrstuhl war schon seit Monaten kaputt, sodass ich mich erschöpft und mit schmerzenden Beinen die vier Stockwerke nach oben kämpfen musste.
Das Auto auf der anderen Straßenseite hatte ich schon beinahe vergessen, als ich endlich vor der Wohnungstür stand, und wäre da nicht die männliche Stimme gewesen, die ich dahinter hören konnte, wäre es wohl ganz in mein Unterbewusstsein gerückt.
Da war jemand in der Wohnung und unterhielt sich mit meiner Mutter. Bill vielleicht? War die Limo sein Wagen? Ich warf einen flüchtigen Blick auf mein Handy. Ihre Schicht begann erst in zwei Stunden. Warum war ich solange nicht in ein Café gegangen und hatte mir die Zeit dort mit Lesen vertrieben?
Ich atmete tief durch, dann sperrte ich auf und betrat die Wohnung. Erleichterung machte sich in mir breit, als ich die beiden in der Küche hörte, sodass ich unbehelligt in meinem Zimmer verschwinden konnte, ohne an ihnen vorbeizumüssen.
Ich schlich durch den Gang und schloss die Tür hinter mir. Bill zu begegnen, hätte dem ganzen Ärger noch die Krone aufgesetzt. Ich wollte jetzt einfach nur noch in mein Bett und vergessen, was ich die Nacht gesehen hatte.
Mein Herz machte einen Satz, als mein Handy zu vibrieren begann. Jenny fragte in einer WhatsApp-Nachricht, ob ich schon in der Schule sei. Sie hätte sicher nicht zugelassen, dass ich dort nur sporadisch auftauchte, wenn wir noch dieselbe besuchen würden.
Schnell tippte ich eine Antwort und schlenderte zu meinem Schreibtisch, da öffnete jemand die Zimmertür, die ich vergessen hatte abzuschließen.
Ich erwartete meine Mutter, die mir unterbreiten wolle, wie wichtig es sei, dass ich mich mit Bill aussprach, oder etwas in der Art. Doch es war weder sie noch Bill. Es war Cooper.
Den Schrecken musste man mir vom Gesicht ablesen können, denn er grinste breit und überlegen, als er mich sah.
Mir wurde schwindelig.
Ich fischte mit der Hand nach meinem Bürostuhl, um mich daran abzustützen, griff daneben, landete mit dem Hintern erst auf der Kante des Sitzes und dann auf dem Boden, als der Stuhl wegrollte und mich wie ein tollpatschiges Kleinkind aussehen ließ.
Meine Mutter drängte sich an Cooper vorbei und half mir auf.
»Hast du dir etwas getan?«, fragte sie.
Ich war nicht fähig zu antworten. Was tat dieser Kerl hier? Und vor allem: Wie hatte er mich gefunden?
»Normalerweise ist sie nicht so ungeschickt«, entschuldigte meine Mutter sich verlegen.
Ich sah sie verwirrt an.
»Ach, wir suchen unsere Kandidaten nicht nach ihrem Gleichgewichtssinn aus, da machen Sie sich mal keine Gedanken, Ms McLaren«, meinte Cooper abwinkend.
Nun sah ich verwirrt zu ihm. Was zur Hölle ging hier vor? Ich wünschte, es wäre mir gelungen, meine Stimme wiederzufinden, dann hätte ich diese Frage laut ausgesprochen. Ich räusperte mich, was sich erbärmlich anhörte, und öffnete dann den Mund, ohne einen weiteren Ton über die Lippen zu bekommen.
»Das hier ist Professor Cooper von der Eliteuniversität in …« Meine Mutter sah Cooper verlegen an.
»Davenport«, ergänzte er mit einem Nicken.
»Illinois?«, krächzte ich.
»Iowa«, verbesserte er mich.
»Iowa, USA?«, fragte ich noch immer ungläubig.
Das ergab keinen Sinn. Dieser Mistkerl log meiner Mutter ins Gesicht ohne rot zu werden. Ihm musste doch klar sein, dass ich nicht daran glaubte, der gestrige Vorfall wäre ein Universitätsausflug gewesen. Mal eben um die halbe Welt reisen, um in einem Park fangen zu spielen? Wohl kaum.
»Nun halt dich fest!«, begann meine Mutter mit überschwänglicher Begeisterung. »Du erinnerst dich doch an diesen Test, ja? Der Eignungstest für die Uni. Rate mal, wen du mit deinen Ergebnissen überzeugen konntest.«
»Niemanden, weil ich den Test geschwänzt habe«, sagte ich trocken und fixierte Cooper dabei durch zusammengekniffene Augen. Ihn brachte das kein Stück weit aus der Fassung.
»Nur keine falsche Bescheidenheit«, sagte er. »So ein Ergebnis wie deines nennen wir bei uns einen Madhead-Treffer. Das kommt nicht allzu häufig vor.«
»Vielleicht, weil es sich ganz nach einer Beleidigung anhört?«, konterte ich.
Cooper lachte. »Das ist es ganz bestimmt nicht. Es soll heißen, dass du ganz unkonventionell denken kannst.«
»Hörst du? Du bist etwas Besonderes. Habe ich es nicht immer gesagt?« Meine Mutter strahlte regelrecht.
Aber nein, das hatte sie nicht. Nicht einmal gedacht hatte sie es. Sie hielt mich für verrückt, so wie mein Vater es war, und war nun erleichtert, dass jemand ihr weismachen wollte, meine Verrücktheit wäre in Wirklichkeit Genialität.
»Wer's glaubt …«, schnaubte ich.
»Ist es nicht so, dass du eine ausgeprägte Fantasie hast?«, fragte Cooper und sah mich durchdringend an. »Siehst du nicht Dinge, für die andere kein Auge haben? Oder etwa nicht?«
Woher wusste er das? Er konnte unmöglich mitbekommen haben, was ich sah. Seit zehn Jahren war mir kein Wort mehr darüber über die Lippen gekommen. Hatte meine Mutter ihm etwa ihr Herz ausgeschüttet? Einem völlig Fremden?
»Ich will, dass Sie auf der Stelle mein Zimmer verlassen«, sagte ich mit fester Stimme.
»Aber Scarlett!«, fuhr meine Mutter mich empört an.
Dass sie meinen vollen Namen nutzte, hieß schon einiges. Aber ich konnte mir das nicht länger anhören. Wer auch immer dieser Mann war, er ging zu weit.
Cooper hob abwiegelnd die Hand.
»Schon gut, Ms McLaren, lassen wir ihr etwas Zeit.« Er deutete auf die Tür und ließ meiner Mutter den Vortritt. »Kommen Sie?«
Sollte ich sie wirklich mit ihm alleine lassen? Es konnte gut sein, dass er gefährlich war. Ich wusste doch nichts über ihn und die Männer, für die er arbeitete.
Cooper war bereits im Begriff die Tür zu schließen, als er doch noch einmal innehielt und mich mit gesenkter Stimme ansprach.
»Du hast völlig recht. Es gibt keine Uni und ich bin auch kein Professor. Deine Testergebnisse, sofern es welche gibt, interessieren uns nicht. Aber deine Mutter können wir doch in diesem Glauben lassen, oder?« Er wartete darauf, dass ich etwas entgegnete, und fuhr dann fort, als das nicht geschah. »Eliteuniversität hört sich für eine Mutter immer besser an als streng geheime Organisation.« Er nickte in Richtung Küche. »Kommst du jetzt oder willst du mich wirklich mit dieser hypereuphorischen Frau alleine lassen?«
Ich knirschte mit den Zähnen. Natürlich wollte ich das nicht. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Trotzig stapfte ich auf ihn zu und riss ihm die Tür aus der Hand.
»Meine Mom zu beleidigen bringt keine Pluspunkte«, knurrte ich, stieß ihn zur Seite und folgte meiner Mutter in die Küche.
Dieser Cooper war das lebende Beispiel dafür, wie schlecht einem Mann zu viel Selbstbewusstsein bekommen konnte. Er war jung – zu jung für einen Professor, was meine Mutter scheinbar nicht sehen wollte – und sah verdammt gut aus. Mit diesem verwegenen Blick und dem verschmitzten Lächeln hatte er sicher schon so manches Mädchen schwach werden lassen. Auch meine Mutter wickelte er damit schnell um den Finger. Wäre er ein paar Jahre älter oder sie ein paar Jahre jünger, würde er gut in die Reihe ihrer Liebhaber passen. Vom selben Schlag war er jedenfalls. Überheblich, arrogant und selbstverliebt.
Doch davon wollte ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich war zu neugierig darauf, zu erfahren, was hinter der ganzen Sache steckte, um mich von ihm ablenken zu lassen.
Am Küchentisch saß ich vor meiner Tasse dampfendem Cadbury-Kakao und lauschte argwöhnisch Coopers Erzählungen über seine frei erfundene Eliteuniversität.
Nach einer Weile wusste ich, woran mich das, was er da von sich gab, erinnerte. Es klang ganz nach dem Internat aus dem Club der toten Dichter.
O Captain, mein Captain, dachte ich mir missmutig und rührte in meiner Tasse.
Meine Mutter hingegen war von den Lügen, die Cooper ihr auftischte, hellauf begeistert. Immer wieder nickte sie eifrig und tätschelte aufmunternd meinen Arm.
»Es ist natürlich Ihre Entscheidung«, beendete Cooper seine Rede mit einer ausholenden Geste und ergänzte mir zuzwinkernd: »Und deine.«
»Und Sie sagen, es wäre ein volles Stipendium?«, hakte meiner Mutter nach.
»So ist es«, bestätigte er, zog sich seinen Aktenkoffer auf den Schoß und kramte ein paar Unterlagen hervor.
Er legte eine Broschüre auf den Tisch, auf deren Einband ein Universitätsgebäude abgebildet war. Bevor meine Mutter zugreifen konnte, schnappte ich mir das Heft und blätterte es eilig durch.
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Das wirkte alles echt. Jede Menge Fotos von glücklichen Studenten, ein Wappen, ausführliche Texte, Kursangebote, alles darin wirkte wie eine echte Werbebroschüre für eine echte Universität.
Cooper reichte meiner Mutter ein paar Formulare. Anmeldeformular, Stipendienanträge, Fragebögen, weiterführende Informationen.
Diese ganze Sache war nahezu perfekt ausgetüftelt. Von dem Gedanken, Cooper und seine Leute könnten Rollenspieler sein, war ich längst abgekommen. Dazu war er einfach zu gut. Ich zog mein Handy aus der Tasche und googelte die Uni. Natürlich, es gab eine Internetseite, eine Adresse, Telefonnummern, Zeitungsartikel. Alles.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, murmelte meine Mutter.
»Lassen Sie sich ruhig Zeit«, beruhigte Cooper sie. »Die Anmeldefrist läuft ja noch ganze drei Tage.«
Erschrocken sah sie zu ihm auf. Viel Zeit war das nicht gerade, um zu entscheiden, ob sie ihre Tochter in ein anderes Land schicken solle.
»Ich habe da noch ein paar Fragen«, sprach ich Cooper an. Es war das Erste, was ich sagte, seit wir am Küchentisch saßen und ich mir seine Lügen anhören musste.
Er lächelte durchtrieben, als er das hörte.
»Unter vier Augen?«, fragte er. »Deine Mutter will sich sicher auf die Unterlagen konzentrieren.«
»Unter vier Augen«, bestätigte ich.
»Ja, geht nur«, sagte meine Mutter gedankenversunken, wobei sie den Blick nicht von dem Papierstapel hob, den sie vor sich liegen hatte.
Wir gingen zurück in mein Zimmer, wo ich die Tür hinter Cooper schloss und mich dagegen lehnte, als könne er mir davonlaufen, ehe ich Antworten bekam.
»Wie soll ich Sie nennen?«, fragte ich. »Professor? Coop?«
»Wenn du magst, nenn mich Chris, und das Sie kannst du dir auch sparen«, meinte er.
»Also Cooper«, sagte ich und nickte ihm auffordernd zu. »Und jetzt raus mit der Wahrheit. Wie habt ihr mich gefunden, was wollt ihr von meiner Mutter und was ist da gestern vor sich gegangen?«
»Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass deine Fantasien gar keine sind?«, fragte er.
»Nein«, antwortete ich und schüttelte ungläubig den Kopf.
»Aber du fragst dich, woher ich davon weiß, nicht wahr?«
Darüber hatte ich mir in der letzten halben Stunde tatsächlich den Kopf zerbrochen und auch eine Antwort gefunden.
»Ihr habt mich gefunden, ohne meinen Namen zu kennen, und du bist hier mit einem Stapel verdammt echt wirkender Unterlagen aufgekreuzt. Ich traue euch durchaus zu, einen Blick in meine Schulakte geworfen zu haben.«
Wieder lachte er auf diese überlegene, freche Art und Weise.
»Punkt für dich«, sagte er.
»Ich wusste nicht, dass hier mitgezählt wird«, knurrte ich zurück.
»Okay, wir hatten einen schlechten Start«, seufzte er, deutete auf mein Bett und bat mich damit, mich zu setzen. Er selbst nahm auf meinem Bürostuhl Platz.
»Zuerst musst du wissen, dass neben unserer Welt noch eine zweite existiert«, begann er.
Ich sah ihn ungläubig an, unterbrach ihn aber nicht. Ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich mir wirklich alles vorstellen konnte. Ob ich ihm glaubte, stand wieder auf einem anderen Blatt geschrieben.
»Sie existiert parallel zu unserer und das schon seit einigen hundert Jahren.«
»Nicht sehr lange«, meinte ich.
»Das stimmt«, bestätigte er. »Sie ist auch nicht wie unsere Erde oder der Rest unseres Universums entstanden. Sie wurde geschaffen. Wie genau, weiß keiner, nur, dass sie geschrieben wurde.«
»Geschrieben?«, fragte ich.
»So ist es. Vor einiger Zeit begann sich unser geschriebenes Wort in einer parallelen Welt zu manifestieren. Wir haben selbst auch nur bruchstückhafte Informationen darüber. Klar ist, dass diese Welt aus Geschichten besteht, die mit Tinte niedergeschrieben wurden.«
»Mit Tinte?«, fragte ich und nahm mir fest vor, keine weiteren dummen Fragen zu stellen, die aus der Wiederholung seiner Worte bestanden.
»Ja, mit Stift und Papier. Neuere Geschichten, die nur auf digitalem Wege existieren, scheinen keinen Einfluss auf diese Welt zu haben.«
»Und das wisst ihr, weil ihr Expeditionen in diese andere Welt geschickt habt, oder woher?«, fragte ich.
Es wunderte mich selbst, wie leicht es mir fiel, zu akzeptieren, was er da sagte. Es kam mir vor, als hätte ich es eigentlich schon längst gewusst. Die Welt, die ich vermeintlich in meiner Fantasie sah, war für mich als Kind schon so real gewesen, dass Coopers Worte wie eine Bestätigung von dem klangen, was in meinem Unterbewusstsein längst schon unumstößlich und Fakt geworden war.
»Nein, wir sind nicht in der Lage, die andere Welt zu bereisen«, erklärte er. »Wir haben dieses Wissen von den Inks. Von Menschen aus der anderen Welt, die in unserer landen. Es ist so, dass uns deren Existenz erst seit wenigen Jahren bekannt ist. Bis dahin waren beide Welten stabil und voneinander getrennt, doch das hat sich geändert.«
»Und wer ist wir?«, wollte ich wissen. »Wer weiß davon und wieso weiß es nicht der Rest der Welt?«
»Die Regierung«, sagte er. »Unsere Regierung, die einiger UN-Staaten, die USA, Kanada. Sie wissen es, wissen von unserer Existenz und schweigen sich darüber aus. Wir tun, was wir tun müssen, und die Regierungen sorgen dafür, dass unsere Spuren verwischt werden.«
»Und wer seid ihr?«
»Wir sind die Gutenberg Organisation.«
Ich erinnerte mich an den Namen der Eliteuniversität. Good Mountain University. Ein ziemlich schlechter Tarnname, wenn man darüber nachdachte. Andererseits spielte das wohl keine Rolle, wenn man einer Organisation angehörte, die von allen eingeweihten Regierungen gedeckt wurde.
»Gutenberg … das ist doch diese Bibel, oder?«, fragte ich.
»Gutenberg ist der Herr, der im westlichen Raum den Buchdruck erfunden hat«, verbesserte Cooper mich.
»Und alle machen ein großes Geheimnis daraus.«
»Es ist besser so«, meinte er. »Was, glaubst du, passiert, wenn jedermann weiß, wie mächtig das geschriebene Wort ist?«
Das wollte ich mir nicht unbedingt ausmalen. Diese Welt hatte schon Probleme genug, da musste nicht auch noch eine zweite hinzukommen.
»Die Welten sind jetzt instabil, hast du gesagt«, drängte ich ihn, fortzufahren.
»So ist es. Dadurch, dass kaum noch von Hand geschrieben wird, gelangt nur noch wenig neues Input in die andere Welt, was sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Es entstanden Risse in der Membran zwischen den Welten. Durch die wurden wir auf das parallele Universum aufmerksam.«
»Und durch die Risse kommen Menschen zu uns?«, fragte ich.
»So ist es«, bestätigte Cooper. »Der Mann, dem du gestern begegnet bist, gehört zu diesen Menschen. Sie sind in unserer Welt oft verloren. Es fällt uns schwer, zu verstehen, was sie sagen, und umgekehrt ist ihnen unsere Welt natürlich total fremd. Wir stöbern sie auf und bringen sie zurück. Das ist alles, was wir momentan tun können.«
»Damit ich das richtig verstehe: Wenn ich jetzt ein Blatt und einen Stift hole und irgendetwas aufschreibe, beginnt es in der anderen Welt zu existieren, ja? Könnte dann nicht jemand aufschreiben, dass die Welt wieder stabil wird und die Risse verschwinden?«
»So einfach ist das leider nicht. Was du aufschreibst, vermischt sich nur mit den anderen Geschichten. Es ist ein kleiner Tropfen im großen Meer. Wir müssten die ganze Welt dazu bewegen, den gleichen Text niederzuschreiben, um einen Effekt erwirken zu können. Abgesehen davon glauben wir nicht, dass das der richtige Weg sein kann. Das Niederschreiben der vielen Geschichten hat uns erst in diese Situation gebracht. Niemand, der von der anderen Welt weiß, schreibt mehr von Hand oder erfindet Geschichten. Wenn man erst einmal weiß, dass sie wahr werden könnten und welche Verantwortung damit einhergeht, überlegt man es sich zweimal, ob man nicht besser das Handy benutzt.«
Bei mir bewirkte dieses Wissen das genaue Gegenteil. Am liebsten hätte ich mich gleich darangesetzt, ganze Bücher niederzuschreiben. Ich hatte in meinem Leben schon so viele wundersame Dinge gesehen und geglaubt, sie entsprängen meiner Fantasie. Dabei waren es die Fantasien anderer gewesen. Es juckte mich in den Fingern, dieser anderen Welt nur ein wenig von mir hinzuzufügen. Selbst wenn es nur ein kleiner Tropfen war, wie Cooper sagte, hörte es sich doch fantastisch an.
»Die Welt wurde aber doch instabil, weil die Leute weniger schreiben, oder?«, fragte ich. »Wird es dann nicht schlimmer?«
Das Mädchen mit dem Einhornrucksack
Oder was ich mit Penny aus The Big Bang Theory gemeinsam habe
Man sollte meinen, es wäre mir leichtgefallen, meinem alten Leben den Rücken zu kehren. Meine Mutter und ich waren von so unterschiedlichem Schlag, wie zwei Menschen nur sein konnten, und wirklich viele Freunde hatte ich nicht. Hatte ich mir nicht immer ein Leben voller Abenteuer gewünscht?
Diese ganze Geschichte nahm den besten Lauf, den sie hätte nehmen können. Statt mit Betonschuhen im Fluss zu landen, wurde ich eingeladen, mich einer Organisation anzuschließen, die sich berufen fühlte, die Welt zu retten. Vielleicht war das etwas übertrieben, aber es fühlte sich so an.
Trotz alledem zögerte ich. Cooper hatte sich wohl eine direkte Antwort von mir erhofft. Wahrscheinlich erwartete er sogar, dass ich kreischend im Kreis hüpfte, wie ein verrückter Groupie, der gerade Backstagekarten seiner Lieblingsband ergattert hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!