
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Ender-Saga
- Sprache: Deutsch
Alles nur ein Spiel ...
Nur dem äußeren Anschein nach ist Andrew Wiggin, genannt Ender, ein ganz normaler Junge. Tatsächlich hat man ihn dazu auserwählt, zu einem militärischen Genie zu werden, das die Welt braucht, um einen übermächtigen Feind zu besiegen. Aber Enders Geschichte verläuft anders, als es die Militärs geplant haben. Völlig anders … Mit »Enders Spiel« hat Orson Scott Card einen einzigartigen dystopischen Roman geschrieben – mit einem Helden, den man nie mehr vergisst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Vor Jahrzehnten ist die Erde von insektenähnlichen Aliens, den so genannten Krabblern, angegriffen worden. In einer verzweifelten Aktion konnte die Invasion zurückgeschlagen werden, doch die Angst sitzt den Menschen im Nacken. Die Militärs suchen nach dem Strategen, der die Krabbler beim nächsten Überfall endgültig besiegen kann – und in dem jungen, hochbegabten Ender Wiggin meinen sie diesen Strategen gefunden zu haben. Doch niemand ahnt, dass mit Enders Ausbildung auf der Militärschule ein Prozess in Gang gesetzt wird, der die menschliche Zivilisation für immer verändern wird …
Ausgezeichnet mit dem Nebula Award und dem Hugo Gernsback Award als bester SF-Roman des Jahres 1985, zählt »Das große Spiel« zu den bedeutendsten Romanen der neueren Science Fiction, ein Klassiker, der bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat.
»Ein einzigartiges Buch! Orson Scott Card hat sich damit in das Pantheon der SF-Autoren geschrieben.« Entertainment Weekly
Der Autor
Orson Scott Card, geboren 1951 in Richland/Washington, studierte englische Literatur und arbeitete als Theaterautor, bevor er sich ganz dem Schreiben von Science-Fiction- und Fantasy-Romanen widmete. »Das große Spiel«, sein erster Erfolg in der Science Fiction, wurde weltweit millionenfach verkauft. Card lebt mit seiner Familie in Greensboro/North Carolina.
Mehr zu Autor und Werk unter: www.hatrack.com
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
von Andreas Brandhorst
Als ich gebeten wurde, ein Vorwort zu »Das große Spiel« zu schreiben, begann eine kleine Zeitreise für mich. Fast zwanzig Jahre kehrte ich in die Vergangenheit zurück, in die Zeit, als ich diesen Roman von Orson Scott Card zum ersten Mal gelesen hatte. Damals existierte die Sowjetunion noch, und niemand hätte den Fall der Berliner Mauer in naher Zukunft für möglich gehalten – eine ähnlich zweigeteilte Welt wie auch die, in der Ender, der Held des Buches, lebt und leidet. Als ich beschloss, den Roman noch einmal zu lesen, war das eine sehr interessante Erfahrung, und sie bestätigt eine Wahrheit, die ich als Autor ebenso gut kenne wie Orson Scott Card und auf die er in seiner Vorbemerkung selbst hinweist: Die Geschichte, die das Buch erzählt, ist nicht fertig, sondern sie entsteht erst im Kopf des Lesers.
Ich glaube, genau hier liegt der Schlüssel für das Verständnis eines Buches, das in den USA sehr umstritten ist. Card betont, eine geradlinige Geschichte erzählt zu haben, ohne doppelte Bedeutung und Hintergründigkeiten, die manche Literatukritiker so sehr lieben. Aber wenn seine Geschichte so gerade und direkt ist, wie kommt es dann, dass sie so unterschiedliche Echos auslöst? Manche hassen »Das große Spiel« zutiefst, andere lieben es und finden den Roman »zum Heulen schön«, wie es kürzlich in einer Rezension hieß.
Die amerikanischen Diskussionen um »Das große Spiel« werden nicht unerheblich davon beeinflusst, dass Orson Scott Card Mormone ist – trotz der angeblichen religiösen Toleranz in den Vereinigten Staaten. Bei den Reaktionen in Europa hingegen spielt dieser Punkt so gut wie keine Rolle, und Cards persönlicher Glaube lässt sich zumindest aus diesem Buch nicht herauslesen (aus anderen schon). Der einzige unmittelbare religiöse Aspekt sind heimliche Taufen, die aber in Hinsicht auf Handlung und Struktur des Buches nicht relevant sind. Trotzdem gibt es auch bei uns sehr kritische Stimmen. »Das große Spiel« scheint niemanden unberührt zu lassen: Entweder man findet den Roman sehr gut oder sehr schlecht; für Wertungen dazwischen gibt es offenbar nicht viel Platz. Jene, die ihn für sehr schlecht halten, führen fast immer politische Gründe an.
Meine kleine Zeitreise brachte mich der Antwort auf die Frage nach dem Warum näher. Ich gewann den Eindruck, zwei verschiedene Bücher gelesen zu haben. Die Saat der »Hoffnung auf eine Geschichte«, wie Card seinen Roman in der Vorbemerkung nennt, ging in meinem älteren Selbst anders auf als im jüngeren. Und wenn ich, der ich doch im Wesentlichen der gleiche Mensch bin, nur gewachsen und gereift, zwei Bücher in einem sehen kann – um wie viel mehr müssen sich dann die einzelnen, in den Köpfen der Leser entstehenden Romanversionen voneinander unterscheiden?
Die Lösung des Rätsels sind »geistiger Nährboden« und »Blickwinkel«. Ich kann das Buch aus einer politischen Perspektive sehen, muss dazu aber den Hinweis des Autors überhören, dass er es ohne solche Absichten geschrieben hat. Wer sich einen solchen Blickwinkel zu Eigen macht und die Saat der Geschichte im eigenen geistigen Nährboden nur an jenen Stellen aufgehen lässt, wo sie ins eigene Weltbild passt, mag imstande sein, dort militaristische oder gar »faschistoide« Tendenzen zu erkennen, wo sie meiner Meinung nach nicht existieren. Eine solche Betrachtungsweise ist nicht nur subjektiv, sondern extrem eingeengt, und sie lässt völlig unberücksichtigt, was im Mittelpunkt von »Das große Spiel« steht: die Entwicklung von außerordentlich begabten Kindern im Allgemeinen und des Jungen namens Ender im Besondern.
Es geht auch um das Militär, um die Ausbildung von Soldaten, um den Kampf der Menschheit gegen die Krabbler, intelligente Insektenwesen, die die Menschheit schon einmal angegriffen haben – und vernichtet hätten, wenn nicht das militärische Genie des legendären Mazer Rackham gewesen wäre. Es geht um einen neuen drohenden Krieg gegen die Krabbler, um Wir oder sie, um die Evolution, die angeblich das völlige Auslöschen des Gegners fordert. Aber wer allein diese Dinge sieht, bleibt in der Requisitenkammer des Theaters und verpasst die Vorstellung auf der Bühne. Die eigentliche Geschichte spielt sich in Köpfen ab, und diesmal meine ich nicht in erster Linie die Köpfe der Leser, sondern die der Protagonisten. »Das große Spiel« ist ein zutiefst psychologischer Roman. Und er betrifft uns alle – denn wir alle sind einmal Kinder gewesen.
Ich erinnere mich an ähnliche Diskussionen in Bezug auf »Der ewige Krieg« von Joe Haldeman und »Die denkenden Wälder« von Alan Dean Foster, ihrerseits zwei sehr erfolgreiche – und sehr empfehlenswerte – Romane, die überschwängliches Lob und harte Kritik einheimsten. Haldeman schrieb mit »Der ewige Krieg« einen Roman, der sich gegen Gewalt, Militär und Krieg richtete, doch seine Kritiker warfen ihm ausgerechnet Gewaltverherrlichung vor, wobei sie vergaßen und vergessen: Die Darstellung von Gewalt ist nicht mit ihrer positiven Bewertung gleichzusetzen. In »Die denkenden Wälder« beschreibt Foster eine extrem feindselige Umwelt, einen Dschungel, der einer Hölle gleichkommt. Manchen Leuten gelang es tatsächlich, daraus eine antiökologische Einstellung abzuleiten, eine Tendenz nach dem Motto »Die Natur ist feindlich, und wir müssen uns gegen sie durchsetzen«. Man braucht jedoch nur ein wenig die eigene Perspektive zu verschieben, um ein ganz anderes Bild zu sehen: Die Natur ist feindlich, wenn wir uns gegen sie stellen; sie wird zum Gegner, wenn wir sie nicht verstehen und kein Gleichgewicht mit ihr suchen.
Ähnlich verhält es sich mit »Das große Spiel«. Die Requisitenkammer steckt voller Dinge, die man hässlich finden kann, aber deshalb muss das Stück auf der Bühne nicht hässlich sein.
Als meine kleine Zeitreise zu Ende ging, als ich die beiden Welten des Damals und Heute nebeneinander betrachten konnte, wurde schnell deutlich, dass der Roman um Ender natürlich ein Kind seiner Zeit ist, und einige der vor zwanzig Jahren beschriebenen Dinge erscheinen heute in anderem Licht. Ganz abgesehen davon, dass zur Zeit von Ender eine Neuauflage des Warschauer Pakts existiert, der sich zwar mit dem Rest der Welt zur Liga zusammengeschlossen hat, weil die Krabbler die ganze Menschheit bedrohen, aber noch immer eine Gefahr darstellt – beim Gedanken an eine vor zwanzig Jahren wünschenswerte »Pax Americana« dürfte heute so manchem grausen. Bush als Retter der Welt? Rumsfeld als Wächter von Recht und Ordnung? Und Condy Rice als Friedenstaube? Und dann das Netz, das für Enders Geschwister Valentine und Peter eine so große Rolle spielt. Heute, ans Internet gewöhnt, an globale Vernetzung, belächelt man manche Beschreibungen in »Das große Spiel«. Doch als der Roman 1985 erschien, war der IBM-PC, mit dem der Siegeszug des Personal Computers begann (Apple-Fans mögen mir verzeihen), mal gerade vier Jahre alt, und zwei Jahre später, 1987, entstand überhaupt erst der Begriff »Internet«, in dem damals sage und schreibe 27 000 Rechner miteinander verbunden waren. Als Orson Scott Card »Ender’s Game« schrieb (die Romanfassung, von der Story-Version Jahre zuvor ganz zu schweigen), war noch nicht abzusehen, was ein »Netz« aus hunderten von Millionen Computern wirklich bedeuten würde.
Dass Valentine und Peter, Enders Schwester und Bruder – zwei Personen mit äußerst nachhaltigem Einfluss auf seine psychologische Entwicklung – das Netz nutzen können, um unter Pseudonymen großen politischen Einfluss zu gewinnen, erscheint aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar. Es entspricht in gewisser Weise der amerikanischen Vorstellung vom »freien Wort«, das Dinge in Bewegung setzt, wenn es an der richtigen Stelle ertönt. Doch um wirklich etwas zu bewirken, braucht man Macht, und die gewinnt man nicht in irgendwelchen Chat-Räumen und Internet-Foren. Solche Dinge, die damals Science Fiction waren und heute Teil unserer Realität sind, wie globale Computernetze, finden sich auch bei anderen Klassikern, zum Beispiel in den Werken von Arthur C. Clarke und Isaac Asimov: Manche Darstellungen sind inzwischen von der Wirklichkeit eingeholt und sogar überholt, aber die Romane sind dadurch nicht weniger lesenswert.
Der Umstand, dass Computer und Computernetze in »Das große Spiel« von zentraler Bedeutung sind, hat auch noch einen anderen interessanten Aspekt: Erstaunlicherweise hat Card in diesem Zusammenhang schon damals die Frage nach der Realität gestellt – eine Frage, die später mit der Cyber-Entwicklung in der SF (man denke nur an die »Neuromancer«-Trilogie von William Gibson) in den Vordergrund rückte.
Verlassen wir die Requisitenkammer und treten in den Zuschauerraum, um zu sehen, was auf der Bühne geschieht. Worum geht es in »Das große Spiel«? Warum ist die Geschichte »zum Heulen schön«? Warum hat sie mich damals gefesselt und auch heute berührt? Warum lieben so viele Leser dieses Buch?
Weil es abgesehen von den vielen interpretativen Versionen und Variationen in den einzelnen Leserköpfen auch Gemeinsames gibt, etwas, das sie alle gleichermaßen anspricht: Enders Schicksal, und auch das der anderen Kinder, wie Petra und Bohne. Enders Erlebnisse wecken Anteilnahme in uns. Wir wachsen mit ihm, wenn er lernt, Hindernisse zu überwinden und Probleme zu lösen. Wir sind mit ihm einsam. Wir sehnen uns mit ihm nach Wärme und Geborgenheit. Denn wir alle haben seinen Schmerz erfahren, manche von uns mehr, andere weniger: den Schmerz, die Träume und Illusionen der Kindheit zu verlieren und erwachsen zu werden. Der friedliche, liebe Ender, der eigentlich niemandem etwas zuleide tun möchte, wird gezwungen zu töten, und diese Fähigkeit entwickelt er bis zur Perfektion, weil man es von ihm erwartet – er kann die Welt der Erwachsenen nicht kontrollieren, muss sich ihr fügen. Die wenigen Freiräume, die ihm bleiben, nutzt er für seine ewige Suche nach Zuneigung und Liebe: Ender, eine Art Werther der Zukunft, jemand, der immer mehr an sich selbst leidet. Erst zum Schluss, als er die Wahrheit erkennt, gelingt es ihm, über sich selbst hinauszuwachsen – und auch über das, was man ihm angetan hat. Denn trotz der Vernichtungsmaschine, zu der man ihn gemacht hat, ist er vor allem Opfer und nicht Täter.
Das ist es, was »Das große Spiel« zu einem großen Roman macht, der mich auch nach zwanzig Jahren wieder beeindruckt hat: das tiefe menschliche Element.
Seien Sie also gewarnt: Dieses Buch wird Ihnen eine mitreißende Geschichte von Verantwortung und Leid erzählen, und vielleicht erkennen Sie an manchen Stellen Ihre eigenen Empfindungen aus der Kindheit wieder, aus dem manchmal sehr schmerzhaften Übergang zwischen Traum und Realität.
Andreas Brandhorst ist einer der bekanntesten deutschen Science-Fiction-Autoren. Zuletzt sind von ihm bei Heyne die Romane »Diamant« und »Der Metamorph« erschienen. Mehr zu Autor und Werk unter: www.kantaki.de
Vorbemerkung des Autors
Es bereitet mir ein gewisses Unbehagen, eine Vorbemerkung zu »Das große Spiel« zu schreiben. Schließlich ist das Buch schon seit einigen Jahren auf dem Markt, und in dieser Zeit hat noch niemand zu mir gesagt: »Es ist ein ziemlich gutes Buch, aber weißt du, was daran noch fehlt? Eine Vorbemerkung!« Doch wenn ein Roman für eine Neuausgabe nachgedruckt wird, sollte es darin zu diesem Anlass irgendetwas Neues geben – abgesehen von den geringfügigen Änderungen, mit denen ich die Fehler, inneren Widersprüche und stilistischen Exzesse beseitigen konnte, die mich seit dem erstmaligen Erscheinen des Buches gestört haben. Sie können also beruhigt sein – der Roman spricht für sich selbst, und Sie können sofort mit dem Lesen beginnen. Ich möchte Ihnen nicht nur nicht im Wege stehen – ich würde Ihnen sogar empfehlen, diese Vorbemerkung zu überspringen!
Die Kurzgeschichte »Enders Spiel« war meine erste Veröffentlichung auf dem Gebiet der Science Fiction. Sie basiert auf einer Idee – die Idee des Kampfraums –, die mir mit sechzehn Jahren gekommen war. Ich hatte gerade Isaac Asimovs »Foundation«-Trilogie gelesen, die (mehr oder weniger) eine Weiterentwicklung der Ideen in Edward Gibbons »Verfall und Untergang des römischen Imperiums« ist, übertragen auf ein galaxisweites Imperium in ferner Zukunft.
Das Buch regte mich nicht zum Träumen, sondern zum Nachdenken an. Wie könnte die Zukunft aussehen? Wie würde sich die Welt verändern? Was würde bleiben, wie es ist? Die Prämisse der »Foundation«-Trilogie schien zu lauten: Auch wenn man die Kulissen und die Schauspieler auswechselt, läuft das Drama der menschlichen Geschichte immer auf die gleiche Weise ab. Gleichzeitig wurde diese sehr pessimistische Prämisse (heißt das, wir werden uns niemals ändern?) durch Asimovs Idee gemildert, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht durch genetische Veränderungen, sondern durch erlernte Fähigkeiten in der Lage sind, den Geist anderer Menschen zu verstehen und zu heilen.
Diese Idee hat mich sofort überzeugt, was vielleicht zum Teil an meinem Hintergrund als gläubiger Mormone liegt: Auch wenn Menschen im Wesentlichen armselige Kreaturen sind, können wir lernen und durch das Lernen zu anständigen Persönlichkeiten werden.
Solche Überlegungen gingen mir durch den Kopf, als ich die Trilogie las, auf meinem Bett zusammengerollt – das aus einer dünnen Matratze auf einer Sperrholzplatte bestand, mein Vater hatte es für mich gebaut –, in meinem Schlafzimmer im Untergeschoss unseres kleinen Hauses in Orem/Utah. Und dann ging es mir genauso wie vielen anderen Science-Fiction-Lesern: Ich verspürte das intensive Bedürfnis, Geschichten zu schreiben, die anderen das geben sollten, was Asimovs Geschichte mir gegeben hatte.
In anderen Genres führt dieses Bedürfnis für gewöhnlich dazu, dass kaum verhohlene Nachahmungen großer Werke hervorgebracht werden. Die Jünger von Tolkien zum Beispiel schreiben nur allzu oft simple Kopien von Tolkiens Werken. In der Science Fiction jedoch geht es um neue, überraschende und faszinierende Ideen. Man imitiert die großen Vorbilder, aber nicht, indem man sie einfach kopiert, sondern durch die Erfindung von Geschichten, die wieder genauso neu und überraschend sind.
Doch in welcher Hinsicht sind sie neu? Asimov war Wissenschaftler und bearbeitete alle seine Themen mit wissenschaftlichen Methoden. Er sammelte Daten, kombinierte sie auf neue und verblüffende Weise und dachte die Folgen jeder neuen Idee bis zum Ende durch. Ich war kein Wissenschaftler, und es sah nicht danach aus, dass ich jemals einer werden würde, zumindest kein richtiger Naturwissenschaftler – kein Physiker, Chemiker oder Biologe, nicht einmal ein Ingenieur. Ich besaß keine Begabung für Mathematik und habe sie auch nie besonders gemocht. Und obwohl ich Gefallen am Studium von Logik und Sprachen fand und historische sowie biografische Bücher verschlang, kam es mir damals nie in den Sinn, dass sie genauso als Quellen für Science-Fiction-Erzählungen dienen konnten wie Werke über Astronomie oder Quantenmechanik.
Wie sollte ausgerechnet ich jemals mit einer Science-Fiction-Idee aufwarten können? Wie konnte ich überhaupt irgendetwas darüber wissen?
Zu jener Zeit leistete mein älterer Bruder Bill seinen Militärdienst. Er war in Fort Douglas in Salt Lake City stationiert. Doch nach einem Motorradunfall steckte sein Bein von der Hüfte bis zum Fuß in einem Gipsverband, und er kam an den Wochenenden nach Hause. In dieser Zeit begegnete er seiner künftigen Frau Laura Dene Low, während er an einem Kirchentreffen auf dem Campus der Brigham Young University teilnahm, und es war Laura, die mir Asimovs »Foundation« zu lesen gab. Vielleicht war es damals für mich also völlig natürlich, dass sich meine Gedanken mit militärischen Dingen beschäftigten.
Für mich war das Militär jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Vietnam-Krieg, der damals gerade eskalierte. Damit hatte ich keine Erfahrung, abgesehen von Bills Erzählungen über die miserablen Bedingungen in der Grundausbildung, die Erniedrigungen an der Schule für Offiziersanwärter und ein einsames, aber in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Leben als Unteroffizier in Korea. Einen viel tieferen Eindruck in meinem Geist hatte fünf oder sechs Jahre zuvor die Lektüre von Bruce Cattons dreibändigem Werk »Army of the Potomac« hinterlassen. Ich erinnerte mich lebhaft an die Geschichten von den Befehlshabern jenes Krieges – die Bemühungen der Union, einen General zu finden, der dazu fähig war, McClellans großartige Armee einzusetzen, um Lee, Jackson und Stuart zu besiegen; schließlich die Entscheidung für Grant. Cattons Geschichte war schuld daran, dass ich die Lust an Schach verlor und die Spielregeln von Risiko revidierte, damit es spielbar wurde. Ich hatte einiges über den Krieg gelernt, aber nicht nur aufgrund der Schlussfolgerungen, die Catton gezogen hatte. Ich selbst hatte Bedeutungen in dieser Geschichte entdeckt, ja in der Geschichte insgesamt.
Ich hatte gelernt, dass Geschichte durch die Benutzung von Macht gestaltet wird und dass verschiedene Menschen, die die gleiche Armee führten und somit in etwa die gleiche Macht zur Verfügung hatten, die Truppen so unterschiedlich einsetzen konnten, dass sie völlig ihren Charakter zu ändern schienen – von einem Haufen edler Irrer vor Fredericksburg zu furchtsamen Feiglingen, die vor Chancellorsville aufgerieben wurden, bis zu den Soldaten, die mit verbitterter Entschlossenheit die Hügel bei Gettysburg hielten, und schließlich zu der disziplinierten, professionellen Truppe, die Lee in Grants langwierigem Feldzug in den Staub trat. Es waren nicht die Soldaten, die sich geändert hatten, sondern ihr Anführer. Und obwohl ich gar nicht hätte artikulieren können, was ich über militärische Führung gelernt hatte, wusste ich, dass ich es verstanden hatte. Ich hatte auch ohne Worte verstanden, wie ein großer militärischer Führer seine Armee lenkt, als wäre sie ein Teil seines Körpers, und sogar dem Feind seinen Willen aufzwingt.
Also fragte ich mich eines Morgens, als mein Vater mich über die Carterville Road durch das dicht bewaldete Tal des Provo River zur Brigham Young High School fuhr: Wie würde man in der Zukunft Soldaten für den Kampf ausbilden? Ich dachte nicht weiter über neue bodengestützte Waffensysteme nach – schließlich ging es mir nach der Lektüre von »Foundation« um den Weltraum. Soldaten und Offiziere mussten im Weltraum ganz anders denken, weil die alten Vorstellungen von oben und unten einfach nicht mehr anwendbar waren. Ich hatte in Nordhoffs und Halls Buch über die Geschichte der Luftstreitkräfte im Ersten Weltkrieg gelesen, dass es für neue Piloten anfangs sehr schwierig war, auch darauf zu achten, ob sich Feinde von oben oder unten näherten, statt einfach nur nach rechts und links zu schauen. Um wie viel schwieriger musste es in einer Situation sein, in der es gar kein Oben oder Unten mehr gab?
Im Training geht es darum, Fehler ohne Konsequenzen zuzulassen. Ein dreidimensionaler Kampf musste in einem geschlossenen Raum geübt werden, damit die Auszubildenden nach einem Irrtum nicht bis zum Jupiter abtrieben. Es musste eine Möglichkeit geben, ohne Verletzungsrisiko das Schießen zu üben. Trotzdem mussten Auszubildende, die »getroffen« wurden, auf irgendeine Weise außer Gefecht gesetzt werden, zumindest vorübergehend. Die Umgebung musste veränderbar sein, um die unterschiedlichen Kampfsituationen zu simulieren – in der Nähe eines Raumschiffs oder inmitten von Asteroidentrümmern. Auch die unvorhersehbaren Überraschungen eines realen Kampfes mussten integriert werden, damit sich die Kriegsspiele nicht zu etwas entwickelten, das genauso starr und sinnlos war wie die Marschformationen und Manöver, mit denen selbst im modernen Militär immer noch ein erstaunlich großer Teil der kostbaren Zeit eines Auszubildenden verschwendet wird.
Das Ergebnis meiner Überlegungen jenes Morgens war der Kampfraum, in genau der Form, wie Sie ihn in diesem Buch sehen werden – oder schon gesehen haben. Das war eine gute Idee, und etwas in dieser Art wird man zweifellos für die Ausbildung benutzen, falls es jemals Militär im Weltraum gibt (etwas sehr Ähnliches wurde übrigens bereits in verschiedenen Vergnügungsparks in ganz Amerika umgesetzt).
Doch nachdem ich mir den Kampfraum ausgedacht hatte, hatte ich nicht den blassesten Schimmer, wie ich aus dieser Idee eine Geschichte machen sollte. Dabei wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass die Idee zu einer Geschichte noch gar nichts ist, dass es viel wichtiger ist, um diese Idee herum eine Figur und eine Handlung zu entwickeln. Nachdem Asimov die Idee vom Aufstieg und Fall eines Imperiums hatte, fehlte ihm immer noch eine Geschichte. Und die Geschichte erhielt erst dann eine Seele, als er sie personalisierte, als er den Psychohistoriker Hari Seldon zur gottgleichen Gestalt machte, zum Planer, zum apokalyptischen Propheten der Geschichte. Ich hatte keine entsprechende Figur und keine Ahnung, wie ich eine entwickeln sollte.
Jahre vergingen. Ich hatte die Schule als Junior abgeschlossen – gerade noch rechtzeitig, denn die Brigham Young High School wurde mit dem Jahrgang 1968 aufgelöst – und ging danach zur Brigham Young University. Dort wählte ich Archäologie als Hauptfach, stellte jedoch sehr bald fest, dass Archäologie unglaublich langweilig ist, verglichen mit der Lektüre der Bücher von Thor Heyerdahl (»Aku-Aku«, »Kon-Tiki«), Yigael Yadin (»Masada«) und James Michener (»Die Quelle«), die mich zum Träumen gebracht hatten. Tonscherben! Die Arbeit als Zahnarzt musste spannender sein, als in den endlosen Wüsten des Nahen Ostens Bruchstücke uralter Keramik zusammenzusetzen!
Als ich erkannt hatte, dass nicht einmal die halb-akademische Wissenschaft der Archäologie etwas für jemanden war, der so ungeduldig war wie ich, hatte ich bereits meine wahre Laufbahn eingeschlagen – auch wenn ich meine Gründe damals noch nicht richtig verstanden hatte: Ich dachte, ich wäre zum Theater gegangen, weil ich die Schauspielerei liebte. Bitte missverstehen Sie mich nicht: Ich stehe wirklich sehr gerne auf der Bühne. Geben Sie mir ein Publikum, und ich unterhalte es, so lange ich kann, mit jedem beliebigen Thema. Aber ich bin kein besonders guter Schauspieler, und das Theater sollte nicht meine Bestimmung sein. Damals jedoch wollte ich einzig und allein Stücke inszenieren, Regie führen, Kulissen bauen, Kostüme anfertigen und Make-up auftragen.
Und vor allem wollte ich die schlechten Vorlagen umschreiben! Ich dachte immer wieder: Wieso hatte der Stückeschreiber nicht gemerkt, wie langweilig die Dialoge waren? Diese oder jene Szene ließ sich ohne große Schwierigkeiten verbessern und viel wirksamer in Szene setzen!
Dann versuchte ich erstmals, in einer Literaturklasse Romane für szenische Lesungen zu dramatisieren, und damit war mein Schicksal besiegelt. Jetzt war ich zum Theaterautor geworden.
Die Menschen kamen in meine Stücke und applaudierten. Sowohl von den Schauspielern als auch vom Publikum lernte ich, wie man eine Szene gestaltete, wie man Spannung aufbaute – und vor allem lernte ich, wie wichtig es war, rücksichtslos mit dem Material umzugehen, alles zu streichen oder umzuschreiben, was nicht funktionierte. Ich lernte, die Geschichte vom Schreiben zu trennen, was vielleicht das Wichtigste ist, das jeder Geschichtenerzähler lernen muss. Die Tatsache, dass es tausend verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen, und eine Million falsche. Und dass es viel wahrscheinlicher ist, es beim ersten Versuch falsch zu machen.
Meine Liebe zum Theater hielt selbst während meiner Mission für die Mormonen in Brasilien an. In meiner Zeit als Missionar in São Paulo schrieb ich ein Stück mit dem Titel »Stone Tables« über die Beziehung zwischen Moses und Aaron im Buch Exodus. Bei der Premiere (an der ich nicht teilnehmen konnte, weil ich mich noch in Brasilien aufhielt) gab es nur noch Stehplätze.
Und gleichzeitig hielt sich mein ursprünglicher Drang, Science Fiction schreiben zu wollen.
Ich hatte am College Schreibkurse belegt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dort jemals Science Fiction geschrieben hätte. Doch nebenbei hatte ich mit der Arbeit an einer Serie begonnen, in der es um Menschen mit Psi-Fähigkeiten ging (ich hatte keine Ahnung, dass das damals bereits ein SF-Klischee war), woraus sich schließlich die »Worthing«-Saga entwickelte. Vor meiner Missionszeit hatte ich eine dieser Geschichten sogar an das SF-Magazin Analog geschickt, und während der Mission schrieb ich mehrere längere Erzählungen für diese Serie (aber auch ein paar Versuche im Mainstream-Bereich).
Und die ganze Zeit hielt sich irgendwo in meinem Hinterkopf die Idee des Kampfraums. Doch erst 1975 holte ich sie wieder hervor, entstaubte sie und versuchte, sie literarisch umzusetzen. In der Zwischenzeit hatte ich eine Theatergruppe gegründet, die während des ersten Sommers recht gute Arbeit leistete, doch schon im folgenden Herbst und Winter unter der Last unglücklicher Umstände und schlechten Managements – wofür ich verantwortlich war – auseinander brach. Ich saß auf einem Berg Schulden, während ich das armselige Gehalt eines Redakteurs des Universitätsverlages bezog. Schreiben war das Einzige, womit ich mich auskannte, abgesehen von der Arbeit als Lektor und Redakteur. Es wurde Zeit, dass ich mich ernsthaft als Schriftsteller betätigte und damit wirklich etwas Geld verdiente – was ich als Dramatiker nicht geschafft hatte.
Als Erstes überarbeitete und verschickte ich »Tinker«, die erste »Worthing«-Kurzgeschichte, die ich geschrieben hatte und die immer noch am besten funktionierte. Ben Bova von Analog antwortete mit einem Ablehnungsbrief, in dem er darauf hinwies, dass sich »Tinker« einfach nicht wie Science Fiction anfühlte, sondern eher wie Fantasy. Also waren die »Worthing«-Geschichten vorläufig aus dem Rennen.
Was hatte ich sonst noch zu bieten? Die alte Idee mit dem Kampfraum. Da ergab es sich, dass eine Freundin von mir, Tammy Mikkelson, mit den Kindern ihres Chefs einen Zirkus in Salt Lake City besuchen wollte und mich fragte, ob ich sie begleiten würde. Ich war einverstanden. Doch da es für mich keine Eintrittskarte mehr gab (und ich mich sowieso nie für den Zirkus begeistern konnte – die Clowns bringen mich zur Raserei!), verbrachte ich die Stunden der Vorstellung auf dem Rasen vor dem Salt Palace und schrieb »Enders Spiel«, genauso wie ich auch meine Theaterstücke geschrieben hatte: in einem Notizbuch mit eng liniertem Papier. »Denkt daran«, sagte Ender. »Das Tor des Feindes ist unten.«
Vielleicht waren die Kinder schuld, mit denen wir im Auto zum Zirkus gefahren waren, dass ich mich entschied, sehr junge Auszubildende im Kampfraum antreten zu lassen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich selbst gerade erst erwachsen geworden war und mich nur mit der Kindheit gut genug auskannte, um darüber schreiben zu können. Möglicherweise hatte es auch mit einem Punkt zu tun, der mich in Cattons »Army of the Potomac« beeindruckt hatte – dass die Soldaten damals allesamt sehr jung und unschuldig waren. Sie hatten ihre Feinde erschossen und mit dem Bajonett niedergestochen und sich dann heimlich in die neutrale Zone zwischen den Fronten geschlichen, um Tauschhandel mit Tabak, Witzen, Alkohol und Lebensmitteln zu betreiben. Obwohl es ein tödliches Spiel war und das Leid und die Angst schrecklich und real waren, war es dennoch ein Spiel zwischen Kindern, das sich gar nicht so sehr von den Kriegsspielen zwischen meinen Brüdern und mir unterschied, die wir mit wassergefüllten Spritzflaschen ausgetragen hatten.
Ich schrieb und verkaufte »Enders Spiel«. Ich wusste, dass es eine kraftvolle Geschichte war, weil sie mir am Herzen lag und ich daran glaubte. Ich hatte jedoch keine Ahnung, welche Auswirkungen sie auf das Science-Fiction-Publikum haben würde. Während sie die meisten Menschen natürlich völlig ignorierten und glücklich und zufrieden weiterlebten, ohne sie oder irgendetwas anderes von mir gelesen zu haben, gab es eine überraschend große Gruppe von Menschen, die recht leidenschaftlich auf die Story reagierten.
»Enders Spiel« wurde bei der Abstimmung zum Nebula Award leider nicht berücksichtigt, doch gelangte es in die Endausscheidung zum Hugo Gernsback Award, wobei die Story dann den zweiten Platz belegte. Vor allem jedoch wurde ich mit dem John W. Campbell Award als bester neuer Autor ausgezeichnet. Zweifellos war »Enders Spiel« nicht nur mein erster Verkauf, sondern auch der Startschuss für meine Karriere.
Das Gleiche geschah noch einmal 1985, als ich die Story zum Roman ausarbeitete – das Buch, dass Sie nun, wenn auch in leicht überarbeiteter Form, in den Händen halten. Zu jenem Zeitpunkt hielt ich »Das große Spiel«, also den Roman, lediglich für die Einleitung zur viel beeindruckenderen Geschichte (wie ich damals dachte) von »Sprecher für die Toten«. Doch als ich das Buch abgeschlossen hatte, wusste ich, dass die Geschichte eine ganz neue Ausdruckskraft gewonnen hatte. Während des Jahrzehnts, das seit der Veröffentlichung der Story vergangen war, hatte ich sehr viel gelernt, sowohl über das Leben als auch über das Schreiben, und all das kam in diesem Buch erstmals zusammen. Wieder meinte es das Publikum gut mit mir. Es gab den Nebula und den Hugo, Übersetzungen im Ausland und gute, kontinuierliche Verkaufszahlen, die zum ersten Mal in meiner Karriere meinen Vorschuss rechtfertigten und mir ein zusätzliches Honorar einbrachten.
Aber es ging nicht nur darum, ein kleines Kultbuch geschrieben zu haben, das mir ein stetiges Einkommen gewährleistete. Es steckte etwas mehr hinter der Art und Weise, wie die Leser auf »Das große Spiel« reagierten.
Zum einen wurde das Buch von jenen, die es hassten, zutiefst gehasst. Die Angriffe gegen den Roman – und gegen mich – waren erstaunlich. Mit einigen Reaktionen hatte ich gerechnet. Ich habe einen Magister in Literatur, und beim Schreiben von »Das große Spiel« hatte ich bewusst auf all die kleinen literarischen Spiele und Tricks verzichtet, durch die »gute« Literatur für das allgemeine Publikum so unzugänglich wird. Alle Ebenen der Bedeutung lassen sich entschlüsseln, wenn Sie Spaß am Spiel der Literaturkritik haben. Aber wenn Sie sich nicht an diesem Spiel beteiligen wollen, habe ich damit kein Problem. Ich habe den Roman so klar und zugänglich wie möglich geschrieben. Die Leser sollten kein literarisches Vorwissen oder auch nur Kenntnisse in Science Fiction benötigen, um die Geschichte in ihrer einfachsten und klarsten Form zu verstehen. Doch da viele große Schriftsteller und Kritiker ihre Karriere auf der Voraussetzung aufgebaut haben, dass alles, was das allgemeine Publikum ohne erklärende Vermittlung begreift, nur wertloser Schund ist, überrascht es mich nicht, dass diese Fraktion nur Verachtung für meinen kleinen Roman übrig hat. Wenn sich alle darauf einigen würden, dass Geschichten auf klare, verständliche Weise erzählt werden sollten, würden die Literaturprofessoren ihren Job verlieren, und die Autoren von schwieriger, komplex verschlüsselter Literatur würden nicht mehr verehrt, sondern wegen ihrer Unzugänglichkeit bemitleidet werden.
Für manche Menschen jedoch ging die Verachtung für »Das große Spiel« weit über literaturkritische Argumente hinaus. Ich erinnere mich an einen Brief an den Herausgeber von Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine, in dem eine Frau, die als Betreuerin für hochbegabte Kinder arbeitete, berichtete, dass sie »Das große Spiel« nur deshalb gelesen habe, weil ihr Sohn ihr ständig vorgeschwärmt habe, wie wunderbar das Buch sei. Sie hat es sofort verachtet. Natürlich habe ich mich gefragt, was eine professionelle Betreuerin dazu veranlassen könnte, den literarischen Geschmack ihres Sohnes in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Doch die Kritik, die mich am meisten verblüffte, war ihre Beteuerung, dass meine Darstellung hochbegabter Kinder hoffnungslos unrealistisch war. Sie sprachen einfach nicht auf die Weise, wie ich es beschrieben hatte. Und sie dachten nicht so.
Diese Kritik wurde nicht nur von ihr, sondern auch von vielen anderen vorgebracht. Damit wurde mir allmählich klar, dass »Das große Spiel« manche Menschen irritiert, weil das Buch ihre Annahmen über die Wirklichkeit infrage stellt. Und die Klarheit des Romans verstärkt diese Wirkung noch, aus dem einfachen Grund, weil die Vision der Geschichte so gnadenlos klar ist. Für viele Menschen war es wichtig, davon überzeugt zu sein, dass Kinder in Wirklichkeit nicht so denken und sprechen, wie sie es in »Das große Spiel« tun.
Dennoch wusste ich – ich wusste es –, dass gerade dieser Punkt zu den wahrhaftigsten Aspekten von »Das große Spiel« gehört. In der Rückschau habe ich sogar erkannt, dass es möglicherweise einer der Gründe ist, warum es für mich so wichtig war, damals auf dem Rasen vor dem Salt Palace eine Geschichte zu schreiben, in der hochbegabte Kinder für den Kampf in einem Krieg der Erwachsenen ausgebildet werden. Denn während meiner gesamten Kindheit hatte ich mich nie wie ein Kind gefühlt. Ich hatte mich die ganze Zeit wie ein Mensch gefühlt – derselbe Mensch, der ich noch heute bin. Ich glaube, ich habe niemals kindlich gesprochen. Ich hatte nie den Eindruck, dass meine Gefühle und Bedürfnisse irgendwie weniger real als erwachsene Gefühle und Bedürfnisse waren. Und mit »Das große Spiel« habe ich das Publikum gezwungen, das Leben dieser Kinder aus genau dieser Perspektive zu sehen – in der ihre Gefühle und Entscheidungen genauso real und bedeutend wie die jedes Erwachsenen sind.
Meine gehässige Seite hätte dieser Betreuerin am liebsten geantwortet: Der einzige Grund, warum Sie glauben, hochbegabte Kinder würden nicht auf diese Weise sprechen, ist der, weil diese Kinder zu klug sind, um so vor Ihnen zu sprechen. Aber eine größere Wahrheit steckt in der Antwort, dass die Kinder in meinem Roman als vollwertige Persönlichkeiten dargestellt werden. Und all jene, die es gewohnt sind, Kinder auf andere Weise zu betrachten – oder deren berufliche Karriere auf dieser Annahme basiert –, müssen das Buch als äußerst beunruhigende Erfahrung erleben. Kinder sind eine ständige, sich laufend erneuernde Unterschicht, die hilflos der Entscheidungsgewalt der Erwachsenen unterworfen ist, bis sie selber zu Erwachsenen werden. Und in diesem Zusammenhang könnte man »Das große Spiel« vielleicht sogar als revolutionäres Traktat sehen.
Denn die Kinder, die das Buch lesen, erkennen die Wahrheit, die darin liegt. Das größte Lob, das ich jemals für eines meiner Bücher erhalten habe, kam von der Bibliothekarin der Schulbücherei an der Farrer Junior High in Provo/ Utah, die zur mir sagte: »Wissen Sie, ›Das große Spiel‹ ist unser am häufigsten entwendetes Buch.«
Und dann sind da noch die Briefe. Zum Beispiel dieser, den ich im März 1991 erhielt:
Sehr geehrter Mr. Card,
ich schreibe Ihnen im Namen meiner zwölf Freunde und Mitstudenten, die in diesem Sommer wie ich an einem vierzehntägigen Seminar für hochbegabte Studenten an der Purdue University teilgenommen haben. Wir haben den Kurs »Philosophie und Science Fiction« unter der Leitung von Peter Robinson besucht, und wir sind zwischen dreizehn und fünfzehn Jahre alt.
Wir alle befinden uns in der gleichen Situation: Wir sind sehr intellektuell orientiert und haben zu Hause nur wenige Menschen gefunden, die dieses Interesse mit uns teilen. Daher haben die meisten von uns seit dem Kindergarten ein recht einsames Leben geführt. Wenn man ununterbrochen von Lehrern gelobt wird, sinken die Chancen, sich in eine Gruppe Gleichaltriger einzufügen, praktisch auf null.
Unser ganzes Leben lang haben wir unbewusst nach dem Leitsatz gelebt: »Die einzige Möglichkeit, sich Respekt zu verschaffen, besteht darin, so gut zu sein, dass man nicht mehr ignoriert werden kann.« Und zumindest Mike und ich haben entschieden, es zu tun, indem wir »das Schulsystem schlagen«. Wir beide haben die Absicht, im zweiten Jahr an der High School Infinitesimalrechnung zu belegen, sofern es die Lehrpläne erlauben. (Sowohl Mike als auch ich streben eine wissenschaftlich-mathematische Laufbahn an.) Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Wir alle sind intelligent und die Besten der Klasse. Doch seit wir diesen Weg eingeschlagen haben, sind wir zwar sehr zufrieden mit der Entwicklung, aber auch sehr einsam.
Deshalb haben uns »Das große Spiel« und »Sprecher für die Toten« so sehr beeindruckt. Diese Bücher waren unsere »Texte« für die Klasse. Wir lasen ein- oder zweihundert Seiten pro Abend und diskutierten dann während des Tages darüber (wie auch über andere Kurzgeschichten und Artikel). Doch in Purdue war es keine »Klassenzimmerdiskussion«. Wir waren eine Gruppe von Freunden, die sich darüber unterhielten, wie ihre Gefühle und Überzeugungen mit den Büchern übereinstimmten oder davon abwichen.
Sie können sich nicht vorstellen, welche Wirkung Ihre Bücher auf uns hatten. Wir sind die Enders von heute. Fast alles, was in »Das große Spiel« und »Sprecher für die Toten« steht, betrifft uns auf einer sehr persönlichen Ebene. Natürlich ist die allgemeine Situation heutzutage nicht so schlimm, aber alle Gefühle sind vorhanden. Ihre beiden Bücher und die exzellente Arbeit von Peter Robinson haben uns zu einem festen Netzwerk zusammengeführt.
Ingrids Brief geht noch weiter. Sie berichtet über Phoenix Rising, ein Magazin, das diese Studenten gemeinsam herausgeben, um ihren Gemeinschaftssinn zu bewahren. (Im Gegenzug habe ich ihnen übrigens gestattet, diese Vorbemerkung in ihrem Magazin zu veröffentlichen, bevor sie in Buchform erscheint.)
Natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn Menschen eine meiner Geschichten gefällt, aber hier geht etwas viel Bedeutenderes vor sich: Diese Leser haben festgestellt, dass »Das große Spiel« nicht nur eine »mythische« Geschichte ist, die sich um allgemeine Wahrheiten dreht, sondern etwas viel Persönlicheres. Für sie war »Das große Spiel« etwas wie eine »Bibel« oder ein »Kultbuch«, in dem das ausgedrückt wird, was sie als Gemeinschaft empfinden, was sie von den anderen Menschen in ihrer Umgebung unterscheidet. Sie liebten Ender nicht, und sie bemitleideten ihn auch nicht – was eine häufige Reaktion von Erwachsenen war; sie waren Ender. Enders Erfahrungen waren ihnen nicht fremd, Enders Leben reflektierte ihr eigenes Leben. Die Wahrheit der Geschichte war keine allgemeine, sondern ihre persönliche Wahrheit.
Eine Geschichte kann auf sehr unterschiedliche Weise gelesen werden – sogar eine sehr klar erzählte Geschichte, die an der Oberfläche bewusst auf Mehrdeutigkeiten verzichtet. Als Beispiel zitiere ich einen weiteren Brief, den ich ebenfalls Mitte März 1991 erhielt. Er wurde am 16. Februar geschrieben, und der Poststempel datiert vom 18. Februar. Diese Daten sind von Bedeutung.
Mr. Card,
ich bin Armeepilot und warte in Saudi-Arabien auf das Ende eines Sandsturms. Ich wollte Ihnen schon seit einiger Zeit schreiben, und da meine Zukunft nun ungewiss ist – ich weiß, wann die Bodenoffensive beginnen soll –, habe ich entschieden, diesen Brief heute zu schreiben.
Ich habe »Das große Spiel« vor vier Jahren während der Pilotenausbildung gelesen. Ich bin Unteroffizier, und unsere Schule war – zumindest in den ersten sechs Wochen – ganz anders als die für die regulären Offiziere. Ich war achtzehn Jahre alt, als ich nach Fort Rucker kam, um mit der Flugausbildung zu beginnen, und ich hätte die ersten sechs Wochen beinahe nicht überstanden. Ender hat mir den Mut zum Weitermachen gegeben, damals und auch viele Male danach. Ich habe die gleiche Erschöpfung wie Ender erlebt, die Art von Erschöpfung, die bis tief in die Seele reicht. Es wäre interessant zu erfahren, was Sie veranlasst hat, auf diese Weise zu empfinden. Niemand kann es beschreiben, der es nicht selbst erfahren hat, aber ich verstehe, wie persönlich so etwas sein kann. Es gibt noch ein anderes Buch, das diesen Zustand beschreibt und das ich genauso sehr schätze wie »Das große Spiel«. Es trägt den Titel »Armour« und wurde von John Steakley geschrieben. Ender und Felix [der Protagonist von »Armour«] sind mir zu jeder Zeit geistig nahe. Leider gibt es im Gegensatz zu »Das große Spiel« keine Forsetzung von »Armour«.
Wir sind der letzte Dreck der militärischen Fliegerei. Unsere Hubschrauber mögen die besten der Welt sein, aber die Ausrüstung, die wir bei uns tragen, und die Systeme in den Maschinen, zum Beispiel die Navigationsinstrumente, sind gegenüber denen in der Navy und der Air Force völlig veraltet. Ich bin sehr glücklich, dass die Air Force in der Lage ist, Ziele mit großer Präzision zu bombardieren, aber wenn sie nicht treffen, landen die Bomben trotzdem auf feindlichem Gebiet. Wenn wir Mist bauen, bedeutet das für die Jungs, die wir ins Kampfgebiet transportieren, die »Stoppelhopser«, den Tod. Wir haben nicht einmal eine Brustpanzerung, die »Geflügelplatten«, mit denen die Hubschrauberpiloten in Vietnam ausgerüstet waren. Letztes Jahr in El Salvador flogen Armeepiloten mit mehreren prominenten Zivilisten und zwanzig Reportern über ein von den Rebellen kontrolliertes Gebiet, und sie konnten nicht einmal Leuchtgeschosse abfeuern, um die mit Wärmesensoren ausgestatteten Raketen der Rebellen abzuwehren. Einer unserer Piloten und ein Besatzungsmitglied kamen letztes Jahr auf einem Trainingsflug ums Leben, weil die Ladeschlinge, die sie transportierten, bei 100 Stundenkilometern mit den Baumwipfeln kollidierte. Dieser Unfall hätte sich verhindern lassen können, wenn unsere Nachtsichtbrillen eingeblendete Displays hätten, wie es bei der Air Force seit vierzig Jahren üblich ist. Sie haben bestimmt von Colonel Pickett gehört, der vor wenigen Monaten in einem Huey in El Salvador abgeschossen wurde. Dieser Hubschraubertyp ist mindestens dreißig Jahre alt und muss ohne Überlebenssysteme auskommen. Pickett war ein guter Mann, ich habe ihn gekannt.
Der Grund, warum ich Ihnen davon erzähle, ist der, dass ich für Sie ein Bild zeichnen wollte. Ich liebe meinen Job, aber wir sind nicht wie die Supersoldaten, über die ständig Filme gemacht werden. Wir erfüllen unsere Arbeit mit weniger Technik, weniger politischer Unterstützung, weniger Anerkennung und größerem Risiko als die anderen, während die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, mit unglaublicher Geschwindigkeit modernisiert werden. Ich erwarte kein Mitleid von Ihnen, aber ich habe mir überlegt, ob Sie oder Mr. Steakley vielleicht einen Roman über die Armeepiloten schreiben könnten, die zwanzig Jahre in der Zukunft mit Hubschraubern fliegen. Viele von uns lesen Science Fiction, und nachdem ich »Das große Spiel« und »Armour« jeweils dreimal gelesen hatte, habe ich die Bücher an meine Kameraden ausgeliehen. Meine Frau hat geweint, als sie »Das große Spiel« gelesen hat. Hier gibt es eine große Anhängerschaft für ein solches Buch. Wir haben niemanden, der für uns spricht, für jene, die bald sterben werden, oder für jene, die überleben …
Genauso wie die begabten jungen Studenten, die dieses Buch als »ihre« Geschichte lasen, hatte auch dieser Soldat – der den Golfkrieg wie die meisten, aber nicht alle Armeepiloten überlebte – »Das große Spiel« nicht als »literarisches« Werk gelesen. Er las es als Kultbuch seiner Gemeinschaft. Natürlich war es nicht sein einziges Kultbuch – »Armour«, John Steakleys großartiger Roman, hatte auf ähnliche Weise seine Geschichte wiedergegeben. Das Wichtigste jedoch war sein deutliches Empfinden, dass diese Geschichten, ganz gleich, wie sehr sie ihn ansprachen, trotzdem nicht das »richtige« Kultbuch für seine Gemeinschaft waren. Er hatte immer noch das Bedürfnis nach einem »Sprecher« für die Toten und für die Lebenden. Vor allem angesichts der Nähe des Todes wünschte er sich, dass jemand seine eigene und die Geschichte seiner Freunde erzählte.
Wozu sonst lesen wir überhaupt Literatur? Nicht, um uns von der großartigen Sprache eines Autors beeindrucken zu lassen – zumindest hoffe ich, dass wir es nicht aus diesem Grund tun. Ich glaube, dass die meisten von uns diese Geschichten, von denen wir wissen, dass sie nicht »wahr« sind, deshalb lesen, weil wir das Bedürfnis nach einer anderen Art von Wahrheit haben, nach der mythischen Wahrheit über die allgemeine Natur des Menschen, über die spezielle Natur der Lebensgemeinschaften, die unsere Identität definieren, und nach der speziellsten Wahrheit überhaupt: die unserer persönlichen Geschichte. Weil Literatur nicht von jemandem erzählt, der tatsächlich in der realen Welt gelebt hat, bietet sie immer die Möglichkeit, dass sie von uns selbst handelt.
»Das große Spiel« ist eine Geschichte über hochbegabte Kinder. Es ist auch eine Geschichte über Soldaten. Für Captain John F. Schmitt, den Autor des Marine-Corps-Handbuchs »Warfighting«, des brillantesten und prägnantesten Werks über Militärstrategie, das jemals von einem Amerikaner geschrieben wurde (der gleichzeitig ein Befürworter der Denkweise war, die für den Sieg der Alliierten im Golfkrieg verantwortlich war), stellte »Das große Spiel« eine so nützliche Geschichte über das Wesen militärischer Führung dar, dass er das Buch in seinen Kursen an der Marine University in Quantico benutzte. Das Watauga College, ein interdisziplinäres Studienprogramm an der Appalachian State University – möglicherweise die unmilitärischste Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann –, setzt »Das große Spiel« zu völlig anderen Zwecken ein: um über Problemlösungsstrategien und die Selbsterschaffung des Individuums zu sprechen. Ein Student in Toronto lotete in einer Abschlussarbeit die politischen Ideen in »Das große Spiel« aus. Ein Autor und Kritiker in Pepperdine hat »Das große Spiel« als religiöse Literatur interpretiert.
All diese Sichtweisen sind gültig, all diese Lesarten des Buches sind »richtig«. Denn all diese Leser haben sich in die Geschichte hineinversetzt, nicht als Zuschauer, sondern als Mitwirkende, und dadurch haben sie die Welt von »Das große Spiel« nicht nur mit meinen Augen, sondern auch mit ihren eigenen gesehen.
Das ist das Wesen der Interaktion zwischen Geschichtenerzähler und Publikum. Die »wahre« Geschichte ist nicht die Geschichte, die in meinem Kopf existiert; sie ist auf keinen Fall der gedruckte Text auf dem gebundenen Papier, das Sie in den Händen halten. Die Geschichte in meinem Kopf ist nicht mehr als eine Hoffnung; der Text der Geschichte ist das Werkzeug, das ich geschaffen habe, um aus dieser Hoffnung etwas Reales zu machen. Die eigentliche Geschichte, die reale Geschichte, ist jene, die die Leser auf der Grundlage meines Textes in ihrem Kopf erschaffen, und sie wird durch ihre persönlichen Erfahrungen, ihre individuellen Wünsche, ihre Hoffnungen und Ängste transformiert, interpretiert, erweitert und bearbeitet.
Die Geschichte von »Das große Spiel« ist nicht dieses Buch, auch wenn es diesen Titel trägt. Die Geschichte ist die, die Sie und ich gemeinsam in unserer Erinnerung konstruieren werden. Wenn die Geschichte für Sie überhaupt irgendeine Bedeutung hat und wenn Sie sich später daran erinnern, stellen Sie sie sich bitte nicht als etwas vor, das ich erfunden habe – sondern als etwas, das wir gemeinsam geschaffen haben.
Orson Scott Card
1
Dritt
»Ich habe durch seine Augen gesehen, ich habe durch seine Ohren gehört, und ich sage Ihnen, er ist derjenige. Oder wenigstens so dicht dran, dass wir keinen Besseren finden werden.«
»Das haben Sie über den Bruder auch gesagt.«
»Der Bruder erwies sich als ungeeignet. Aus anderen Gründen. Hatte nichts mit seinen Fähigkeiten zu tun.«
»Das Gleiche wie bei der Schwester. Und auch bei ihm bestehen Zweifel. Er ist zu formbar. Zu leicht bereit, sich dem Willen eines anderen zu unterwerfen.«
»Nicht, wenn der andere sein Feind ist.«
»Was sollen wir denn tun? Ihn die ganze Zeit über mit Feinden umgeben?«
»Wenn wir müssen.«
»Ich dachte, Sie hätten gesagt, Sie mögen dieses Kind.«
»Wenn die Krabbler ihn erwischen, werde ich im Vergleich mit ihnen wie sein Lieblingsonkel wirken.«
»Na gut. Schließlich müssen wir die Welt retten. Nehmen Sie ihn.«
Die Monitordame lächelte sehr nett, zauste sein Haar und sagte: »Andrew, ich nehme an, inzwischen hast du es restlos satt, diesen schrecklichen Monitor zu tragen. Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Monitor kommt heute raus. Wir werden ihn einfach herausnehmen, und es wird kein bisschen wehtun.«
Ender nickte. Dass es kein bisschen wehtun würde, war natürlich eine Lüge. Aber weil Erwachsene das immer sagten, wenn es doch wehtat, konnte er sich auf diese Erklärung als exakte Voraussage der Zukunft verlassen. Manchmal waren Lügen verlässlicher als die Wahrheit.
»Komm also bitte hier herüber, Andrew, und setz dich auf den Untersuchungstisch. Der Doktor wird gleich da sein, um nach dir zu sehen.«
Der Monitor entfernt. Ender versuchte sich vorzustellen, wie es wohl war, wenn die kleine Apparatur in seinem Nacken fehlte. Ich werde mich im Bett auf den Rücken rollen, und er wird dort nicht mehr drücken. Ich werde nicht spüren, wie er prickelt und brennt und die Hitze aufnimmt, wenn ich dusche.
Und Peter wird mich nicht mehr länger hassen. Ich werde nach Hause kommen und ihm zeigen, dass der Monitor fort ist, und er wird sehen, dass ich es auch nicht geschafft habe. Dass ich nun auch ein gewöhnliches Kind sein werde, genau wie er. Das wäre sicher gar nicht so schlecht. Er wird mir vergeben, dass ich meinen Monitor ein ganzes Jahr länger getragen habe als er seinen. Wir werden …
Nein, Freunde würden sie wohl nicht sein. Peter war zu gefährlich. Peter wurde immer so wütend. Aber Brüder. Nicht Feinde, nicht Freunde, doch Brüder – fähig, im selben Haus zu leben. Er wird mich nicht hassen, er wird mich bloß einfach in Frieden lassen. Und wenn er Krabbler und Astronauten spielen will, werde ich vielleicht nicht mitspielen müssen, kann vielleicht weiter ein Buch lesen.
Aber Ender wusste schon, als er das dachte, dass Peter ihn nicht in Frieden lassen würde. Da war etwas in Peters Augen, wenn er in seiner verrückten Stimmung war, und immer wenn Ender diesen Blick sah, dieses Glitzern, wusste er, dass das eine, was Peter nicht tun würde, war, ihn in Frieden zu lassen. Ich übe Klavier, Ender. Los, komm und schlag die Seiten für mich um. Ach, ist der Monitorjunge zu beschäftigt, um seinem Bruder zu helfen? Ist er zu gescheit? Musst wohl los und ein paar Krabbler töten, Astronaut? Nein, nein, ich will deine Hilfe nicht. Ich kann’s auch alleine, du kleiner Bastard, du kleiner Dritt.
»Es wird nicht lange dauern, Andrew«, sagte der Doktor.
Ender nickte.
»Er ist dafür konstruiert, wieder entfernt zu werden. Ohne Infektion, ohne Verletzung. Aber es wird ein bisschen brennen, und manche Leute sagen, sie hätten das Gefühl, als fehle etwas. Eine Zeit lang wirst du nach etwas suchen, etwas, wonach du dich immer umgeschaut hast, aber du kannst es nicht finden, und du kannst dich auch nicht daran erinnern, was es war. Darum werde ich es dir sagen. Es ist der Monitor, nach dem du dich umschaust, und er ist nicht da. In ein paar Tagen verschwindet dieses Gefühl.«
Der Doktor verdrehte etwas an der Rückseite von Enders Kopf. Plötzlich durchbohrte ihn ein Schmerz wie eine Nadel vom Genick bis zur Leistengegend. Ender spürte, wie sich sein Rücken verkrampfte, und sein Körper krümmte sich heftig nach hinten; sein Kopf schlug auf das Bett. Er konnte spüren, wie seine Beine ausschlugen, und seine Hände umkrampften einander so fest, dass es schmerzte.
»Deedee«, rief der Doktor. »Ich brauche Sie!« Die Schwester kam hereingestürzt, schnappte nach Luft. »Er muss die Muskeln entspannen. Geben Sie schon her! Worauf warten Sie noch?«
Etwas wurde weitergereicht; Ender konnte nichts sehen. Er drehte sich auf die Seite und fiel vom Untersuchungstisch. »Fangen Sie ihn auf!«, schrie die Schwester.
»Halten Sie ihn nur ruhig …«
»Sie müssen ihn halten, Herr Doktor, er ist zu stark für mich …«
»Nicht die ganze Dosis! Sonst bleibt sein Herz stehen …«
Ender spürte, wie knapp oberhalb seines Hemdkragens eine Nadel in seinen Rücken eindrang. Es brannte, aber wo immer sich das Feuer in ihm ausbreitete, entspannten sich seine Muskeln allmählich. Jetzt konnte er vor Angst und Schmerz weinen.
»Geht’s jetzt wieder, Andrew?«, fragte die Schwester.
Andrew konnte sich nicht erinnern, wie man sprach. Sie hoben ihn auf den Tisch. Sie kontrollierten seinen Puls, taten andere Dinge – er begriff nicht alles davon.
Der Doktor zitterte; seine Stimme bebte, als er sprach. »Sie lassen diese Dinger drei Jahre lang in den Kindern. Was erwarten sie da? Wir hätten ihn abschalten können, begreifen Sie das? Wir hätten sein Gehirn für alle Zeiten ausstöpseln können.«
»Wann lässt die Wirkung des Medikaments nach?«, fragte die Schwester.
»Behalten Sie ihn noch wenigstens eine Stunde hier. Beobachten Sie ihn. Wenn er nicht in fünfzehn Minuten zu sprechen anfängt, rufen Sie mich. Hätten ihn für immer ausgestöpselt haben können. Ich habe nicht den Verstand eines Krabblers.«
Erst eine Viertelstunde vor dem Läuten der Schlussglocke kam er in Miss Pumphreys Klasse zurück. Er war immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen.
»Alles in Ordnung, Andrew?«, fragte Miss Pumphrey.
Er nickte.
»Warst du krank?«
Er schüttelte den Kopf.
»Du siehst aus, als ginge es dir nicht gut.«
»Ich bin okay.«
»Setz dich besser hin, Andrew.«
Er begann auf seinen Platz zuzugehen, hielt dann aber inne. Wonach habe ich bloß gesucht? Ich kann mich nicht erinnern, wonach ich gesucht habe.
»Dein Platz ist dort drüben«, sagte Miss Pumphrey.
Er setzte sich, aber es war etwas anderes, das er brauchte, etwas, das er verloren hatte. Ich werde es später finden.
»Dein Monitor«, flüsterte das Mädchen hinter ihm.
Andrew zuckte die Achseln.
»Sein Monitor«, flüsterte sie den anderen zu.
Andrew langte hinauf und betastete seinen Nacken. Nichts, nur ein Verband. Er war fort. Jetzt war er genau wie alle anderen.
»Total hinüber, Andy?«, fragte ein Junge, der hinter ihm auf der anderen Seite des Mittelgangs saß. Sein Name wollte ihm nicht einfallen. Peter. Nein, das war jemand anderes.
»Ruhe, Mr. Stilson«, sagte Miss Pumphrey. Stilson grinste affektiert.
Miss Pumphrey sprach über das Multiplizieren. Ender kritzelte gedankenlos auf seinem Pult, malte Umrisskarten von gebirgigen Inseln und befahl seinem Pult dann, sie dreidimensional aus jeder Perspektive zu zeigen. Die Lehrerin würde natürlich wissen, dass er nicht aufpasste, aber sie würde ihn nicht behelligen. Er wusste immer die Antwort, auch wenn sie dachte, dass er nicht aufpasste.
In der Ecke seines Pultes erschien ein Wort und begann, den Rand des Pultes entlangzuwandern. Zuerst stand es seitenverkehrt auf dem Kopf, aber Ender wusste, lange bevor es den unteren Rand des Pultes erreichte und sich mit der richtigen Seite nach oben drehte, wie es lautete.
DRITT
Ender lächelte. Er war es, der ausgeknobelt hatte, wie man Botschaften schickte und sie wandern ließ – selbst jetzt, da sein geheimer Feind ihn mit Schimpfnamen belegte, bewies die Methode der Übermittlung noch seine Fähigkeiten. Es war nicht sein Fehler, dass er ein Dritt war. Es war die Idee der Regierung, sie waren es, die es genehmigt hatten – wie sonst hätte ein Dritt wie Ender die Schule besuchen können? Und jetzt war der Monitor fort. Das Experiment »Andrew Wiggin« hatte schließlich doch nicht geklappt. Wenn sie könnten, da war er sich sicher, würden sie jetzt bestimmt gerne die Verzichtserklärungen rückgängig machen, die es ihm gestattet hatten, überhaupt geboren zu werden. Hat nicht geklappt, also löscht das Experiment.
Die Glocke läutete. Alle sperrten ihre Pulte oder tippten rasch Gedächtnishilfen für sich ein. Ein paar begannen, Hausaufgaben oder Daten an ihre Computer zu Hause zu schicken. Einige wenige scharten sich um die Drucker, während etwas ausgedruckt wurde, das sie vorzeigen wollten. Ender spreizte seine Hände über der für Kinder ausgelegten Tastatur nahe des Pultrandes und fragte sich, wie es wohl sein würde, Hände so groß wie die eines Erwachsenen zu haben. Sie mussten sich so riesig und sperrig anfühlen, dicke kurze Finger und fleischige Handflächen. Natürlich hatten sie größere Tastaturen – aber wie konnten ihre dicken Finger eine so feine Linie ziehen, wie Ender es konnte, eine dünne Linie, die so präzise war, dass er sie siebenundneunzigmal in Spiralen von der Mitte zum Rand des Pultes laufen lassen konnte, ohne dass die Linien sich jemals berührten oder überlagerten. So hatte er etwas zu tun, während die Lehrerin weiter über Arithmetik sprach. Rechnen! Valentine hatte ihm Rechnen beigebracht, als er drei war.
»Alles in Ordnung mit dir, Andrew?«
»Ja, Ma’am.«
»Du wirst den Bus verpassen.«
Ender nickte und stand auf. Die anderen Kinder waren fort. Aber sie würden warten, die schlimmen jedenfalls. Sein Monitor saß nicht mehr auf seinem Nacken und hörte, was er hörte, sah, was er sah. Sie konnten sagen, wonach ihnen der Sinn stand. Vielleicht würden sie ihn jetzt sogar schlagen – niemand konnte sie jetzt noch sehen, und darum würde auch niemand Ender zu Hilfe kommen. Der Monitor hatte schon seine Vorteile, und er würde sie vermissen.
Natürlich war es Stilson. Er war nicht größer als die meisten anderen Kinder, aber er war größer als Ender. Und er hatte ein paar andere bei sich. Wie immer.
»He, Dritt.«
Nicht antworten. Es gibt nichts zu sagen.
»He, Dritt, wir reden mit dir, Dritt! He, Krabblerliebchen, wir reden mit dir.«
Mir fällt nichts ein, was ich antworten könnte. Alles, was ich sage, macht es nur schlimmer. Werd also lieber nichts sagen.
»He, Dritt, he, Schitt, du bist durchgerasselt, was? Hast gedacht, du wärst besser als wir, aber du hast dein kleines Vögelchen verloren, Dritti, hast einen Verband im Nacken.«
»Lasst ihr mich durch?«, fragte Ender.
»Ob wir ihn durchlassen werden? Sollen wir ihn durchlassen?« Sie lachten alle. »Natürlich werden wir ihn durchlassen. Zuerst lassen wir deinen Arm durch, dann deinen Arsch, dann vielleicht ein Stück von deinem Knie.«
Die anderen fielen jetzt ein. »Hast dein Vögelchen verloren, Dritti. Hast dein Vögelchen verloren, Dritti.«
Stilson begann, ihn mit einer Hand zu stoßen, und jemand hinter ihm schubste ihn dann auf Stilson zu.
»Wippe, olle Hippe«, sagte einer.
»Tennis!«
»Pingpong!«
Das hier würde kein glückliches Ende nehmen. Also entschied Ender, dass er am Ende nicht der Unglückliche sein wollte. Als Stilsons Arm das nächste Mal vorschnellte, um ihn zu schubsen, griff Ender danach. Er fasste daneben.
»Ach, willst gegen mich kämpfen, wie? Willst gegen mich kämpfen, Dritti?«
Die Burschen hinter Ender griffen nach ihm, um ihn festzuhalten.
Ender war nicht nach Lachen zumute, aber er lachte. »Du meinst, so viele von euch sind nötig, um gegen einen Dritt zu kämpfen?«
»Wir sind Menschen, keine Dritts, Kackgesicht. Du bist ungefähr so stark wie ein Furz!«
Aber sie ließen ihn los. Und sobald sie das taten, trat Ender aus, hoch und hart, traf Stilson mitten aufs Brustbein. Er fiel um.
Das überraschte Ender – er hatte nicht geglaubt, Stilson mit einem Tritt zu Boden zu bringen. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass Stilson einen Kampf wie diesen hier nicht ernst nahm, dass er nicht auf einen wirklich verzweifelten Schlag vorbereitet war.
Einen Augenblick lang wichen die anderen zurück, und Stilson lag reglos da. Sie fragten sich alle, ob er wohl tot war. Ender hingegen versuchte, einen Weg zu finden, wie er ihrer Rache zuvorkommen könnte. Sie davon abzuhalten, dass sie morgen im Rudel über ihn herfielen. Ich muss das hier jetzt gewinnen, und zwar ein für alle Mal, oder ich werde es jeden Tag auszukämpfen haben, und es wird schlimmer und schlimmer werden.
Ender kannte die ungeschriebenen Gesetze von Kämpfen zwischen Männern, auch wenn er erst sechs war. Es war verboten, einen Gegner anzugreifen, der hilflos am Boden lag; nur ein Tier täte das.
Also ging Ender zu Stilsons reglosem Körper und trat ihm noch einmal brutal in die Rippen. Stilson stöhnte und rollte sich von ihm weg. Ender ging um ihn herum und trat ihn noch einmal, in den Schritt. Stilson konnte keinen Ton hervorbringen, er klappte nur wie ein Taschenmesser zusammen, und Tränen strömten ihm aus den Augen.
Darauf sah Ender die anderen kalt an. »Vielleicht habt ihr jetzt die Absicht, euch gegen mich zusammenzutun. Ihr könntet mich wahrscheinlich ziemlich bös verprügeln. Aber denkt immer daran, was ich mit Leuten mache, die versuchen, mir wehzutun. Von da an werdet ihr euch fragen, wann ich euch erwische und wie schlimm das werden wird.« Er trat Stilson ins Gesicht. Blut aus seiner Nase
HEYNE SCIENCE FICTION
Band 06/8226
Titel der amerikanischen Originalausgabe
ENDER’S GAME
Deutsche Übersetzung von Karl-Ulrich Burgdorf Neu durchgesehen und vollständig überarbeitet von Rainer-Michael Rahn Deutsche Übersetzung der Vorbemerkung von Bernhard Kempen Das Umschlagbild ist von Michael Whelan
Lektorat: Sascha Mamczak
Copyright © 1977, 1985, 1991 by Orson Scott Card
Copyright © 2005 des Vorworts by Andreas Brandhorst Copyright © 2005 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random Househttp://www.heyne.de
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, München – Zürich Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
eISBN 978-3-641-08250-5
www.randomhouse.de
Leseprobe

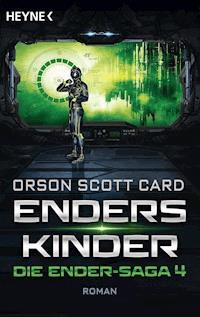

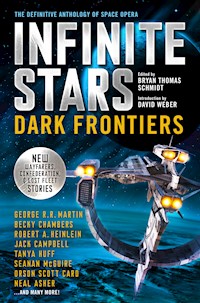















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









