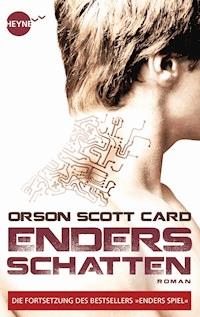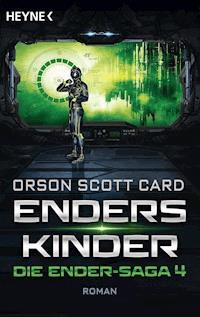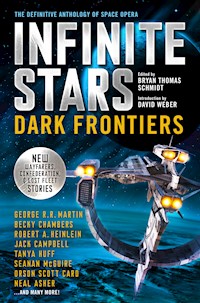3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mensch und KI
Die Nachkommen der Auserwählten vom Planeten Harmonie und die neuen Bewohner der Erde haben endlich Frieden geschlossen. Das Leben auf dem Planeten wächst und gedeiht; Städte und Nationen sind entstanden, die entweder Nafai oder seinem Bruder Elemak folgen. Nur Nafais Nachfolgerin Shedemei befindet sich noch an Bord der Basilika, dem Raumschiff, mit dem die Auserwählten zur Erde gekommen sind. Sie hat viele Kämpfe und viel Leid gesehen, doch das, was sie zu suchen aufgebrochen ist, hat sie noch nicht gefunden: den Hüter der Erde, den gewaltigen Zentralcomputer, der Überseele, die KI vom Planeten Harmonie, retten kann – und der ihr auch die Rückkehr zum Planeten Harmonie ermöglichen könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ORSON SCOTT CARD
DER HÜTER DER ERDE
Die Homecoming-Saga 5
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Die Nachkommen der Auserwählten vom Planeten Harmonie und die neuen Bewohner der Erde haben endlich Frieden geschlossen. Das Leben auf dem Planeten wächst und gedeiht; Städte und Nationen sind entstanden, die entweder Nafai oder seinem Bruder Elemak folgen. Nur Nafais Nachfolgerin Shedemei befindet sich noch an Bord der Basilika, dem Raumschiff, mit dem die Auserwählten zur Erde gekommen sind. Sie hat viele Kämpfe und viel Leid gesehen, doch das, was sie zu suchen aufgebrochen ist, hat sie noch nicht gefunden: den Hüter der Erde, den gewaltigen Zentralcomputer, der Überseele, die KI vom Planeten Harmonie, retten kann – und der ihr auch die Rückkehr zum Planeten Harmonie ermöglichen könnte …
Der Autor
Orson Scott Card, 1951 in Richland, Washington geboren, studierte englische Literatur und arbeitete als Theaterautor, bevor er sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Mit »Enders Spiel« gelang ihm auf Anhieb ein internationaler Bestseller, der mit dem Hugo und dem Nebula Award ausgezeichnet wurde. Auch die Fortsetzung Sprecher für die Toten gewann diese beiden prestigeträchtigen Auszeichnungen, somit ist Orson Scott Card der bislang einzige SF-Schriftsteller, dem es gelang, beide Preise in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen. Enders Game wurde 2013 mit Asa Butterfield und Harrison Ford in den Hauptrollen verfilmt. Card lebt mit seiner Familie in Greensboro, North Carolina.
Im Heyne Verlag sind die Romane der Ender-Saga und der Homecoming-Saga als E-Books lieferbar:
Ender-Saga: Enders Spiel, Sprecher für die Toten, Xenozid, Enders Kinder
Homecoming-Saga: Die verlorene Erde, Der Ruf der Erde, Die Schiffe der Erde, Die Kinder der Erde, Der Hüter der Erde
www.diezukunft.de
Titel der Originalausgabe
EARTHBORN
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe
© Copyright 1995 by Orson Scott Card
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-22868-2V002
Charaktere
Anmerkungen zu den Regeln der Namengebung
Beim Volk der Nafari ist es Brauch, dass besonders bekannte Personen ihrem Namen Ehrentitel hinzufügen. Formell wird der Ehrentitel an den Anfang eines Namens gesetzt; bei offiziellen Staatsakten beispielsweise wird der König von Darakemba mit Ak-Moti angesprochen. Doch im Allgemeinen wird der Ehrentitel am Ende hinzugefügt, spricht: also Motiak. Hin und wieder werden Ehrentitel abgewandelt, damit sie zu dem betreffenden Namen passen, und gelegentlich Namen, damit sie zum Ehrentitel passen. Als Jamim also Thronerbe war, hieß er – dem normalen Muster zufolge – Ha-Jamim oder Jamimha; doch als König war er Ka-Jamim oder Jaminka (vergleiche Nuak/Ak-Nu und Motiak/Ak-Moti); und als ehemaliger König spricht man von ihm als Ba-Jamim oder Jamimba (vergleiche Nuab/Ab-Nu und Motiab/Ab-Moti).
Die Ehrentitel für Männer, die in diesem Band eine Rolle spielen, lauten: Ak/Ka, was ›herrschender König‹ bedeutet; Ha/Akh, ›Thronerbe‹; Ab/Ba, ›ehemaliger König‹; Usch, ›mächtiger Krieger‹; Dis, ›geliebter Sohn‹; Og/Go, ›Hohepriester‹; Ro/Or, ›weiser Lehrer‹; Di/Id, ›Verräter‹. Die Ehrentitel für Frauen, die in diesem Buch erwähnt werden, sind: Dwa, ›Mutter des Thronerben‹ (ob sie nun lebt oder bereits verstorben ist); Gu/Ug, ›verehrte Frau des Königs‹; Ja, ›sehr leidenschaftliche Frau‹.
Darüber hinaus wird die Silbe da als allgemeine Kosebezeichnung benutzt und an das Ende eines normalerweise abgekürzten Namens gesetzt, aber vor jeden hinzugefügten Ehrentitel. Dementsprechend nennt Chebeja in privatem Kreis ihren Gatten ›Kmadaro‹, was sich zusammensetzt aus (A)kma + da (Kosebezeichnung) + ro (Ehrentitel mit der Bedeutung »großer Lehrer«); Akmaro wiederum nennt seine Gattin ›Bedaja‹, also (Che)be + da (Kosebezeichnung) + ja (Ehrentitel mit der Bedeutung ›sehr leidenschaftliche Frau‹).
Die Söhne eines hervorragenden Mannes werden insgesamt als sein ›Stamm‹ betrachtet und auch so bezeichnet. Also werden die vier Söhne Motiaks manchmal ›die Motiaki‹ genannt; die vier Söhne Pabulogs wurden ›die Pabulogi‹ genannt, bis sie diesen Namen zurückwiesen.
Man sollte auch darauf hinweisen, dass es für die unterschiedlichen intelligenten Spezies verschiedene Bezeichnungen gibt. Himmelsvolk, Erdvolk und Mittelvolk werden auch Engel, Wühler beziehungsweise Menschen genannt. Die ersten drei Begriffe stehen für Formalität, Würde und Gleichberechtigung unter den Arten. Doch die drei letzteren sind lediglich informell, nicht aber unbedingt abwertend, und die Angehörigen aller drei Spezies bezeichnen sich selbst bereitwillig mit den formellen wie auch informellen Namen.
Menschen (Mittelvolk)
In Darakemba
Motiak, oder Ak-Moti – der König, Eroberer des Großteils des Reichs Darakemba
Dudagu, oder Gu-Duda – Motiaks derzeitige Frau, Mutter seines jüngsten Sohnes
Toeledwa, oder Dwa-Toel – Motiaks verstorbene Frau, Mutter seiner ersten vier Kinder
Jamimba, oder Ba-Jamim – Motiaks verstorbener Vater
Motiab, oder Ab-Moti – Jamimbas Vater, der die Nafari aus dem Land Nafai führte, um sie mit dem Volk von Darakemba vereinen, und damit den Kern des Reiches gründete Aronha, oder Ha-Aron – Motiaks ältester Sohn, sein Thronerbe
Edhadeja, oder Ja-Edhad – Motiaks älteste Tochter und zweites Kind
Mon – Motiaks zweiter Sohn und drittes Kind, benannt nach Monusch
Ominer – Motiaks dritter Sohn und viertes Kind, das letzte von Toeledwas Kindern
Khimin – Motiaks vierter Sohn, das einzige Kind von Dudagu, Motiaks derzeitiger Frau
Monusch, oder Usch-Mon – Motiaks führender Soldat
In Chelem
Akmaro, oder Ro-Akma – ein ehemaliger Priester von König Nuak der Zenifi, der nun eine Gruppe von Gefolgsleuten in den Lehren von Binaro/Binadi unterweist; seine Anhänger werden gelegentlich Akmari genannt
Chebeja, oder Ja-Cheb – Akmaros Frau, eine Entwirrerin
Akma – Akmaros und Chebejas Sohn und ältestes Kind
Luet – Akmaros und Chebejas Tochter und jüngstes Kind
Pabulog, oder Og-Pabul – ehemaliger Hohepriester König Nuaks und nun ein besonders brutaler Führer unter den Elemaki, dem ein Heer zur Verfügung steht
Pabul – Pabulogs ältester Sohn
Udad – Pabulogs zweiter Sohn
Didul – Pabulogs dritter Sohn
Muwu – Pabulogs vierter und jüngster Sohn
Unter den Zenifi
Zenifab, oder Ab-Zeni – der Gründungskönig der Zenifi, nach dem der Stamm benannt ist; sie hängen dem grundlegenden Glauben an, dass Menschen nicht mit Engeln oder Wühlern zusammenleben sollten, und haben versucht, in ihrem angestammten Heimatland Nafai eine rein menschliche Kolonie zu gründen, nachdem die Nafari mit den Darakembi verschmolzen.
Nuak, oder Ak-Nu – auch Nuab, oder Ab-Nu –; Zenifabs Sohn und derzeitiger König der Zenifi; spricht man von der Zeit seiner Herrschaft, wird die Form »Nuak« benutzt; bezieht man sich auf spätere Zeiten, wird er »Nuab« genannt; eine Zeitlang entsteht beim Wechsel von einem Ehrentitel zum anderen stets Verwirrung
Ilihiak, oder Ak-Ilihi – Nuaks Sohn, von dem man nie erwartet hat, dass er König werden würde; doch in der Krise nach der Ermordung seines Vaters wurde ihm das Amt aufgezwungen
Wissedwa, oder Dwa-Wiss – Ilihiaks Frau; sie hat die Zenifi nach Nuaks feigem Rückzug gerettet
Khideo – führender Soldat Ilihiaks; er lehnt alle Ehrentitel ab, weil er einmal versucht hat, Nuak zu töten
Binadi, oder Di-Bina; auch Binaro oder Ro-Bina genannt – zum Tode verurteilt und von Nuak und Pabulog hingerichtet, wurde er offiziell zum Verräter erklärt (daher Binadi); doch von Akmaros Leuten wird er Binaro genannt und als großer Lehrer verehrt
Im Raumschiff Basilika
Schedemei – die Herrin der Sterne, eine brillante Genetikerin, die letzte Überlebende der ursprünglichen Gruppe von Menschen, die vom Planeten Harmonie zur Erde zurückgeführt wurden. Unter den Wühlern oder Erdmenschen ist sie als Die-nie-begraben-Wurde bekannt
Engel (Himmelsvolk)
Husu – Kommandant der Späher, eine Art ›Kavallerie‹, die vollständig aus Himmelsvolk besteht
bGo – Motiaks Oberbuchhalter, Vorstand eines Großteils der Bürokratie von Darakemba
Bego – bGos Ander-Ich, der Archivar des Königs und Tutor von Motiaks Kindern
Wühler (Erdvolk)
Uss-Uss, oder Voozhum – Edhadejas Zimmermädchen, eine Sklavin; aber gewissermaßen eine Weise und Priesterin unter den anderen Wühlersklaven
Prolog
Einst, vor langer Zeit, hatte der Computer des Raumschiffs Basilika den Planeten Harmonie vierzig Millionen Jahre lang beherrscht. Nun gab dieser Computer auf eine viel kleinere Bevölkerung acht und verfügte nur noch über viel geringere Möglichkeiten zum Eingreifen. Doch der Planet, um den er sich kümmerte, war die Erde, die uralte Heimat der menschlichen Rasse.
Das Raumschiff Basilika hatte eine Gruppe Menschen zurück nach Hause gebracht, nur um festzustellen, dass während der Abwesenheit der menschlichen Rasse zwei neue Spezies den hohen Gipfel der Intelligenz erklommen hatten. Nun teilten drei Völker sich ein gewaltiges Massiv hoher Berge, üppiger Täler und ein Klima, das eher mit der Höhe als mit der geographischen Breite variierte.
Die Wühler nannten sich selbst das Erdvolk; sie gruben Tunnels durch das Erdreich und in Baumstämme, die sie ausgehöhlt hatten. Die Engel waren das Himmelsvolk; sie bauten überdachte Nester in Bäumen und hingen mit den Köpfen nach unten von Ästen, um zu schlafen, zu streiten und zu unterrichten. Die Menschen waren jetzt das Mittelvolk und wohnten in Häusern auf dem Boden.
Es gab keine Wühlerstadt ohne Menschenhäuser auf dem Erdboden darüber, kein Engeldorf ohne die ummauerten Kammern des Mittelvolks, die künstliche Höhlen darstellten. Das gewaltige Wissen, das die Menschen vom Planeten Harmonie mitgebracht hatten, war nur ein Bruchteil dessen, was ihre Vorfahren auf der Erde gewusst hatten, bevor vierzig Millionen Jahren zuvor ihr Exil begonnen hatte. Nun war auch dies zum größten Teil vergessen; doch was blieb, war dem, was die Völker der Erde und des Himmels je gewusst hatten, so hoch überlegen, dass das Mittelvolk überall wo es wohnte, große Macht besaß und normalerweise auch herrschte.
Im Himmel jedoch vergaß der Computer des Raumschiffs Basilika nichts; er sammelte Daten mit Hilfe von Satelliten, die er um den Planeten in Umlauf gebracht hatte, den er beobachtete, und erinnerte sich an alles, was er in Erfahrung gebracht hatte.
Und er beobachtete nicht allein. Denn in dem Schiff lebte eine Frau, die mit den ersten Kolonisten zur Erde gekommen war; dannaber war sie, mit dem Mantel des Herrn beziehungsweise der Herrin der Sterne bekleidet, in den Himmel zurückgekehrt, um lange Jahre zu schlafen und kurz zu wachen. Ihr Körper wurde von dem Mantel geheilt und unterstützt, so dass der Tod noch ein ferner Besucher war, falls er denn je zu ihr kommen sollte. Sie erinnerte sich an alles, was ihr wichtig war, an Menschen, die einst gelebt hatten und nun tot waren. Geburt und Leben und Tod – sie hatte so viel davon gesehen, dass sie jetzt kaum noch darauf achtete. Für sie spielten nur Generationen eine Rolle, Jahreszeiten in ihrem Garten, Bäume und Gras und Menschen, die aufstiegen und fielen, aufstiegen und fielen.
Auch auf der Erde gab es gewisse Erinnerungen. Zwei Bücher, auf Metallplatten geschrieben, waren seit der Rückkehr der Menschen erhalten geblieben. Eins befand sich in den Händen des Königs der Nafari und wurde vom einen Herrscher an den nächsten weitergegeben. Das andere, nicht so umfassende, war dem Bruder des ersten Königs übergeben worden und von diesem an seine Söhne, die keine Könige waren, nicht einmal berühmte Männer, bis schließlich der letzte dieser Linie, der nicht mehr imstande war, diese uralte Schrift auch nur zu lesen, das kleinere Metallbuch dem Mann übergab, der zu seiner Zeit König war. Lediglich auf den Seiten dieser Bücher befand sich eine Erinnerung, die unverändert von Jahr zu Jahr überdauerte.
Im Herzen der Bücher, in den Tiefen der Schiffsaufzeichnungen und warm in der Seele der Frau lag die größte dieser Erinnerungen: dass die Menschen zur Erde zurückgebracht worden waren, weil eine Wesenheit sie gerufen hatte, die sie nicht verstanden und die der Hüter der Erde genannt wurde. Die Stimme des Hüters war nicht deutlich, nicht verständlich, wie die des Schiffscomputers es gewesen war, damals in den Tagen, als man sie Überseele genannt hatte und als sie von den Menschen als Gott verehrt worden war. Stattdessen sprach der Hüter durch Träume, und während viele die Träume empfingen und glaubten, dass sie eine Bedeutung hatten, wussten nur wenige, wer sie geschickt hatte oder was der Hüter von den Völkern der Erde verlangte.
1
Gefangenschaft
Akma war im Hause eines reichen Mannes geboren worden. An diese Zeit erinnerte er sich kaum. Er wusste noch, dass sein Vater, Akmaro, ihn einmal auf einen hohen Turm getragen und ihn dort einem anderen Mann übergeben hatte, der ihn über die Brüstung baumeln ließ, bis er vor Furcht schrie. Der Mann, der ihn festhielt, lachte, bis Vater die Hand ausstreckte, Akma ergriff und ihn packte. Später erzählte Mutter Akma, der Mann, der ihn auf dem Turm gequält habe, sei der König des Landes Nafai gewesen, ein Mann namens Nuak. »Er war ein sehr schlechter Mensch«, sagte Mutter, »aber die Leute schienen nichts dagegen zu haben, solange er ein guter König war. Doch als die Elemaki kamen und das Land Nafai eroberten, hasste das Volk Nuak so sehr, dass es ihn verbrannte.« Jedes Mal, nachdem die Mutter ihm diese Geschichte erzählt hatte, veränderte Akmas Gedächtnis sich, und wenn er nun von dem lachenden Mann träumte, der ihn über den Rand des Turms hielt, stellte er sich vor, der Mann sei von Flammen umgeben, bis der gesamte Turm brannte, und Vater streckte nicht mehr die Hand aus, um seinen kleinen Jungen zu retten, sondern Akmaro sprang hinab, fiel und fiel und fiel, und Akma wusste nicht, was er tun sollte, auf dem Turm bleiben und verbrennen oder seinem Vater in den Abgrund hinterherspringen. Aus diesem Traum erwachte er stets mit Schreckensschreien.
Eine andere Erinnerung war die, dass sein Vater mitten am Tag ins Haus stürmte, während Mutter gerade zwei Wühlerfrauen beaufsichtigte, die ein Fest vorbereiteten, das an diesem Abend veranstaltet werden sollte. Der Ausdruck auf Akmaros Gesicht war schrecklich, und obwohl er mit ihr flüsterte und Akma keine Ahnung hatte, was er sagte, wusste er, dass es sehr schlimm war, und bekam es mit der Angst zu tun. Vater stürmte sofort wieder aus dem Haus, und Mutter ließ die Wühlerinnen augenblicklich die Vorbereitungen für das Fest abbrechen und Vorräte für eine Reise zusammentragen. Nur ein paar Minuten später kamen vier Menschenmänner mit Schwertern an die Tür und verlangten, den Verräter Akmaro zu sprechen. Mutter tat so, als sei Vater hinten im Haus, und versuchte zu verhindern, dass die Männer hereinkamen. Der größte aber schlug sie nieder und hielt ihr ein Schwert an die Kehle, während die anderen sofort das Haus nach Akmaro durchsuchten. Der kleine Akma war wütend und lief zu dem Mann, der Mutter bedrohte. Der Mann lachte ihn aus, als Akma sich an einem der Steine seines Schwertes schnitt, doch Mutter lachte nicht. »Warum lachst du?«, sagte sie. »Dieser kleine Junge war so mutig, einen Mann mit einem Schwert anzugreifen, während du nur den Mut aufbringst, eine unbewaffnete Frau anzugreifen.« Daraufhin wurde der Mann wütend, doch als die anderen zurückkamen, ohne Vater gefunden zu haben, gingen sie alle davon.
Dort gab es auch Nahrung. Akma war sicher, dass es dort jede Menge Nahrung gegeben hatte, die von Wühlersklaven sorgfältig zubereitet wurde. Doch nun, in seinem Hunger, konnte er sich nicht daran erinnern. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, sich jemals satt gegessen zu haben. Hier auf den Maisfeldern, unter der heißen Sonne, konnte er sich nicht an eine Zeit ohne Durst erinnern, ohne einen müden Schmerz in den Armen, dem Rücken, den Beinen, ohne ein Pochen hinter den Augen. Er wollte weinen, wusste jedoch, dass er damit seine Familie beschämen würde. Er wollte dem Wühleraufseher zurufen, dass er trinken und sich ausruhen und essen musste und dass es dumm sei, sie ohne Nahrung arbeiten zu lassen, weil sie dann nur umso schneller erschöpft seien und es ihnen wie dem alten Tiwiak ergehen würde, der gestern tot umgefallen war, einfach so. Er war in den Mais gekippt und hatte sich nicht einmal von seiner Frau verabschieden können. Dennoch war sie still geblieben, hatte nichts gesagt, als sie weinend über seiner Leiche kniete. Doch der Aufseher hatte sie trotzdem geschlagen, weil sie zu arbeiten aufgehört hatte. Dabei war Tiwiak doch ihr Gatte gewesen.
Akma hasste nichts auf der Welt so sehr wie die Wühler. Es war falsch von seinen Eltern gewesen, damals im Land Nafai Wühler als Sklaven zu halten. Man hätte alle Wühler umbringen sollen, bevor sie sich richtigen Personen nähern konnten. Vater konnte so viel darüber reden, wie er wollte, dass die Wühler sich nur für die lange, grausame Oberhoheit Nuaks rächten. Er konnte spät in der Nacht flüstern, der Hüter der Erde wolle nicht, dass das Erdvolk und das Himmelsvolk und das Mittelvolk Feinde seien. Akma kannte die Wahrheit: Solange auch nur ein Wühler lebte, war die Welt nicht sicher.
Als die Wühler kamen, weigerte Vater sich, einen seiner Leute kämpfen zu lassen. »Ihr seid mir nicht in die Wildnis gefolgt, um Mörder zu werden, oder?«, fragte er sie. »Der Hüter will nicht, dass seine Kinder getötet werden.«
Der einzige Protest, den Akma hörte, war Mutters Flüstern: »Ihre Kinder.« Als ob es eine Rolle spielte, ob der Hüter der Erde einen Pflug oder einen Topf zwischen den Beinen hatte. Akma wusste nur, dass der Hüter eine schlechte Entschuldigung für einen Gott war, wenn er nicht verhinderte, dass seine Anbeter von schmutzigen, tierischen, dummen, grausamen Wühlern versklavt wurden.
Doch Akma ließ von diesen Gedanken nichts verlauten, denn als er es einmal getan hatte, war Vater still geworden und hatte den Rest der Nacht nicht mehr mit ihm gesprochen. Das war unerträglich. Das Schweigen während der Tage war schon schlimm genug, doch dass Vater ihn auch des Nachts von den Gesprächen ausschloss, war das schlimmste überhaupt auf der Welt. Also behielt Akma seinen Hass auf die Wühler für sich, wie auch seine Verachtung für den Hüter, und des Nachts flüsterte er kaum verständlich mit seiner Mutter und seinem Vater und trank ihre geflüsterten Worte, als wären sie das klare, kalte Wasser eines Gebirgsflusses.
Und dann erschien eines Tages ein neuer Junge im Dorf. Er war nicht hager und sonnengebräunt wie all die anderen, und seine Kleidung war gut, bunt und nicht geflickt. Sein Haar war sauber und lang, und der Wind fing sich darin und zerzauste es, als er auf der Kuppe des niedrigen Hügels inmitten der Gemeinde stand. Nach allem, was Vater und Mutter über den Hüter der Erde gesagt hatten, war Akma noch immer unvorbereitet auf diese Vision eines Gottes und unterbrach die Arbeit, nur um ihn anzusehen.
Der Aufseher schrie Akma an, doch er hörte ihn nicht. Jedes Geräusch war von seiner Vision verschluckt worden, jede Sinneswahrnehmung bis auf das Sehvermögen war ausgeschaltet. Erst als der Schatten des Aufsehers über ihm ganz groß wurde, den Arm erhoben, um ihn mit dem Stock zu schlagen, bemerkte Akma ihn. Er zuckte zusammen, duckte sich und rief – es war beinahe ein Reflex – dem Jungen zu, dessen Gesicht das Bild eines Gottes war: »Lass nicht zu, dass er mich schlägt!«
»Halt!«, rief der Junge. Seine Stimme klang selbstbewusst und kräftig, als er den Hügel hinabschritt, und – so unglaublich es auch sein mochte – der Aufseher gehorchte ihm sofort.
Vater stand weit von Akma entfernt, doch Mutter war nah genug, um Akmas kleiner Schwester Luet etwas zuzuflüstern, und Luet trat ein paar Schritte näher an Akma heran, damit sie ihm leise etwas zurufen konnte. »Er ist der Sohn von Vaters Feind«, sagte sie.
Akma hörte sie und wurde sofort misstrauisch. Doch die Schönheit des älteren Jungen verringerte sich nicht, als er näherkam.
»Was hat sie dir gesagt?«, fragte der Junge. Seine Stimme war freundlich, auf seinem Gesicht lag ein Lächeln.
»Dass dein Vater der Feind meines Vaters ist.«
»Ah, ja. Aber nicht, weil mein Vater es so gewollt hat«, sagte er.
Das ließ Akma innehalten. Niemand hatte sich je die Mühe gemacht, dem sieben Jahre alten Jungen zu erklären, wieso sein Vater so viele Feinde hatte. Es war Akma nie in den Sinn gekommen, dass es vielleicht die Schuld seines Vaters war. Aber er war argwöhnisch: Wie konnte er dem Sohn des Feindes seines Vaters glauben? Und doch … »Du hast verhindert, dass der Aufseher mich schlägt«, sagte Akma.
Der Junge sah den Aufseher an, dessen Gesicht unergründlich war. »Von nun an«, sagte er, »wirst du diesen Jungen oder seine Schwester ohne meine Zustimmung nicht mehr bestrafen. Mein Vater befiehlt es.«
Der Aufseher senkte den Kopf. Akma hatte allerdings den Eindruck, dass er nicht allzu glücklich wirkte, von einem Menschenjungen Befehle wie diesen entgegennehmen zu müssen.
»Mein Vater ist Pabulog«, sagt der Junge, »und ich heiße Didul.«
»Ich bin Akma. Mein Vater ist Akmaro.«
»Ro-Akma? Akma der Lehrer?« Didul lächelte. »Was hat Ro zu lehren, das er nicht von Og gelernt hat?«
Akma wusste nicht genau, was Og bedeutete.
Didul schien zu wissen, warum er verwirrt war. »Og ist der Taghüter, der Höchste der Priester. Nach dem Ak, dem König, ist niemand klüger als Og.«
»König bedeutet lediglich, dass man die Macht hat, jeden zu töten, den man nicht mag, außer er hat ein Heer, wie die Elemaki.« Akma hatte seinem Vater dies oft sagen hören.
»Und doch herrscht mein Vater jetzt über die Elemaki dieses Landes«, sagte Didul. »Während Nuak tot ist. Weißt du, sie haben ihn verbrannt.«
»Hast du es gesehen?«, fragte Akma.
»Geh ein Stück mit mir. Du bist für heute mit der Arbeit fertig.« Didul blickte den Aufseher an. Der Wühler, der sich zu voller Größe aufgerichtet hatte, war kaum so groß wie Didul; wenn der zur vollen Mannesgröße herangewachsen war, würde er den Wühler überragen wie ein Berg einen Hügel. Doch bei Didul und dem Aufseher hatte die Größe nichts mit ihrer stummen Konfrontation zu tun. Der Wühler erschlaffte unter dem Blick des Jungen.
Akma verspürte Ehrfurcht. »Wie machst du das?«, fragte er Didul, als der seine Hand nahm und ihn davonführte.
»Was?«, fragte Didul.
»Dass der Aufseher so …«
»So nutzlos wirkt?«, fragte Didul. »So hilflos und dumm und niedrig?«
Hassten die Menschen, die Freunde der Wühler waren, sie ebenfalls?
»Ganz einfach«, sagte Didul. »Er weiß, wenn er mir nicht gehorcht, werde ich es meinem Vater erzählen, und dann verliert er seinen bequemen Job hier und muss wieder bei den Befestigungen und Tunnels arbeiten oder bei Angriffen mitziehen. Und würde er je eine Hand gegen mich erheben, würde mein Vater ihn zerreißen lassen.«
Die Vorstellung, der Aufseher – alle Aufseher – würde zerrissen, bereitete Akma große Befriedigung.
»Ja, ich habe gesehen, wie sie Nuak verbrannten. Er war natürlich König, also führte er unsere Soldaten im Krieg an. Aber er war alt und weich und dumm und ängstlich geworden. Alle wussten es. Vater versuchte, es auszugleichen, aber Og kann nur so viel bewirken, wenn Ag schwach ist. Einer der großen Soldaten, Teonig, schwor, ihn zu töten, damit ein wirklicher König seinen Platz einnehmen konnte – wahrscheinlich sein zweiter Sohn, Ilihi – aber du kennst keinen dieser Leute, oder? Du musst … wie alt gewesen sein? Drei Jahre? Wie alt bist du jetzt?«
»Sieben.«
»Also drei, als dein Vater Verrat beging, wie ein Feigling in die Wildnis flüchtete und anfing, Ränke gegen die reinen menschlichen Nafari zu schmieden, sich gegen sie zu verschwören, zu versuchen, Menschen, Wühler und Himmelsfleisch zu bewegen, als Gleichberechtigte zusammenzuleben.«
Akma sagte nichts. Das lehrte sein Vater tatsächlich. Doch Akma hatte es niemals für Verrat an dem rein menschlichen Königreich gehalten, in dem er geboren worden war.
»Also, was weißt du? Ich wette, du erinnerst dich nicht mal daran, am Hof gewesen zu sein, oder? Aber du warst da. Ich habe dich gesehen, wie du die Hand deines Vaters gehalten hast. Er hat dich dem König vorgestellt.«
Akma schüttelte den Kopf. »Ich erinnere mich nicht.«
»Es war Familientag. Wir alle waren da. Aber du warst noch klein. Doch ich erinnere mich an dich, weil du nicht schüchtern warst oder Angst hattest oder so etwas. Du warst richtig tapfer. Der König hat eine Bemerkung über dich gemacht. ›Der hier wird ein großer Mann, wenn er jetzt schon so tapfer ist.‹ Mein Vater hat sich daran erinnert. Deshalb hat er mich geschickt, dich zu suchen.«
Akma verspürte ein Prickeln der Freude in der Brust aufflattern. Pabulog hatte seinen Sohn geschickt, nach ihm zu suchen, weil er als Baby so tapfer gewesen war. Er erinnerte sich daran, wie er den Soldaten angegriffen hatte, der seine Mutter bedroht hatte. Bis zu diesem Augenblick hatte er sich nie für tapfer gehalten, doch nun sah er ein, dass es stimmte.
»Auf jeden Fall stand Nuak kurz davor, von Teonig ermordet zu werden. Es heißt, Teonig habe immer wieder gefordert, dass Nuak mit ihm kämpft. Aber Nuak hat immer nur gesagt: ›Ich bin der König! Ich muss nicht gegen dich kämpfen!‹ Und Teonig brüllte immer wieder: ›Beschäme mich nicht, indem ich dich wie einen Hund erschlage.‹ Nuak floh zur Spitze des Turms, und Teonig wollte ihn gerade töten, als der König zur Grenze schaute, zum Land der Elemaki. Und da sah er, wie das größte Heer von Wühlern, das man je gesehen hat, wie ein Sturm auf das Land brandete. Also ließ Teonig ihn leben, damit der König die Verteidigung führen konnte. Doch statt sein Land zu verteidigen, befahl Nuak seinem Heer die Flucht, damit es nicht vernichtet wurde. Es war feige und schändlich, und Männer wie Teonig haben ihm den Gehorsam verweigert.«
»Aber dein Vater nicht«, sagte Akma.
»Mein Vater musste dem König folgen. Das tun Priester nun mal«, sagte Didul. »Der König hat den Soldaten befohlen, ihre Frauen und Kinder zurückzulassen, aber Vater wollte es nicht; zumindest nahm er mich mit. Trug mich auf seinem Rücken und hielt mit den anderen Schritt, obwohl ich nicht mehr so klein und er nicht mehr so jung war. Deshalb war ich dabei, als den Soldaten klar wurde, dass ihre Frauen und Kinder in der Stadt wahrscheinlich abgeschlachtet wurden. Also zogen sie den alten Nuak aus, stachen ihn nieder und hielten brennende Stöcke an seine Haut, damit er schrie und schrie.« Didul lächelte. »Du würdest nicht glauben, wie er geschrien hat, die alte Wurst.«
Die bloße Vorstellung war schrecklich. Es war furchterregend, dass Didul, der sich daran erinnerte, es selbst gesehen zu haben, so selbstgefällig darüber sprechen konnte.
»Natürlich wurde Vater ungefähr zu dieser Zeit klar, dass die Soldaten darüber sprachen, wen sie sonst noch verbrennen könnten, und die Priester boten sich natürlich an. Deshalb sagte er ein paar ruhige Worte in der Priestersprache und führte uns in Sicherheit.«
»Warum seid ihr nicht zur Stadt zurückgekehrt? Wurde sie zerstört?«
»Nein, aber Vater sagt, die Leute dort seien es nicht wert, wahre Priester zu haben, die die geheime Sprache kennen, und den Kalender und so weiter. Du weißt schon. Die lesen und schreiben können.«
Akma war verwirrt. »Können nicht alle lesen und schreiben?«
Didul wirkte plötzlich wütend. »Das ist die schrecklichste Tat deines Vaters, dass er allen das Lesen und Schreiben hat beibringen lassen. All den Leuten, die seine Lügen glaubten und sich aus der Stadt schlichen, um sich zu ihm zu gesellen, auch wenn sie nur einfache Bauern waren – und die meisten waren nur Bauern, oder sogar Truthahnhirten. Weißt du, er hat heilige Eide geleistet, als man ihn zum Priester machte. Dein Vater legte diese Eide ab. Er schwor, niemandem die Geheimnisse der Priesterschaft zu verraten. Und dann brachte er sie allen bei.«
»Vater sagt, alle Leute sollten Priester sein.«
»Alle Leute? Das sagt er?« Didul lachte. »Nicht nur Leute, Akma. Er wollte nicht nur den Leuten das Lesen beibringen.«
Akma stellte sich vor, dass sein Vater versuchte, dem Aufseher das Lesen beizubringen. Er versuchte sich vorzustellen, wie einer der Wühler sich über ein Buch beugte, einen Griffel hielt und die Zeichen in das Wachs der Tafeln zu ritzen versuchte. Der Gedanke ließ ihn erschauern.
»Hast du Hunger?«, fragte Didul.
Akma nickte.
»Komm, iss mit mir und meinen Brüdern.« Didul führte ihn in den Schatten eines Wäldchens hinter dem Hügel der Gemeinde.
Akma kannte den Ort – bis die Wühler kamen und sie versklavten, hatte Mutter dort die Kinder versammelt, um sie zu unterrichten und leise mit ihnen zu spielen, während Vater beim Hügel die Erwachsenen unterrichtete. Es war ein seltsames Gefühl, dort einen großen Korb mit Früchten und Kuchen und ein Fass Wein zu sehen, und Wühler, die drei Menschen die Mahlzeit servierten. Wühler gehörten nicht an den Ort, an dem seine Mutter die Kinder im Spiel geführt hatte.
Aber die Menschen gehörten dorthin. Oder besser gesagt, sie gehörten überall hin, wo sie sein wollten. Einer war klein, kaum älter als Akma. Die beiden anderen waren älter und größer als Didul – fast schon Männer, keine Knaben mehr. Einer der älteren sah Didul sehr ähnlich, wenn er auch nicht ganz so schön war. Die Augen standen vielleicht etwas zu dicht zusammen, und das Kinn war ein wenig zu stark ausgeprägt. Diduls Ebenbild, aber verzerrt, minderwertig, unfertig.
Der andere manngroße Junge war Didul so unähnlich, wie man es nur sein konnte. Während Didul anmutig war, war dieser Junge stark; während Diduls Gesicht offen und licht wirkte, sah dieses grübelnd und verschlossen und dunkel. Sein Körper schien so kräftig zu sein, dass es Akma erstaunte, dass der junge Mann überhaupt eine der Früchte ergreifen konnte, ohne sie zu zerquetschen.
Didul bemerkte offensichtlich, welcher seiner Brüder Akmas Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. »Ah, ja. Jeder sieht ihn so an. Pabul, mein Bruder. Er führt Wühlerheere. Er hat schon mit bloßen Händen getötet.«
Als Pabul Diduls Worte hörte, schaute er auf und funkelte ihn an.
»Pabul mag es nicht, dass ich davon erzähle. Aber ich habe einmal gesehen, wie er einen ausgewachsenen Wühlersoldat hochhob und ihm das Genick brach, als wäre es ein verfaulter trockener Zweig. Knack. Das Tier pinkelte überall hin.«
Pabul schüttelte den Kopf und widmete sich wieder seiner Mahlzeit.
»Iss etwas«, sagte Didul. »Setz dich zu uns. Brüder, das ist Akma, der Sohn des Verräters.«
Der ältere Bruder, der wie Didul aussah, spuckte aus.
»Sei nicht unhöflich, Udad«, sagte Didul. »Sag ihm, er soll nicht unhöflich sein, Pabul.«
»Sag's ihm selbst«, erwiderte Pabul leise. Doch Udad tat, als habe Pabul gedroht, ihn zu töten – er verstummte augenblicklich und konzentrierte sich auf seine Mahlzeit.
Der jüngere Bruder sah Akma ruhig an, als wolle er ihn einschätzen. »Ich könnte dich verprügeln«, sagte er schließlich.
»Halt die Klappe und iss, Affe«, sagte Didul. »Das ist der Jüngste, Muwu. Wir wissen nicht genau, ob er menschlich ist.«
»Wir nehmen an, Vater ist betrunken gewesen und hat sich mit einer Wühlerin gepaart, um Muwu zu zeugen. Siehst du seine kleine Rattennase?«
Muwu schrie wütend auf und warf sich auf Didul, der ihn mit Leichtigkeit abwehrte. »Hör auf, Muwu, sonst kommt Schlamm in das Essen! Schluss damit!«
»Hör auf«, sagte Pabul leise, und Muwu ließ augenblicklich von seinem Angriff auf Didul ab.
»Iss«, sagte Didul. »Du musst hungrig sein.«
Akma war hungrig, und das Essen sah gut aus. Er setzte sich gerade, als Didul sagte: »Unsere Feinde leiden Hunger, aber unsere Freunde essen.«
Das erinnerte Akma daran, dass seine Eltern ebenfalls hungrig waren, und auch seine Schwester Luet. »Lass mich etwas davon meinen Eltern und meiner Schwester bringen«, sagte er. »Oder lass sie alle kommen und mit uns essen.«
Udad brach in johlendes Gelächter aus. »Dumm«, murmelte Pabul.
»Ich habe dich eingeladen«, sagte Didul ruhig. »Bring mich nicht in Verlegenheit, indem du mich dazu bewegen willst, die Feinde meines Vaters zu füttern.«
Erst jetzt wurde Akma klar, was hier geschah. Didul mochte wunderschön und faszinierend sein, voller Geschichten und Freundlichkeit und Witz – doch im Grunde war Akma ihm völlig gleichgültig. Didul versuchte lediglich, Akma dazu zu bringen, seine Familie zu verraten. Deshalb sagte er unentwegt diese Dinge über Vater … dass er ein Verräter war und so weiter. Damit Akma sich gegen seine eigene Familie stellte.
Das wäre, als … als würde er sich mit einem Wühler anfreunden. Es war unnatürlich und falsch. Akma erkannte, dass Didul wie der Jaguar war, verschlagen und grausam. Er war schlank und wunderschön, doch wenn man ihn zu nah an sich herankommen ließ, dann sprang er und tötete.
»Ich habe keinen Hunger«, sagte Akma.
»Er lügt«, sagte Muwu.
»Nein, ich lüge nicht«, sagte Akma.
Pabul sah ihn zum ersten Mal an. »Widersprich meinem Bruder nicht«, sagte er. Die Stimme klang tot, doch die Bedrohung war unüberhörbar.
»Ich habe nur gesagt, dass ich nicht lüge«, entgegnete Akma.
»Aber du lügst«, sagte Didul fröhlich. »Du bist fast verhungert. Deine Rippen ragen so scharf aus deiner Brust hervor, dass du dich daran schneiden könntest.« Er lachte hell und hielt ihm einen Maiskuchen hin. »Bist du nicht mein Freund, Akma?«
»Nein«, sagte Akma. »Du bist auch nicht mein Freund. Du bist nur zu mir gekommen, weil dein Vater dich geschickt hat.«
Udad lachte seinem Bruder zu. »Ach, was bist du doch klug, Didul. Du hast gesagt, du könntest dich mit ihm anfreunden. Ihn schon am ersten Tag für dich einnehmen. Tja, er hat dich sofort durchschaut.«
Didul funkelte ihn an. »Das hat er vielleicht nicht, bis du gesprochen hast.«
Akma stand auf; nun war er wütend. »Du meinst, das war ein Spiel?«
»Setz dich«, sagte Pabul.
»Nein«, sagte Akma.
Muwu kicherte. »Brech ihm ein Bein, Pabul, wie du es bei dem anderen getan hast.«
Pabul schaute Akma an, als würde er darüber nachdenken.
Akma wollte ihn anflehen, wollte sagen: Bitte tu mir nicht weh. Doch er wusste instinktiv, dass er bei einem wie Pabul eins auf keinen Fall tun durfte: seine Schwäche zeigen. Hatte er nicht gesehen, wie sein Vater vor Pabulog selbst stand und ihn anschaute, ohne auch nur einen Augenblick Furcht zu zeigen? »Brech mir ein Bein, wenn du willst«, sagte Akma. »Ich kann dich nicht daran hindern, denn ich bin nur halb so groß wie du. Doch wärest du an meiner Stelle, Pabul – würdest du dich setzen und mit dem Feind deines Vaters essen?«
Pabul legte den Kopf auf die Seite und winkte Akma dann gemächlich mit der Hand heran. »Komm her«, sagte er.
Akma spürte, dass die Drohung schwächer wurde, während Pabul gelassen seine Annäherung erwartete. Doch in dem Augenblick, da Akma in seine Reichweite kam, schnellte Pabuls gerade noch so regungslose Hand vor, packte ihn an der Kehle, würgte ihn und zerrte ihn zu Boden. Nach Luft ringend, schaute Akma in die abgeschirmten Augen seines Feindes. »Warum töte ich dich jetzt eigentlich nicht und werfe deine Leiche deinem Vater zu Füßen?«, sagte Pabul sanft. »Oder vielleicht reiße ich nur Teile deines Körpers ab. Jeden Tag ein kleines Stück. Hier ein Zeh, dort ein Finger, die Nase, ein Ohr, und dann Fetzen von den Armen und Beinen. Er könnte dich wieder zusammensetzen, und wenn er alle Teile hat, wären alle wieder glücklich, nicht wahr?«
Akma war fast schlecht vor Furcht. Er hielt Pabul durchaus für fähig, eine so monströse Tat zu begehen. Er dachte an die Trauer, die seine Eltern empfinden würden, wenn sie seine blutigen Körperteile sahen, und dieser Gedanke lenkte ihn von der großen Pranke ab, die noch immer seine Kehle umklammerte, wenn jetzt auch so locker, dass er wieder atmen konnte.
Udad lachte. »Akmaro soll sich so gut mit dem Hüter der Erde stehen, dass er den alten unsichtbaren Traumsender vielleicht dazu bringen kann, ein Wunder zu wirken und die Einzelteile wieder in einen richtigen Jungen zu verwandeln. Andere Götter wirken ständig Wunder. Warum nicht auch der Hüter?«
Pabul schaute nicht einmal auf, als Udad sprach. Es war, als gäbe es seinen Bruder gar nicht.
»Willst du nicht um dein Leben bitten?«, fragte Pabul leise. »Oder zumindest um deine Zehen?«
»Soll er doch um seinen kleinen Piephahn bitten«, schlug Muwu vor.
Akma antwortete nicht. Er dachte noch immer daran, wie seine Eltern trauern würden – wie sie sogar in diesem Augenblick mit entsetzlicher Furcht um ihn erfüllt sein mussten, während sie darüber nachdachten, wohin dieser Junge ihn geführt hatte. Mutter hatte Luet geschickt und versucht, ihn zu warnen. Aber Didul hatte so wunderschön ausgesehen, war so freundlich und charmant gewesen, und … und jetzt war der Lohn dafür diese Hand um seine Kehle. Na ja, Akma würde sie so lange schweigend ertragen, wie es ihm möglich war. Selbst der König hatte schließlich geschrien, als man ihn folterte, doch Akma würde so lange ausharren, wie er konnte.
»Du solltest die Einladung meines Bruders jetzt lieber annehmen«, sagte Pabul. »Iss.«
»Nicht mit euch«, flüsterte Akma.
»Er ist dumm«, sagte Pabul. »Wir müssen ihm helfen. Bringt mir Essen, Jungs. Viel Essen. Er ist sehr, sehr hungrig.«
Mit einem raschen Griff hatte Pabul Akmas Mund aufgezwungen, und die anderen schoben Essen hinein, viel schneller, als Akma kauen oder schlucken konnte. Als sie sahen, dass er durch die Nase atmete, zwängten sie Krümel in seine Nasenlöcher, damit er nach Luft schnappen musste und dann an den Krümeln erstickte, die in seine Luftröhre gerieten. Pabul ließ endlich Akmas Hals und das Kinn los, aber nur, weil der nun hustende Akma so hilflos war, dass sie mit ihm anstellen konnten, was sie wollten, und dazu gehörte, dass sie seine Kleidung aufrissen und seinen gesamten Körper mit Früchten und Krümeln beschmierten.
Endlich war die schwere Prüfung vorbei. Pabul beauftragte Didul – und Didul wiederum seinen älteren Bruder Udad –, den undankbaren und verräterischen Akma, der sich überdies nicht benehmen konnte, zurück zu seiner Arbeit zu bringen. Udad ergriff Akmas Handgelenke und zerrte so heftig daran, dass Akma nicht laufen konnte, sondern stolpernd über den Grasboden zur Spitze des Hügels geschleift wurde. Dann warf Udad ihn den Hügel hinab, und Akma fiel Hals über Kopf, während hinter ihm Udads Gelächter hallte.
Der Aufseher untersagte, dass irgendeiner von den Menschen seine Arbeit unterbrach, um Akma zu helfen. Beschämt, verletzt, erniedrigt und wütend erhob Akma sich und versuchte, sich von den schlimmsten und unangenehmsten Flecken des Nahrungsbreis zu reinigen, ihn wenigstens von der Nase und aus den Augen zu wischen.
»Geh an die Arbeit«, verlangte der Aufseher.
»Beim nächsten Mal«, rief Udad vom Gipfel des Hügels hinab, »laden wir vielleicht deine Schwester zu einer Mahlzeit ein!«
Die Drohung rief bei Akma eine Gänsehaut hervor, doch er ließ sich nicht anmerken, dass er die Worte gehört hatte. Dies war die einzige Möglichkeit des Widerstandes, die ihm noch blieb: starrköpfiges Schweigen, genau wie die Erwachsenen es an den Tag legten.
Akma kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück und schuftete bis zum Anbruch der Dämmerung weiter. Erst als der Himmel sich verdunkelte und der Aufseher sie schließlich gehen ließ, konnte er sich zu seinen Eltern begeben und ihnen endlich erzählen, was geschehen war.
Sie sprachen in der Dunkelheit. Ihre Stimmen bildeten nur ein leises Flüstern, denn die Wühler gingen des Nachts Streife durch das Dorf und lauschten auf jede Zusammenkunft, jede Verabredung – ja, sogar auf jedes Gebet an den Hüter der Erde, denn Pabulog hatte verkündet, dies sei Verrat, der mit dem Tode bestraft werde, da jedes Gebet eines Anhängers des Renegatenpriesters Akmaro eine Beleidigung aller Götter sei. Als Mutter also die getrockneten Früchte von seinem Körper schrubbte und dabei leise weinte, erzählte Akma Vater alles, was gesagt und getan worden war.
»So ist Nuak also gestorben«, sagte Vater. »Er war einmal ein guter König. Aber er war nie ein guter Mensch. Und als ich ihm diente, war auch ich kein guter Mensch.«
»Du hast nie wirklich zu ihnen gehört«, sagte Mutter.
Akma wollte seinen Vater fragen, ob auch alles andere wahr sei, das Pabulogs Söhne gesagt hatten, wagte es aber nicht, da er nicht wusste, was er mit der Antwort anstellen sollte. Wenn sie recht hatten, war sein Vater ein Eidbrecher, und wie konnte Akma ihm dann noch irgendetwas glauben?
»Du kannst es nicht einfach dabei bewenden lassen«, sagte Mutter leise. »Siehst du denn nicht, wie weit sie Akma von dir entfernt haben?«
»Akma ist sicher alt genug, um zu wissen, dass man einem Lügner nicht glauben kann.«
»Aber sie haben ihm gesagt, du wärest ein Lügner, Kmaro«, sagte sie. »Wie also kann er dir glauben?«
Es verwunderte Akma, dass seine Mutter Dinge in seinem Verstand sah, die sogar er selbst kaum erfassen konnte. Doch er wusste auch, dass es schändlich war, den eigenen Vater anzuzweifeln, und er erschauerte, als er den Ausdruck auf dem Gesicht seines Vaters sah.
»Sie haben mir also dein Herz gestohlen? Ist es das, Kmadis?« Er nannte ihn Dis, was geliebtes Kind bedeutete, und nicht Ha, was geehrter Erbe hieß – den Namen, den er benutzte, wenn er besonders stolz auf Akma war. Kmaha – das war der Name, den er über die Lippen seines Vaters kommen hören wollte, und er blieb unausgesprochen. Ha-Akma. Ehre, nicht Mitgefühl.
»Er hat sich gegen sie gestellt«, erinnerte Mutter ihn. »Und dafür gelitten, und er war tapfer.«
»Aber sie haben in deinem Herz den Samen des Zweifels gesät, nicht wahr, Kmadis?«
Akma konnte nicht mehr dagegen ankämpfen. Es war zu viel für ihn. Jetzt endlich weinte er.
»Räume seine Zweifel aus, Kmaro«, sagte Mutter.
»Und wie soll ich das anstellen, Chebeja?«, fragte Vater. »Ich habe den Eid nie gebrochen, den ich dem König geleistet habe. Aber als sie mich vertrieben und versuchten, mich töten zu lassen, ja, da erkannte ich, dass Binaro recht hatte: Der einzige Grund, das gemeine Volk davon abzuhalten, lesen und schreiben und die uralte Sprache sprechen zu lernen, war der, das Monopol der Priester auf die Macht zu erhalten. Wenn jeder den Kalender lesen könnte und die alten Aufzeichnungen und Gesetze, müssten sie sich nicht mehr der Macht der Priester unterwerfen. Also habe ich die formelle Übereinkunft gebrochen und jedem, der zu mir kam, das Lesen und Schreiben beigebracht. Ich habe ihnen den Kalender enthüllt. Aber es ist gut, eine schlechte und ungerechte Übereinkunft zu brechen.« Vater wandte sich Mutter zu. »Er versteht das nicht, Chebeja.«
»Psst«, sagte sie.
Sie verstummten, und nur das Geräusch ihres Atems erfüllte die Hütte. Sie hörten die trippelnden Schritte eines Wühlers, der durchs Dorf lief.
»Was er wohl für einen Auftrag hat?«, flüsterte Mutter.
Vater drückte einen Finger auf ihre Lippen. »Schlaf«, sagte er leise. »Wir alle sollten jetzt schlafen.«
Mutter legte sich neben Luet, die schon lange eingeschlafen war, auf die Matte. Vater legte sich neben Mutter, und Akma ließ sich auf der anderen Seite von ihm nieder. Aber er wollte nicht, dass Vater den Arm um ihn legte. Er wollte allein schlafen, seine Schande in sich aufnehmen. Das schlimmste an seiner Erniedrigung war nicht das Würgen, das Aufsperren des Mundes, das Beschmieren mit den Früchten. Auch nicht, dass man ihn den Hügel hinabgeworfen hatte und er in zerrissener Kleidung und schmutzbedeckt vor alle Leute treten musste. Die schlimmste Erniedrigung war die, dass sein Vater ein Eidbrecher war, und dass er dies von Pabulogs Söhnen hatte erfahren müssen.
Jeder wusste, dass ein Eidbrecher der schlimmste Mensch überhaupt war. Er würde zwar etwas versprechen, aber niemand konnte sich darauf verlassen, dass er es auch hielt. Man konnte ihm nie vertrauen, sofern man ihn nicht stets unter Beobachtung hielt. Hatten Mutter und Vater ihm nicht von frühester Kindheit an beigebracht, dass er immer tun musste, wenn er es gesagt hatte, oder er hätte keine Ehre, und man könnte ihm nicht vertrauen?
Akma versuchte, über Vaters Worte nachzudenken – dass es gut sei, eine schlechte und ungerechte Übereinkunft zu brechen. Aber warum sollte man den Eid überhaupt leisten, wenn er schlecht war? Das ging Akma nicht in den Kopf. War Vater einst böse gewesen, als er den bösen Eid abgelegt hatte, und hatte dann aufgehört, böse zu sein? Wie konnte jemand aufhören, böse zu sein, wenn er erst einmal damit angefangen hatte? Und wer entschied überhaupt, was böse war, gut oder schlecht?
Der Soldat, von dem Didul ihm erzählt hatte – Teonig? –, hatte die richtige Auffassung gehabt. Man tötet einen Feind. Man schleicht sich nicht von hinten an und bricht Versprechen. Keines der Kinder würde je eine Petze dulden. Wenn man Streit hatte, stand man auf und schrie sich gegenseitig an, oder man rang miteinander, um den anderen seinem Willen zu unterwerfen. Auf diese Weise konnte man mit einem Freund streiten und doch sein Freund bleiben. Aber wenn man ihn hinterrücks angriff, war man nicht mehr sein Freund. Dann war man ein Verräter.
Kein Wunder, dass Pabulog wütend auf Vater war. Vater war verschlagen; er hatte sich in der Wildnis verborgen und Versprechen gebrochen.
Akma fing an zu weinen. Das waren schreckliche Gedanken, und er verabscheute sie. Vater war gut und freundlich, und alle Leute liebten ihn. Wie konnte er böse und verschlagen sein? Alles, was Pabulogs Söhne gesagt hatten, war gelogen, musste einfach gelogen sein. Sie waren die Bösen, sie hatten ihn gequält und erniedrigt. Sie waren die Lügner.
Aber Vater hatte gestanden, dass sie die Wahrheit gesagt hatten. Wie konnten schlechte Leute die Wahrheit sagen und gute Leute ihre Versprechen brechen? Der Gedanke drehte sich irrwitzig in Akmas Kopf, bis er endlich einschlief.
2
Wahre Träume
Mon stieg auf das Dach des Hauses des Königs, um den Untergang der trockenen Sonne zu beobachten, als sie hinter den Bergen am nördlichen Ende des Tals versank. Bego, der königliche Bibliothekar, hatte Mon einmal erzählt, dass die Menschen, als sie auf der Erde eingetroffen waren, geglaubt hätten, die Sonne ginge im Westen unter und im Osten auf. »Das liegt daran, weil sie von einem Ort mit wenig Bergen kamen«, sagte Bego. »Deshalb konnten sie Norden nicht von Westen unterscheiden.«
»Oder oben von unten?«, hatte Aronha abfällig gefragt. »Waren die Menschen völlig dumm, bevor sie Engel hatten, die ihnen etwas beibringen konnten?«
Tja, so war Aronha nun mal, immer auf Begos großes Wissen neidisch. Warum sollte Bego nicht stolz darauf sein, ein Himmelsmensch zu sein, und auf die Weisheit, die das Himmelsvolk zusammengetragen hatte? Während des Unterrichts in der Schule wies Aronha immer wieder darauf hin, dass die Menschen dem Himmelsvolk dieses oder jenes Bröckchen Weisheit gebracht hatten. Herrje, wenn man Aronha so sprechen hörte, könnte man fast glauben, das Himmelsvolk würde noch immer mit den Köpfen nach unten in den Bäumen schlafen, wären die Menschen nicht gekommen!
Was Mon betraf, so war er stets neidisch auf die Schwingen des Himmelsvolks geblieben. Selbst der alte Bego, der so stämmig war, dass er kaum von einem oberen Stockwerk zum Boden hinabgleiten konnte – Mon sehnte sich sehr nach seinen alten, ledernen Schwingen. Die größte Enttäuschung seiner Kindheit erlebte er, als er erfuhr, dass Menschen nie zu Engeln heranwachsen und dass einem niemals Schwingen sprießen konnten, wenn sie nicht schon bei der Geburt vorhanden waren, pelzig und nutzlos an den Körper gedrückt. Als Mensch war man verflucht, mit nackten, nutzlosen Armen zu leben.
Mit neun Jahren konnte Mon lediglich bei Sonnenuntergang auf das Dach steigen und das junge Himmelsvolk beobachten – diejenigen, die in seinem Alter oder noch jünger waren, aber umso freier –, wie sie ausgelassen über den Bäumen am Fluss herumtollten, über den Feldern, über den Hausdächern, wie sie aufstiegen und hinabtauchten, sich wie verrückt in der Luft balgten und wie Steine in die Tiefe stürzten, bis sie der Erde gefährlich nahe kamen, dann die Schwingen ausbreiteten, den Sturz abfingen und wie Pfeile zwischen den Häusern die Straßen entlang rasten, während an die Erde gefesselte Menschen die Fäuste hoben und die jungen Rowdys verfluchten, die eine Bedrohung für schwer arbeitende Leute darstellten, die sich lediglich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten. Ach, wäre ich doch ein Engel!, rief Mon in seinem Herzen. Ach, könnte ich doch fliegen und auf Bäume und Berge hinabschauen, auf Flüsse und Felder! Ach, könnte ich doch die Feinde meines Vaters aus weiter Ferne erspähen und zu ihm fliegen, um ihn zu warnen!
Doch Mon würde niemals fliegen können. Er würde nur auf dem Dach sitzen und vor sich hinbrüten, während andere in der Luft tanzten.
»Weißt du, es könnte schlimmer sein.«
Er drehte sich um und schnitt seiner Schwester eine Grimasse. Edhadeja war die einzige, der er je von seiner Sehnsucht nach Schwingen erzählt hatte. Man musste ihr zugute halten, dass sie es nie jemandem verraten hatte. Doch wenn sie allein zusammen waren, zog sie Mon gnadenlos damit auf.
»Es gibt auch welche, die dich beneiden, Mon. Der Sohn des Königs, groß und stark; sie sagen, du wirst ein mächtiger Krieger.«
»Niemand kann nach der Größe des Jungen urteilen, wie groß der Mann sein wird«, entgegnete Mon. »Und ich bin der zweite Sohn des Königs. Jeder, der mich beneidet, ist ein Narr.«
»Es könnte schlimmer sein«, sagte Edhadeja.
»Das hast du schon einmal gesagt.«
»Du könntest die Tochter des Königs sein.« In ihrer Stimme lag ein Anflug von Wehmut.
»Na ja, wenn man überhaupt ein Mädchen sein muss, kann man durchaus die Tochter der Königin sein«, sagte Mon.
»Wie du dich vielleicht erinnerst, ist unsere Mutter tot. Die derzeitige Königin ist Dudagu Dickarsch. Wage es ja nicht, das auch nur einen Augenblick lang zu vergessen.« Der kindische Ausdruck Dickarsch wurde in der uralten Sprache der Könige mit dem viel härteren Dermo übersetzt, und es bereitete Kindern großes Vergnügen, ihre Stiefmutter Dudagu Dermo zu nennen.
»Ach, das hat doch nichts zu bedeuten«, sagte Mon, »einmal abgesehen davon, dass der kleine Khimin im Vergleich zu allen anderen Kindern Vaters hoffnungslos hässlich ist.« Der Fünfjährige war Dudagus bislang einziges Kind, und obwohl sich sie ständig bemühte, dass man ihn statt Ha-Aron Ha-Khimin nannte, bestand nicht die geringste Aussicht, dass der Vater oder das Volk ihn als Ersatz für Aronha akzeptieren würden. Mons und Edhadejas älterer Bruder war zwölf Jahre alt und hatte bereits so viel von seiner Manneshöhe erreicht, dass das Volk sehen konnte, was für ein mächtiger Soldat er später im Kampf sein würde. Und er war ein natürlicher Führer; auch das war jetzt schon zu erkennen. Selbst wenn jetzt zu den Waffen gerufen werden sollte, bestand kaum Zweifel daran, dass Vater eine Kompanie Soldaten unter Aronhas Befehl stellte, und diese Soldaten würden stolz unter dem Jungen dienen, der einmal König werden würde. Mon sah, wie die anderen seinen Bruder betrachteten; er hörte, wie sie von ihm sprachen, und brannte innerlich. Warum hatte Vater weitere Söhne bekommen, nachdem Mutter ihm den perfekten Erstgeborenen geschenkt hatte?
Das Problem bestand darin, dass es unmöglich war, Aronha zu hassen. Gerade die Eigenschaften, die ihn mit zwölf Jahren zu einem so guten Führer machten, bewirkten auch, dass seine Brüder und Schwestern ihn liebten. Er verprügelte sie nie. Er hänselte sie nur selten. Er half ihnen stets und ermutigte sie. Er ertrug geduldig Mutters Launenhaftigkeit, Edhadejas Temperament und Ominers Rotznäsigkeit. Er war sogar zu Khimin freundlich, obwohl er von Dudagus Plänen wissen musste, ihren Sohn an Aronhas Stelle zu setzen. Die Folge davon war natürlich, dass Khimin Aronha geradezu verehrte. Edhadeja vermutete, dass dies vielleicht sogar Aronhas Plan war – womöglich wollte er alle seine Geschwister dazu bringen, ihn so sehr zu lieben, dass sie keine Ränke gegen ihn schmiedeten. »In dem Augenblick, in dem er dann den Thron besteigt, geht es schnipp, schnapp, und man schneidet uns die Kehle durch oder bricht uns das Genick.«
Edhadeja sagte das nur, weil sie die Familiengeschichte gelesen hatte. Sie war nicht immer schön verlaufen. In der Tat war der erste nette König seit vielen Generationen Vaters Großvater gewesen, der erste Motiak, derjenige, der das Land Nafai verlassen hatte, um sein Volk mit dem von Darakemba zu vereinigen. Die Könige davor waren allesamt Tyrannen mit Blut an den Händen gewesen. Aber vielleicht musste es damals ja so sein, als die Nafai ständig Krieg führten. Wollten sie überleben, konnten sie es sich nicht leisten, Erbstreitigkeiten und Bürgerkriege zu führen. Also hatten neue Könige mehr als einmal ihre Geschwister getötet, und gleichzeitig alle Nichten und Neffen; einer von ihnen hatte sogar die eigene Mutter umgebracht, weil … na ja, man kam unmöglich dahinter, warum diese Leute vor langer Zeit all diese schrecklichen Dinge getan hatten. Aber der alte Bego erzählte solche Geschichten gern, und er beendete sie stets mit irgendeinem Hinweis darauf, dass das Himmelsvolk so etwas nie getan hatte, als es noch über sich selbst herrschte. »Die Ankunft der Menschen war der Anfang des Bösen beim Himmelsvolk«, sagte er einmal.
Worauf Aronha erwidert hatte: »Ach? Also machst du dir einen kleinen Scherz daraus, das Erdvolk Teufel zu nennen? Du willst es damit wohl aufziehen?«
Bego nahm Aronhas Unverschämtheit wie immer ruhig hin. »Wir haben das Erdvolk nicht unter uns leben lassen und es zu unseren Königen gemacht. Deshalb konnte sein Böses uns nie anstecken. Es blieb fern von uns, da das Himmelsvolk und die Teufel nie zusammen wohnten.«
Wenn wir nie zusammen gewohnt hätten, dachte Mon, würde ich mir vielleicht nicht unentwegt wünschen, fliegen zu können. Vielleicht wäre ich dann damit zufrieden, wie eine Echse oder Schlange über die Erde zu kriechen.
»Nimm die Sache nicht so ernst«, sagte Edhadeja. »Aronha wird niemandem die Kehle durchschneiden.«
»Ich weiß«, sagte Mon. »Ich weiß, du wolltest mich nur aufziehen.«
Edhadeja setzte sich neben ihn. »Mon, glaubst du diese alten Geschichten über unsere Vorfahren? Über Nafai und Luet? Wie sie mit der Überseele sprachen? Dass Huschidh Leute anschauen konnte und wusste, wie sie miteinander verbunden waren?«
Mon zuckte mit den Achseln. »Vielleicht stimmen diese Geschichten.«
»Auch die über Issib und seinen fliegenden Stuhl, und dass er manchmal einfach so fliegen konnte, solange er sich im Land Pristan befand?«
»Ich wünschte, es wäre wahr.«
Edhadeja hatte sich in ihre Träumerei vertieft. Mon schaute sie nicht an; er beobachtete lediglich, wie der letzte Zipfel der Sonne über dem fernen Fluss verschwand. Das Funkeln des Wassers endete, nachdem die Sonne versunken war.
»Mon, glaubst du, dass Vater diesen Ball hat? Den Index?«
»Keine Ahnung«, sagte Mon.
»Glaubst du, dass Vater Aronha den Index zeigen wird, wenn er dreizehn Jahre alt ist und in die Geheimnisse eingeweiht wird? Und vielleicht auch Issibs Stuhl?«
»Wo sollte er so etwas denn verstecken?«
Edhadeja schüttelte den Kopf. »Ich weiß es auch nicht. Ich frage mich nur, warum wir diese wunderbaren Dinge nicht mehr haben, wo wir sie doch einst hatten.«
»Vielleicht haben wir sie ja noch.«
»Meinst du?« Edhadeja wurde plötzlich lebhaft. »Mon, glaubst du, dass Träume manchmal wahr sind? Denn ich träume immer wieder denselben Traum. Jede Nacht, manchmal sogar zwei-, dreimal in einer Nacht. Und er kommt mir so echt vor, nicht wie meine anderen Träume. Aber ich bin keine Priesterin. Und mit Frauen sprechen die Priester sowieso nicht. Würde Mutter noch leben, könnte ich sie fragen. Aber zu Dudagu Dorma gehe ich nicht.«
»Ich weiß weniger als alle anderen«, sagte Mon.
»Ich weiß«, sagte Edhadeja.
»Danke.«
»Du weißt weniger, also hörst du genauer zu.«
Mon errötete.
»Darf ich dir meinen Traum erzählen?«
Er nickte.
»Ich sah einen kleinen Jungen. In Ominers Alter. Und er hatte eine Schwester im Alter von Khimin.«
»Du findest in deinen Träumen heraus, wie alt andere Leute sind?«, fragte Mon.
»Sei still, Holzkopf. Sie haben auf den Feldern gearbeitet. Und sie wurden geschlagen. Ihre Eltern und alle anderen Leute. Sie waren halb verhungert und wurden verprügelt. Sie waren so hungrig. Und die Leute, die sie gepeitscht haben, waren Wühler. Das Erdvolk, meine ich.«
Mon dachte darüber nach. »Vater würde nie zulassen, dass Wühler über uns herrschen.«
»Aber wir waren es doch gar nicht. Verstehst du nicht? Sie waren so echt. Ich habe gesehen, wie der Junge einmal verprügelt wurde. Aber nicht von Wühlern, sondern von Menschenjungen, die die Wühler beherrschten.«
»Elemaki«, murmelte Mon. Die bösen Menschen, die sich mit den Wühlern zusammengetan hatten, in ihren feuchten Höhlen lebten und das Himmelsvolk aßen, das sie entführten und ermordeten.
»Die Jungen waren größer als er. Er hatte Hunger, und so quälten sie ihn, indem sie ihm mehr Essen in den Mund stopfen, als er schlucken konnte, bis er würgte und fast erstickt wäre. Dann rieben sie ihn am ganzen Körper mit Früchten und Krümeln ein und rollten ihn im Schlamm und Gras, damit niemand die Reste essen konnte. Es war schrecklich. Aber er war sehr tapfer und hat sie nicht beschimpft. Er hat es mit solcher Würde hingenommen, dass ich um ihn geweint habe.«
»In dem Traum?«
»Nein, als ich aufwachte. Ich wachte weinend auf. Ich wachte auf und sagte: ›Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen sie suchen und nach Hause führen.‹«
»Wir?«
»Vater, nehme ich an. Wir. Die Nafari. Weil ich glaube, dass diese Leute Nafari sind.«
»Warum schicken sie dann nicht Himmelsleute aus, damit sie uns suchen und um Hilfe bitten? Das machen die Leute doch, wenn die Elemaki sie angreifen.«
Edhadeja dachte darüber nach. »Weißt du was, Mon? Es war kein einziger Engel unter ihnen.«
Nun drehte Mon sich zu ihr um. »Überhaupt kein Himmelsvolk?«
»Vielleicht haben die Wühler sie alle umgebracht.«
»Erinnerst du dich nicht?«, fragte er. »Die Leute, die zur Zeit von Vaters Großvater zurückblieben? Diejenigen, die Darakemba hassten und umkehren und das Land Nafai wieder in Besitz nehmen wollten?«
»Zef …«
»Zenif«, sagte Mon. »Sie sagten, es sei falsch, dass Menschen und Himmelsvolk zusammenleben. Sie haben keinen einzigen Engel mitgenommen. Sie sind es. Sie sind diejenigen, von denen du geträumt hast.«
»Aber sie wurden alle getötet.«
»Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir nie wieder von ihnen gehört haben.« Mon nickte. »Sie müssen noch leben.«
»Dann glaubst du, dass es ein wahrer Traum ist?«, fragte Edhadeja. »Wie die Träume, die Luet hatte?«
Mon zuckte mit den Achseln. Irgendetwas störte ihn. »Dein Traum«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass er genau von den Zenifi handelt. Ich meine … er kommt mir einfach nicht vollständig vor. Ich glaube, es ist etwas anderes.«
»Woher willst du das wissen?«, sagte sie. »Du hast doch sofort vermutet, dass er von den Zenifi handelt.«
»Und es fühlte sich richtig an, als ich das sagte. Aber jetzt … jetzt stimmt einfach etwas nicht damit. Aber du musst es Vater erzählen.«
»Erzähl du es ihm«, sagte sie. »Du siehst ihn beim Abendessen.«
»Und du, wenn er kommt, um gute Nacht zu sagen.«
Edhadeja verzog das Gesicht. »Dudagu Dermo ist immer dabei. Ich sehe Vater nie allein.«
Mon errötete. »Das ist nicht richtig von Vater.«
»Ja, aber … du bist derjenige, der immer weiß, was richtig ist.« Sie knuffte ihn gegen den Arm.
»Ich erzähle ihm beim Abendessen von deinem Traum.«
»Sag ihm, es sei dein Traum gewesen.«
Mon schüttelte den Kopf. »Ich lüge nicht.«
»Er wird nicht zuhören, wenn er glaubt, es sei der Traum einer Frau gewesen. All die anderen Männer beim Abendessen werden lachen.«
»Ich werde ihm erst sagen, wessen Traum es war, wenn ich ihn erzählt habe. Wie ist es damit?«
»Dann sag ihm auch das. In den letzten paar Träumen lagen der Junge, seine Schwester und ihre Eltern schweigend da und sahen mich an. Sie haben nichts gesagt, lagen einfach in der Dunkelheit da. Doch ich wusste, dass sie mich baten, zu ihnen zu kommen und sie zu retten, ohne dass sie etwas sagten.«
»Dich?«
»Na ja, in dem Traum. Ich glaube nicht, dass richtige Menschen – falls es überhaupt richtige gibt – einfach dasitzen und hoffen werden, dass ein zehnjähriges Mädchen kommt und sie rettet.«
»Ich frage mich, ob Vater Aronha schicken wird.«
»Glaubst du, er wird überhaupt jemanden ausschicken?«
Mon zuckte mit den Achseln. »Es ist dunkel. Bald ist Zeit zum Abendessen. Hör doch.«
Von den Bäumen am Fluss, von den hohen, schmalen Häusern des Himmelsvolkes, erklang der Abendgesang, zuerst nur einige wenige Stimmen, in die dann immer mehr einfielen. Ihre hohen, schwingenden Melodien verflochten sich, spielten miteinander, erfanden verrückte, herausfordernde, sich wieder auflösende Dissonanzen und stachelten sich dann zu erwarteten Harmonien auf, ein sehnsüchtiges Geräusch, das an eine frühere Zeit erinnerte, als das Leben für das Himmelsvolk eine kurze Spanne von Jahren darstellen, von der man jeden Augenblick genießen musste, weil der Tod stets nahe war. Die Kinder hörten zu spielen auf und sanken aus dem Himmel herab, flogen zum Abendessen nach Hause, zu ihren singenden Müttern und Vätern, kehrten in Häuser zurück, die mit Musik erfüllt waren, wie einst die strohgedeckten Unterkünfte der Engel in den hohen Ästen der Bäume mit Liedern erfüllt gewesen waren.
Ungewollt traten Tränen in Mons Augen. Deshalb verbrachte er den Augenblick des Abendgesangs allein; er wollte nicht, dass jemand sein Weinen sah, und sich dann über ihn lustig machte. Zumindest nicht Edhadeja.