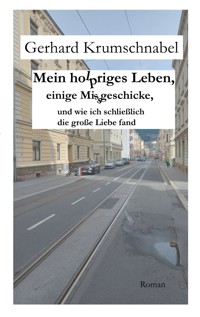Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Musik zu hören könnte in meiner Situation jetzt zwar sehr beruhigend sein, aber ein ganzes Album wird sich eher nicht mehr ausgehen, richtig, Frau Doktor?" Julian erfährt, dass er vielleicht nicht mehr lange zu leben hat und stellt sich die Frage: Was mache ich denn nun? Lohnt es sich, einmal ins Fernsehen zu kommen, noch einmal ans Meer zu fahren, Liechtenstein zu durchqueren? Oder sich mit dem Lebensfeind zu versöhnen, endlich die Ex zu fragen, warum sie einen verlassen hat, ein altes Vergehen zu sühnen? Oder gar eine neue Beziehung zu beginnen? Vielleicht wird ja doch noch alles gut. Man darf jedenfalls keine Zeit vertrödeln, weil man sich sonst den Rest des Lebens über die verpasste Chance ärgern könnte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Annemaria
Die Krankheit war nichts anderes als ein Versuch der Natur, den Menschen an das Sterben zu gewöhnen.
Joseph Roth
Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in den Sattel schwingt.
John Wayne
Inhaltsverzeichnis
Hiob
Der Vorzugsschüler
Julian, 45, Schreiberling
Der Besuch der alten Dame
Die heiligen Trinker
Planspiele
Die Bucket List
Darwins Rache
15 Minutes of Fame
In Treatment
Dead Man Walking
Die andere Liste…
Über uns das Meer…
Date mit einem Clown
Hirn scharf im Ei
Eier-Feier
Superman
Bernd, alter Feind!
Medicine-Man
Reisefieber
Die Rückkehr des Clowns
Das falsche Gewicht
Schreiberling
Maria
Maria, Maria!
Beichte eines Schwerenöters, erzählt auf einer Bank
Der blinde Spiegel
Immer seltener werden in dieser Welt
Means to an End
Linda
Zukünftige Erinnerungen
Liechtenstein
Pyjama-Alarm
Die Flucht ohne Ende
London Calling
Von dem Orte, von dem ich jetzt sprechen will…
Schwerelos
Frau Roth und das Ende der Welt
London Calling II
Der Leviathan erhebt sich
Der mit dem Wolf tanzt
Uns bleibt immer Paris
Triumph der Schönheit
1002 Nächte
On The Road
Ich bin der Schnee, ich bin der Winter
Das Spinnennetz
Hiob
„Ich fürchte, ich habe keine besonders guten Nachrichten für Sie, mein lieber Herr Jelinek.“
Dr. Kovaleva blickte ernst über den Rand ihrer Lesebrille, spitzte die Lippen und wandte die Augen wieder zurück auf die Papiere, die vor ihr auf dem Schreibtisch lagen.
„Warten Sie!“, beeilte sich Julian einzuwerfen, ehe Dr. Kovaleva weitersprechen konnte. „Ganz sicher habe ich nicht mehr oft die Gelegenheit, diesen Scherz anzubringen, ich darf daher diese hier jetzt nicht ungenutzt lassen.“
Die Ärztin schaute verblüfft auf, runzelte die Stirn und sah ihn fragend an.
„Sie wollen mir so etwas sagen wie: Musik zu hören könnte in meiner Situation jetzt zwar sehr beruhigend sein, aber eine Langspielplatte brauche ich mir eher nicht mehr aufzulegen, richtig?“
Mit etwas Verzögerung umspielte ein Lächeln Dr. Kovalevas Mund, sie schüttelte den Kopf und sagte: „Den kannte ich noch gar nicht, dabei habe ich ehrlich schon so einige Witze dieser Art gehört. Aber nein, ganz so schlimm ist es zum Glück auch wieder nicht. Ich möchte Ihnen das hier jetzt ganz genau erklären, so wie Sie sich das gewünscht haben, einverstanden?“
Julian dachte zurück an ihr letztes Treffen, als sie ihn überzeugt hatte, eine weitere Gewebeprobe zu entnehmen und einige zusätzliche Tests durchführen zu lassen.
„Wir müssen einfach Klarheit gewinnen, sehen, woran wir genau sind“, hatte sie argumentiert, „dann können wir auch über konkrete Behandlungen nachdenken und verschiedene Optionen abwägen.“
Es war über eine relativ lange Zeit gut gegangen, mehr als zwei Jahre schien alles stabil, waren die relevanten Werte unverändert geblieben, hatte alles darauf hingedeutet, dass er den Krebs besiegt hatte. Er war schon so oft bei diesen halbjährlichen Kontrollen erschienen – es waren wohl erst fünf, fühlte sich für ihn aber an, als hätte er nie etwas anderes gekannt – dass sich das anfängliche ungute Gefühl, das Kribbeln in seinen Eingeweiden, schon gar nicht mehr einstellte, wenn er die Praxis betrat. Es war wie die Kontrolle beim Zahnarzt geworden, viel eher lästig denn furchterregend. Aber diesmal war es anders, der PSA-Wert war wieder deutlich angestiegen, die MRT-Untersuchung schien den Verdacht zu bestätigen, wie ihm die Ärztin erklärt hatte, und es war Zeit für eine erneute Biopsie geworden.
„Ich verstehe schon“, hatte ihr Julian damals zurückgegeben, „aber wenn wir das tun, müssen Sie mir eines fest versprechen, und zwar, dass Sie mir schonungslos sagen, wie es um mich steht und wie die Aussichten für mich sind. Sie dürfen mich keinesfalls in Watte packen und die Tatsachen beschönigen, ich werde dann nur misstrauisch. Außerdem wissen Sie, dass ich sowieso selbst dazu recherchieren werde.“
„Ja, das ist mir klar“, hatte Dr. Kovaleva diese Forderung mit einem Seufzer quittiert, „Sie sind nicht gerade das, was man einen einfachen Patienten nennt, wahrlich nicht. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich Ihnen reinen Wein einschenken werde, so gut es eben geht, es gibt da kaum jemals nur Schwarz oder Weiß in diesen Dingen, aber das wissen Sie selbst.“
Nun war es also Wirklichkeit geworden, die Befürchtungen schienen sich zu bewahrheiten, der Frühling, während dessen Julian sich immer am glücklichsten fühlte, läutete in diesem Jahr vielleicht nicht das Erblühen neuer Hoffnungen und Wünsche ein. Julian lehnte sich in seinem Stuhl zurück und umklammerte mit seinen Fingern die Armlehnen, so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten.
„Dann schießen Sie los, Frau Doktor. Und wie ausgemacht: keine Beschönigung!“
Dr. Kovaleva nickte, holte tief Luft und sagte: „Der Krebs ist ganz eindeutig wieder da, Sie haben ein sogenanntes biochemisches Rezidiv, es hat sich erneut ein Tumor gebildet. Allerdings ist dieser, und das ist die besonders schlechte Nachricht dabei, etwas anders beschaffen als jener, den wir zuvor erfolgreich bekämpft haben.“ Dr. Kovaleva blätterte die Seiten des Befundformulars um, fuhr mit dem Zeigefinger die Zeilen des enggedruckten Texts entlang.
„Das Übel des Ganzen ist, dass Sie nun ein fortgeschrittenes Stadium des Krebses erreicht haben, eines, das auf verschiedene Standardbehandlungen nicht mehr so gut anspricht, weil die Zellen resistent dagegen geworden sind. Außerdem ist die Gefahr groß, dass sich der Krebs nun ausbreitet, falls er das nicht schon getan hat, das müssen wir noch abklären. Das heißt, dass wir nun nicht einfach das Gleiche noch einmal machen können, das hätte nämlich kaum die Wirkung, die wir uns wünschen, und ganz sicher keine bleibende Wirkung.“
„Und gibt es auch eine gute Nachricht dazu?“, fragte Julian an dieser Stelle und sah die Ärztin erwartungsvoll an.
„Ja, die gibt es, wenn es sich so verhält, wie ich vermute und hoffe. Und zwar, dass die Mutationen, die ihre Tumorzellen aufweisen, genau jene sehr häufigen sind, für die ein neuartiges Medikament als besonders wirkungsvoll eingestuft wird. Ich kann Ihnen das hier zeigen.“ Sie nahm eine Broschüre zur Hand, legte sie seitlich für beide lesbar auf den Schreibtisch und deutete mit dem Zeigefinger auf eine Abbildung.
„Für Patienten mit einem Rezidiv, also einem erneut aufgetretenen Tumor, sind die Behandlungsmöglichkeiten beim Fehlen dieser Mutationen schon etwas eingeschränkt. Und wie diese Studie zeigt, ist die mittlere Dauer nach der Diagnose bis zum Zeitpunkt, wo der Krebs wieder voranschreitet, deutlich kürzer als bei Patienten mit den Veränderungen, die wir bei Ihnen glauben gefunden zu haben. Wir müssen das im Detail noch abklären, aber Sie scheinen zu dieser besser reagierenden Gruppe zu gehören.“
„Ich verstehe“, warf Julian zustimmend ein, überflog rasch lesend einige Zeilen der Broschüre und blieb dann mit dem Blick an ein paar Zahlen hängen, die ihm nicht gerade beruhigend erschienen. „Aber der Unterschied, der hier beschrieben wird, beträgt ja nur vier Monate und die gesamte Dauer bloß acht Monate. Und was kommt danach? Nach acht Monaten kann ich mich hinlegen zum Sterben?“
Die Ärztin schüttelte den Kopf und sagte: „Selbst dann kann man noch etwas machen. Aber Sie wollten die Wahrheit, hier ist sie. Die acht Monate beziehen sich auf die Zeit bis zum Progress der Erkrankung, und da besteht schon ein deutlicher Unterschied. Aber sehen Sie hier, die mittlere Überlebensdauer beträgt bei der Kontrollgruppe eineinhalb Jahre“, Dr. Kovaleva deutete auf eine andere Abbildung, „bei jener Gruppe, zu der Sie gehören würden, immerhin zwei Jahre.“
„Was?“, rief Julian erschrocken aus. „Dann habe ich also auch im günstigeren Fall nur noch circa zwei Jahre zu leben?“ Julian musste schlucken, ehe er weitersprechen konnte und in einem ruhigen, resignativen Ton fortfuhr: „Aber Sie haben recht, dann kann ich mir sogar noch mehrere Langspielplatten auflegen, vielleicht endlich die Complete Works of Arnold Schönberg. Die habe ich einmal billig im Abverkauf erstanden, gedacht, dass ich sie mir irgendwann später einmal anhören könnte, wenn ich in Pension bin, zum Beispiel, wenn ich geduldiger sein würde solchen seltsamen Klängen gegenüber. Aber wenn ich mir das nicht jetzt bald anhöre, komme ich gar nicht mehr dazu, dann war das ein Fehlkauf, über den ich mich dann ein Leben lang ärgern werde.“
„Schön, dass Sie immer noch Scherze machen können. Humor ist gesund, sagt man, auch wenn es in Ihrem Fall eher nach Galgenhumor klingt. Seien Sie nicht so pessimistisch, diese zwei Jahre sind nur ein Mittelwert, manche Patienten leben noch sehr lange nach dieser Behandlung, viel länger als diese zwei Jahre.“
„Und andere dafür nur wenige Monate, nicht wahr? Jaja, ich weiß, wie so ein Mittelwert zustande kommt“, beeilte sich Julian zu ergänzen. „Aber jetzt erklären Sie mir bitte, was das konkret bedeutet, welche Behandlung erwartet mich da nun…“
Der Vorzugsschüler
Die Besprechung mit Dr. Kovaleva ging noch fast eine Stunde weiter und endete in der Vereinbarung neuer Untersuchungen, die noch zu machen sein würden. Daran anschließend würde eine Diskussion dieser neuen Resultate folgen, ehe man in einem ‚Prozess der gemeinsamen Entscheidungsfindung‘, wie Dr. Kovaleva das nannte, das letztendliche Vorgehen abschließend festlegen würde. Tatsächlich zog sich alles noch über mehrere Wochen hin, und während dieser ganzen Phase lebte Julian fast so weiter, als wäre nichts geschehen in seinem Leben, als gäbe es nichts, worüber er sich Sorgen machen müsste. Er ging, lediglich unterbrochen von den medizinischen Terminen, die er wahrnehmen musste, weiterhin unverändert seiner Arbeit nach, traf seine Freunde und Bekannten und führte seine täglichen Routinen aus wie eh und je: vom morgendlichen Zähneputzen, während dessen er am Mobiltelefon die Nachrichten des Tages zu lesen pflegte, über den mittäglichen Spaziergang, der ihm ein Mindestmaß an Bewegung bescheren sollte zwischen den Stunden, die er am Computer saß, bis zur spätabendlichen letzten Entleerung seiner Blase, mit der er den Tag typischerweise beschloss. Und wenn er während dieser ganzen Zeit so völlig ruhig und unaufgeregt blieb, dann lag das an der stets präsenten Hoffnung in seinem Hinterkopf, dass sich letztlich alles doch noch als Irrtum entpuppen könnte, dass man entdecken würde, es wäre alles halb so schlimm, wie gedacht, und man müsste lediglich die Hormonbehandlung und die Bestrahlung, wie er sie bei der ersten Behandlung erlebt hatte, wiederholen und alles wäre wieder beim Alten.
Doch das Schicksal tat ihm diesen Gefallen nicht, die Analysen bestätigten die vorangegangenen Befunde, auch wenn man wenigstens noch keine Metastasen finden konnte, was ein sehr gutes Zeichen war, wie Dr. Kovaleva ihm versicherte.
„Mit etwas Glück könnten wir mit dem neuen Medikament sehr erfolgreich sein“, schloss Dr. Kovaleva die jüngste Besprechung der Befunde ab. Sie sah Julian herausfordernd an, gestikulierte mit ihrer abgesetzten Lesebrille in der Hand und fuhr fort: „Wenn wir jetzt nichts finden konnten, bedeutet das zwar nicht mit 100-prozentiger Sicherheit, dass nichts da ist, aber vorerst einmal heißt es, in der Behandlung konsequent zu sein und positiv zu denken. Sie werden Ihre Plattensammlung sogar noch vergrößern können, und noch Gelegenheit für viele makabre Scherze haben, bevor der Schlussakkord ertönt.“
Julian liebte es, dass die Ärztin ihn mit seinem eigenen Witz aufzog, seinem aus schierer Todesverachtung geborenen unernsten Zugang zu seinem Problem mit ihrem eigenen Humor begegnete. Auch wenn er über die slawische Seele nur so viel wusste, wie er aus den Büchern Joseph Roths oder Dostojewskis erfahren hatte, schrieb er dies vor allem ihren ukrainischen Wurzeln zu, dem Selbstvertrauen, sogar dem Teufel ein Schnippchen schlagen zu können, mit einem Quäntchen Gewitztheit und Hinterfotzigkeit dem Schicksal die gewünschte Wendung abtrotzen zu können.
Dabei hatte er anfangs gar nicht so geringe Bedenken gehabt, was die Wahl dieser Ärztin betraf. Schließlich schien es ihm eher ungewöhnlich, sich als Mann eine Frau zur Urologin zu wählen. Er hatte zuvor in seinem Leben noch nie die Expertise eines Urologen gebraucht, das war ihm stets als eine Angelegenheit für alte Männer erschienen, und als solcher hatte er sich mit seinen damals 43 Jahren noch lange nicht gefühlt. Das Wenige, das er wusste über Urologen, war, dass sie einem die Prostata abtasten würden. „Der Arzt steckt dir einen Finger in den Arsch, ganz tief hinein, und dann lässt er dich husten“, wie ihm ein Freund berichtet hatte, und ob ihm dies von einer Frau durchgeführt Recht sein würde, darüber war er sich keineswegs sicher gewesen. Andererseits würde er das ja auch bei einem Mann nicht als angenehm empfinden, und er hatte außerdem die Vermutung, dass das auch für die Ärztin kein Honigschlecken war, ganz sicher nichts, was ihr Freude bereiten würde. „Sehr viele Frauen haben ja auch einen männlichen Frauenarzt“, war der Kommentar seiner Hausärztin zu seinen Bedenken, „für den Arzt und die Ärztin sind Sie bei der Untersuchung einfach ein Patient, quasi geschlechtslos, soweit das in diesem Fall überhaupt möglich ist.“
Es waren letztlich die Worte seiner Hausärztin Dr. Hartbacher, die den Ausschlag gaben, sie hatte ihm Dr. Kovaleva empfohlen und sich ja selbst als seine Ärztin sehr bewährt über die Jahre. Dr. Hartbacher war ihm schon über lange Zeit eine Vertraute in Bezug auf seine körperlichen und sogar seelischen Wehwehchen geworden, hatte ihn stets gut beraten und ganz sicher immer gut behandelt.
„Ich empfehle Ihnen Dr. Kovaleva nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie ihr Fach gut versteht. Ich habe außerdem das Gefühl, dass Sie bei einer Frau sehr gut aufgehoben sind. Sie sind eine empfindsame Seele, auch wenn Sie das vielleicht gar nicht so gerne hören. Und Sie brauchen jemanden, der dafür Verständnis hat.“
Als auch die letzten Unsicherheiten beseitigt waren und das fortgeschrittene Stadium der Krebserkrankung nicht mehr länger in Zweifel gezogen werden konnte, begann Julian mit seinen eigenen Recherchen, sah sich auf einschlägigen Websites um, las Beiträge auf Selbsthilfeforen, deren Zahl sich seit seinem ‚ersten Krebs‘ um ein Vielfaches vermehrt hatte, und versuchte sogar, wissenschaftliche Studien nachzuvollziehen, um sich nicht ausschließlich auf die Werbebroschüren der Pharmaindustrie verlassen zu müssen. Am wichtigsten aber blieben ihm die Einschätzungen seiner beiden Ärztinnen, erst ihre in der Sache nüchternen, aber auf einfühlsame Art und Weise vermittelten Einschätzungen brachten Julian dazu, seinen Zustand zu akzeptieren und auch die Notwendigkeit des weiteren Vorgehens, das auf die gesicherte Diagnose der Erkrankung nun folgen würde.
Erst da endlich überwand er sich, seine tägliche Routine zu durchbrechen, schränkte er die Arbeit auf ein Minimum ein und nahm sich die Zeit, über seinen Zustand nachzudenken, darüber, was zu tun wäre, wie es mit ihm nun weitergehen sollte. Er hatte bislang mit keinem seiner Freunde über die Diagnose gesprochen, auch nicht mit seiner Exfrau, mit der er immer noch ein passables Verhältnis pflegte, und auch nicht mit seiner Tochter, die ohnehin außer Landes weilte, in London ein Studienjahr im Ausland zubrachte. Als er darüber nachdachte, fühlte er sich an die Schwangerschaft erinnert, die er als betroffener Vater mit seiner Ex durchlebt hatte, als es anfangs geheißen hatte, man möge mindestens zwölf Wochen warten, bevor man die freudige Nachricht verkünden dürfe, weil die Gefahr eines Scheiterns noch so groß sei. Diesmal hatte die Herausforderung nicht im Bändigen eigener Glücksgefühle bestanden, nicht darin, sich das Herausplatzen mit der erfreulichen Neuigkeit zu verkneifen, eines zunehmenden freudigen inneren Überdrucks Herr zu werden, seine Gedanken und Zukunftspläne mit jemandem zu teilen. Ganz im Gegenteil, diesmal musste er eine überaus unerfreuliche Nachricht für viele Wochen bei sich behalten, hatte sämtliche Untersuchungen abwarten müssen, um sicherzugehen, dass es tatsächlich schlimm um ihn stand, um nur niemanden unnötig zu beunruhigen. „Das erste Mal war die Geheimniskrämerei eindeutig schöner“, rekapitulierte er, als er überlegte, wen er mit einbeziehen wollte und wem er es unbedingt weiter verheimlichen sollte. Aber selbst, wenn jemand Bescheid darüber wüsste, wäre damit keines seiner Probleme gelöst, bloß der Drang, sich jemandem mitzuteilen, wäre weggefallen. Es würden sich unabhängig davon eine Unzahl an Fragen auftun, Fragen, die dann jener an ihn und auch er sich selbst weiter stellen musste und für die er im Moment noch keine Antworten wusste. „Wie willst du jetzt weitermachen, was ist dein Plan? Wie lebst du weiter für den Fall, dass es nur ein paar Monate sind, wie, wenn du darauf vertraust, dass es sich noch um zwei Jahre oder mehr handelt?“
Es gab viel zu bedenken, und ein Freund könnte dabei tatsächlich hilfreich sein. Oder auch vieles noch komplizierter machen, das war auch nicht gänzlich auszuschließen. Ein Problem schien das nächste hervorzubringen, und er fürchtete sich davor, dass die Schwierigkeiten gerade erst begonnen haben könnten.
Julian, 45, Schreiberling
Julian war 45 und Schreiberling. Nicht als Schriftsteller oder Journalist, auch nicht als Verfasser eines Blogs, in dem er sich wie viele andere ‚Berufene‘ über die Themen des Alltags auskotzte, seine Ansichten zu Politik, Kultur oder dem Leben im Allgemeinen zum Besten gab. Tatsächlich hätte ihn das schon gereizt, hatte er kurz überlegt, einer der vielen zu werden. Doch für all diese Arten des Schreibens nahm er sich selbst nicht wichtig genug, hielt er seine eigene Meinung für zu wenig originell und sah auch keine Chance, damit sein eigenes Geld zu verdienen. Sein Schreiben blieb von ihm als Person entkoppelt, ja sogar von seinem Denken, es war ihm im Grunde fast einerlei, was er schrieb, solange es ihm sein Leben finanzierte. Julian arbeitete als anonymer Verfasser von Beiträgen, die auf den verschiedenartigsten Websites erschienen, oder als Text auf gedruckten Broschüren, die ungefragt in den Postkästen der Menschen landeten. Seine Texte reichten vom Bericht über die selbst nie getätigte Urlaubsreise nach Bali, die großartigen Gerichte beim neuen Italiener in der Innenstadt, über die Schilderung, welch große Erfüllung in der Zucht von Tulpen stecken mag oder vom Wert des Erlernens einer Fremdsprache, bis hin zur Übersetzung der Produktbeschreibung für ein Rudergerät und dem Verfassen von Erfahrungsberichten über dessen Gebrauch.
„Die Verwendung dieser Schnellfritteuse hat mein persönliches Kocherlebnis dramatisch rationalisiert. Der Hauptvorteil ist die superschnelle Erhitzung, die hilft, enorm viel Zeit zu sparen. Gerichte, die normalerweise 30 Minuten brauchen, können dank der leistungsstarken Heizelemente und des effizienten Designs in weniger als 15 Minuten zubereitet werden. Mit der Fr-9020 gelingen knusprige Pommes, goldbraune Hähnchenflügel und sogar Tempura in einem Bruchteil der Zeit, die eine herkömmliche Fritteuse im Ofen oder auf dem Herd benötigt. ….“
Die Beschreibung des Kocherlebnisses mit der Fr-9020, von der er nie mehr gesehen hatte als die englische Gebrauchsanweisung, hatte Julian zuletzt ein Drittel seiner Monatsmiete eingebracht, dabei war er in seiner Routine, die er inzwischen erlangt hatte, kaum mehr als drei Stunden damit beschäftigt gewesen. Das Schreiben solcher Gebrauchstexte war mittlerweile seine Haupteinnahmequelle, seine wesentliche Beschäftigung, ja, nach einem überaus mühsamen Einstieg in diese Tätigkeit, tatsächlich zu seinem Beruf geworden.
Das Ganze hatte eigentlich schon früh angefangen, auch wenn die Anfänge seiner Existenz noch nicht unbedingt nach dem Leben eines Schreibers ausgeschaut hatten. Eines Lebens, dessen Umstände sich derzeit so charakterisieren ließen: Julian hatte zwei Geschwister, einen toten Vater und eine noch lebende, aber demente Mutter, deren Dasein in seinen Augen allerdings bereits in einer Art Zwischenreich angesiedelt war. Und zu alledem hat er noch eine Exfrau, eine bereits erwachsene Tochter, aktuell keine Partnerin, und Krebs. Gerne hätte er diesbezüglich getauscht, das heißt, eine Freundin gegen Krebs, in den meisten anderen Belangen war er bislang recht zufrieden gewesen mit dem Leben.
Als eines von drei Kindern eines gelernten Druckers und einer Stenotypistin – so die Bezeichnung in der Heirats-Annonce, die Julian aufbewahrt hatte-, die ab dem ersten Kind in das unbezahlte Fach einer Mutter und Hausfrau gewechselt war, hätte Julian im Grunde unter ärmlichen Bedingungen aufwachsen und eine entbehrungsreiche Kindheit erleben können. Drucker wurden nicht besonders gut bezahlt, und den Erzählungen alter Zeiten zufolge barg das fortwährende Hantieren mit giftigen Bleilettern die Gefahr, ernsthaft krank zu werden und eine Bleilähmung, Verstopfung und Gelenkschäden davonzutragen. Doch sein Vater war umtriebig, neugierig und überaus kontaktfreudig, und als in der Wochenzeitung, für die er als Drucker arbeitete, die Stelle eines Redakteurs vakant wurde, gelang es ihm, diese provisorisch zu ergattern und so dem vermeintlich über ihm schwebenden, bleiernen Damoklesschwert zu entkommen. Schon nach wenigen Monaten, in denen er sich als Schreiber bewährt und zudem als Keiler für Inserate hervorgetan hatte, wechselte er auf Dauer zum Journalismus.
Eine Folge davon war, neben einem erheblich gesteigerten Familieneinkommen, dass sich für Julian bereits in jungen Jahren die Möglichkeit eröffnete, für Geld zu schreiben. Und zwar als Sportreporter, der schon im zarten Alter von 13 Jahren über die Heimspiele der lokalen Fußballmannschaft berichten durfte und sich damit schreibend und einige Fotos knipsend sein erstes Geld verdienen konnte. Dem nur mäßig sportbegeisterten Vater waren damit endlich die Wochenenden gerettet, dem Sohn ein mehr als üppiges Taschengeld gesichert. Dabei waren vor allem die mit einer alten Kamera des Vaters gemachten Schnappschüsse lukrativ, während die kurzen Spielberichte, deren Inhalt er ohnehin meist von einer Tageszeitung abkupferte, ziemlich schlecht bezahlt waren. Immerhin erlaubte ihm dieser kleine Job die ersten Fingerübungen im Formulieren und Umformulieren von Inhalten, und gab ihm schließlich mit 16, als journalistischen Höhe- und zugleich Endpunkt seiner Karriere bei der Wochenzeitung, sogar die Gelegenheit, einen ‚politischen Bericht‘ zu verfassen. Da der Vater bereits mit einer anderen Veranstaltung beschäftigt und am konkreten Ereignis auch herzlich wenig interessiert war, durfte Julian an seiner statt von einer Autobahnblockade berichten, die als Demonstration gegen den überbordenden LKW-Verkehr veranstaltet wurde, der die Bevölkerung der heimatlichen Provinz belastete. Julian verbrachte beinahe den ganzen Tag auf der Demo, wieselte aufgeregt zwischen den beteiligten Menschen herum, befragte Demonstranten und einen überraschend aufgetauchten Lokalpolitiker und schoss Foto um Foto, in der Hoffnung, die zeitweise sehr aufgeladene Stimmung einzufangen. Hier ging es nicht um Tore in einer unteren Provinzliga, nicht um das Ergebnis eines Spiels, das schon eine Woche später nur noch den Beteiligten erinnerlich sein würde, hier ging es um das wirkliche Leben, hier wurde Politik gemacht, die Zukunft von Menschen verändert ….
Zu seinem Entsetzen aber fand Julian dann in der Zeitung neben dem von ihm aufgenommenen Foto mehrerer Polizisten, die einige ob der Störung ihres Vorankommens auf der Transportroute aufgebrachten LKW-Fahrer von den große Transparente schwenkenden und Parolen skandierenden Demonstranten abschotteten, nicht den von ihm verfassten leidenschaftlichen Report, in dem er eloquent dem Anliegen der Demonstrierenden und den Leiden der verkehrsgeplagten Anrainer eine Stimme verliehen hatte, sondern eine todlangweilige, im Stile einer amtlichen Verlautbarung verfasste Aufzählung von Fakten, die völlig unkritisch erneut vorgebrachten Versprechungen des Politikers, sowie die Anzahl der erschienenen Demonstranten und der zur Bewahrung der Ordnung versammelten Polizeikräfte resümierend, ohne auch nur den flüchtigsten Hinweis auf die größere Bedeutung des ganzen Ereignisses.
„Das ist Zensur!“, klagte er seinen Vater an, als dieser sich von der Arbeit heimgekehrt wie üblich in den Wohnzimmersessel fallen ließ und den Fernseher anmachte. „Das klingt nun ja so, als hätten da ein paar Verrückte völlig mutwillig den Verkehr behindert“, fuhr er fort, „und es wird kein Wort darüber verloren, wie viele Opfer der Lärm und die Abgase der Bevölkerung abverlangen, oder darüber, dass die Politik seit Jahren trotz vieler Versprechen nicht das geringste dagegen unternimmt.“
„Du hast einen politischen Kommentar geschrieben“, entgegnete der Vater mit unbewegter Miene, er schien vom Aufbegehren seines Sohnes nicht sonderlich überrascht. „Das ist beeindruckend, ich hätte das in deinem Alter noch nicht gekonnt. Aber was ich gebraucht hätte, wäre ein objektiver Bericht gewesen, einfach eine Beschreibung dessen, was da vor sich gegangen ist. Wir verkaufen eine Wochenzeitung, die informiert, ganz sachlich und unvoreingenommen, und nicht eine politische Streitschrift.“
Halb ermutigt vom Lob und zugleich enttäuscht vom Resultat der Einschätzung des Vaters, warf Julian diesem sein fehlendes Rückgrat vor, den Mangel an Mitgefühl mit jenen, die unter dem Verkehr zu leiden hatten, und schließlich äußerte er auch noch Zweifel an der journalistischen Integrität des Vaters, woraufhin dieser „Jetzt reicht es aber!“ knurrte und die Anklage damit zu einem abrupten Ende brachte. Julian zog sich beleidigt in sein Zimmer zurück und trug zugleich mit seinem Abgang das gerade erwachte Interesse am politischen Journalismus zu Grabe. Erst Jahre später erfuhr er von den engen Banden, die den Besitzer der Wochenzeitung mit Vertretern des lokalen Transportwesens verknüpften, und dass möglicherweise der Chefredakteur der Zeitung und gar nicht sein Vater der Urheber des zensorischen Eingriffs gewesen war. Doch weil sein Vater die Angelegenheit nie mehr zur Sprache brachte und Julian seinerseits die mögliche Ungerechtigkeit seiner Anklage stets davon abhielt, dies selbst zu tun, nahm der Vater das Wissen darum, wie es tatsächlich gewesen war, letztlich mit in sein Grab. Genauso wie es nun Julian vielleicht bald selbst mit seinem spät erwachten schlechten Gewissen tun würde.
Der zweite Ansporn, Julian vom Schreiben und Lesen zu begeistern, kam von seiner Mutter, selbst Tochter eines Lehrers für Griechisch und Latein und immer bestrebt, auch den eigenen Kindern so etwas wie eine kulturelle Vorbildung weiterzugeben. Und wenigstens bei Julian, der sich immer irgendwie als ihr Lieblingskind gefühlt hatte, fiel dies auf fruchtbaren Boden. Mit Twain und Kipling fütterte sie ihn an, und mit Dostojewski und Mann zog sie ihn gänzlich hinein in die Welt der Literatur. Und mit lieblichen Melodien von Mozart und Bach köderte sie ihren Sohn für die Musik, die sie so liebte, auch wenn sie seine später entfachte Leidenschaft für Beethoven und Mahler nicht mehr uneingeschränkt teilen konnte.
„Es ist wirklich schade, dass wir uns kein Klavier leisten können“, versuchte seine Mutter ihn zu trösten, als er erstmals Interesse am Musikzieren bekundete und statt mit einem Flügel mit einer billigen Gitarre abgespeist wurde. „Du hättest die wunderschönen Sonaten von Mozart spielen können, oder Beethoven oder Chopin…. Vielleicht wird das ja später einmal möglich sein.“
Durchaus nicht allzu traurig, diese Träume der Mutter nicht ausleben zu können, lernte Julian im Eigenunterricht, die Gitarre zu spielen, und beschränkte sein klassisches Repertoire auf ein paar Stücke, die er zu Geburtstagen und bei Verwandtenbesuchen zum Besten gab. Und schließlich wurden im Zuge seiner ungestümen Jugendjahre seine literarischen und musikalischen Vorbilder deutlich weniger anspruchsvoll, er verschlang Kerouac und Christian Kracht, um etwas über das wahre Leben zu lernen, und beschallte sein Zimmer mit den Klängen der Pixies und von Nirvana, um den passenden Soundtrack dazu zu hören. Literatur und Musik waren seither ein wichtiger Teil seines Lebens geblieben und er selbst immer offen für neue Entdeckungen auf beiderlei Gebieten.
Das enge Verhältnis zur Mutter blieb auch nach dem frühen Krebstod des Vaters bestehen, ja vertiefte sich gar und ließ ihn sie vermehrt besuchen in dieser Zeit, die neben der tiefen Trauer um den Gatten auch zunehmend einen geistigen Verfall offenkundig werden ließ. Von der jahrelangen Last der Versorgung des Ehemanns befreit, die zugleich Lebensinhalt und Tagewerk bedeutet hatte, zeigte sich nämlich rasch eine schwindelerregende Zunahme ihrer Vergesslichkeit, die sie letztlich, nach einigen Jahren des einsamen Lebens in der einst von der ganzen Familie geteilten Wohnung, ins Altenheim führte.
Der Besuch der alten Dame
Hier saß er nun wieder, in der Cafeteria des Wohnheims, gemeinsam mit seiner Mutter, die gerade mit Eifer dabei war, ein Stück Kuchen zu essen. Hochkonzentriert war sie dabei, die nur einen Meter fünfzig große Frau, mit ihren weißen, aus Anlass des Besuchs frisch gewaschenen und gescheitelten Haaren, mit ihren von tiefen Falten zerfurchten Wangen und den wie von ständiger Traurigkeit mit dunklen Ringen untermalten Augen. Und auch wenn Essen, wie es Julian schien, zur letzten wirklichen Freude ihres Lebens geworden war, war sie deutlich geschrumpft in den vergangenen Jahren, sodass ihre Bluse viel zu groß und ihre Hose viel zu weit geworden waren und die Kleidungsstücke ihren ohnehin zarten Körper sogar noch etwas winziger scheinen ließen. Julian besuchte sie nach Möglichkeit jede Woche, rief sie stets kurz vorher an, um seinen Besuch anzukündigen, um sie dann, eine 45-minütige Zugfahrt später, bei seinem Eintritt in ihr Zimmer doch jedes Mal überrascht zu finden.
„Ah, Julian, was für eine nette Überraschung!“
Umständlich richtete sich die Mutter auf, nachdem sie eben noch mit geschlossenen Augen, aber keineswegs schlafend auf ihrem Bett gelegen hatte, blickte Julian mit weit aufgerissenen Augen an, lächelte und fragte: „Unternehmen wir etwas, haben wir etwas vor?“
Julian liebte diesen Moment, der ihm stets die noch immer vorhandene Fähigkeit seiner Mutter, Freude zu empfinden, verdeutlichte, etwas, das er in dem dumpfen Brüten, in das sie manchmal später im Verlauf des Besuchs zurückfallen konnte, schmerzlich vermisste.
„Selbstverständlich unternehmen wir etwas!“
Julian beugte sich zu ihr hinunter, umarmte sie und gab ihr einen flüchtigen Kuss.
„Ich dachte, wir könnten gemeinsam Kaffee trinken und Kuchen essen, und wenn du Lust dazu hast, auch noch ein Kreuzworträtsel lösen.“
Sowohl die Eröffnung dieser Begegnung als auch der einleitende Dialog folgten seit längerem der stets gleichen Routine, ebenso wie das anschließende gemeinsame Ankleiden, die Abmeldung der Mutter bei einer Pflegerin und die Fahrt mit dem Bus ins Zentrum der Kleinstadt, wo sie dann das immer gleiche Kaffeehaus besuchten. In dieser Phase erschien Julian seine Mutter stets kribbelig, sie genoss die Abwechslung, die sich ihr beim Blick aus dem Busfenster bot, und fieberte freudig erregt den kommenden Ereignissen entgegen. Beim Kaffeehaus angekommen, wurde die Aufregung von einer über lange Zeit eingeübten Routine abgelöst, sie blieb wie selbstverständlich vor der Kuchentheke stehen, suchte sich nach geübtem Blick über das Angebot den stets gleichen Kuchen aus und drängte zu jenem Tisch, der seit Langem der ihre war, früher auch der ihres Mannes.
Diesmal war der Besuchstag allerdings ein Sonntag und das Kaffeehaus im Stadtzentrum geschlossen, weshalb Julian mit seiner Mutter im Wohnheim blieb, und die dortige Cafeteria besuchte. Glücklicherweise herrschte wenigstens am Wochenende sogar dort ein recht reger Betrieb, sodass seine Mutter als Ersatz für den Ausblick aus dem Bus wenigstens die Menschen an den Nachbartischen beobachten konnte. Die Kuchenauswahl war zwar geringer und ihr Standardkuchen nicht im Angebot, aber nach kurzer Rücksprache mit Julian über den Fettgehalt einer interessant scheinenden Torte - sie schien immer Angst zu haben im Alter noch dick zu werden - hatte sie eine Wahl getroffen, die sie zufriedenstellte.
„Altes Apothekergewicht“, las Julian vor, sie waren inzwischen beim Kreuzworträtsel angelangt.
„Das muss wohl die Unze sein oder das Gran“, antwortete wie aus der Pistole geschossen seine Mutter. „Gibt es schon einen Buchstaben?“
„Du hast recht, es muss Gran heißen, der letzte Buchstabe war ein N“, bestätigte Julian, der auf das entsprechende Feld tippte, woraufhin die Mutter mit zittrigen Fingern das G und das R und das A in die leeren Felder daneben malte.
Meist konnte er seine Mutter auf diese Weise eine knappe halbe Stunde beschäftigen, in dem Bestreben, ihren Geist zu trainieren und den weiteren Verfall wenigstens zu verlangsamen. Bis sie sich dann zurücklehnte, mit einem Seufzer „Jetzt kann ich nimmer“ sagte und Julian sie nach der Versicherung „Willst du dich jetzt ausruhen gehen, zurück in dein Zimmer?“ eben dorthin begleitete.
Manchmal blieb er dann noch eine Weile neben ihr am Bett sitzen und ließ seine Gedanken schweifen, bis die Mutter zum Abendessen abgeholt wurde, das man im Altenheim ja schon am späten Nachmittag servierte. Zuletzt hatte sich beim Sinnieren immer sein Krebs vorgedrängt und die Frage, was wohl aus seiner Mutter werden würde, wenn er nicht mehr fähig wäre, sie zu besuchen, oder wenn er dann gar nicht mehr wäre. Seine Geschwister waren weit weggezogen, sein Bruder in die Hauptstadt, seine Schwester ins benachbarte Deutschland, und beide hatten selbst Familie und wenig Gelegenheit, die lange Reise zur Mutter zu machen. Aber würde sie es denn überhaupt merken, wenn niemand mehr käme, fragte sich Julian, würde sie die Ausflüge vermissen? Und würde ihr überhaupt jemand mitteilen, wenn er seinem Krebs erlegen wäre, und sollte das überhaupt jemand tun?
Diese Fragen machten ihn traurig, und er war nicht sicher, ob es Selbstmitleid war oder Mitgefühl für seine Mutter. Julian spürte, wie es ihm die Brust zuschnürte, und er fühlte, dass es Zeit wäre zu gehen und sich nicht länger der deprimierenden Umgebung auszusetzen, der leise atmenden Mutter, von der er inständig hoffte, dass sie wenigstens in ihren Träumen Glück empfand, und dem kargen Zimmer, das ihn stets an ein Krankenhaus erinnerte und damit an das, was ihm nun selbst bevorstand.
Er erhob sich aus dem Stuhl, küsste die schlafende Mutter sachte auf die Wange, flüsterte ein „Bis zum nächsten Mal, liebe Mama“ und verließ das Altenheim.
„Es nützt niemandem, wenn ich mich hier herunterziehen lasse“, dachte er bei sich auf dem Weg zum Bahnhof, „auch nicht meiner Mama. Sie würde sicher wollen, dass ich mich bemühe, noch etwas Spaß zu haben im Leben. Ich sollte Hannes anrufen.“
Genau in diesem Moment vibrierte sein Mobiltelefon und als er am Display ‚Hannes‘ aufscheinen sah, musste Julian lachen. „Ich weiß ja, dass es dich nicht gibt, lieber Gott, aber manchmal machst du es uns Atheisten echt schwer!“, sagte er leise zu sich selbst und dann laut, sein Mobiltelefon am Ohr: „Hallo Hannes, was gibt´s? Willst du mir irgendetwas vorschlagen, das Freude in mein Leben bringen kann? Ich hätte gerade Bedarf.“
„What the fuck?“ Hannes klang ernsthaft verblüfft. „Kannst du Gedanken lesen? Oder hat dich Albert schon angerufen, der alte Sack. Wir sollten uns auf alle Fälle treffen, da gibt es einiges zu besprechen.“
Die heiligen Trinker
„Sei kein Spielverderber, wir hatten doch so viel Spaß beim letzten Mal.“
„Hatten wir das?“ Julian schaute Hannes skeptisch an. „Ich erinnere mich nicht, wir waren die ganze Zeit so betrunken. Ich weiß nur noch, dass wir in Frankreich waren und ein paar Fußballspiele gesehen haben, die meisten im Fernsehen, ein paar auch live. Ach ja, und daran, dass ich beim Spiel gegen Italien einem Herzinfarkt nahe war, als wir fast per Fallrückzieher den Anschlusstreffer erzielt hätten, der … ach, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat eh nichts genützt.“
„Aber das war wirklich ein Erlebnis, das musst du zugeben. Und so viel trinken wie damals, das können wir alle zusammen nicht mehr, das verträgt keiner mehr von uns. Und außerdem sind wir inzwischen alle erwachsen und vernünftig geworden.“ Hannes musste über die eigene Behauptung lachen. „Oder wenigstens halbwegs erwachsen“, fügte er hinzu, „und zumindest ein bisschen vernünftiger.“
Er wollte seinen Freund Julian zu einem Roadtrip überreden, gemeinsam mit zwei alten Kumpels, mit denen sie schon einmal Ähnliches unternommen hatten. Vor ewig langer Zeit, wie es Julian erschien, tatsächlich waren viele Jahre vergangen inzwischen, und aus den trinkfreudigen und abenteuerlustigen Jungspunden von damals waren besonnene und gut integrierte Familienväter und Stützen der Gesellschaft von heute geworden. Wenigstens dem äußeren Anschein nach, tief in ihrem Inneren waren sie immer noch jung und übermütig geblieben, zumindest empfand Julian dies bei den gelegentlichen Treffen so. ‚Erwachsen‘ werden vor allem flüchtig Bekannte oder ganz fremde Menschen, bei den eigenen Freunden scheint die erwartete Reifung nur schwer wahrnehmbar zu sein. Damals waren sie auch nach außen hin noch weit entfernt von jeglicher Vernunft, hatten sich ein Wohnmobil gemietet, - das billigste, das allen vier Männern Platz bieten konnte – in der Duschkammer des Fahrzeugs Paletten von billigem Dosenbier hüfthoch gestapelt und waren nach Frankreich gefahren. Um dort die WM-Spiele der Nationalmannschaft anzuschauen, für welche sie schon im Vorhinein Tickets erworben hatten. Dabei durchkreuzten sie das halbe Land des WM-Veranstalters, von St. Etienne im ersten Spiel (eine die Nerven übermäßig strapazierenden Begegnung mit Kamerun, in der erst in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang), über Montpellier im zweiten (diesmal: eine die Nerven übermäßig strapazierenden Begegnung mit Chile, in der erst in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang), bis nach Paris beim dritten und letzten Vorrundenspiel (erwartungsgemäß: eine die Nerven übermäßig strapazierenden Begegnung mit Italien, die mit Anstand 2:1 verlorenging, der Anschlusstreffer gelang in der Nachspielzeit). Danach war die Nationalmannschaft ausgeschieden, was ihnen wohl viele Gehirn- und Leberzellen rettete, weil sie dann wieder nach Hause fuhren. Und zwischen den Spielen der eigenen Mannschaft, die sie im Stadion erlebten, hatten sie gegessen und getrunken, in Seen gebadet und gedöst, geredet und gestritten und sich dann im Suff wieder versöhnt und gemeinsam im Fernseher in einer Bar weitere Fußballspiele angeschaut. Sich zwischendurch auch irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzusehen, hatte nicht auf ihrem Plan gestanden, lediglich am Eiffelturm waren sie nicht vorbeigekommen, ohne Notiz von ihm zu nehmen, erst die endlos lange Schlange vor dem Tickethäuschen hatte sie davon überzeugt, doch lieber wieder in eine Bar zu gehen, zu trinken und Fußballberichte anzuschauen. Der Urlaub lag in Julians Erinnerung hinter einem undeutlichen Schleier insgesamt sehr erfreulicher Empfindungen, beides (sowohl der Schleier als auch die Freude) geschuldet nicht zuletzt dem übermäßigen Konsum von Pastis, mit dem sie ihren sonst durch das stets lauwarme Dosenbier konstant gehaltenen Pegel der Besäufnis zwischendurch immer wieder auf dem Delir nahe Höhen getrieben hatten.
Nun, zwanzig Jahre später, war einem von ihnen die Idee gekommen, einen ähnlichen Trip ein weiteres Mal zu machen, diesmal allerdings ohne Live-Spiele, weil man Tickets für diese inzwischen nicht mehr einfach kaufen konnte, sondern nur mehr in einer Lotterie „gewinnen“, wobei die Gewinnchancen mikroskopisch klein schienen. Sie würden auch nicht durch Russland fahren, wo die WM dieses Mal stattfand, sondern erneut durch Frankreich, „in Memoriam 1998“, wie es einer der beiden anderen Begleiter formuliert hatte.
„Wir bleiben diesmal mehr im Süden, vor allem auch am Meer, und schauen uns noch ein paar andere Fußballstadien an. Bordeaux, Toulouse, Marseille…, alles etwas entspannter und zivilisierter. Aber auf den Spirit kommt es an!“
„Das Trinken ist nicht das Problem“, antwortete Julian, „das ist nicht der Grund, warum ich nicht mitkommen kann.“
„Was heißt ‚können‘, du willst nicht!“, rief Hannes aus. „Du kannst dir jederzeit selbst freigeben, wenn du willst, das hast du uns oft genug unter die Nase gerieben, wenn du dich über uns Angestellten lustig machen wolltest. Und es ist ja noch wirklich eine lange Zeit hin, mehr als ein Jahr. Aber wir sollten nur schon früh genug planen, vier Menschen mit einem Job, das muss man gut vorbereiten.“
„Das stimmt ja alles, du hast ja recht, aber ich kann wirklich nicht.“
„Warum nicht?“, Hannes hatte den ernsten Ton in Julians Stimme registriert, schaute seinen Freund nun selbst mit ernstem Gesicht an und fragte: „Was ist los, was hast du denn?“
Julian sah zu Boden, überlegte, dass es nun wohl unvermeidlich geworden war, seinem besten Freund reinen Wein einzuschenken.
„Der Krebs ist wieder zurück“, sagte er mit zögerlicher Stimme, „und diesmal scheint es schlimmer als beim ersten Mal. Ich muss wieder eine Therapie machen, aber selbst dann kann es sein, dass ich die WM nach der in Russland gar nicht mehr erlebe.“
„Ja, aber… Katar interessiert eh kein Schwein, da ist es nur heiß und was Alkohol betrifft, sicher auch nicht nach unserem Geschmack.“ Die Antwort war aus Hannes ohne viel Nachdenken geradezu herausgeplatzt, mit etwas Verzögerung schien ihn nun die eigentliche Nachricht zu erreichen. „Aber okay, das klingt jetzt tatsächlich sehr… suboptimal, möchte ich sagen. Das tut mir leid. Wann beginnst du mit der Therapie, wie lange geht sie, wie wirst du beisammen sein? Beim letzten Mal war das ja nicht so toll.“