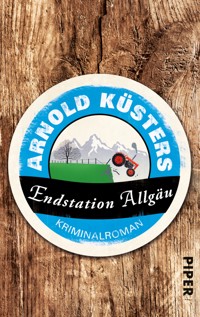
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als der Kemptener Kommissar Carsten Jakisch von seinem grantigen Vorgesetzten dazu verdonnert wird, ungelöste Fälle aufzuarbeiten, stößt er auf eine alte Vermisstensache. Vor Jahren ist im Werdensteiner Moos eine Frau verschwunden, Spuren führen an den Niederrhein. Jakisch bittet die Mönchengladbacher Kollegen um Hilfe, schließlich gilt es auch noch die allesentscheidende Frage nach dem einzig wahren Schweinebraten zu klären: Kartoffelklöße oder Semmelknödel?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Edith
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96765-5
© Piper Verlag GmbH, München 2014
Covergestaltung und -motiv: buerosüd°, München
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Come here, let me show you how hard my heart beats
when I’m under the sheets with you.
Harry Rowland (Rosie, »Southward Bound«)
Figuren und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären damit rein zufällig.
Sie öffnete die Tür und betrat eine Welt, in der ihr einziger Bewohner geduldig auf ihren Tod wartete. Was sie nicht ahnte: Er hasste bereits jetzt den Augenblick, in dem sie von ihm gehen würde.
I.
Der Ärmel bewegte sich. Zunächst war es nur ein Züngeln. Zug um Zug schob sich die Kreuzotter unter der Wolle hervor. Sie verharrte einen Augenblick, als spürte sie einen Rest Wärme. Dann glitt sie in gleichförmigen Wellenbewegungen davon und verschwand zwischen flachen Torfmoosen und dichtem Wollgras. Zurück blieb eine feine Spur im taufeuchten Untergrund. Hoch über ihr segelte ein Bussard. Lautlos stürzte sich der Greif dem Erdboden entgegen, fing sich alsbald, kreiste, gewann wieder an Höhe, und sein Tanz über dem Werdensteiner Moos begann aufs Neue. Einem der größten Hochmoore im Oberallgäu, das wie ein riesiger Schwamm in der Landschaft liegt. Im Zentrum können sich die sensiblen Bereiche ungestört entwickeln. Vor gut dreißig Jahren waren die Gräben für die Entwässerung wieder zugeschüttet worden. Seither steigt das Wasser und sterben die Gehölze. Ihr Tod schafft Raum für anderes. Dort, wo kein Wasser hinkommt, gedeihen Faulbaum und Birke. Nur auf vorgezeichneten Wegen dürfen sich Besucher durch das Reservat bewegen.
Ein schlüpfriger Pfad führte zu der Stelle. Pullover, Bluse, Hose, Unterwäsche und Schuhe. Den Bussard störte das sorgfältig zusammengelegte Bündel nicht. Er zog weiter aufmerksam seine Kreise.
Ein blauer Himmel. Über den plötzlich Wolkenfetzen jagten. Es wurde kalt. Eine Schar Krähen stob kreischend in die Höhe.
II.
»Was willst du, meine Liebe?« Justus Liebig musterte sie von oben bis unten und schickte ein spöttisches »Karriere machen?« hinterher.
Katharina war mal wieder spät dran. Wie immer hatte sie keinen Parkplatz gefunden. Laut fluchend war sie durch den Platzregen zur Redaktion gelaufen. Nun saß sie im Büro des Chefredakteurs. Ihre nackten Füße steckten in nassen Ballerinas, und ihre Haare waren eine einzige Katastrophe. Sie verkniff sich eine Antwort. Sie wollte möglichst schnell raus aus ihren Schuhen und raus aus der Redaktion.
»Wenn du vorankommen willst, sei wenigstens pünktlich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« Liebig hob die Hand, als erwarte er Widerspruch. »Und bring mir eine Story, die deine Oma berührt. Keine C-Promis, nix über aufgespritzte Lippen. Obwohl«, er grinste anzüglich, »na ja – nee, schon gut, brauchst gar nicht so pikiert zu tun. Ich will das echte Leben. Die Leser haben genug von Irak, Syrien oder Ukraine. Bring mir den«, er warf sich mit übertriebener Geste in eine Denkerpose, »ja, bring mir den echten Menschen. Die besten Geschichten liegen vor deiner Haustür. Du musst nur zugreifen.« Liebig sah ihr direkt in die Augen. »Als ob du das nicht wüsstest, meine Liebe.« Der Redaktionsleiter wippte auf seinem Drehstuhl vor und zurück und spielte dabei mit seinem Kugelschreiber. Seine Augen wanderten ungeniert über ihr feuchtes Sommerkleid. Dann warf er eine Büroklammer Richtung Terminplaner, der an der Wand gegenüber hing. »Und beeil dich. Ich habe noch jede Menge Platz.«
Blablabla. Liebig war ein dickes, trotziges Kind. Katharina bekam Kopfschmerzen. Sie hätte seine Unverschämtheiten parieren können, doch sie beschloss, weiterhin zu schweigen. Stattdessen schoss ihr der Gedanke an den Trockner ihrer gehbehinderten Nachbarin durch den Kopf. Sie hatte vergessen, ihn auszuschalten! Na prima! Vor zwei Jahren wäre fast das Haus abgefackelt, weil das Ding im Keller einen Kurzschluss gehabt hatte. Sie hatte damals der alten Dame versprochen, ihr regelmäßig mit dem Trockner zu helfen. Liebigs überfallartiger Anruf hatte sie völlig aus dem Konzept gebracht.
»Was ist?« Liebig deutete ihren erschrockenen Blick als Reaktion auf seine Forderung.
»Ich muss dann mal wieder.« Katharina griff nach ihrer Tasche und stand auf. In ihren Schuhen schmatzte es hörbar.
Liebig hob mit gespieltem Erstaunen eine Augenbraue. »Willst du nicht wissen, warum ich dich herbestellt habe?«
Was denn noch?
Der Chefredakteur grinste. »Setz dich ruhig wieder.«
Sie zögerte. In ihrer Phantasie loderten bereits die Flammen. Sie musste die Redaktion augenblicklich verlassen! Liebig! Der Fettsack wollte mal wieder sein Lieblingsspiel spielen: Ich bin dein Chef! Katharina zog ungeduldig Luft durch die Nase.
»Du bist jung und gut – aber du musst noch eine Menge lernen. Bilde dir auf das Lob bloß nichts ein. Also: Ich finde deine Story über diesen Dings, diesen Arzt im Praktikum, gar nicht mal so schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass du daraus was stricken kannst. Wir setzen sie auf Seite eins der Sonntagsbeilage. Aber«, er hob den Zeigefinger, »nicht abheben, Frau Starjournalistin.«
Ole! Wenn Liebig wüsste! Sie war mit dem angehenden Dr. med. Ole Olsen zum Abendessen verabredet. Wenn nicht noch ein Notfall dazwischenkam.
»War’s das?« Katharina klang ungehaltener als gewollt. Aber es geschahen noch Zeichen und Wunder: Liebig war tatsächlich zufrieden! Andererseits, sie hatte schließlich alles gegeben. Bei dem Gedanken an Oles Hintern lächelte sie.
»Dein überhebliches Grinsen kannst du dir sparen.« Liebig drehte sich mit seinem Stuhl schwungvoll zu seinem Bildschirm hin. Für Katharina das untrügliche Zeichen dafür, dass die Besprechung beendet war.
»Mein Mentor hat immer gesagt, die besten Storys schreibst du nur, wenn du sie auch selbst erlebt hast. Nur so gibt’s den Pulitzerpreis. Merk dir das.« Liebig starrte angestrengt auf seinen Bildschirm.
Eben, dachte Katharina.
Sie verließ Liebigs Büro auf Zehenspitzen. Sie wollte nicht, dass er das Schmatzen ihrer Ballerinas hörte. Sie würde einen Schnupfen bekommen. Welch ein Spätsommer.
Justus Liebig sah ihr hinterher. Warum nur lief sie wie auf Eiern? Ein Meter achtzig schwankendes Weib. Er grinste. Nicht die schlechteste Aussicht.
Der Chefredakteur der Rheinischen Allgemeinen Nachrichten warf einen Blick in seinen Kaffeebecher. Auf der Oberfläche hatte sich ein schillernder Film gebildet. Er trank dennoch einen Schluck. Er verzog das Gesicht. Kalt, der Kaffee. Und der Text über die Sitzung des Heimatvereins viel zu lang. Auch der Volontär musste noch viel lernen. Er speicherte den Text ab und schob sorgfältig die Papiere zusammen, die sich auf seinem Tisch angesammelt hatten. Eigentlich hasste er Unordnung, aber hier in der Redaktion entstand ständig neues Chaos.
Liebig hielt einen Augenblick inne und betrachtete versonnen den Terminplaner, der fast die gesamte Stirnwand seines Büros einnahm. Katharina! Das Mädchen würde er auch noch knacken. Die Kleine würde bald das beste Pferd in seinem Stall sein.
Er drehte sich um. »Kann jemand mal die Tür zumachen? Der Lärm ist ja nicht zu ertragen!«, brüllte Liebig ansatzlos Richtung Großraum. Die Kollegen verstummten und duckten sich hinter ihre Bildschirme. Schließlich stand die Praktikantin auf und schloss mit unsicherem Lächeln die Tür zu seinem Büro.
Liebig grinste. Es klappte doch immer wieder.
»Du, es geht heute Abend nicht. Wirklich nicht. Ich habe noch Termine.« Katharina sah zum Küchenfenster hinaus, ohne seinem Redeschwall wirklich zuzuhören. »Ich weiß, was ich dir versprochen habe. Ja, wir sehen uns in letzter Zeit nicht mehr so oft. Das stimmt. Aber –« Sie kam nicht weiter.
Ja, sie hatte Paul vernachlässigt. Aber ihre gemeinsame Zeit war ohnehin abgelaufen. Sie hatte das Gefühl zwar schon länger gehabt, jedoch ganz intensiv seit dem Wochenende, an dem sie zu seinen Eltern gefahren waren. Nette Menschen, aber auch nervig. Was allerdings weitaus schlimmer gewesen war: Paul war, kaum dass er die Türschwelle passiert hatte, zum Muttersöhnchen mutiert. Paul hatte alles getan, um die vollkommene Aufmerksamkeit seiner Mutter zu bekommen. Mama hier, Mama da. Ein Chamäleon war dagegen ein armseliger Amateur. Unglaublich, was aus einem Mann werden kann, wenn er auf seine Mutter trifft!
Sie hatte es Paul schon auf der Rückfahrt sagen wollen. Aber er hatte ihr die ganze Zeit über von seiner glücklichen Kindheit in Celle vorgeschwärmt. Am Ende hatte sie nur noch nach Hause gewollt.
»Paul. Paul, hör mir bitte mal einen Augenblick zu!« Eine Katastrophe! Er wollte nicht zuhören, aber er wollte noch viel weniger verstehen. Sie musste es ihm sagen! Nicht am Telefon. Sie würde es Paul ins Gesicht sagen müssen.
Katharina hielt den Hörer ein Stück vom Ohr weg und schloss eine Abmachung mit sich selbst: Ich treffe mich mit ihm. Und ja, jetzt am Telefon bin ich nett zu ihm. Ich reserviere noch heute bei seinem Lieblingsgriechen, und dort werde ich endlich reinen Tisch machen.
Das war sie ihm schuldig. Und auch sich selbst. Da war schließlich Ole. Mit Ole konnte noch einiges passieren. Und dazu brauchte sie klare Verhältnisse.
Katharina lehnte sich an den Küchentisch. Sie brauchte jetzt Halt. »Paul? Hör zu, ich habe eine gute Idee. Was hältst du von einem Abendessen im Zorbas?«
Gut. Er hatte zugesagt. Erleichtert legte sie auf und öffnete einen Fensterflügel. Dicke Tropfen trommelten auf das Blätterdach der Bäume und auf das Blech der parkenden Autos. Katharina atmete die klare Luft tief ein. Sie ließ das Fenster geöffnet.
Eine Stunde und eine Kanne Tee später hatte sie Simone am Telefon.
»Ich hab nicht viel Zeit. Ich muss los. Recherche, weißt du. Paul hat mich aufgehalten.« Katharina biss sich auf die Lippen. Die kleine Notlüge war nicht zu vermeiden gewesen. Simone würde sie sonst totquatschen, aber sie wollte jetzt keinen Small Talk. Sie wollte einfach nur ihre Ruhe.
»Wie geht’s dem Guten?« Simones Stimme verrutschte einen Tick ins Kindliche und verriet, was sie über Paul dachte.
»Er nervt.« Katharina hatte dummerweise zu spät daran gedacht, dass »Paul« für Simone das Schlüsselwort war. Ihre Freundin hatte eine Menge Meinung zu Paul.
»Du bist auch nicht viel anders, wenn du verliebt bist, meine Liebe.« Simone verpackte ihren Vorwurf in ein Kichern. »Bei dem Hintern sollte dir seine Nerverei egal sein. Der Rest ergibt sich.«
Das sagte ausgerechnet Simone! Die nach spätestens drei Wochen merkte, dass auch Männer nicht immer nur ins Bett wollten und, außer ihren Kumpels, fast alles vergaßen: Socken, Verabredungen, Geburtstage. Und am Ende sogar den Spaß am aktuellen Betthupferl.
»Hör zu, ich muss jetzt wirklich los. Ich melde mich bei dir.« Katharina wollte auflegen.
»Wir sollten mal wieder einen Mädelsabend machen. Mit viel Ratschen und viel Wein.« Simone klang ehrlich enttäuscht.
»Viel Wein ist immer gut«, versuchte Katharina, versöhnlicher zu klingen, und verabschiedete sich.
Typisch Simone. Ein bisschen mehr als »er nervt« hatte sie wohl doch erwartet, dachte Katharina amüsiert. Wie sie Simone kannte, hatte sie garantiert die Chancen ausloten wollen, Paul unter Umständen für eine Zeit übernehmen zu können.
Sie wählte Oles Nummer, aber sie stieß lediglich auf seine Mailbox. Dann fiel es ihr wieder ein: Ole hatte Bereitschaft. Trotzdem war sie enttäuscht.
Katharina brühte sich einen frischen Tee auf und schloss das Fenster. Unter ihr hasteten die Passanten durch den Regen. Es würde bald Herbst werden. Dabei hatte der Sommer in diesem Jahr seinen Namen kaum verdient.
Sie schlürfte vorsichtig ihr heißes Getränk. Bring mir den echten Menschen: Der Satz ging ihr nicht aus dem Kopf. Was wusste Liebig schon? Er redigierte Texte, saß in Ausschuss- und Ratssitzungen und traf bei Terminen immer die gleichen aufgeblasenen Wichtigtuer.
Und ausgerechnet Liebig tat jetzt so, als wisse er, was das richtige Leben ist und wer die »echten« Menschen sind. Sie verzog verächtlich das Gesicht. Liebig – ein am wahren Leben Gescheiterter.
Wie auf ein Stichwort schrillte das Telefon. Liebig. Er habe »die Wahnsinnsidee«. Müde stellte sie den Teebecher ab.
»Mach was über die Schülerszene. Was treiben die Kids nach der Schule? In welchen Kneipen hängen sie ab? Zu meiner Zeit war es das St. Michele. Total verräuchert. Mann, was war da immer los! Schach spielen, saugute Musik. Wir haben mehr als einmal Mathe geschwänzt.«
»Kids? Du meinst Oberstufenschüler. Was soll das bringen?« Ihr ging Liebigs aufdringliche Euphorie auf den Wecker.
»Eine Milieu- und Szenestudie. Klapper die Kneipen und Cafés ab. Frag nach ihren Träumen. Ihrer Mode, Musik und dem ganzen Zeug. Twitter, Facebook. Geh auf ihre Konzerte.«
»Twitter? Facebook? Woher kennst du solche Fremdworte?«
Er lachte angestrengt. »Du weißt, was ich will. Die Kids sind unsere Leser von morgen.«
»Liebig?« Hätte er ihr das nicht schon in der Redaktion sagen können?
»Ja, meine Liebe?«
»Hat dir das unser Verleger eingeblasen?«
Justus Liebig blieb unbeeindruckt. »Eine Serie.« Das mit dem Blasen würde er auch noch mit ihr klären. Später. »Acht Geschichten. Mindestens.«
»Mensch, Liebig.« Katharina hatte vor Augen, wie er mit schwitzigen Händen imaginäre Schlagzeilen in die Luft schrieb.
»Ich zähl auf dich, meine Liebe. Du wirst noch ganz groß rauskommen. Das verspreche ich dir.«
Noch bevor sie etwas sagen konnte, hatte Liebig aufgelegt.
III.
Heinz-Jürgen Schrievers sah sich zufrieden um und rieb sich die Hände. Auf den Metallschränken stapelten sich keine Akten mehr, von seinem Schreibtisch war die Arbeitsplatte wieder zu sehen, die Kaffeemaschine blitzeblank, das längst überfällige Umtopfen seines geliebten Bogenhanfs endlich erledigt. Derart aufgeräumt hatte sein Archiv lange nicht mehr ausgesehen. Die Ruhe der vergangenen Wochen hatte ihn auf die Idee gebracht, mal wieder klar Schiff zu machen.
Das deutlich sichtbare Ergebnis seiner Mühen war aber nur der halbe Grund für seine gute Laune. Die weitaus wichtigere Hälfte lieferten die dick belegten Leberwurstbrote, die seine Gertrud ihm eingepackt hatte und die er sich nun bei einer frischen Tasse Kaffee und der Begutachtung des neuen Posters an der Wand neben der Bürotür zu gönnen gedachte.
Schrievers setzte sich und goss sich ein. Genüsslich kauend betrachtete er das Objekt seiner Begierde. Das Poster zeigte einen Traktor von 1956. Einen Schlüter. Genau so einen würde er sich zulegen. Gertrud hatte endlich grünes Licht gegeben. Gertrud! Ohnehin die beste aller Archivarehefrauen! Schrievers lächelte. Sie hatte ihm über Wochen geduldig zugehört, wenn er wieder mal von dem Traktor geschwärmt hatte.
Er war zufällig im Internet auf das Bild des Treckers gestoßen. Seither hatte es ihn nicht mehr losgelassen. Er erinnerte sich wieder genau an das satte Geräusch des Motors. Und an den Geruch. Auf dem Hof seiner Eltern war genau dieses Modell ein paar Jahre im Einsatz gewesen. An einem Morgen war er wach geworden, hatte seine Gertrud in den Arm genommen und von dem Schlüter und seiner Idee erzählt. Er hatte gewusst, dass sie ihn nicht für verrückt halten würde.
Schrievers rieb sich erneut die Hände und nahm das zweite Brot aus der Frühstücksdose. Er würde sich gründlich umsehen. Irgendwo in Deutschland wartete sein Schlüter Baujahr 1956 auf ihn. Er musste den Trecker nur noch finden. Sein Blick fiel auf die wichtigste Fachzeitschrift für Schlepperfreunde, die auf einem Aktenstapel auf ihn wartete. Auf dem Titelbild prangte ein alter Lanz. Der Archivar seufzte voller Vorfreude auf den restlichen Vormittag. Vielleicht hatte er ja Glück und wurde gleich fündig. Zustand und Preis spielten keine große Rolle, schließlich war sein Bruder Horst Landmaschinentechniker. Wie gesagt, es gab nur noch dieses eine kleine Problem: Wo stand ein Schlüter zum Verkauf?
Schrievers wischte ein paar Krümel von der Strickjacke. Warum war er nicht schon eher auf den Gedanken gekommen? Der Trecker würde die Attraktion in seinem Dorf werden. Fröhlich pfeifend griff der Archivar der Mönchengladbacher Polizei zu dem Heft und strich andächtig über das glänzende Deckblatt.
Er hatte gerade das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen, als sein Telefon klingelte.
»Schrievers?«, meldete er sich ungehalten. Der Anruf kam nun wirklich zum völlig falschen Zeitpunkt.
»Carsten Jakisch.«
Seine Laune verbesserte sich schlagartig. »Junge. Lange nix gehört. Bist du noch bei, wie heißt er doch gleich, Mayr?«
»Schon. Ihr wisst ja, wie er ist. Er kann mich halt nicht leiden. Ein echter Allgäuer Schädel.«
»Klingt nicht gut.« Schrievers erinnerte sich noch genau an Jakischs Gesicht, wenn er von seinem Vorgesetzten sprach. Robert Mayr war ein selbstgefälliger Grantler ersten Grades. Ein Kriminalhauptkommissar, den seine Verlobte Martina und deren Käse mehr zu interessieren schienen als die Aufklärung der Verbrechen im Oberallgäu. Er stellte sich Mayr als Älpler mit Gamshut vor, dessen Horizont nicht weiter reichte als zum nächsten Gipfel und zum Aschermittwochstreffen der CSU.
»Mayr kann vielleicht nix dafür«, versuchte der Archivar, dem jungen Kollegen aus Kempten Mut zu machen, »das liegt sicher an den Genen. Allgäuer werden in Lederhosen geboren und sind zwanghaft Anhänger schroffer Felsen und ebenso schroffer Lebensart.« Bei dem Gedanken musste er lachen. »Nichts für ungut, ich wollte jetzt nicht auch noch Salz in deine Wunden reiben. Kann ich was für dich tun, außer mit dir über die Herzlichkeiten deines Volksstamms zu jammern?«
»Hallo, ich bin nur ein halber Allgäuer«, begehrte Jakisch auf. »Opa und Oma kommen aus Schwalmtal –«
Schrievers fiel ihm ins Wort. »Stimmt. Hätte ich fast vergessen. Gertrud hat sie vor einiger Zeit auf dem Friedhof getroffen. Sie sehen noch recht fit aus, hat sie mir erzählt.« Er räusperte sich. »Du musst doch hin und her gerissen sein. Halb Niederrheiner und halb Allgäuer – geht das überhaupt?«
»Ja, ja, hack du auch noch auf mir rum.« Jakisch klang bekümmert, und seine Stimme bekam diesen knödeligen Tonfall, den sie immer dann annahm, wenn er aufgeregt war.
»Entschuldige. Was kann ich für dich tun?« Schrievers hatte vergessen, dass Pumuckl, oder Knödel, wie sie den knubbeligen Kollegen mit den roten Haaren während der Zeit genannt hatten, in der er sie bei der Aufklärung der Morde um den Unternehmer Ernst Büschgens unterstützt hatte, schnell beleidigt war. Sein Chef in Kempten hatte ihn hoch ins »Rheinland« geschickt, wie Mayr so stur wie falsch den Niederrhein bezeichnete, da einige der Taten in und um Moosbach passiert waren, die Spuren aber deutlich nordwärts gezeigt hatten. Schrievers war damals den Eindruck nicht losgeworden, dass Mayr Jakisch aus den Augen hatte haben wollen. Wie auch immer, Jakisch hatte sein Mitgefühl. Der junge Kommissar ging im Allgäu durch eine harte Schule.
»Du kannst mir in der Tat helfen.« Jakischs Stimme klang wieder normal. »Mayr lässt mich gerade alte Vermisstenfälle bearbeiten.« Er machte eine kurze Pause. »Wenn du mich fragst, eine Strafaktion.« Er stockte erneut. »Na ja. Er hat nicht ganz unrecht. Ich habe halt ein paarmal verschlafen. Und, na ja, außerdem habe ich zwei Asservate verschludert.«
Schrievers wollte etwas sagen, hielt sich aber zurück. Jakisch war schon gestraft genug.
»Jedenfalls, bei der Durchsicht der Akten habe ich eine Sache gefunden, die auch für euch interessant sein könnte.«
Jakisch berichtete Schrievers von einer Frau, die vor sechs Jahren im Werdensteiner Moos, einem großen Hochmoor zwischen Kempten und Immenstadt, spurlos verschwunden war. Ein Förster hatte mitten in dem Naturreservat Kleidung gefunden. Sorgsam gefaltet.
»Trotz Großfahndung hat sich lediglich eine Frau gemeldet, die die Kleidungsstücke auf einem Zeitungsfoto erkannt hat. Sie erinnerte sich daran, der Unbekannten auf dem Parkplatz eines Discounters in Immenstadt begegnet zu sein. Allerdings hat sie die Frau nur vage beschrieben. Es habe an jenem Tag wie aus Eimern gegossen. Außerdem sei sie sehr aufgeregt gewesen, weil die Unbekannte beim Rangieren ihren neuen Opel Corsa leicht berührt hatte. Den Wagentyp der seltsamen Frau hat sie sich nicht gemerkt, wohl aber die Anfangsbuchstaben des Kennzeichens: MG.«
Schrievers nickte nachdenklich. »Das ist in der Tat dünn. Ein Auto mit dem Kennzeichen MG. Farbe?«
»Dunkel, steht hier.«
Der Archivar strich seine Notizen durch. »Ein dunkles Auto, ein Kleiderbündel. Das ist wenig, Knödel.«
»Ich weiß. Ich hatte gehofft, in deinem Kopf würde etwas klingeln, wenn ich dir von der Frau im Moor erzähle. Ihr habt ja auch nicht immer alle Vermisstensachen auf dem Schirm. Die Kollegen haben damals auch in NRW nachgefragt. Ohne Erfolg. Also haben sie die Ermittlungen eingestellt. Kann auch sein, dass sich damals jemand einen Scherz erlaubt hat und den Förster aufschrecken wollte.«
»Bei mir klingelt im Augenblick nichts. Aber versprochen, ich schau mal in mein Archiv. Vor sechs Jahren, sagst du?«
»Ja. Ich habe auch schon die BKA-Datei durchforstet. Negativ. Aber möglicherweise habe ich ja etwas übersehen. Und: Nenn mich nicht immer Knödel.«
»Wie gesagt, Knödel, ich kümmere mich darum.« Schrievers überkam ein Geistesblitz. »Sag mal, lieber Carsten, du kennst nicht zufällig einen Bauern, der seinen alten Schlüter-Schlepper verkaufen will? Im Allgäu müssten noch einige von der Sorte rumstehen. Ich suche einen mit Baujahr ’56.«
Jakisch verneinte. Aber er versprach, sich umzuhören.
Nachdem Carsten »Pumuckl« Jakisch sich »mit den besten Wünschen an Frank und Ecki« verabschiedet hatte, stand der Archivar auf und schüttete den mittlerweile kalt gewordenen Kaffee in den Ausguss. Dabei warf er einen Blick auf die Uhr. Herrje. Fast Mittag. Die Kantine hatte schon geöffnet. Die Treckerzeitung würde warten müssen.
IV.
Sie stand schräg vor ihm. Keine zwei Armlängen entfernt. Er konnte im Licht der tief stehenden Sonne den Flaum an ihrem Haaransatz erkennen. Ihr schlanker Hals lief in harmonischer Linie in schmale Schultern aus. Sie hielten ein hellgraues Top mit dünnen Trägern. Satin. Keine störenden Leberflecken, keine Sommersprossen. Reine Haut. Er nickte zufrieden.
Sie konnte nicht älter als Ende zwanzig, höchstens Anfang dreißig sein. Ihr blondes Haar hatte sie nachlässig zu einem Zopf gewunden. Er wippte im Takt der Musik.
Er spürte ihre Aura. Jede seiner Fasern drängte sich ihr entgegen. Er lächelte in sich hinein. Sie war ein Magnet und wusste es nicht. Er würde ihre Haut schon bald riechen. Und dann jede Pore, jedes noch so kleine Fältchen, jedes Haar sorgsam prüfen auf Brauchbarkeit. Er schloss die Augen. Die Menschen um ihn herum waren seine Deckung.
Er hatte mit Freude festgestellt, dass sie allein gekommen war. Die Hände lässig in den Taschen ihrer Jeans, das Top, das eng auf ihrem schmalen Körper lag und das den Bronzeton ihrer Haut erst sichtbar machte, Chucks: Sie war sich selbst genug.
Selbstvergessen hing ihr Blick an der Sängerin. Er folgte ihm. Die kleine Amy sah auf der großen und dunkel abgehängten Bühne verloren aus. Ein schottisches Mädchen in einer tiefen Schlucht. Lautsprechertürme wie schwarze schroffe Felsen. Diese zarte Person, die mit ihrer Gitarre tapfer gegen die Angst vor dem bösen Wolf ankämpfte.
Ihre Augen! Sie passten perfekt. Dazu die klare Luft. Er genoss die vibrierende Vorfreude seines Körpers. Das Licht war optimal! Sie war die perfekte Bühne für seine Phantasien.
Die Menge war ständig in Bewegung. Aber er hatte immer noch den besten Blick auf sie. Er notierte die exakte Uhrzeit in seinem Mobiltelefon und imitierte dann ihre Körperhaltung. Er würde schon bald besitzen, was er sich so sehr gewünscht hatte.
Amy trat ab. Nebensache. Er sah alles in ihren Augen. Sie waren perfekte Spiegel für das Licht und die Bewegungen auf der Bühne. Wunder der Natur! Fotorezeptoren, deren jeweiliger Erregungszustand durch die unterschiedlichen Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung verändert wurde.
In den Glaskörpern brachen sich das Blau, Gelb, Rot und das Grün der Scheinwerfer. Sie erschufen Symphonien aus Licht, die im Augenblick ihrer Entstehung verlöschten, um anders temperiert neu zu entstehen. Gemischt mit dem weißen Licht der Verfolger. Verstärkt durch die Blitze der Lichtkanonen.
Im Dunkel seines Zimmers hatte er festgelegt, welchen Typ er suchte. Und nun hatte er sie gefunden! Ihre Augen spielten die eigentliche Symphonie dieses Open-Air-Konzerts.
This is the Life hatte Amy Macdonald gesungen. Er hatte begeistert zugehört. Amy hatte allein für ihn gesungen.
Es war nun Nacht. Das Open-Air-Konzert würde bald zu Ende sein. Mit seinem Blick vermaß er jede der wiegenden Bewegungen seiner Auserwählten. Er durfte diese Augen auf keinen Fall verlieren. Er würde sehen, wie das farbige Leuchten in ihren Glaskörpern von jetzt auf gleich verlosch.
V.
»Wer hat sie gefunden?«
Der diensthabende Rechtsmediziner wies, ohne aufzublicken, stumm über seine Schulter.
Ecki folgte der Geste mit seinem Blick. »Da ist niemand. Geht’s auch ein bisschen genauer, Leenders?«
Richard Leenders drehte den Schädel der Toten mit beiden Händen vorsichtig hin und her. Dabei nickte er bedächtig. »Was weiß denn ich?« Als könnte er die Tote erschrecken, zog er mit einer ebenso bedächtigen Bewegung seinen Koffer zu sich und nahm ein Skalpell heraus, um eine eingetrocknete Substanz von der Schulter der Toten in ein Plastiktütchen zu kratzen.
»Fundort gleich Tatort?«
Leenders reagierte nicht.
Kriminalhauptkommissar Michael »Ecki« Eckers hob lediglich eine Augenbraue. Leenders war und blieb unausstehlich. Im Präsidium hielten ihn alle für verrückt. Im reich bestückten Fundus der Polizeiprosa hatten sie für ihn den Begriff Mad Doc gefunden. Wie sie meinten, das passende Attribut für einen Mediziner, der mit Hingabe an toten Körpern schnüffelte und für gewöhnlich Mentholzigaretten bei der Arbeit rauchte. Aber erst seit Leenders mit dem Rauchen aufgehört hatte, war er seinem Spitznamen so richtig gerecht geworden.
Ecki stapfte zu einem der Polizeibullis, die ein Stück entfernt am Rand des kleinen Wäldchens standen. Als er die Schiebetür eines Transporters aufzog, sprang ihm unversehens ein schmaler Rauhaardackel entgegen. Ohne weiter auf den Ermittler der Mönchengladbacher Polizei zu achten, verschwand das krummbeinige Tier mit wippenden Ohren Richtung Leenders.
»Schröder! Schröö-derr!«
Ecki konnte nur knapp ausweichen. Andernfalls wäre er zum Sprungkissen für den beleibten Hundehalter geworden, der auf seinen ebenfalls kurzen Beinen seinem Dackel hinterherstürzte.
»’tschuldigung. Schröder hört nicht mehr richtig. Er wird Ihrem Kollegen noch alles durcheinanderbringen.«
»Das glaube ich eher weniger.« Ecki sah dem Vierbeiner hinterher und musterte dann dessen Herrchen, der auf die Jagd verzichtet hatte. Ein Mann im Rentenalter. Kugeliger Bauch. Über dem dichten grauen Bart blitzten listige kleine Augen.
Er bemerkte Eckis fragenden Blick. »Hubert Heuts. Ich habe die Frau, nee, Schröder hat sie gefunden«, verbesserte er sich. »Wir sind oft hier unterwegs. Gestern lag sie noch nicht da.« Schröders Herrchen strich sich über den Bart und sah in Richtung Leenders. »Wer tut so etwas?«
Bevor Ecki antworten konnte, winkte Frank, der neben Mad Doc stand, ihn ungeduldig herbei.
Hubert Heuts sah dem Kommissar kopfschüttelnd hinterher. Entschleunigung wäre ein wichtiges Thema für den Betriebssport der Polizei, dachte er. Diese Hektik konnte auf Dauer nicht gut gehen. Er beugte sich zu seinem Hund, der kurzatmig zu ihm zurückgetrippelt war. »Schröööder. Bei Fuß. Ja, so ist’s gut.«
Die nackte Tote lag auf dem Rücken. Ihr Haar floss blond und lang über ihre Schultern. Die gefalteten Hände lagen auf ihrem Bauch, die Beine parallel nebeneinander. Der schmale Körper war nicht mit Zweigen oder Laub abgedeckt worden.
»Wie aufgebahrt.«
»Ophelia.«
Ecki zog die Stirn kraus. »Du kennst sie?«
Frank ließ seinen Blick langsam über ihren Körper wandern. »Hamlet. Ophelia, die nach dem Tod ihres Vaters wahnsinnig geworden ist und sich ertränkt hat.«
»Wie? Sie hat im Wasser gelegen?« Ecki musterte die Tote skeptisch.
»Die hier natürlich nicht! Mir fiel eben Ophelia ein, so wie sie hier aufgebahrt liegt. So voller Unschuld.«
»Ach so, ja.« Mit Klassikern hatte es Ecki nicht.
Leenders hockte noch immer neben der Leiche und hatte das Gespräch der beiden Todesermittler schweigend verfolgt. »Vielleicht ein Freund Shakespeares, unser Täter. Bernhard Minetti war klasse.« Er sah Frank schräg von unten herauf an. »Ich gebe Eckers ja ungern recht, aber nass ist die Gute seit ihrer letzten Dusche nicht geworden.« Leenders kratzte nun an einem Knöchel der Toten.
»Aufgebahrt? Eine Altarsituation? Eine Opferung.« Ecki ging in die Hocke und machte sich Notizen. Leenders ignorierte er. »Wie friedlich sie aussieht. Oberkörper, Arme und Beine ohne äußere Verletzungen. Wären nicht die Wunden im Gesicht und die Verfärbungen am Hals, man könnte meinen, sie schläft.«
»Auf einer Plastikfolie?« Leenders stand leise ächzend auf und deutete auf die Ränder der dicken Plane. Sie umrahmten den Körper der Frau wie ein Passepartout.
»Du meinst, sie ist erst hier im Wald ausgepackt worden?« Frank ging ebenfalls in die Hocke. »Sieht aus wie Baufolie.«
Die Folie war dreifach gelegt und akkurat gefaltet. Der Täter, oder die Täterin, muss sich sehr sicher gefühlt haben, dachte Frank. Warum war die Leiche nicht abgedeckt? Er sah sich um. Die Leiche lag zwischen Haselnusssträuchern. Die Stelle war von der Straße aus, die nahezu schnurgerade zwischen Breyell und Kaldenkirchen verlief, nicht einzusehen. Die Tote und der Ablageort waren perfekt getarnt.
»Der Täter hat sie nicht beerdigt, weil er sie betrachten wollte. Vielleicht ist Sex das Motiv. Das Bild der toten Frau hat ihn geil gemacht.« Frank deutete auf die Kleidung, die neben der Frau lag.
»Ein Sextäter?« Ecki zog die Stirn kraus. »Hm. Und wenn eine Frau ihre Rivalin tot sehen wollte? Dazu passt eher das zerschnittene Gesicht.«
Frank nahm den Gedanken auf. »Schau dir die Kleidung an. Das Shirt, die Hose, die Unterwäsche: ordentlich gefaltet. Die Haare sehen aus wie frisch gekämmt. Wer die Frau getötet hat, legt äußerst viel Wert auf Ordnung. Die exakte Anordnung erregt ihn oder sie. Guck dir die Plastikplane an: Wenn du ein Lineal anlegst, ich wette, die Kanten sind gleich lang und der Körper liegt genau in ihrer Mitte.«
»Hm.« Ecki fuhr mit dem Finger über die Kante der Folie.
Frank trat einen Schritt zurück und ließ seinen Blick über das Unterholz und die angrenzenden Felder schweifen. Weiter hinten zeichnete sich deutlich ein altes Bahnwärterhäuschen gegen den makellos blauen Himmel ab. Eine leichte Brise fuhr durch das Wäldchen. Aber Frank ließ sich nicht täuschen. Der Herbst war nicht mehr weit. Er seufzte bei dem Gedanken.
»Wir müssen klären, wo die nächsten Funkmasten stehen und welche Handys dort in den vergangenen 24 Stunden eingeloggt waren. Hat der Zeuge sonst noch etwas gesagt?«
Leenders klappte seinen Koffer zu und kam Ecki zuvor. »Das Wäldchen wird oft von Liebespaaren genutzt. Sagt der Typ mit dem Dackel.«
»Wie lange liegt sie schon hier?« Frank drehte sich einmal um seine Achse. Zwischen den Bäumen waren drei Kirchtürme zu sehen. Breyell. Sein Heimatdorf. Bis zum Marktplatz waren es gut drei Kilometer Luftlinie. In die andere Richtung ebenfalls locker zwei Kilometer bis Kaldenkirchen. Viel Betrieb gab es auf den Feldwegen ringsum sicher nicht.
Leenders grinste. »Pass auf, Borsch.« Er bückte sich und hob einen Arm der Toten ein Stück an. »Was meinst du, he?«
Du bleibst ein Drecksack, dachte Frank. »Keine 24 Stunden. Eher zwischen zwölf und 24 Stunden. Die Leichenflecken?«
Leenders ließ den Arm wieder sinken. »Bravo. Aus dir könnte ein ganz brauchbarer Rechtsmediziner werden.«
»Verarschen kann ich mich alleine.«
»Macht aber nicht so viel Spaß.« Richard Leenders nahm seinen Koffer. Im Gehen sah er sich noch einmal um. »Möchte mal wissen, warum der Toten die Augen herausgenommen wurden.«
Ecki beachtete Leenders’ grußlosen Abgang nicht weiter. »Ein Spinner, aber er hat recht. Warum fehlen die Augen? Hat sie etwas nicht sehen sollen? Fühlte sich der Mörder von ihr beobachtet und ist ausgerastet? Sie hat sicher wunderschöne Augen gehabt.«
»Schau dir die Bäume an, Ecki.« Frank fuhr mit den Fingern über die glatte Rinde einer Buche. »Überall Initialen. 1943, da 1957. B + H 7.68. Das hier ist von 2010. Ein Liebeshain. Vielleicht der Quell ewiger Liebe.«
»Klingt nach großem Theater.« Ecki hatte in der Schule mal von griechischen Tragödien gehört.
»Nee, reine Vermutung.«
»Sie war noch jung.« Ecki winkte die Bestatter heran, die mit ihrem Kunststoffsarg geduldig in der Nähe gewartet hatten.
»Wer tut so etwas?«
Frank Borsch legte den Bericht zur Seite, den Leenders ihnen überraschend schnell zugeschickt hatte.
»Die Augen fachgerecht aus ihren Höhlen geholt, die Lider sauber abgetrennt. Die Frau hat noch gelebt! Erst danach wurde sie erwürgt.« Er hob eines der Fotos an, die vor ihnen auf dem Konferenztisch lagen. Leere Augenhöhlen in Großaufnahme, aus denen dünne Blutfäden zu den Schläfen liefen.
»Keine Papiere, kein Geld. Trotzdem können wir Raubmord wohl ausschließen. Wir hatten Wochenende. Streit in der Disco? Eifersuchtsdrama? Aussprache im Auto, und dann: zack.«
Ecki sah Heinz-Jürgen Schrievers dabei zu, wie er sich redlich mühte, es sich auf dem altersschwachen Drehstuhl für Besucher einigermaßen gemütlich zu machen.
»Was wissen wir über die Frau? Und was sagt dein Archiv über ähnliche Fälle?«
Schrievers’ Schulterzucken endete in einem kreischenden Klagen des Stuhls. Mehr als hundertzehn Kilo Lebendgewicht waren in seinem Alter entschieden zu viel.
»Nix Vergleichbares. Auch die Kollegen haben nix. Wenn ihr mich fragt: Das Ganze hat etwas von Bestrafung. Das Blenden von Menschen ist schon seit dem 14. Jahrhundert vor Christus belegt.« Der Archivar hatte endlich eine erträgliche Position für seinen Körper gefunden, der von einer Strickjacke mit Zopfmuster dominiert wurde.
»Blenden? Wie passt das Erwürgen dazu?« Frank sah den Archivar neugierig an.
»Keine Ahnung. Das ist euer Job. Sadismus? Triebtäter?« Schrievers musterte seine braun karierten Filzpantoffeln.
»Täter? Keine Frau?«
»Eher unwahrscheinlich. Aber wie sagt Ecki immer: Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Möglich ist alles. Eifersucht ist ein starkes Motiv. Manch eine könnte ›der falschen Schlange die Augen auskratzen‹. Der Spruch ist so abwegig nicht.«
»Folter? Vielleicht waren mehrere an der Tat beteiligt.« Frank ließ seinen Gedanken freien Lauf.
Ecki schaltete sich ein. »Leenders hat mir eben am Telefon gesagt, er bekommt das Gesicht so hin, dass wir mit einem Foto an die Presse geben können. Lasst uns derweil den Zahnstatus klären. Vielleicht haben wir dann schon einen Namen. Die Frau hatte kurz vor ihrem Tod Sex. Leenders geht davon aus, dass sie betäubt wurde. Er tippt auf Propofol. Wenn das stimmt, sagt er, dann wollte der Täter seinem Opfer bewusst Schmerzen zufügen. Er hat die Frau lediglich sedieren wollen. Propofol lindert keine Schmerzen.«
»Einstichstellen?«, fragte Frank.
»Fehlanzeige.« Der Archivar stand schwerfällig auf und zog seine Jacke glatt. »Ich muss los. Das Archiv wartet, Jungs.«
An der Tür drehte er sich noch einmal um. »Und wenn sie nicht aus Nettetal ist oder dem Kreis Viersen? Vorgestern war Nettetal rappelvoll: WDR 2 für eine Stadt. Mit Festival – Nena, Amy Macdonald und so. Die Fans kamen aus halb Deutschland.«
Frank nickte. »Dann haben wir ein Problem.«
»Die Frage ist doch auch, wie kommt der Täter an dieses Narkosemittel? Ist er Arzt? Apotheker? Krankenpfleger?«
»Recht hat er.«
Nachdem Schrievers gegangen war, zog Ecki eine Schublade seines Schreibtisches auf und hielt Frank eine aufgerissene Tüte mit Lakritzschnecken hin. »Bis zur MK-Sitzung kriegste eh nichts Gescheites mehr zu essen. Okay, ein Hefeteilchen wär mir jetzt auch lieber. Aber immerhin besser als nix.«
Sechshundert Kilometer weiter südlich steckte Carsten Jakisch seinen Kopf in Mayrs Büro. »Ich bin so weit durch, Chef. Wenn nichts mehr anliegt, würde ich gerne Feierabend machen.«
»Wer will das nicht?« KHK Robert Mayr schloss für einen Moment die Augen. Jakisch hatte ihn bei seinen Gedanken an das nächste Heimspiel des Greuther Fürth gestört. Sechsundzwanzig Punkte, Platz drei. Die Kölner mit nur einem Punkt Vorsprung auf Platz zwei. Das war zu packen! Spätestens nach der Winterpause. Dann mussten die Kölner durch die Karnevalszeit. Diesmal würde es klappen, und seine geliebten Kleeblätter wären endlich wieder erstklassig. Ja, die Rheinländer waren zu packen!
»Chef? Ich meine, haben Sie mir zugehört?«
»Waaas?« Der Pumuckl war einfach nur lästig. Wäre er nach der Sache mit dem Toten aus Mönchengladbach doch im Norden geblieben. Er, Robert Mayr, dienstältester KHK der Kemptener Polizei, hätte sicher nichts dagegen gehabt.
Rein statistisch hätte sich ja auch nichts geändert. Der tote Unternehmer lag gut verwahrt auf dem Kirchhof droben in Moosbach, da würde es nicht weiter auffallen, wenn einer aus dem Allgäu wegzöge. Na ja.
»Ich meine«, Jakisch räusperte sich verlegen. Er schien Mayr wieder auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. Sein Chef träumte entweder von der Greuther Fürth, den geliebten Kässpatzen seiner Martina oder einem Schweinsbraten mit allem Drum und Dran. Träumen schien Mayrs Lieblingsbeschäftigung zu sein. Somit kam Jakisch stets ungelegen. »Also, ich würde gerne –«
»Ach, gehen S’ nur.« Mayr wischte mit der Hand durch die Luft, in der Art, wie einst die Herrschaften ihr Personal aus dem Zimmer schickten. »Ich habe alles.«
Herrgott noch mal, dachte Jakisch. »Steffi hat gekocht. Schweinebraten mit Klößen.« Er wollte so kurz vor Feierabend nicht noch Streit mit Mayr. »Ein Rezept meiner Oma.«
»Herrschaftszeiten, Jakisch! Das heißt Knö-del und Schwein-s-braten.« Er betonte das »s« besonders. »Wann lernen S’ das endlich? Wir sind hier im Allgäu und nicht da oben bei den Rheinländern.« Die zu allem Übel zum Braten eine Plörre servierten, zu der sie Kölsch sagten. Und sie aus Gläsern tranken, die die Bezeichnung Bierglas niemals verdienten. Für ihn gehörte zum Schweinsbraten eine ordentliche Maß. Basta.
Diese armen Seelen würden ihm bis in alle Ewigkeit hinein unbegreiflich bleiben: keine Ahnung von Kässpatzen, schon gar nicht von gutem Bier. Und alle auch nicht von der sportlichen Qualität, mit der in seiner Heimat gegen den Ball getreten wurde. Er sah auf. Jakisch stand immer noch in der Tür. Ein kugeliger Polizist, rote Haarstoppeln und erfolglos. Und immer stand er einem auf den Füßen.
»Nun gehen S’ endlich.« Mayr zögerte, fügte dann aber doch hinzu: »A guate.«
Nachdem Jakisch die Tür hinter sich geschlossen hatte, zog Mayr einen Katalog eines Hochzeitsgestalters hervor. Das macht man heute so, hatte Martina ihm nun schon zum wiederholten Mal und mit einem zärtlichen Stups gegen die Brust gesagt. Alles aus einer Hand, von der Einladung über die Ringe, bis hin zum Blumengesteck am Altar. Hundert Seiten Hochglanz, samt Preisliste.
Er schlug die erste Seite auf und wollte sich gemütlich zurücklehnen, als die Tür zu seinem Büro erneut aufging. Mit einer einzigen Handbewegung schlug er den Katalog zu und zog eine Umlaufmappe darüber. Er wurde so rot wie damals, als seine Mutter ihn im Bett erwischt hatte, wie er in der Bravo höchst interessiert Dr. Sommers Kolumne gelesen hatte. »Kruzitürken.«
»Sorry, mir ist da noch etwas eingefallen.« Jakisch ließ nicht erkennen, ob er den Katalog gesehen hatte.
»Was denn?« Mayr faltete seine Hände und drückte sie fest auf die Umlaufmappe.
»Die Sache im Werdensteiner Moos.«
Werdensteiner Moos? Was hatte der knödelige Pumuckl mit dem Hochmoor zu schaffen? »Ja? Machen Sie’s kurz, ich habe noch zu arbeiten. Die Überstundenaufstellung muss heute noch raus.«
»Geht ganz schnell.« Jakisch setzte sich ungefragt auf den Stuhl neben der Tür. »Ich habe mit dem Archivar in Mönchengladbach gesprochen. Sie erinnern sich? Schrievers.«
Meine Güte, dachte Mayr, mach hin. »Ja. Der mit der Liebe zum Allgäu. Komischer Kauz. Als wenn der wüsste, wie’s da bei uns zugeht. Dieser durchgedrehte Karnevalsprinz aus der Kölner Bucht.«
Jakisch wollte schon entgegnen, dass Mönchengladbach weiß Gott nicht in der Nähe von Köln liege, nicht im Rheinland, sondern am Niederrhein, aber dann schwieg er doch. Es war müßig, Mayr den besonderen Landstrich zwischen Rhein und Maas zu erklären. Die Laune des Todesermittlers würde nur noch ungenießbarer werden.
»Schrievers hat mir«, Jakisch sah, wie sich Mayrs Stirn in gefährlich tiefe Falten legte, und verbesserte sich umgehend, »er hat uns Unterstützung zugesagt.«
Wobei nur? Mayr konnte sich nicht erinnern. Er warf einen Blick zu der einsamen Topfpflanze, mit der er seit Jahren einträchtig sein Büro teilte und die längst wieder mal hätte gegossen werden müssen. »Gut.«
Jakisch nickte. »Das wollte ich nur schnell loswerden. Ich hoffe nämlich, dass sich doch noch ein vielversprechender Ermittlungsansatz ergibt.«
Hm, dachte Mayr. Er würde nachher unauffällig auf Jakischs Schreibtisch ermitteln. Das Werdensteiner Moos würde er dort sicher finden. Er nickte mehrmals freundlich. »Gut, gut, Herr Kollege, Ermittlungsansätze sind immer gut.«
Was hatte Mayr nur? Egal, was machte er sich Gedanken! Endlich Feierabend. Bestimmt hatte Steffi den Braten schon im Ofen. Jakisch lächelte bei dem Gedanken. »So viele dunkle Autos mit Kennzeichen MG wird es damals auch nicht gegeben haben.«
»Scho recht.« MG? Hatten die Kölner nicht ein K im Schild? Wann verschwand Jakisch endlich?
Der Kriminaloberkommissar rieb sich erwartungsfroh über die Oberschenkel. »Sobald die Liste vorliegt, werde ich sie akribisch abarbeiten.«
»Gut.« Nun verschwinde endlich! Mayr spürte ein Kribbeln in seinem Rücken. Kein gutes Zeichen. Wenn Jakisch nicht endlich verschwand, würde er gleich explodieren. Dann kam ihm die Erleuchtung. »Wenn Sie dazu eine Dienstreise brauchen? Ich bin der Letzte, der Sie Ihnen verweigern würde. Länderübergreifende Polizeiarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg«, dozierte er.
Jakisch spürte, wie er wuchs. Er hatte gewusst, dass er mit seiner Idee richtig lag. Und warum eigentlich nicht? Auf Staatskosten an den Niederrhein reisen? Guter Gedanke. Vielleicht nahm er diesmal sogar Steffi mit. »Ja, wäre doch gelacht, wenn ich, äh, wenn wir den Fall nicht lösen würden.«
»Ja, das wäre gelacht.« Mayr nickte. So, und nun raus.
»Ähm, noch etwas.« Jakisch spürte, dass sich auf der anderen Seite des Schreibtisches ein Unwetter zusammenbraute. Er stand auf. »Wenn Sie jemanden kennen, der einen Trecker verkaufen will, ich hätte da einen Abnehmer – am Niederrhein.«
Robert Mayr sah seinem Mitarbeiter irritiert hinterher. Was sollte das nun wieder? Trecker? Was wollte der mit einem Schlepper? Für einen Moment sah er den lästigen Jakisch hinter dem Steuer eines Treckers sitzen und gegen Norden fahren. Bis hoch ins Rheinland. Vor der untergehenden Sonne waren Jakisch und sein Gefährt nicht mehr als ein Schattenriss.
Der Kriminalhauptkommissar horchte zur Tür. Als er sicher sein konnte, dass Jakisch endgültig weg war, zog er erneut den Hochzeitskatalog hervor und begann zu blättern. Nur glückliche Gesichter, Kerzenschein, Ringe, und in der Wäscheabteilung Dinge, die ihm bisher fremd waren.
VI.
Katharina beendete mit entschlossenem Tastendruck das Gespräch und steckte das Telefon in ihre Schultertasche zurück. Sie war zu wütend, um das Café zu betreten. Sie blieb einen Augenblick auf dem Bürgersteig stehen.
Paul wollte es nicht kapieren! Hätte sie sich nur nicht mit ihm getroffen! Anstatt mit Simone loszuziehen, hatte sie nämlich am Ende doch wieder auf seiner Couch gehockt, zu viel Rotwein getrunken und zu wenig erreicht.
Zum Glück hatte Paul keinen Sex gewollt. Jedenfalls hatte er das nicht offensiv betrieben. Das hätte sie nicht ertragen: Einen Mann, der bettelt. Stundenlang hatte sie auf ihn eingeredet und ihm unermüdlich erklärt, warum es nur noch um ihre Trennung gehen konnte. Er war immer stiller geworden, aber er hatte sie nicht verstehen wollen.
Sie hatte sich gefühlt wie eine Therapeutin ohne Aussicht auf Behandlungserfolg. Im Taxi hatte sie dann das erste Mal geheult. Nicht aus Trauer, sondern aus Wut über sich selbst. Sie hätte sich den Abend schenken können, wenn sie in den Wochen vorher ein bisschen konsequenter gewesen wäre. Sie war auch deshalb wütend gewesen, weil Simone in einem Punkt recht hatte: Sie würde seinen Hintern vermissen.
Zu Hause hatte sie sich statt eines Tees einen Espresso gemacht, auf die Couch gekuschelt und Ole angerufen. Aber er hatte keine Zeit für sie gehabt. Wieder nicht. Eine Kollegin war krank geworden, und er kurzerhand eingesprungen. Ole war gerade für eine schnelle Zigarette nach draußen gegangen, als sie ihn erreicht hatte. Bevor er zurück in den OP musste, hatten sie sich immerhin für den nächsten Tag verabredet.
Obwohl es schon spät in der Nacht gewesen war, hatte sie schließlich Simone angerufen. Sie brauchte jemanden, der ihr beim Heulen zuhörte. Aber bei ihr war nur der AB angesprungen.
Zum Glück hatte sie keinen Sonntagsdienst gehabt. So müde und verkatert, wie sie war, hätte sie den Tag nicht eine Minute durchgestanden. Schon gar nicht Liebig und seine Sprüche. Am allerwenigsten aber den Trubel um die Tote aus dem Wäldchen zwischen Kaldenkirchen und Breyell.
Als sie am Morgen Liebigs knappen Bericht gelesen hatte, war sie froh gewesen, dass er sie nicht angerufen und auf die Polizei angesetzt hatte. Sie hätte ihm die Augen ausgekratzt, denn in seinem Text hatte nämlich nur so viel gestanden, dass es sich um eine junge blonde Frau handelte, deren Identität noch nicht bekannt war. Mehr hätte auch sie nicht erfahren. Die Bullen waren bei Mord äußerst zugeknöpft.
Seinen dürren Artikel hatte Liebig vermutlich eins zu eins aus der Pressemitteilung der Polizei übernommen, ohne auch nur einmal den Telefonhörer in die Hand genommen zu haben.
Der Abend mit Paul hatte auch ihren Elan in Sachen »jungeMenschen« geknickt. Das Open Air am vergangenen Wochenende in Nettetal-Lobberich wäre die beste Gelegenheit gewesen, einen Einstieg in ihre Artikelserie zu finden.
Nun stand Katharina etwas ratlos vor dem Café, von dem Simone schon seit Längerem behauptete, dass sich dort die Szene treffe und es somit »das ideale Biotop für deine Feldforschung« sei. Sie hatte gelacht, weil sie wusste, was Simone unter »Feldforschung« verstand. Für ihre Freundin hatte das Thema unbedingt mit behaarten Beinen, einem V-Körper und blauen Augen zu tun.
Katharina schmunzelte bei dem Gedanken und zog erneut ihr Telefon hervor. Sie wählte nun schon zum x-ten Mal Simones Nummer. Sie wollte sichergehen, dass sie tatsächlich vor dem richtigen Café stand. Aber Simone meldete sich auch diesmal nicht. Dann eben nicht! Während sie das Telefon wegsteckte, drückte sie die schwere Tür auf.
Überrascht blieb sie stehen. Sie fand sich unvermittelt in einer anderen Zeit wieder. Das Café stammte entweder original aus den ganz frühen Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts oder es war eine gut gemachte Kopie: Blümchentapete, Stühle und Sessel, gepolstert mit großzügig abgestepptem Kunstleder. Lindgrün. An den Wänden Lampen mit Schirmchen aus Milchglas wie Blütenkelche. Auf den Tischen Väschen mit roten Anemonen.
Hinter der Kuchentheke stand eine ältere Frau. Streng frisiert, in dunklem Rock und weißer Spitzenschürze, schien sie ebenfalls aus der Zeit gefallen zu sein. Sie nickte freundlich, als Katharina sich nach einem freien Platz umsah.
Das Café war gut besucht. Vorwiegend junge Frauen saßen in Gruppen um die Tischchen und unterhielten sich angeregt. Ihr Alter stand im deutlichen Widerspruch zu der gediegenen Atmosphäre, die das Café ausstrahlte.
Katharina blieb mitten im Lokal stehen. Sie tat so, als sei sie mit jemandem verabredet, den sie unter den Gästen suchte. Die Frauen hatten sie kurz gemustert und sich sofort wieder ihren Gesprächen zugewandt.
Katharina hatte das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Sie verspürte wenig Lust, bei diesen Schnepfen, die ganz ungeniert den Marktwert des Neuankömmlings taxiert hatten, ihr Thema zu recherchieren. Nein, sie würde an einem anderen Tag wiederkommen. Eine Story wird nur dann zu einer guten Geschichte, wenn die eigene Gemütsverfassung stimmt, sagte sie sich. Lieber wollte sie zu Hause auf Ole warten.
Sie war schon auf dem Weg zur Tür, als sie den Mann sah. Sie hatte ihn zunächst nur aus den Augenwinkeln wahrgenommen. Nun bemerkte sie seine einladende Geste. Sie sah sich um, um sicher zu sein, dass sie gemeint war.
Sie war gemeint.
Katharina überlegte. Ein Milchkaffee oder ein Tee konnte nicht schaden. Und wer weiß, vielleicht kam sie doch noch zu einer Story. Unsympathisch sah der Typ auf den ersten Blick jedenfalls nicht aus. Eher ein wenig skurril. Sie sah auf ihre Uhr. Ole steckte sicher noch in seinem weißen Kittel. Warum also nicht? Sie ging die wenigen Schritte bis zu dem Tisch in der hinteren Ecke. Etwas in ihr war neugierig geworden.
»Es ist immer voll um diese Uhrzeit. Setzen Sie sich doch zu mir.« Der Mann lächelte. »Ich beiße nicht.«
Dummer Spruch, dachte sie und zog dennoch einen Stuhl zu sich. Ihre Tasche stellte sie neben sich ans Tischbein.
»Sie sind das erste Mal hier?« Der Mann lüftete kurz seinen Hut.
Ein Mann, der seinen Hut im Café aufbehielt! Diese Marotte kannte sie bisher nur von den Freundinnen ihrer Oma, als sie sich noch regelmäßig in ihrem Lieblingscafé zum Kaffeeklatsch getroffen hatten. Die Damen hätten niemals ihre Hüte abgesetzt oder auf ihre Schals verzichtet. Sie waren Katharina immer wie auf der Durchreise vorgekommen. Aber Männer? Männer behielten im Café ihre Hüte nicht auf. Nicht in diesem Jahrhundert.
»Ich komme jeden Tag her.« Sein Kinn deutete in den Raum.
»Ich war noch nie hier. Und ich frage mich gerade, warum eigentlich nicht.« Sie folgte seinem Blick. »Echt nett.«
»Nicht wahr? Man betritt eine andere Welt, wenn man durch die Tür geht. Als sei man auf einer Zeitreise. Ich mag dieses Gefühl, durch die Zeiten wandern zu können.«
»Sicher.« Sie wusste nicht, was sie noch sagen sollte. Dass sie ihn für ebenso skurril hielt wie das Café?
»Darf ich Ihnen etwas bestellen?« Die Handbewegung des Unbekannten wirkte ein wenig ungelenk.
Sie hob unschlüssig die Hände. »Ich –«
»Bitte seien Sie mein Gast.« Er neigte sich zu ihr. »Sie werden es nicht bereuen. Die Kuchen sind ein Gedicht, und die Stücke so groß, dass manch eine Konditorei glatt zwei daraus machen würde.«
Katharina zögerte immer noch.
»Bitte.« Er rückte seine Tasse ein Stück zur Seite. »Machen Sie mir doch die Freude. Bitte.«
Er hat schmale Hände. Ein Pianist, dachte Katharina und sah ihrem Gegenüber geradewegs in die Augen. Tiefblaue Seen. Um ihre Ufer lagen feine Fältchen.
»Also gut. Ein Milchkaffee wäre schön.«
»Kein Kuchen?«
Sie hob die Schultern und ärgerte sich zugleich über ihre mädchenhafte Schüchternheit.
»Den Apfelkuchen müssen Sie probieren.«
»Eigentlich esse ich nicht so gerne Kuchen.« Sie wusste nicht, warum, doch sie setzte schnell hinzu: »Aber ich mache heute mal eine Ausnahme.«
Die Fältchen um seine Augen wurden tiefer. »Fein.«
Während er die Bestellung aufgab, nutzte Katharina die Gelegenheit, ihren unerwarteten Gastgeber etwas eingehender zu betrachten. Sie tat dies verdeckt, indem sie sich erneut umsah und ihn dabei mit ihrem Blick wie zufällig streifte.
Der Mann war auf jeden Fall jenseits der fünfzig. Sein wahres Alter vermochte sie nicht zu bestimmen. Das lag unter anderem an seinem Dreitagebart, der seine klar geschnittenen Gesichtszüge und die fein geschwungenen Lippen unterstrich. Der Bart verlieh seinem Gesicht etwas Jugendliches. In seinen Mundwinkeln bemerkte sie leichte Spuren von Spott. Aber vielleicht täuschte ihr schneller Blick sie auch. In seinen Augen jedenfalls lag eine Wachsamkeit, die sie in dieser Intensität zuvor noch bei niemand anderem gesehen hatte. Wenn er ihre Augen eine Wimpernschlaglänge festhielt, tauchte sein klarer Blick mühelos tief in ihr Innerstes ein. Etwas, das sie gleichermaßen erstaunte, verlegen und auf unerklärliche Weise unruhig machte.
Der Mann trug einen dunklen Anzug, dazu ein weißes, am Kragen offen stehendes Hemd. Ihr Blick fiel erneut auf seine Hände, die er beim Sprechen sparsam einsetzte. Seine schlanken und doch kräftigen Finger gefielen ihr auf Anhieb.
Musiker. Wissenschaftler. Ihre journalistische Neugier war geweckt. Auch ein aus der Zeit gefallenes Wesen. Ein Forscher, der sich hier seinem Müßiggang hingab. Auf den einen Moment bedacht, da ihn neue Ideen für den Fortgang seiner Studien ansprangen.
Ihr Blick blieb an seinem Hut hängen. Dessen Größe ließ sie an jene Hüte denken, die sie von orthodoxen Juden kannte.
Der Mann bemerkte ihr Stirnrunzeln. Sein Lächeln wurde noch eine Spur spöttischer.
»Sie wundern sich über meinen Hut?«
Katharina fühlte sich ertappt und nickte verlegen. Seine Stimme hatte einen angenehm dunklen Unterton.
»Das ist ein Fedora. Ein, zugegeben, extravagantes Stück. Ein wenig in die Jahre gekommen.« Er legte einen Finger an die Krempe. »Wissen Sie, ich halte es mit dem Hut wie die älteren Frauen früher, wenn sie sich zum Kaffeeklatsch trafen.«
Sie lächelte. Sie war also nicht allein mit ihrer Beobachtung.
»Das mag ein wenig absonderlich aussehen.«
Sie schüttelte vehement den Kopf.
»Danke, bemühen Sie sich nicht.« Seine Augen flogen über ihr Gesicht, als müssten sie dort auf Anhieb alle besonderen Merkmale entdecken. »Darf ich Ihnen das erklären? Meine Marotte hat einen tieferen Sinn. Wissen Sie, es ist eine Reminiszenz an meine Mutter. Sie hatte Hutmacherin gelernt. Sie ist schon lange tot.« Sein Blick wurde eine Spur dunkler. »Was erzähle ich Ihnen da? Das muss Sie langweilen.«
Katharina schüttelte erneut heftig den Kopf. »Keineswegs. Im Gegenteil. Hutmacherin? Das klingt ja sehr interessant.«
Den Typ schickt der Himmel, dachte Katharina. Wer weiß, vielleicht saß ihr in diesem Augenblick genau die Geschichte gegenüber, die Liebig so dringend von ihr erwartete. Das hatte zwar wenig bis gar nichts mit dem Lifestyle der jungen Hühner zu tun, die Liebig im Blick hatte, versprach aber deutlich mehr Unterhaltungswert. Ein Unbekannter mit einem altmodischen Hut in einem Café, das es im Grunde so auch nicht mehr geben durfte. Sie würde gleich nachher mit Liebig sprechen.
»Na ja. Viel weiß ich nicht über meine Mutter. Deshalb der Hut. Ich habe das Gefühl, ihr damit nahe zu sein. Auf meine Art.« Er hob den Kopf. »Ah, da kommt Ihr Gebäck.« Er räumte die Zeitung beiseite, die aufgefächert neben seinem leeren Teller gelegen hatte.
Während Katharina aß, tauschten sie einige höfliche Bemerkungen über den verregneten Sommer aus. Je länger er mit ihr sprach, umso mehr vergaß sie, warum sie das Café ursprünglich betreten hatte. Aber der Zufall hielt eben oft die besten Geschichten bereit. Die alte Journalistenweisheit.
Wenn er den Kopf drehte, um seinen Blick schweifen zu lassen, gab er ihr die Gelegenheit zu weiteren Studien. Sein Profil ist geradezu klassisch schön, dachte sie. Der Unbekannte trug sein Haar im Nacken länger. Seine Locken waren von grauen Strähnen durchzogen. Eine durch und durch italienisch anmutende Erscheinung, stellte sie mit ungewohnter Freude fest. Im Grunde mochte sie das aufgeblasene Gehabe südländischer Machos nämlich nicht.
Aber dieser Mann war anders. Wobei sie dieses Anderssein nicht in Worte fassen konnte. Sie spürte lediglich, dass ihn eine Ruhe umgab, die ihr gefiel. Sie wollte nun unbedingt herausfinden, was sie sonst noch an ihm mochte. Sie war jetzt ganz sicher, sie hatte ihr Thema gefunden.
»Den Hut lege ich in der Tat nur in besonderen Situationen ab. Und zum Schlafen natürlich.« Er lächelte.
Katharina spürte, dass sie rot wurde.
Der Mann neigte sich zu ihr. »Ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt. Moritz. Moritz Grünewald.«
Sie hatte mit allem gerechnet. Maurice vielleicht. Oder Patrick. Irgendetwas Künstlerisches. Aber Moritz? Gut, dann eben Moritz Grünewald.
»Was erstaunt Sie so?«
Er hat ein feines Gespür für Stimmungen, dachte Katharina. Das machte ihn ihr noch sympathischer. Konzentriert zerteilte sie mit der Gabel das letzte Stückchen Kuchen. Dann lächelte sie. »Katharina.«
Er erwiderte ihr Lächeln mit einem Schmunzeln. »Haben Sie auch einen Nachnamen? Oder haben Sie den vergessen?«
»Oh, nein. Natürlich. Ungerechts. Katharina Ungerechts.« Sie streckte ihm über den Tisch hinweg ihre Hand entgegen. »Rheinische Allgemeine. Ich bin Journalistin. Frei.«
Sein Händedruck war angenehm fest. Die Haut fühlte sich warm und trocken an. Die Berührung löste in ihr ein samtiges Gefühl aus, das zu seiner Stimme passte und sich unversehens über ihren Körper ausbreitete. Das Stimmengewirr um sie herum hatte sie längst vergessen.
»Journalistin?« Er musterte sie neugierig. »Auf der Suche nach einer Geschichte? Oder sind Sie zufällig hier?«
Katharina lachte. Sie mochte Menschen, die klar und direkt zur Sache kamen, ohne dabei unverschämt zu wirken. Grünewald hatte zudem das Talent, Gedanken lesen zu können.
»Um ehrlich zu sein, ich bin in der Tat beruflich hier.« Mit ausholender Geste umfasste sie das Café. »Eine Freundin hat mir erzählt, ich könnte hier eine Menge Leute treffen, die mir einen Einblick in den aktuellen Lifestyle geben könnten. Wenn sie denn wollten.« Sie musste an den taxierenden Blick der Frauen von vorhin denken.
»Dazu müssen Sie doch nicht extra in dieses Lokal kommen, um nahe dran zu sein.«
»Ich verstehe Sie nicht.«
»Wenn jemand etwas über Lifestyle weiß, dann doch Sie.«
Grünewald irritierte sie zunehmend. »Wie meinen Sie das?«
Er lächelte, ohne zu antworten.
»Ach so, Sie meinen?« Sie spürte, dass ihre Wangen zu glühen begannen. »Sie machen sich lustig über mich.«
»Auf keinen Fall.«
Er schien tatsächlich amüsiert.
VII.
»Ich gehe da nicht rein.« Leon hockte mit Christopher hinter einem der Büsche, die in Mengen auf dem Gelände standen und an einigen Stellen zu einem undurchdringlichen Dickicht geworden waren. Von ihrer Position aus hatten sie jedoch einen direkten Blick auf den Eingang.
»Wenn du dich nicht traust, Leon, bist du nicht mehr mein Freund.« Christopher kickte mit der Hand einen Kieselstein weg. »Ich war schon dreimal drin.«
»Ja klar, mit deinem Vater.« Leon zog unschlüssig die Nase hoch und wischte mit der Hand über den sandigen Boden.
Schon ein paarmal hatte er mit den Fingern Muster gemalt und anschließend wieder ausgewischt. Er musste nach Hause. Das hatte er seiner Mutter versprochen.
»Nur mal mit dem Fahrrad durchs Dorf fahren. Nicht lange, Mama«, hatte er gebettelt und ihr einen Kuss auf die Wange gegeben, als sie ihn schließlich hatte ziehen lassen.
»Aber um fünf bist du zurück«, hatte sie ihm hinterhergerufen. Doch das hatte er schon nicht mehr gehört. Er hatte Christopher nicht länger warten lassen wollen. Sein bester Freund hatte ihm nämlich ein Geheimnis versprochen.
»Du bist ein Feigling.«
»Bin ich nicht.« Leon zeichnete erneut Kreise in den Sand.
»Dann geh doch rein.« Christopher brach mit provozierend gelangweilter Miene einen Zweig aus dem Strauch, hinter dem sie seit einigen Minuten hockten, und begann, die Rinde mit den Fingernägeln abzuschälen.
»Willst du mein Taschenmesser?« Leon versuchte abzulenken.
»Ich will keinen Feigling zum Freund.«
Leon wischte die Kreise weg. »Ich muss nach Hause.«
»Feigling.« Christopher ließ den nackten Zweig wie eine Peitsche durch die Luft sausen. Beim zweiten Mal zischte der Zweig dicht an Leons Gesicht vorbei.
Leon zuckte zurück. »Was ist denn da drin?«
Christopher benutzte den Zweig nun seinerseits als Pinsel. »Das siehst du dann.«
Was, wenn ich kurz reinginge und dann wieder rauskäme? Christopher würde nicht merken, dass er hinter dem Eingang stehen geblieben wäre. Leon sah zu seinem Fahrrad, das neben Christophers stand. Oder sollte er doch schon zurückfahren?
»Was jetzt?« Christopher bog den Zweig in seinen Händen. »Das wird unser geheimstes Geheimnis sein.«
Der Stock sauste wieder an Leons Kopf vorbei.
Leon schniefte erneut und wischte sich die Hände an seiner Hose ab. »Aber nur ganz kurz.«
Christopher lachte. »Nein. Es ist ganz hinten versteckt.«
»Aber du kommst mit.«
»Feigling.«
Leon spürte die späte Nachmittagssonne in seinem Nacken. Er wollte keine Angst haben. Nicht, wenn Christopher dabei war. Er stand auf. »Na gut. Wenn du unbedingt willst.«
Christopher lachte verächtlich und brach den Zweig in der Mitte durch. »Nun mach schon.«
Leon ging zögernd auf das Gebäude zu. Eine richtige Tür gab es nicht. In der Wand klaffte lediglich eine ausgebrochene Öffnung. Das Gemäuer sah verfallen aus. Die Arbeiter seien schon lange weg, hatte Christopher behauptet. Und dass dort immer ein Feuer gebrannt habe. Aber das sei längst aus.
Kurz vor dem Einstieg drehte Leon sich zu seinem Freund um. Doch der winkte nur verächtlich. Mist. Hätte ich nur eine Lampe dabei, dachte er und streckte die Hand aus. Die Steine fühlten sich warm an. Ob da drin doch noch Feuer ist?
»Feigling. Leon ist ein Feigling«, hörte er hinter sich seinen Freund. Am liebsten wäre er umgekehrt und zu seinem Fahrrad gelaufen. Er hätte schon längst daheim sein sollen.
»Feigling. Leon ist ein Feigling.«
Leon gab sich einen Ruck und tat einen tastenden Schritt in das Innere des seltsamen Hauses.
Sofort war es deutlich kühler als draußen in der Sonne. Er spürte einen leichten Luftzug. Leon tastete sich ein Stück vor. Viel sehen konnte er nicht. Je weiter er in den dunklen Schlauch vordrang und je mehr Ecken und Kurven er folgte, umso dunkler wurde es.
Christophers »Feigling« klang nun deutlich schwächer. Leon drehte sich um, aber er sah den Ausgang nicht mehr.
Tief im Bauch des Gewölbes meinte Leon, ein Geräusch zu hören. Als fielen Steine gegen Steine.
»Hallo?« Er blieb stehen. Sein Nacken war jetzt ganz kalt, und er hatte Gänsehaut auf den Armen. Das sieht ihm ähnlich, dachte er, Christopher steht längst da hinten und spielt mir einen Streich. Seine Gänsehaut wurde immer dicker.
»Christopher? Komm raus.« Leons halb laute Stimme wurde von den Steinwänden aufgesogen.
Nichts.
Er blieb stehen. Er wollte umkehren. Aber er hatte Angst, sich umzudrehen. Er wartete darauf, dass sich eine Hand auf seine Schulter legte.
»Christopher?« Es fehlte nicht mehr viel, und er würde losschreien. Obwohl er nun etwas besser sehen konnte, blieb der Gang dunkel. Es roch hier anders als am Eingang. Irgendwie nach faulen Kartoffeln. So, wie es in der Scheune von Opa immer roch, besonders dann, wenn es geregnet hatte.
Leon horchte angestrengt in die Dunkelheit hinein. Hier musste doch irgendwo der Raum sein, den Christopher meinte. Zu hören war nichts. Oder doch? War da ein Husten? Es raschelte und knisterte. Etwas, das schwer sein musste, bewegte sich.
Hoffentlich sind hier keine Ratten, durchfuhr es Leon. Eine Hand auf seiner Schulter! Er schrie auf und fuhr herum.
»Du Angsthase.«
Christopher! Um ein Haar hätte Leon sich auf ihn gestürzt und ihn verprügelt. Sein Herz raste wie noch nie.
»Hier ist nichts.« Christopher lachte immer noch. Es wurde von den Wänden mehrfach zurückgeworfen. »Komm, lass uns hier verschwinden.« Er versuchte, Leon mit sich zu ziehen. Aber sein Freund rührte sich nicht von der Stelle. »Nun komm schon. Du bist kein Feigling. Ehrenwort.«
Leon schüttelte Christophers Arm ab. »Da hinten ist was.«
Christophers Grinsen wich einem verärgerten Blick. »So ’n Quatsch, alles leer. Das habe ich schon tausendmal gecheckt.«
»Nein. Hör doch.« Leon deutete in den Gang. »Hör doch, da sind Geräusche.«
Nun war es Christopher, der flüsterte. »Unsinn.«
»Doch.«
Christopher stellte sich hinter Leon und horchte nun ebenfalls in die Dunkelheit hinein.
Deutlich war so etwas wie Flattern zu hören. Ganz leise. Kein richtiges Flattern. Was war das?
»Lass uns abhauen.« Christopher straffte sich.
Aber Leon war schon ein paar Schritte weiter den Gang entlanggegangen.
»Leon. Warte.« Christopher kam nun kaum hinterher. Hätte er nur nicht sein Taschenmesser zu Hause vergessen. Saublöd!





























