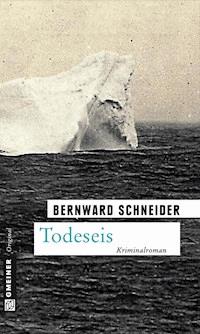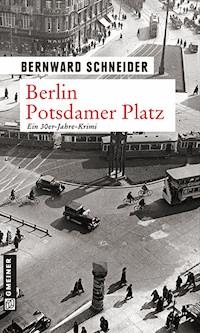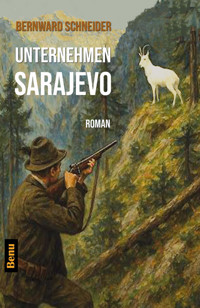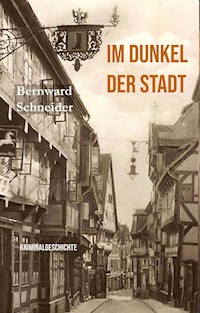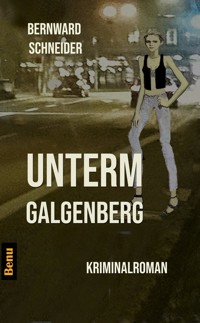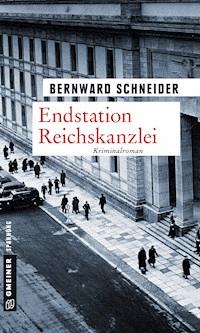
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Eine Gestapoagentin - das ist Greta Jenski, eine ehemalige Tänzerin, die in einem geheimen Berliner Edelbordell als Bardame arbeitet und im Auftrag der Gestapo die Kunden aushorcht. Aber Greta fungiert in Wahrheit als Doppelagentin, die im Auftrag ihres Geliebten Michel Greinz für einen fremden Geheimdienst spioniert. Mitte April 1945 - der „Russe“ steht vor den Toren der Reichshauptstadt - zieht sich auch für sie die Schlinge um den Hals immer enger zu. Ist Selbstmord tatsächlich der einzige Ausweg für Greta?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernward Schneider
Endstation
Reichskanzlei
Kriminalroman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch
die Agentur Erzählperspektive Klaus Gröner.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – ullstein bild
ISBN 978-3-8392-4676-4
1. Kapitel
Greta Jenski wurde das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet wurde. Der Mann in der Ecke machte sie nervös. Nicht die Tatsache, dass er gelegentlich in ihre Richtung schaute, setzte ihr zu. Sie war es gewohnt, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Es war etwas anderes, etwas in seinen Augen, bei dessen Anblick ihr Instinkt Alarm geschlagen hatte. Die Tatsache, dass er sich keine Mühe gab, sein Interesse an ihr zu verbergen, trug weit mehr als alles andere zu ihrer Beunruhigung bei.
Der Mann hatte das Lokal kurz nach ihnen betreten und saß allein an seinem Tisch. Er las den Völkischen Beobachter oder tat wenigstens so. Er hatte einen blassen Teint, blaue Augen, hohe Backenknochen über lang gezogenen Wangen und war in Zivil gekleidet. Sein Alter war schwer zu bestimmen; Anfang vierzig, nahm Greta an. Sie konnte sich nicht erinnern, ihm schon einmal begegnet zu sein. Ein Häscher der Gestapo, der sich auf ihrer Spur befand, dachte sie, und viel Hoffnung, dass sie sich in ihrer Annahme täuschte, hatte sie nicht.
Sie fühlte eine bohrende Angst und tief in ihrem Inneren eine mörderische Wut. Deutschland stand vor dem Untergang, Berlin vor der Einnahme durch feindliche Truppen, aber die Gestapo machte weiter wie in den Zeiten des militärischen Erfolgs. Es war sogar noch schlimmer geworden. Seit Mitte März hingen Dutzende von Hingerichteten an den Bäumen und Laternenmasten der Stadt; harmlose, kriegsmüde Menschen, denen man vorwarf, fahnenflüchtig, feige oder defätistisch zu sein.
Es war ein Fehler gewesen, in das Lokal zu gehen, sagte sie sich. Sie hatte es getan, weil sie befürchtet hatte, Dr. Bewel könnte argwöhnisch werden, wenn sie seine Einladung zurückgewiesen hätte. Dabei war längst keine Zeit für falsche Rücksichtnahme mehr. Ihre Feinde saßen ganz woanders, wie sie nun mit Schrecken erkennen musste.
»Mich wundert, dass es heute noch keinen Alarm gab«, sagte sie zu dem Mann neben ihr am Tisch. »Normalerweise fliegen die amerikanischen Tagesbomber spätestens um die Mittagszeit über der Stadt.«
»Die Bomber ziehen sich allmählich zurück«, erwiderte Bewel leise. »Wenn erst alliierte Truppen in der Stadt sind, wird man uns gar nicht mehr von oben beharken.«
Luftangriffe rund um die Uhr waren in den vergangenen Wochen an der Tagesordnung gewesen. Wenn es hell war, bombardierten die Amerikaner und in der Nacht griffen die Engländer an. Aber Bewel hatte recht. Seit einigen Tagen hatten die Angriffe nachgelassen.
»Wer wird als Erstes an der Stadtgrenze stehen?«, fragte Greta. »Die Amerikaner oder die Russen?«
»Sobald die Russen die Seelower Höhen genommen haben, gibt es kein Hindernis mehr zwischen ihnen und dem Verteidigungsring rund um die Stadt«, gab Bewel zurück. »Der Sturm auf Berlin hat begonnen. Hören Sie es nicht? Das Grollen aus der Ferne? Man hört es schon seit dem Morgengrauen.«
Auch Greta war dieses Grollen schon aufgefallen. Sie hatte sich gefragt, was es wohl war. »Woher wissen Sie, dass es die Russen sind?«
Bewel zuckte mit den Achseln. »Die Leute flüstern es einander auf der Straße zu«, erwiderte er. »Als ich heute Morgen hinausging, machte es bereits die Runde. Ich habe keine Zweifel, dass es stimmt.«
Vor ein paar Wochen schon hatte die Rote Armee die Oder überschritten, den Bewohnern der Stadt war das bekannt. Zwar wurden die Russen erbittert bekämpft, doch die deutschen Verteidigungsstellungen mussten sich beständig weiter westwärts zurückziehen. Es war eine Frage der Zeit, bis die Russen die Stadtgrenzen erreicht hätten. Trotzdem klammerten sich die Berliner an die Hoffnung, dass die Westalliierten die Stadt vor ihnen einnehmen würden. Die Angst in der Bevölkerung, dass es anders käme als erhofft, wuchs von Tag zu Tag, führte aber nicht zu dem Wunsch, die Russen mochten dem Spuk ein schnelles Ende bereiten. Die Furcht vor der Roten Armee war einfach zu groß.
»Optimisten lernen Englisch, Pessimisten Russisch«, sagte Greta. »So hieß es doch! Gilt dieser Satz etwa nicht mehr?«
»Die Pessimisten scheinen recht zu behalten«, erwiderte Bewel knapp. »Es ist wohl sinnlos, darauf zu hoffen, dass die Amerikaner vor den Russen hier sein werden. Man sollte jegliche Hoffnung darauf fahren lassen.«
Wenn das stimmte, war die Information, die sie nach anstrengendem Bettgeflüster von ihm erhalten hatte, kaum noch etwas wert, ging es Greta durch den Sinn, dann hätte sie sich ganz unnötig in Gefahr begeben.
»Wie lange wird das alles noch dauern?«, fragte sie. »Wann ist es endlich vorbei?«
»Niemand kennt die Antwort«, sagte Bewel einsilbig und nippte an seinem Glas mit dem dünnen Wein. »Besser das Ende kommt schnell. Je länger es bis dahin dauert, umso mehr Menschen werden noch sterben.«
Aus den Augenwinkeln sah sie zu dem unheimlichen Mann in der Ecke, der weiter vorgab, in der Zeitung zu lesen. Schnell senkte sie die langen Wimpern, da sie ahnte, dass er ihren Blick spüren würde, wenn sie auch nur einen Augenblick zu lange hinsah. Warum wurde sie das Gefühl nicht los, dass es ihrem Beschatter vollkommen egal war, ob sie ihn durchschaute?
Der Mann war ihnen wahrscheinlich von der Wohnung Dr. Bewels aus gefolgt, sagte sie sich; aber wusste er, wer sie war? Hatte er herausbekommen, welchen Auftrag sie hatte, oder hegte er bloß einen unbestimmten Verdacht? Einige Momente lang überlegte sie, ob Bewel nicht selbst ein Spitzel war, der sie verraten hatte und nun darauf aus war, ihr eine defätistische Äußerung zu entlocken. Es war unwahrscheinlich, dennoch war es besser, vorsichtig zu sein. Außerhalb des Lokals hätte sie ihren Verfolger wahrscheinlich nicht bemerkt, machte Greta sich klar, und so gesehen hatte die Situation auch etwas Gutes. Sie hätte die Gefahr sonst nicht wahrgenommen und wäre zu Tode erschrocken gewesen, wenn die Gestapo plötzlich vor ihrer Tür gestanden hätte.
»Glauben Sie, dass der Krieg verloren ist?«, fragte sie Bewel, indem sie sich um einen ungläubig klingenden Tonfall bemühte. »Was ist denn mit den Wunderwaffen?«
»Sie dürfen nur auf den persönlichen Befehl des Führers eingesetzt werden«, sagte Bewel. »Es sind keine ›Wunderwaffen‹, sondern simple chemische Waffen, die frühestens dann zum Einsatz kommen, wenn der erste feindliche Soldat seinen Fuß über die Stadtgrenze setzt. Es liegt in der Natur dieser Waffen, dass sie auch für die deutsche Bevölkerung sehr gefährlich wären.«
»Ich muss gehen«, sagte sie. »Meine Mutter wartet auf mich.«
Bewel nickte und zahlte bei der Serviererin. »Wo müssen Sie hin?«, fragte er, als sie vor dem Lokal auf der Straße standen. »Vielleicht können wir ein Stück zusammen gehen.«
Auf der Straße war niemand zu sehen, der auf den ersten Blick dafür in Betracht kam, dass er zur Gestapo gehörte. Aber das bedeutete nichts. Gewiss war der Gestapomann nicht ohne Helfer gekommen. Wahrscheinlich würde es nicht der Beschatter aus dem Lokal sein, der sie verfolgen würde, eher ein Kumpan, der draußen geblieben war. Waren sie nicht immer zu zweit oder zu dritt? Was hatte die Gestapo vor? Drohte ihr gar ein Zugriff? Sie musste sich etwas einfallen lassen, um ihren möglichen Verfolgern zu entkommen.
»Zum Anhalter Bahnhof«, sagte sie, und hoffte, dass Bewel einen anderen Weg nehmen musste.
»Schade, dann müssen wir uns trennen«, sagte dieser. »Wann sehen wir uns wieder?«
»Nach dem Krieg um acht«, lächelte sie. »Ich habe ja Ihre Adresse.«
Er machte ein zweifelndes Gesicht. »Wollen wir hoffen, dass es bis dahin nicht zu lange dauert«, gab er zurück und fasste sie am Arm. »Wenn es doch länger dauern sollte, Hilde, melde ich mich bei Ihnen.«
Hilde war ihr Tarnname, und sie benutzte ihn in letzter Zeit immer öfter. Natürlich hatte sie nicht vor, Bewel wiederzusehen. Die Tarnung war wichtig, diente aber weniger zu ihrem als zu seinem Schutz. Auch die Sache mit ihrer Mutter war ein Teil dieser Tarnung. In Wahrheit war ihre Mutter seit dem dritten Februar tot. Sie war einer von mehreren tausend Menschen gewesen, die bei dem verheerenden Bombenangriff jenes schrecklichen Tages ihr Leben gelassen hatten. Wenn man Bewel vernehmen sollte, würde er sich erinnern, dass sie von ihrer Mutter gesprochen hatte.
Bei dem Gedanken an den Tod der Mutter musste Greta die aufsteigenden Tränen niederkämpfen. Es war grauenhaft gewesen, fast noch schlimmer als die Nachricht von Rolfs Tod. Die Tage danach hatte sie wie betäubt erlebt. Die Leiche ihrer Mutter war vollständig verbrannt, sodass sie keinen Abschied von ihr hatte nehmen können, und das hatte sie am meisten geschmerzt.
»Na klar, dann melden Sie sich einfach«, sagte sie zu Bewel und setzte ein kokettes Lächeln auf.
Falls die Gestapo ihn besuchte, würde er schnell erkennen, dass es ein einmaliges Abenteuer gewesen war, das er mit ihr erlebt hatte. Er würde es schon verstehen und schnell merken, dass sein kleines Abenteuer stattgefunden hatte, weil sie auf bestimmte Informationen von ihm scharf gewesen war. Blieb zu hoffen, dass er kein Dummkopf oder Angsthase war, der sich zu schnell in die Enge treiben ließ. Wenn er darauf beharrte, dass er keinen Geheimnisverrat begangen hatte, konnte ihm eigentlich nichts passieren.
Sie ließ es sich gefallen, dass Bewel sie umarmte, dann wandte sie sich um und eilte davon.
Berlin war von Ruß geschwärzt, die Straßen durch Tausende von Kratern entstellt. Ausgebrannte fensterlose Häuser starrten in den Himmel. Ganze Wohn- und Geschäftshäuser waren verschwunden. Wo einst breite Straßen und Alleen gewesen waren, schlängelten sich jetzt Trampelpfade durch die Trümmerberge und das bizarre Gewirr verbogener Eisenträger. Viele Fenster waren mit Brettern vernagelt und auf eine Hauswand war eine Durchhalteparole gepinselt: »Unsere Mauern brechen, aber unsere Herzen nicht!«
Es waren nicht nur die Straßen und Häuser. Seitdem Berlin zur Festung erklärt worden war, befand sich die Stadt in einer Art Hysterie. Von Flüchtlingen wurden furchtbare Geschichten über das Schicksal von Deutschen erzählt, die in die Hände der Roten Armee gefallen waren. Ganze ostpreußische Familien waren massakriert worden und Frauen, ob alt oder jung, systematisch vergewaltigt worden. Viele Frauen, die den Soldaten nicht lebendig in die Hände fallen wollten, begingen Selbstmord. Diejenigen, die keine Pistole oder Gift zur Verfügung hatten, erhängten ihre Kinder und sich selbst an den Dachbalken ihrer Häuser. Die von dem Propagandaminister Goebbels ausgegebene Durchhalteparole »Wir werden siegen, weil wir siegen müssen!« hatte eine schreckliche Bedeutung bekommen, und so sehr sich viele Menschen von solchen Parolen abgestoßen fühlten, stießen sie nicht mehr nur auf taube Ohren. Der Führer ließ nichts mehr von sich hören. Er hatte schon lange keine Reden mehr gehalten. Er hielt sich in Berlin auf, so viel war bekannt.
Greta war noch keine fünf Minuten unterwegs, als die Sirenen zu heulen begannen, und zum ersten Mal registrierte sie den Alarm mit einem Gefühl der Erleichterung. Die Bomben gaben ihr die Chance, zu entkommen und ihren Gegnern ein Schnippchen zu schlagen. Vor den Bomben davon zu laufen, war schließlich erlaubt, und sie war eine ausgezeichnete Sportlerin.
Sie lief sofort los. Ihre Verfolger sollten denken, dass sie den Luftschutzkeller am Anhalter Bahnhof erreichen wollte. In Wahrheit würde sie nicht im Bunker, sondern im Bahnhofsgebäude verschwinden.
Die Straßen waren kaum noch zu passieren, die Räumdienste kamen nicht mehr gegen die Masse an Schutt und Geröll an. Die Taktik der Luftangriffe hatte sich verändert. Täglich wurden nun ein oder mehrere Angriffe neuer und besonders rascher Flugzeuge geflogen, in einer Höhe, die außerhalb der Reichweite der Flak lag. Jedes konnte eine riesige Menge an Bomben tragen. Es starben weniger Menschen, doch der Tod lauerte überall und konnte einen an jeder Straßenecke und zu jeder Tages- und Nachtstunde ereilen.
Es gab noch andere Passanten, die in Richtung Anhalter Bahnhof eilten. Einige Leute hoben die Fäuste zum Himmel, als wollten sie nicht nur den Fliegern drohen, sondern auch gleich dem lieben Gott.
Es nutzte ihnen nichts und Greta hatte nur ein müdes Lächeln für sie übrig. Sie sprang über die Trümmer und umkurvte die Menschen und andere Hindernisse auf ihrem Weg. Kein einziges Mal sah sie sich um, und sie zwang sich, nicht einmal an mögliche Verfolger zu denken, solange sie durch die Straßen lief.
Der Bahnhof kam in Sicht, oder richtiger gesagt, das Gebäudeskelett, das noch von ihm übrig geblieben war. Der Bunker befand sich direkt neben dem Bahnhof. Er war ein kantiger Würfel, ein gewaltiger Betonklotz zwischen den verzweigten Gleisen, der die Dächer der Nachbarhäuser und Ruinen überragte. Er bestand aus Eisenbeton und verfügte über mehr als vier Meter dicke Mauern sowie mehrere Stockwerke, von denen drei über und zwei unter der Erde lagen. Er war einer der größten Luftschutzräume in Berlin und schien äußerst sicher. Keine Bombe oder Granate hatten ihm bisher etwas anhaben können.
Ein weiterer Vorteil des Anhalter Bunkers war die direkte Verbindung zur S-Bahn. Der Bunker war durch das unterirdische Schienennetz auch von anderen Bahnhöfen aus zu erreichen und durch mehrere Gänge mit dem Bahnhof verbunden. Diesen Vorteil wollte Greta nutzen, um mögliche Verfolger zu täuschen.
Sie verschwand in dem Gebäude, und dort bewegte sie sich so behände wie geschwind. Sie lief an den Gleisen entlang und dann auf der anderen Seite des Bahnhofs wieder auf die Straße hinaus.
Eine Explosion ließ die Erde erbeben. In der Ferne brannten Häuser und Rauch kräuselte sich bis in den Himmel. Es wurde höchste Zeit, dass sie sich in Sicherheit brachte. Sie blickte sich um, sah einen Kellereingang, der zu einem Mietshaus gehörte, und lief darauf zu.
»Na, kommen Se«, sagte ein alter Mann am Eingang. »Für so ’ne Hübsche wie dich haben wir immer noch ’n Plätzchen.«
Schon hörte sie eine weitere Detonation in der Nähe. Ein Luftstoß trieb eine ganze Wolke von Staub, Kieselsteinen und zermahlenem Glas zu ihnen herüber. Sie kamen gerade rechtzeitig nach unten. Kurz darauf fand Greta sich in einem wilden Durcheinander von Koffern, Regenschirmen und staubbedeckten Gesichtern, japsenden Schoßhündchen und weinenden Kindern wieder.
Der Angriff dauerte eine halbe Stunde, dann entfernten sich die Einschläge. Wie immer, wenn die Sirenen über der verwüsteten Stadt Entwarnung heulten, löste sich die Spannung in nervösem Gelächter, und die Leute fingen wieder an, miteinander zu sprechen.
Greta dankte dem alten Luftschutzwart für seine Hilfe und machte sich auf den Weg zur S-Bahn-Station.
Feiner Regen aus Ruß und Asche bedeckte die Mauern und Ruinen. Fensterlose Häuser starrten auf Trümmerberge herab. Die Bäume an der Straße waren kahl, die Knospen an den Zweigen verdorrt. In den Gebäuden dahinter, in denen noch Menschen wohnten, waren viele Fenster mit Brettern vernagelt oder mit Pappen abgedichtet.
Der Bahnsteig der S-Bahn war voller Menschen. Ein Wunder, dass die Züge überhaupt noch fuhren. Doch die meisten Rädchen, die die Metropole am Leben hielten, drehten sich noch, sodass die Stadt im Großen und Ganzen immer noch funktionierte. Die Leute gingen zur Arbeit, Polizisten und Briefträger taten nach wie vor ihren Dienst. Jeden Morgen öffneten die Kaufhäuser und boten die Berliner Blumenfrauen ihre Sträuße an. U-Bahnen und S-Bahnen waren in Betrieb. Einige Kinos und Theater hatten noch geöffnet und die Berliner Philharmonie gab heute Nachmittag sogar ein Konzert.
Die Züge fuhren unregelmäßig, aber Greta hatte Glück und musste nicht lange warten, bis die Bahn in die Station gerollt kam. Alle auf dem Bahnsteig drängten hinein. Greta hasste volle Züge, doch es blieb ihr nichts anderes übrig. Sie käme sonst zu spät und würde ihre Verabredung mit Michel verpassen. Zu Fuß bis zu ihrer Wohnung würde es viel zu lange dauern.
Die Fahrgäste standen dicht gedrängt. Viele der Menschen wirkten müde und erschöpft, blass und abgespannt von den ständigen Alarmen, und in den Gesichtern standen Verzweiflung und Angst geschrieben. Einige Leute waren erregt und wütend. Flüche und Sprüche im Waggon.
»Im Häuserkampf sind die Verteidiger dem Angreifer immer überlegen«, sagte ein Mann. »Das wird durch die Militärgeschichte aller Zeiten eindrucksvoll belegt.«
»So weit wird es nicht kommen«, sagte ein anderer. »In unterirdischen Werkstätten sind superschnelle Flugzeuge im Bau, die keine Propeller benötigen. Ihre Explosionen lassen ganze Geschwader in der Luft auseinanderplatzen, die Feinde werden buchstäblich zerstäubt. Der Führer berechnet noch den Zeitpunkt, der für ihren Einsatz am effektivsten ist.«
»Hoffentlich verrechnet er sich nicht«, kam von irgendwo ein zynisch klingender Kommentar. »Langsam muss er sich beeilen, dass er mit seinen Rechenaufgaben fertig wird.«
»In Kürze wird eine Flotte von modernen Unterseeboten in Dienst gestellt«, sagte eine junge Frau. »Sie verfügen über stratosphärische Geschosse, mit denen New York in Grund und Boden geschossen werden kann.«
»Soll Gröfaz doch endlich seine Wunderwaffe aus dem Keller holen«, drang es dunkel an ihr Ohr. »Soll er sie hochjagen, dann ist das hier endlich alles vorbei.«
Es war so ein Augenblick, wo ein Wort das andere gab, wo sich lange Angestautes Bahn brechen und unbedachte Bemerkungen fallen konnten, die einem leicht zum Verhängnis wurden. Greta vermied es tunlichst, sich an solchen Unterhaltungen zu beteiligen.
»Das Leben ist wie ein Kinderhemd«, sagte jemand. »Kurz und beschissen.«
Einige Leute lachten.
»Ruhe!«, rief plötzlich jemand inmitten des Lärms.
Greta drehte sich um und erblickte nahe der Tür einen schon älteren Soldaten mit zwei eisernen Kreuzen am Revers. An den Ärmel seiner Jacke war ein Abzeichen genäht, das mehrere Panzer zeigte. Greta erinnerte sich, einmal gehört zu haben, dass solche Panzerabzeichen bedeuteten, dass er die Anzahl der gezeigten Panzer aus nächster Nähe vernichtet hatte.
»Hört mit dem dummen Gerede auf«, fuhr der Frontsoldat fort und brachte mit seiner energischen Stimme die Unruhe im Waggon zum Schweigen. »Ob ihr es glauben wollt oder nicht: Wir müssen diesen Krieg gewinnen, so schwer es werden wird! Wenn die anderen siegen und uns einen Bruchteil dessen antun, was wir in den besetzten Gebieten angerichtet haben, dann wird in ein paar Wochen kein einziger Deutscher mehr am Leben sein!« Seine Stimme senkte sich. »Wir an der Front kämpfen nicht mehr für den Führer oder das Dritte Reich! Wir kämpfen nicht für unsere Bräute, Mütter oder Familien, sondern wir kämpfen für uns selbst. Um nicht in Löchern voller Dreck und Schlamm wie Ratten zu verrecken!«
Im Wagen wurde es still. Niemand sagte mehr etwas. Man hätte eine Stecknadel fallen gehört.
2. Kapitel
Als Greta ihre kleine Wohnung in der Giesebrechtstraße erreichte, war es fast vier. Sie war sich sicher, dass niemand ihr gefolgt war, aber das Gefühl, sich in Gefahr zu befinden, hatte nichts von seiner Bedrohlichkeit eingebüßt. Vor heimlichen Beobachtern, die von ihr wussten, war sie zu Hause nicht geschützt. Es war eine neue, unsichtbare Gefahr, der sie sich gegenübersah; eine Gefahr, die alles andere, mit dem man in diesen furchtbaren Tagen zu kämpfen hatte, noch schlimmer machte; die Gefahr einer konkreten, auf sie selbst und auf Michel zielenden Bedrohung.
Es war Zeit, sich für das Konzert fertig zu machen, zu dem Michel sie an diesem Nachmittag mitnehmen wollte. Sie durchstöberte ihren Kleiderschrank. Es war ein milder Frühlingstag und sie entschied sich für ein kniefreies und ärmelloses Kleid, das ihre schönen langen Arme und Beine gut zur Geltung brachte. Für die Philharmonie war es vielleicht eine Spur zu freizügig, aber sie liebte es, sich aufreizend zu kleiden, und bei ihrem Gliederbau konnte sie es sich leisten, bis an die Grenzen des Schicklichen zu gehen. Wer wusste, ob es nicht die letzte Gelegenheit war, sich in einem der Kleider, die sie so liebte, in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Sie lauschte nach draußen. Das Grollen in der Ferne hatte nicht nachgelassen. Dr. Bewel hatte recht. Die Front im Osten zerfiel. Die Rote Armee stand vor den Toren Berlins. Es hatte begonnen. Das Ende rückte unaufhaltsam näher. Deutschland würde in Schutt und Asche versinken, und um Berlin, ihre Heimatstadt, stand es besonders schlimm. Die Führung verlangte von den Einwohnern, bis zum letzten Blutstropfen gegen die Rote Armee zu kämpfen, und es deutete nichts darauf hin, dass den Berlinern dieser Kampf erspart bleiben könnte. Die Hauptstadt des Deutschen Reiches trieb auf eine infernalische Katastrophe zu.
Um Viertel nach vier klopfte es an die Tür. Michel! Sie war jedes Mal erleichtert, wenn er kam. So wie die Verhältnisse nun einmal waren, lebte sie in der beständigen Furcht, dass etwas Schreckliches ihn daran hindern könnte, seine Verabredungen mit ihr einzuhalten. In Tagen wie diesen war nichts mehr sicher, und nach ihrem heutigen Erlebnis in dem Lokal war ihre Angst besonders groß.
Michels Gesicht leuchtete auf, als er sie sah. Er trug seine schwarze SS-Uniform, die ihm so ausgezeichnet stand. Er war ein attraktiver Mann.
»Du bist für mich der schönste Lichtblick in dieser furchtbaren Welt«, sagte er und nahm sie fest in den Arm. »Und fast der einzige.«
»Fast?«, fragte sie mit einem bezaubernden Lächeln. »Bist du mir untreu gewesen?«
Michel und sie hatten sich mehrere Tage nicht gesehen und küssten einander mit Leidenschaft. Am liebsten hätte Greta auf der Stelle mit ihm geschlafen, doch vor dem Konzert war dafür nicht mehr genug Zeit.
»Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen«, sagte Michel und drückte sie ganz fest. »Du kannst mir vertrauen.«
Michel war seit dem vergangen Herbst ihr Geliebter. Er war Hauptsturmführer und Offizier der Waffen-SS, hatte ein juristisches Examen abgeschlossen und war in der Abwehr des Reichssicherheitshauptamtes tätig. Er verkehrte nicht nur privat, sondern auch dienstlich in Nellies Salon, dem Etablissement, in dem sie seit dem August des vergangenen Jahres arbeitete und sie sich zum ersten Mal begegnet waren.
Er war ein schöner Mann, den auch andere Frauen begehrten. Berlin wimmelte von attraktiven Frauen, die Männer hingegen waren rar.
»Mit ist etwas Komisches passiert, Michel«, sagte sie, »ich glaube, die Gestapo beobachtet mich.« Sie erzählte Michel von ihrem Erlebnis in dem Lokal.
»Bist du sicher, dass du dich nicht täuschst?«, fragte Michel zurück. Sein Gesicht war ganz ruhig geblieben.
»Ich wünsche mir sehr, dass ich mich grundlos sorge«, antwortete sie. »Aber ich habe ein ungutes Gefühl.«
Sie sprachen in der Wohnung stets leise miteinander, als rechneten sie damit, die Wände könnten Ohren haben. Die Sorge war berechtigt. Böswillige Nachbarn, die andere denunzierten, waren über die ganze Stadt verteilt.
»Und bei Nellie hast du diesen Mann noch nicht gesehen?«, fragte Michel.
»Nein, er war mir ganz unbekannt.«
Michel rieb sich die Stirn. »Du musst dich irren, Greta. Wir sind alle mit unseren Nerven ziemlich am Ende.«
Sie schaute ihn mit hochgezogenen Brauen an. Obwohl sie wusste, dass Michel kein Mann war, der bei Gefahr in Panik verfiel, sondern überstürzte Handlungen tunlichst vermied, hatte sie mit einer anderen Reaktion gerechnet, und sich sogar vorgestellt, dass er ihr vorschlagen könnte, sich irgendwo zu verstecken.
»Ich möchte es ja gern glauben«, sagte sie. »Doch ich denke nicht, dass ich mein Erlebnis auf die leichte Schulter nehmen kann.«
»Warum sollte man dich beobachten, Greta?«, sagte Michel. »Du bist de facto eine Gestapoagentin und weißt nichts davon, was ich mit den Informationen mache, die ich von dir erhalte. Du gehst davon aus, dass du die Informationen für meine Abwehrabteilung beschaffst.«
»Wird man mir glauben, dass ich von deiner heimlichen Tätigkeit für den Feind nichts weiß?«
Er lächelte. »Eine Organisation wie die Gestapo wird es nicht verwundern, wenn ein Agentenführer seinen Mitarbeitern nicht anvertraut, wem er die erhaltenen Informationen weitergibt.«
»Du bist mein Geliebter!«
»Das ändert nichts.«
Sie fühlte sich etwas besser. Michels Ruhe und Besonnenheit gaben ihr Kraft. »Nun gut«, erwiderte sie, »vielleicht hast du ja recht. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ich mich täusche.«
Sie lösten sich voneinander.
»Wie schätzt du diesen Dr. Bewel ein?«, fragte Michel.
»Es macht mir Sorgen, wenn ich an ihn denke. Er bräuchte nur den Mund zu halten, falls man ihn vernimmt; ich konnte ihm natürlich nicht sagen, wie er sich verhalten soll. Er weiß nicht, wer ich bin.«
»Was hast du von ihm erfahren?«
»Er hat mir erzählt, dass das Uran samt Gerätschaften nach Haigerloch in den Schwarzwald gebracht worden ist. Auch die wichtigsten Mitarbeiter haben sich dorthin abgesetzt.«
Michel nickte, er schien zufrieden. »Das ist eine sehr gute Nachricht«, sagte er.
Wie sie wusste, hatte er bereits vermutet, dass das Uranforschungslabor geräumt worden war und dessen wichtigste Mitarbeiter Berlin verlassen hatten. Der Hinweis auf das russische Interesse an dem Institut stammte von der Abwehr, aber da er selbst dort keine weiteren Informationen hatte in Erfahrung bringen können, hatte er Greta auf den Institutsmitarbeiter Bewel angesetzt, um seinen Auftraggebern sichere Angaben darüber machen zu können, was mit dem Uran und den Mitarbeitern des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik geschehen war.
»Es hätte eine gute Nachricht sein können«, entgegnete Greta. »Doch die Information kommt wohl zu spät. Wie ich hörte, stehen die Russen schon vor den Seelower Höhen. Glaubst du etwa, Stalin wird seine Truppen stoppen, weil das Uran weg ist?«
»Ich werde die Information auf jeden Fall weitergeben«, erwiderte Michel. »Ein paar Dinge sind nun klar. Wenn die Amerikaner es wollen, können sie binnen 48 Stunden in der Stadt sein. Sie stehen an der Elbe, kaum 80 Kilometer entfernt. Wenn die Russen nur ein wenig in ihrem Bemühen nachlassen, als Erste Berlin einzunehmen, sind die Amerikaner vor ihnen da. Nach Westen hin existiert kaum noch eine nennenswerte Verteidigung.«
Nach Michels Ansicht war das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik der Hauptgrund dafür, weshalb Stalin Berlin durch seine Armee einnehmen lassen wollte, was er seinen westlichen Verbündeten natürlich verschwiegen hatte. Stalin wollte eine Uranbombe bauen, an der die Westalliierten bereits bastelten, doch besaß er in seinem großen Reich kein Uran oder hatte dort noch keines gefunden.
»Gibt es nicht die Möglichkeit, die Amerikaner über Stalins Anliegen zu informieren?«, fragte Greta. »Wenn sie erfahren, dass Stalin auf das Uran des Instituts scharf ist, werden sie ihm nicht gestatten, die Stadt einzunehmen. Dass das Zeug weg ist, braucht man sie ja nicht wissen zu lassen.«
»Ich habe keine Verbindung zu den Westalliierten«, sagte Michel. »Sie wäre äußerst schwierig herzustellen, wenn überhaupt. Die Überzeugungsarbeit, die notwendig wäre, um ihnen klar zu machen, worum es Stalin geht, kann ich nicht leisten. Nein, die Russen sollen erfahren, dass Stalins Plan, mehrere Tonnen Uraniumoxyd und alles Gerät und Material des Uranforschungslabors in seinen Besitz zu bringen, gescheitert ist. Dort kann die Information hilfreiche Wirkungen entfalten.«
Durch einen Spalt im Fenster sah sie nach draußen. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Es tat fast weh, mitansehen zu müssen, wie die Natur inmitten des Schreckens, der die Stadt beherrschte, erblühte, als wäre überhaupt nichts Ungewöhnliches geschehen.
»Hoffentlich war nicht alles umsonst«, seufzte sie. »Wann werden die Russen an der Stadtgrenze stehen, einmal angenommen, dass es so weiter geht wie jetzt?«
»In ein paar Tagen«, antwortete Michel, ohne zu zögern.
»Und wie lange wird Berlin sich dann noch verteidigen können?«
»Kaum länger als eine Woche, höchstens zwei.«
»Ich habe genug«, sagte sie. Es kam ihr alles plötzlich so sinnlos vor. »Von allem! Von dem Krieg, von der Spioniererei, von den Männern in Nellies Bordell! Ich habe die Schnauze voll. Ich mache nicht mehr mit! Am liebsten würde ich aus Berlin fliehen.«
Michel nahm sie in die Arme. »Man darf nicht aufgeben«, sagte er beruhigend. »Manchmal erscheint alles vergeblich und dabei ist man in Wahrheit schon kurz vor dem Ziel.« Er drückte sie ganz fest, sodass sie angenehm erbebte. »Habe ich nicht immer recht behalten, Liebes?«
Greta wurde nachdenklich. »Na ja, niemand ist unfehlbar«, sagte sie leicht dahin.
»Wenn man aufgibt, hat man schon verloren«, sagte Michel, »dann handelt man nicht mehr, sondern wird behandelt.«
Sein Gesicht war ihrem ganz nahe und sie spürte seinen Atem auf ihrer Haut. »Ich habe diese Stadt geliebt«, sagte sie, »ich liebe sie noch, es ist meine Heimatstadt, ich bin hier geboren, ich habe hier viel Schönes, aber auch viel Schreckliches erlebt. All das sind Gründe, die mich hier festhalten könnten; doch all diese Gründe zählen nicht mehr! Ich will fort! Ich will in den Westen!«
»Wer sagt denn, dass es dort besser ist?«
»Was von den Berlinern erwartet wird, ist doch klar. Sie sollen bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Wenn ich das täte, würde ich mich aufgeben und am Ende verlieren. Es ist so, wie du es sagst! Ich will deshalb in den Westen, weil ich mich nicht aufgeben will! Auf der anderen Seite der Elbe muss ich nicht bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.«
»Denkst du ernstlich an Flucht?«
»Erst seit heute. Ich hatte immer noch Hoffnung, dass die Amerikaner vor den Russen ankämen. Doch inzwischen überwiegen meine Zweifel.«
»Noch ist nichts verloren! Du schätzt die Lage falsch ein!«
Greta fand es verwunderlich, wie gelassen Michel alles nahm. Ob nicht doch sie selbst es war, die sich irrte, weil sie unter all der Belastung, der sie ausgesetzt war, die Welt um sie herum falsch wahrzunehmen begann? War Berlin vielleicht doch noch nicht verloren?
Sie dachte wieder an den Mann in dem Lokal. Sah sie wirklich schon Gespenster? »Irgendwie schaffst du es immer, mich milde zu stimmen«, gab sie zurück. »Ich will keine übereilten Entschlüsse fassen.« Sie löste sich aus seiner Umarmung. »Wir müssen aufbrechen, wenn wir das Konzert nicht verpassen wollen«, sagte sie. »Ich habe mich extra fein gemacht.«
»Einverstanden.« Er lächelte charmant. »Es wäre wirklich schade, wenn die Leute dich nicht in deinem reizenden Kleid sehen könnten. Eine schöne Frau wie dich an meiner Seite zu haben, macht mich ganz stolz.«
Michel besaß einfach den besseren Überblick über die Vorgänge, die sich um sie herum ereigneten, sagte sie sich. Seine Nähe und seine Zuversicht taten ihr gut. Sie trat zum Schrank, nahm ihren Mantel und zog ihn über ihr Kleid, dann verließen sie die Wohnung.
Michels Horch war auf der Straße geparkt. In der Ferne hörte man das Grollen der Geschütze. Alles war frühlingshaft hell und mild. Inmitten der Ruinen hatte es zu blühen begonnen; sie hörten sogar die Vögel zwitschern.
Geschickt kurvte Michel den Wagen um die Trümmerberge herum. Kilometerweit passierten sie unzählige Ruinen und rauchgeschwärzte Häuser.
»Wie weit ist die Front noch entfernt?«, wollte Greta wissen.
»Mehr als 50 Kilometer«, gab Michel zur Antwort.
Auf den Straßen waren Menschen unterwegs, die von der Arbeit kamen. Das Leben in der Stadt ging auf eine gespenstisch anmutende Weise seinen normalen Gang.
»Reymann, der für die Verteidigung von Berlin zuständig ist, hat im Gespräch mit dem Führer im Bunker darauf hingewiesen, dass unter den dreieinhalb Millionen Einwohnern, die Berlin noch hat, 120.000 Säuglinge sind«, erzählte ihr Michel. »Hitler hat ihn fassungslos angestarrt und behauptet, es seien keine Säuglinge mehr in Berlin, worauf Goebbels, der mit Reymann einer Meinung war, meinte, es seien große Vorräte von Kondensmilch in der Stadt, und wenn Berlin eingeschlossen werde, könne man die Kühe ins Zentrum bringen. Worauf Reymann fragte, womit er denn die Kühe füttern solle.« Michel lachte. »Darauf hat Goebbels nichts mehr gesagt.«
Greta lachte. »Denen da unten im Bunker scheint allmählich der Bezug zur Realität abhanden zu kommen.«
Der Beethovensaal in der Köthener Straße war voll. Trotz allgemeiner Stromsperre brannten an den Wänden ein paar glanzvolle Lichter. Es gab eine Garderobe, doch die meisten Leute behielten ihre Mäntel an. Wenn es Bombenalarm gab, wollte man nicht noch nach seinen Sachen anstehen müssen. Greta zog ihren Mantel trotzdem aus und gab ihn an der Garderobe ab. Mit Alarm war ohnehin kaum zu rechnen. In der Regel blieb es am späten Nachmittag ruhig.
Es machte Greta nichts aus, dass sie in ihrer luftigen Schönheit sofort Aufsehen erregte. Im Gegenteil, die bewundernden Blicke taten ihr gut. Sie fühlte sich wundervoll, mehr bei sich selbst, obwohl sie ein wenig fror. Sie wusste, dass sie wie ein Wesen aus einer anderen Zeit wirkte, aber genau das wollte sie mit ihrem Auftritt erreichen. Es war ihr recht, dass ihre Erscheinung dazu beitrug, dass sich viele der anwesenden Offiziere in eine andere Welt versetzt fühlten und an ein Leben außerhalb von Krieg und Zerstörung dachten.
Der Dirigent Robert Heger leitete das Konzert der Philharmoniker und Michel erläuterte ihr das Programm. Es gab Auszüge aus der ›Götterdämmerung‹ von Wagner, Sinfonien von Beethoven und Bruckner. Gespielt wurde die ›Egmont-Ouvertüre‹, von Brahms das Doppelkonzert für Violine und Violoncello und von Strauss ›Tod und Verklärung‹.
Die Zuhörer lauschten schweigend und waren tief beeindruckt. Greta erging es nicht anders. Für den Augenblick vergaß sie ihr Erlebnis mit dem Gestapomann. Es gab Momente im Konzert, da hätte man wirklich glauben können, nicht mitten im Krieg zu sein.
Frieden! Oh, wie sehr sehnte sie sich danach! Würde es jemals wieder Frieden geben? Manchmal konnte sie nicht daran glauben. Überall lauerte der Tod, an jeder Ecke und zu jeder Zeit, in solchen Augenblicken war ihr, als könnte sich all das erst ändern, wenn Berlin vollständig von der Weltkarte verschwunden war. So wie Pompeji oder das alte Rom.
»Siehst du eine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen?«, fragte Greta ihren Geliebten, als sie nach dem Konzert zurück zu ihrer Wohnung fuhren.
»Ich kann nicht fort«, sagte Michel. »Das wäre Fahnenflucht. Wer hinaus will, braucht einen Passierschein. Du könntest natürlich versuchen, einen zu bekommen. Wo willst du hin?«
»Ist doch egal! Ich werde schon etwas finden.« Sie seufzte. »Ach, ich weiß es nicht. Es ist so ein Gedanke, der mir in den letzten Tagen immer wieder kommt. Ich glaube, alle Berliner Frauen haben ihn. Man wird ja an jeder Straßenecke darauf hingewiesen, was die russischen Soldaten mit einem anstellen werden, sollten sie die Stadt einnehmen.«
»Das mit den Russen wird übertrieben«, entgegnete Michel. »Die westalliierten Soldaten sind keine besseren Menschen als die Soldaten der Roten Armee.«
»Die russischen Soldaten haben aber andere Erfahrungen mit den Deutschen gemacht als zum Beispiel die Amerikaner, in deren Land niemand einmarschiert ist. Ich brauche dir das nicht zu erzählen. Du bist selbst im Osten gewesen.«
Michels Miene verfinsterte sich. Greta wusste, dass er über seine Erlebnisse an der russischen Front nicht gerne sprach. Er war nicht ständig in der Verwaltung tätig gewesen, sondern in den vergangenen Jahren immer wieder einmal an die Front abkommandiert worden. Er war überzeugt gewesen, für eine bessere Sache zu kämpfen, als er gegen Stalin ins Feld gezogen war. Doch seine Erlebnisse hatten ihm den Glauben daran genommen, dass er für die Rettung des Abendlandes kämpfte. Gelegentlich hatte sie versucht, Näheres von ihm zu erfahren, aber er hatte stets ausweichend reagiert.
Die restliche Fahrt schwiegen sie, und als Michel den Wagen in der Giesebrechtstraße zwischen den Trümmern am Straßenrand parkte, war es dämmerig geworden. Die Eindrücke des Konzerts, das Gretas Stimmung für eine Weile erhellt hatte, waren schon wieder verblasst. Unruhe und Sorge meldeten sich zurück.
»Woher kann die Gestapo, dieser Kerl von mir wissen?«, fragte Greta ihren Geliebten, bevor sie aus dem Wagen stiegen. »Weshalb beobachtet er mich?«
»Der Mann in dem Lokal?« Michel blickte nachdenklich durch die Windschutzscheibe. Die Straße vor ihm lag im Schatten der Häuserzeilen. »Er kann von dir nicht mehr wissen, als dass du ein Gestapomädchen bist. Du musst dich irren! Er hat dich nicht beobachtet! Ich dachte, das Thema sei erledigt!«
»Kannst du dich auf deine Leute verlassen?«
»Was für Leute?«
»Die Russen! Die Leute in Moskau!«
Michel antwortete nicht. Sie kletterten aus dem Wagen, traten ins Haus und stiegen schweigend die Treppen hinauf.
»Leider kann ich nicht über Nacht bleiben«, sagte Michel, als Greta die Tür hinter ihm geschlossen hatte. »Ich werde im Amt benötigt.«
Greta seufzte. »Wofür denn noch? Es ist ja doch alles vergeblich.«
»Die Stadt muss verteidigt werden. Es gibt mehr zu tun denn je! Aber ein oder zwei Stunden Zeit haben wir noch.«
Greta atmete auf. »Gott sei Dank. Wenigstens reicht die Zeit noch ein wenig für uns.«
»Hast du noch Kontakt zu Fegelein?«, fragte Michel.
»Wahrscheinlich sehe ich ihn am Mittwoch bei Nellie«, gab Greta zurück. »So war es jedenfalls geplant. Sicher ist es nicht.«
»Fegelein gehört zur engsten Umgebung des Führers. Es ist wichtig für uns zu wissen, was in der Reichskanzlei vor sich geht. Der amerikanische Befehlshaber Eisenhower glaubt, dass Hitler sich auf seine Alpenfestung zurückziehen wird. Deshalb will er die Einnahme Berlins den Russen überlassen, während er selbst seine Truppen nach Bayern und Richtung Alpen marschieren lässt.«
»Du meinst, wenn sich herausstellen sollte, dass Hitler nicht nach Bayern gehen wird, könnte das Eisenhowers Entschluss noch ändern?«
Michel nickte. »Hitler hat einen riesigen strategischen Fehler begangen, als er den Kommandeuren im Westen befahl, alle Stellungen zu halten und nicht zurückzuweichen. Folglich werden nun im Westen immer mehr deutsche Truppenteile eingeschlossen, die Deutschland mehr genutzt hätten, wenn sie sich rechtzeitig auf weiter östlich gelegene Verteidigungsstellungen hätten zurückziehen dürfen. So schildern es jedenfalls unsere Verbindungsleute beim Oberkommando der Wehrmacht. Hitler wird Berlin nicht kampflos übergeben, heißt es, egal, wer die Stadt einzunehmen versucht. Manchmal könnte man denken, Hitler plane, den Westalliierten den Weg nach Berlin zu erleichtern. Seine Befehle führen jedenfalls dazu, dass die Briten zügig durch Norddeutschland marschieren und Berlin von Westen her einnehmen könnten. Die Briten möchten das. Die Amerikaner aber wollen den Russen die Stadt überlassen.«
»Sagtest du nicht, du könntest keine Verbindung zu den Westalliierten herstellen?«
»Es ist für unsere eigenen Pläne von Bedeutung, über Hitlers Entschlüsse frühzeitig informiert zu sein«, erklärte Michel. »Egal, ob Hitler die Entscheidung trifft, in seine Alpenfestung zu fliehen oder bis zum Ende in Berlin zu bleiben, Fegelein wird es dir nicht verschweigen.«
»Unsere eigenen Pläne? Was für Pläne haben wir denn?«
»Das kann sich erst entscheiden, wenn der Fall eingetreten ist«, wich Michel ihr aus.
»Nur ist es dann wahrscheinlich zu spät.«
»Vertrau mir! Noch sind nicht alle Wege aus Berlin versperrt. Wo für die Bonzen und Goldfasane ein Weg ist, aus der Stadt zu entkommen, findet sich auch einer für uns.«
Greta zog ihren Mantel aus. »Es klingt, als hätten wir die Wahl zwischen Pest und Cholera!«, sagte sie. »Wenn Hitler in die Alpen flieht, ist der Krieg früher zu Ende, aber die Amerikaner überlassen den Russen die Stadt. Steht fest, dass er in Berlin bleibt, kommen die Amerikaner vielleicht hierher, anstatt nach Berchtesgaden zu marschieren, aber der Krieg dauert länger. Alles liegt in der Hand der Amerikaner. Was wir selbst veranstalten, ist gehüpft wie gesprungen.«
»Bleib an Fegelein dran!«, entgegnete Michel. »Hitlers Pläne frühzeitig zu kennen, kann viele Menschenleben retten. Die Kampfkraft der unteren Chargen wird nachlassen, wenn herauskommt, dass Hitler die Stadt verlassen wird. Es wird schnell die Runde machen, dafür werden ich und andere schon sorgen.«
»Hoffentlich haut der Führer bald ab!«, sagte Greta. »Das wäre mir das Liebste. Den meisten Berlinern wahrscheinlich auch. Es würde uns das Leben gewaltig erleichtern.«
Sie trat zu ihrem Geliebten und streckte sich ihm entgegen. »Ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden, Michel. Schlaf jetzt mit mir! Das Vögeln mit dir ist so herrlich und das Einzige, was diese Tage erträglich macht.«
3. Kapitel
Nellies Salon war kein gewöhnliches Bordell, sondern ein geheimes Etablissement, in dem SS-Offiziere ebenso wie Wehrmachtsgeneräle und ausländische Diplomaten verkehrten. Es war eines der letzten Überbleibsel einer Art, von denen es in Berlin einst eine ganze Reihe gegeben hatte. Es lag in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms und war von Gretas Wohnung zu Fuß bequem zu erreichen.
»Es hat nicht jedermann Zutritt.« Ihre Kollegin Marlene Raulf hatte ihr von dem Klub erzählt, als sie beide noch Tänzerinnen an der Scala gewesen waren. »Du triffst dort interessante Männer. Natürlich musst du auch etwas für dein Geld tun, aber Hauptsache, du bist schön und gern ein bisschen nackt. Es ist jedenfalls viel besser, als in einer Fabrik dienstverpflichtet zu werden. Du kannst es ja einfach mal ausprobieren. Wenn es dir nicht gefällt, lässt du es eben wieder bleiben.«
Nachdem der Varietébetrieb an der Scala kriegsbedingt eingestellt worden war, hatte Greta nicht lange gezögert. Natürlich war ihr klar gewesen, dass sie in dem Etablissement nicht nur als schön anzusehende Bardame Konversation mit den Gästen betreiben würde; aber nachdem der Krieg in sein fünftes Jahr gegangen war, hatte sie die Aussicht, mit dem einen oder anderen der Männer im Bett zu landen, nicht mehr gestört. Rolf, ihr Verlobter, hatte sein Leben in Russland gelassen, und es gab keinen Mann außer ihm, dem sie hätte treu sein wollen. Jeder Tag konnte der letzte sein. Sie war ein schönes Mädchen und wollte leben, solange es noch ging.
Die Atmosphäre in Nellies Bordell war nicht schmuddelig, sondern von einer gewissen frivolen Gediegenheit, und sie empfand den Umgang mit den meisten von den Männern, denen sie dort begegnete, als angenehm. Gretas Kolleginnen waren keine gewöhnlichen Prostituierten, vielmehr gehörten sie der Sorte Frauen an, für die die körperliche Liebe einen hohen Stellenwert besaß und die in Zeiten, in denen die Männer rar geworden waren, nicht auf erotische Kontakte verzichten mochten. Greta hatte jedoch bald durchschaut, dass das Amüsement der Gäste nicht der einzige Zweck des edlen Etablissements war, das ihr den Lebensunterhalt gewährte, sondern dass Nellies Salon als eine Art Börse für Nachrichtenbeschaffung diente. Marlene hatte ihr gegenüber eines Tages unumwunden eingeräumt, dass sie für den deutschen Geheimdienst arbeitete. »Es ist allgemein bekannt, dass die Männer in den Armen einer schönen Frau gesprächig sind«, hatte sie erklärt. »Du wirst wertvolle Informationen erfahren. Die Herren von der Abwehr sind einem ganz dankbar dafür. Warum soll man nicht ein wenig mit ihnen darüber plaudern, über das, was man so hört?«
Abwehr klang gut, besser als Gestapo; die Mitarbeiter der Abwehr waren wirklich nicht die schlechtesten Männer. Greta verstand sich bald blendend mit den Offizieren der Abwehr, dem militärischen Geheimdienst der Wehrmacht. Einer der Herren, die gute Kontakte zur Abwehr unterhielten, war Michel Greinz, der selbst der Abwehrabteilung des Reichssicherheitshauptamtes angehörte. Michel war ihr Geliebter geworden und die Verbindung zu ihm hatte Greta zu einer Doppelagentin gemacht. Sie hatte die Informationsbeschaffung in Michels Auftrag trotz gewisser Andeutungen, die er ihr gegenüber ab und an hatte fallen lassen, zunächst sportlich aufgefasst, und war erschrocken gewesen, als ihr bewusst wurde, dass ihr Geliebter wichtige Neuigkeiten mittels eines Kurzwellenfunkgeräts an den Feind weitergab. Doch da war es bereits zu spät gewesen. Es hatte sie nicht lange belastet. Sie hatte sich gesagt, dass sie durch ihr Tun dabei mithalf, den Krieg, der nicht mehr gewonnen werden konnte, schneller zu beenden, und sich zu keinem Zeitpunkt gegen die ihr zugewiesene Rolle gewehrt. Sie war gern mit Michel zusammen. Er war nicht nur ein wundervoller Liebhaber, sondern gehörte wie sie selbst zu den Menschen, für die die Gefahr eine erotische Komponente besaß, was ihrer Beziehung ein prickelndes Fundament verlieh.
»Hast du schon Pläne gemacht für die Zeit nach Nellie?«, fragte Greta ihre Kollegin Marlene, mit der sie an einem der Tische zusammensaß.
»Darüber mache ich mir keine Gedanken«, erwiderte Marlene. »Wenn es ganz schlimm kommt, schnappe ich mir einen gut aussehenden russischen Offizier, und der wird dann mein Beschützer. Lieber gehe ich mit so einem Mann freiwillig ins Bett, als dass ich zulasse, dass ein einfacher, dreckiger Soldat über mich herfällt.«