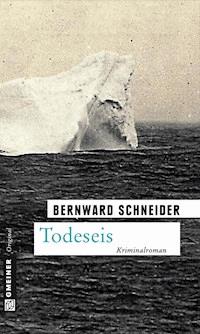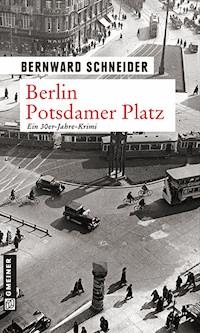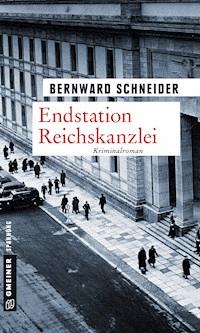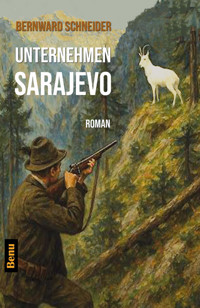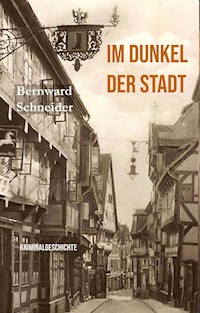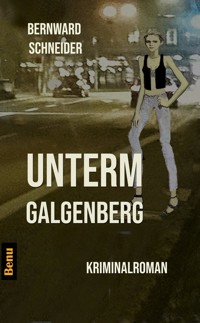Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Die Tänzerin und Abwehragentin Marion Bendt bringt ein geheimes Protokoll in ihren Besitz, das Hitlers Pläne zum Polenfeldzug beinhaltet. Sie erkennt sofort die Brisanz des Materials und übergibt ihrem Führungsoffizier Rolf Michalik Kopien davon. Als dieser kurz darauf tot aufgefunden wird, geht die Polizei von Selbstmord aus. Doch Marion ist sich sicher, dass sie den Schatten des Mörders mit eigenen Augen gesehen hat. Nun schwebt auch sie in Lebensgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernward Schneider
Vor dem großen Sterben
Kriminalroman
Zum Buch
Berlin, August 1939 In Berlin herrscht schönstes Sommerwetter. Noch wirkt das Leben in der Stadt normal, doch die Hinweise auf einen bevorstehenden Krieg verdichten sich. Die Varieté-Tänzerin Marion Bendt kopiert im Auftrag der deutschen Abwehr ein geheimes Protokoll der Besprechung Hitlers mit seinen höchsten Offizieren. Darin enthalten sind die wahren Kriegsziele Hitlers. Nicht lange nachdem Marion ihrem Führungsoffizier Rolf Michalik Fotos des Dokuments übergeben hat, findet sie ihn erschossen auf. Scheinbar ein Selbstmord. Doch Marion ist sich sicher, dass sie den Schatten des Mörders mit eigenen Augen gesehen hat. Aber auch sie ist nicht unentdeckt geblieben und wird von Unbekannten verfolgt. Als sie dem SS-Mann Ludwig Krieck und seiner Freundin Sybille Seeckt begegnet, weiß sie nicht, ob sie den beiden vertrauen kann. Während der drohende Krieg die Menschen von Tag zu Tag in größere Unruhe und Angst versetzt, verstrickt sie sich immer tiefer in das unheimliche Netz ihrer Feinde.
Bernward Schneider, Jahrgang 1956, studierte Jura in Marburg und ist seit 1986 in Hildesheim als Rechtsanwalt tätig. Von 1991 bis 1994 arbeitete er zudem in Berlin-Köpenick. Mit seinen historischen Berlin-Krimis um den anwaltlichen Ermittler Eugen Goltz ist er einer breiten Leserschaft bekannt geworden. Der Kriminalroman »Vor dem großen Sterben« um die Tänzerin und Agentin Marion Bendt ist sein neuester Berlin-Krimi aus der Zeit des Dritten Reichs. Bernward Schneider ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zudem ist er Mitglied des Vereins Hildesheimliche Autoren e. V.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Der Teufel des Westens (2017)
Endstation Reichskanzlei (2015)
Berlin Potsdamer Platz (2013)
Todeseis (2012)
Flammenteufel (2011)
Spittelmarkt (2010)
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6194-1
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel
Marion richtete sich auf. Der Mann auf der anderen Seite des Bettes schlief tief und fest. Vorsichtig schob sie die Beine unter der Decke hervor, setzte die Füße auf den Teppichläufer und griff nach dem Handtäschchen, das auf dem Boden stand. Vom Flur drang ein schwacher Schein durch die halb offene Tür. Sie erhob sich leise und glitt nackt, wie sie war, aus dem Zimmer.
Das Licht kam von einer kleinen Lampe auf einem Tischchen am Ende des Flurs. Zum Arbeitszimmer waren es nur ein paar Schritte. Vorsichtig drückte sie die Klinke nieder, öffnete die Tür einen Spalt und schlüpfte auf Zehenspitzen hindurch, dann schob sie sie von innen zu, ohne sie ganz zu schließen.
Marion stand im Dunkeln. Im ersten Moment waren kaum Einzelheiten im Zimmer auszumachen, aber nach einer Weile gewöhnten sich ihre Augen an die Verhältnisse. Sie wusste, wo sie zu suchen hatte. Bereits bei ihrem ersten Besuch in Böhmes Wohnung hatte sie sich mit den Räumen vertraut gemacht. Sie tastete nach dem Lichtschalter neben der Tür und ließ das Deckenlicht aufglimmen. Auf der anderen Seite vor dem mit Vorhängen bedeckten Fenster stand ein Schreibtisch. Links davon tickte eine große Standuhr an der Wand. An seiner rechten Seite thronte eine Stehlampe. Leichtfüßig näherte sie sich und schaltete sie an, eilte dann nochmals zurück und löschte das Deckenlicht wieder.
Der Schreibtisch war wuchtig, ein antikes Schwergewicht aus dunklem Kirschbaumholz mit kunstvollen Intarsien und einer grünen Linoleumauflage. Ein paar Bücher lagen darauf. Als Erstes die Schubladen, dachte sie. Sie hockte sich vor den Schreibtisch, legte das Täschchen neben sich, und zog eine nach der anderen auf. Sie besah sich die Unterlagen und Mappen, stellte aber schnell fest, dass nichts dabei war, was es wert gewesen wäre, fotografiert zu werden.
Sie richtete sich auf und lauschte. Alles war still. Außer dem selig schlummernden Henning Böhme gab es niemanden in der Wohnung, der sie überraschen könnte. Der Offizier der Wehrmacht lebte allein, und aufwachen konnte er so bald nicht. Die Tatsache, dass die Herren der Schöpfung nach vollzogenem Akt gern noch ein Gläschen tranken, hatte sie sich zunutze gemacht und dem Cocktail ein paar Tropfen eines geschmacklosen Schlafmittels beigesetzt. Das gehörte zu der Arbeitsausrüstung, die Michalik ihr zur Verfügung gestellt hatte. Es gab eigentlich kein Risiko, was die Durchführbarkeit und die Erfolgsaussichten des Auftrags anging, dennoch galt es, auf der Hut zu sein.
Ihre Augen streiften schmale Regale mit Büchern, die an den Wänden standen. Ein Bild zwischen einem der Regale und der Tür hing ein wenig schief. Sie trat heran, nahm es vorsichtig ab und erblickte den in die Wand eingelassenen Tresor. Natürlich war er verschlossen. Sie hängte das Bild wieder hin und wandte sich erneut dem Schreibtisch zu.
Marion betrachtete das Möbelstück eine Weile. Sie wusste genau, wonach sie suchte: Sie zog die große Schublade in der Mitte heraus. An der inneren Seitenwand gab es einen kleinen Riegel. Sie probierte daran herum. Nach einer Weile gab er nach und ein kleines Holzpaneel klappte auf.
Einige Papiere waren darin, sie blätterte sie durch, doch es waren nicht die, nach denen sie suchte. Dann entdeckte sie etwas anderes und ihr Herz machte einen Satz: Unter den Papieren lag ein kleiner Schlüssel.
Sie nahm ihn heraus, trat flugs zu dem Bild vor dem Tresor und nahm es erneut von der Wand. Sie hatte sich nicht getäuscht, der Schlüssel passte. Die Scharniere der Panzertür waren gut geölt, das Öffnen verursachte kein Geräusch. Sie erblickte eine Geldkassette und ein Aktenstück und atmete auf. Sie hatte befürchtet, dass sie sich durch Berge von Unterlagen würde kämpfen müssen, doch es war nur diese eine Mappe, die nicht mehr als zwölf oder fünfzehn Blätter Papier enthielt.
Einseitig handschriftlich geschrieben, bildeten sie zusammen ein amtlich aussehendes Dokument. Das Datum auf der ersten Seite stimmte mit dem ihr von Rolf Michalik genannten überein: 23. Mai 39. Es bezeichnete den Tag einer Besprechung, als deren Ort das Arbeitszimmer des Führers in der Neuen Reichskanzlei genannt wurde. Diensttuender Adjutant war der Oberstleutnant Schmundt, und dieser war es, der Rolfs Angaben zufolge die Rede Hitlers vor der militärischen Führungsspitze in seinem Bericht aufgezeichnet hatte. Das Dokument führte sämtliche Beteiligten der Zusammenkunft auf, auch der Gegenstand der Besprechung sowie ein Stempel »Chef-Sache/Nur durch Offizier« waren angegeben. Perfekt, dachte sie, es war das Dokument, nach dem sie gesucht hatte.
»Präg dir so viel ein wie möglich. Wichtig vor allem: Datum, Teilnehmer, Protokollunterschriften, und natürlich des Führers Pläne«, hatte Rolf ihr aufgetragen.
Marion begann, durch das Dokument zu blättern. Ihr Vorhaben ging glatter vonstatten, als sie befürchtet hatte. Bis eben hatte sie gezweifelt, ob sie überhaupt etwas entdecken würde oder die Wohnung unverrichteter Dinge würde verlassen müssen. Bezahlt wurde sie auch, wenn sie nichts entdeckte, aber es war ihr natürlich wichtig, erfolgreich zu sein. Mittlerweile arbeitete sie schon seit einem halben Jahr als geheime Mitarbeiterin der Deutschen Abwehr. Ein paar kleinere Spionageaufträge, die Diplomaten benachbarter Länder betrafen, hatte sie schon erledigt. Doch dieser Auftrag war etwas Besonderes, vielleicht ihre eigentliche Bewährungsprobe. Die Brisanz des Auftrags war ihr nicht entgangen, obwohl Rolf so getan hatte, als ob sich die Angelegenheit Böhme nicht von ihren früheren Arbeiten unterschiede.
Rolf hatte ihr den Major Böhme als einen Vertrauten von Oberstleutnant Schmundt, Hitlers Wehrmachtsadjutanten, bezeichnet und ihr erklärt, dass sich in seinem Besitz eine der Ausfertigungen eines geheimen Protokolls befände. Darin äußere sich Hitler zu seinen wahren und von den öffentlichen Verlautbarungen abweichenden Kriegszielen. Insbesondere gehe es um die Hintergründe des befürchteten Angriffs auf das Nachbarland Polen, von dem dieser Tage überall im Land die Rede war. Rolf hatte ihr keine Erklärung für die Merkwürdigkeit gegeben, dass er als Offizier der Abwehr gegen Kreise um den Adjutanten des Führers operierte. Er war über diese Fragwürdigkeit hinweggeglitten, obschon er ihre Zweifel registriert hatte, und schnell war Marion klar geworden, dass er keine weiteren Fragen von ihr hören wollte. Es war ihr bekannt, dass es unter den Geheimdiensten im Reich, wie auch zwischen anderen Dienststellen der Partei Feindschaften und Rivalitäten gab, und deshalb hatte sie keine Einwände erhoben. Meistens war es ja doch besser, nicht mehr als nötig zu erfahren.
Böhme verkehrte regelmäßig im Ciro. Marion sollte mit einem Bekannten Böhmes eines Abends in dem Lokal erscheinen. Ihr Begleiter war ein Wehrmachtshauptmann, der sie Böhme vorgestellt hatte, der Rest ergab sich fast von selbst. Sie hatte ein Kleid getragen, das von ihrem gelungenen Gliederbau und ihrer Seidenhaut mehr gezeigt als verborgen hatte, ein aufmunterndes Lächeln in die Richtung ihres Opfers, und schon hatte der Hering angebissen. Eine dezente Bemerkung, dass sie nicht umsonst zu haben sei, dann hatte sie ihn nach Steglitz hinaus begleitet, und wie so oft in solchen Fällen hatte sie genau das Richtige gesagt. Sie hielt sich selbst nicht für eine Prostituierte, sondern sah die Liebesdienste, die sie gegen Bezahlung verrichtete, als einen Teil ihrer Tarnung an. Die meisten Diplomaten und hohen Offiziere hatten ihre Ehefrauen und Familien im Ausland oder irgendwo in der Provinz und besaßen in Berlin eine kleine oder auch größere Wohnung, je nach Herkunft und Rang. Eine Geliebte hätte diesen Männern am Ende nur Probleme beschert, mit einer reizenden Prostituierten aber, der gegenüber sie, mit Ausnahme der pekuniären, keine Verpflichtungen eingingen, ließen sie sich gern einmal ein.
Marion studierte das oberste Blatt des Dokuments, das vor ihr lag. Als sie die Namen der an der Besprechung Beteiligten und verschiedene Vermerke auf dem Dokument registrierte, befiel sie ein leiser Schrecken. Ein Dokument, in dem Hitler seine Absicht verkündete, so bald wie möglich das Nachbarland Polen anzugreifen, war nicht bloß geheim, erkannte sie. Die Geheimhaltung bildete – und so war es auf dem Dokument auch vermerkt – die Voraussetzung dafür, dass die Pläne des Führers gelingen würden.
Sie legte die Mappe aufgeschlagen auf den Schreibtisch, griff nach dem Handtäschchen und nahm aus dem Beutel mit den Binden und den Fromms-Präservativen die kleine Spionagekamera heraus. Es war eine Minox Kleinbildkamera, die seit dem vergangenen Jahr von einer Firma in Riga in größeren Stückzahlen produziert wurde, wie Michalik ihr erzählt hatte. Ihre Abmessungen waren so gering, dass sie mühelos in einer Faust verschwand. Trotzdem lieferte die Minox Bildergebnisse von hervorragender Qualität.
Das Licht war kein Problem, stellte sie beim Umgang mit der Kamera fest, die Lampe strahlte sehr hell; dennoch beherzigte sie Michaliks Rat und studierte so gut es ging den Inhalt der Blätter, die sie fotografierte.
Die wahren Pläne des Führers, wie sie sich aus dem vor ihr liegenden Protokoll ergaben, entsprachen nicht dem, was dieser Tage in den Zeitungen geschrieben stand, stellte Marion fest, nachdem sie mehr als die Hälfte der Seiten abgelichtet hatte.
Die Nachrichtenblätter im Lande schrieben über den deutsch-russischen Nichtangriffspakt, den der deutsche Außenminister von Ribbentrop vor ein paar Tagen in Moskau mit dem russischen Staatsführer Stalin geschlossen hatte. Was dieser Pakt bedeutete, war klar, auch wenn es nicht so klar aus den Berichten hervorging. Deutschland verlangte von Polen die Rückgabe von Danzig und einen Durchgang durch den Polnischen Korridor, und der Pakt mit Russland ebnete den Weg für Deutschland, seine Ansprüche mit militärischer Gewalt durchzusetzen.
Im Protokoll sah das anders aus. Hitler erklärte, dass er Polen bei erstbester Gelegenheit angreifen wolle, nicht wegen Danzig und des Korridors, sondern zur Erweiterung des deutschen Lebensraums im Osten. Dieser Erweiterungsraum aber lag nicht in Polen, sondern in Russland. Wenn es dem Führer in Wahrheit um Russland ging und Polen nur einen Zwischenschritt auf dem Weg dorthin bildete, sagte Marion sich, war der Pakt mit den Russen bloße Makulatur.
Sie arbeitete konzentriert, ohne dass sie sich durch ihre Gedanken stören ließ. Sie spürte Erleichterung, als sie endlich alle Einzelseiten abfotografiert hatte. Die Luft im Raum war zum Schneiden dick. Obwohl sie nichts am Leibe trug, war ihr so warm geworden, dass sich auf ihrer Stirn Schweißperlen gebildet hatten. Sie legte das Aktenstück in den Panzerschrank zurück, zog die Tür leise zu und verschloss sie, dann deponierte sie den Schlüssel an der vorgesehenen Stelle im Schreibtisch und packte die kleine Kamera in den Beutel zurück. Wenn jemand nur einen oberflächlichen Blick in das Täschchen warf, würde er die Minox nicht entdecken.
Sie wandte sich ab, schlich leise federnd zur Tür und löschte die Lampe. Eine Weile wartete sie noch und lauschte, aber dann, gerade als sie die Tür weiter aufschob, verdunkelte ein Schatten das Licht im Flur.
Ein eiskalter Schauer lief über ihren bloßen Rücken. Sie ignorierte den Schrecken, der nach ihr griff, und blieb in der Bewegung, als wäre nichts Ungewöhnliches geschehen. Es gab ja doch kein Zurück. Das Leben wurde schließlich nach vorne gelebt, das war ihr Motto, denn nur dann hatte man Erfolg. Nichtsdestoweniger schlug ihr Herz so heftig, dass sie Angst hatte, man könnte es hören.
Vor ihr stand ein Mann, der genauso splitternackt wie sie selbst war. Der Major Böhme, dessen Bettgenossin sie in dieser Nacht geworden war.
»Sind Sie eine Schlafwandlerin?«, fragte er.
»Ich wollte zum Klo. Irgendwie scheine ich wirklich noch nicht ganz wach zu sein, denn ich habe mich in der Tür geirrt.«
»Das Klo ist direkt gegenüber«, sagte er und starrte sie an. Der Major hatte pechschwarze Haare und strahlend blaue Augen. Sein schmaler Schnauzbart war frisch gestutzt.
Wie konnte es sein, dass er aufgewacht war, schoss es ihr durch den Kopf. Eigentlich war das gar nicht möglich. Doch es war müßig, auch nur daran zu denken, im Moment würde es ihr nicht helfen, nach einer Antwort zu suchen.
»Ich wollte kein Licht im Schlafzimmer machen«, sagte sie und öffnete ihr Täschchen, bevor er selbst auf den Gedanken kommen konnte, es von ihr zu verlangen. Sie tat so, als ob sie darin nach etwas suchte, schließlich zog sie das Päckchen mit den Fromms heraus. »Ich konnte es nicht finden und hatte mich schon gefragt, ob ich es überhaupt wieder eingepackt hatte.« Sie schob das Päckchen in den Beutel zurück und schloss das Täschchen.
»Dann nehme ich mal die Tür auf der richtigen Seite«, sagte sie und wandte sich zum Gehen.
»Halt! Warten Sie!«, erwiderte der Offizier.
Marion hielt in der Bewegung inne, warf den Kopf zurück und schaute den Mann offen an. Ihr Herz schlug schneller und sie musste sich anstrengen, ganz unbefangen zu bleiben, während sie in seine aufmerksamen blauen Augen sah. Sie wusste, dass sie wie die nackte Unschuld vom Lande aussah, die nichts dafürkonnte, dass sie die Gefühle der Männer in Aufruhr versetzte, und gab sich nun alle Mühe, ein Gesicht zu machen, das diesen Eindruck noch verstärkte. Kurz sah es so aus, als ob Böhme gleich etwas sagen wollte, doch dann zeigte die süße Naivität, die sie zur Schau stellte, ihre Wirkung. Böhme schien den Blick nicht mehr von ihr losreißen zu können.
»Mein Gott, wie schön Sie sind«, sagte er und sein Gesicht nahm einen fast betroffenen Ausdruck an. »Sie sind Ihren Preis wirklich wert, Marion. Eigentlich unbezahlbar, pures Gold.«
Sie lächelte, während sie sich gleichzeitig fragte, ob er wirklich so arglos war, wie er tat. Befürchtete er, dass es seinen Tod bedeuten könnte, falls er sie enttarnte, und wollte so Unannehmlichkeiten aus dem Wege gehen? Gut, dass man nicht hinter die Stirn eines Menschen blicken konnte, dachte sie, das war manchmal wirklich besser; nicht nur für den anderen, sondern ebenso für einen selbst.
»Übertreiben Sie nicht, Henning!«, sagte sie. »Wie Sie sehen, bin ich auch nur aus Fleisch und Blut gemacht, und zwar von Kopf bis Fuß.«
»Sie sind von Kopf bis Fuß für die Liebe gemacht«, seufzte er in Anspielung auf einen bekannten Schlager.
»Sie selbst sind auch nicht von schlechten Eltern«, gab sie zurück.
Böhme erwiderte ihr Lächeln und die Situation entspannte sich. Dass er ein gut aussehender Mann war, hatte nicht nur den Vorteil, dass die körperliche Berührung für sie leichter zu ertragen war; ein Mann wie er war es außerdem gewohnt, dass Frauen ihm schöne Augen machten, sodass sie mit ihrer dezenten Annäherung kein Misstrauen erregt hatte. Dass sie Geld nahm, bedeutete schließlich nicht, dass sie sich mit jedem einließ. Von Leidenschaft konnte natürlich keine Rede sein. Selbst wenn sie so tat, als ob ihr der körperliche Akt gefiel, empfand sie beim Umgang mit einem Kunden selten Spaß. Mit Felix, ihrem Liebhaber, war das etwas völlig anderes. Wichtig war nur, dass sie keinen Widerwillen gegenüber den Kunden fühlte.
»Ich hatte schon befürchtet, dass ich unsere Verabredung absagen müsste, müssen Sie wissen«, sagte Böhme. »Die Zeichen stehen auf Sturm. Der Führer hatte bereits den Angriffsbefehl für morgen früh unterschrieben. Erst im letzten Moment wurde der Befehl rückgängig gemacht.«
»Es wird also keinen Krieg geben?«, fragte Marion hoffnungsvoll.
»An diesem Wochenende nicht«, sagte Böhme. »Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es gibt zwar nicht wenige Leute in der Wehrmacht, die nun plötzlich glauben, dass der Krieg nicht mehr stattfinden wird. Doch ich befürchte, dass diese Verzögerung nicht mehr als eine letzte Galgenfrist ist.« Er machte eine nachdenkliche Pause. »Wenn es zum Krieg kommt, werden viele Männer sterben, nicht nur Polen, sondern auch Deutsche«, fuhr er fort, »und eines sage ich Ihnen …« Er wandte den Blick von ihr ab und starrte zu den verschlossenen Vorhängen vor dem Fenster. »Eine Nacht mit einer Frau wie Ihnen kann einem in dunklen Stunden eine wahrhaft tröstliche Erinnerung sein.«
Marion schwieg, dann nickte sie. »Ja, das verstehe ich«, sagte sie schließlich und setzte, bevor sie ins Badezimmer entschwand, mit einem charmanten Lächeln hinzu: »Ich bin gleich wieder bei Ihnen, Henning, und dann will ich gern noch etwas für Ihre Erinnerungen tun.«
2. Kapitel
»Bist du sicher, dass er keinen Verdacht geschöpft hat?«, fragte Rolf Michalik.
»Er ist nicht blöd«, erwiderte Marion leise. »Vielleicht nimmt er an, dass ich vorhatte, ihn auszuspionieren. Aber dass ich die Fotos bereits angefertigt hatte, dachte er wohl nicht. Er hat sich jedenfalls nichts anmerken lassen. Wir haben am Morgen noch eine Tasse Kaffee zusammen getrunken, dann bin ich fort. Die ganze Zeit hatte ich Angst, dass er noch etwas sagt, aber es passierte nichts.«
Sie saßen in der Kneipe von Mutter Maenz, einem einfachen Lokal mit schlichten Holztischen, das am oberen Ende der Augsburger Straße lag, nicht weit vom mondänen Kurfürstendamm entfernt. Die Straße gehörte zu Berlins Amüsiermeilen und beherbergte zahlreiche Restaurants, Kneipen, Bars und Varietés. Ganz in der Nähe befand sich das Coco, in dem Marion an mehreren Abenden in der Woche als Tänzerin arbeitete.
»Entweder hast du die Tropfen falsch dosiert oder es stimmt etwas nicht mit der Rezeptur«, sagte Rolf nachdenklich. »Ich muss das Mittel überprüfen.«
»Überprüfst du es an dir selbst?«, fragte sie.
»Zur Not auch das.«
Er strich mit der Hand durch sein glattes, vom Seitenscheitel herabfallendes Haar. Es war von hellem Blond mit einem leichten rötlichen Ton. Er war ein Mann von ungefähr dreißig Jahren, mit einer intelligenten Stirn und großen blaugrauen Augen, die bis vor ein paar Tagen eine gewisse Strahlkraft besessen hatten. Doch an diesem Tag wirkten sie müde, Schatten hatten sich wie Ringe darumgelegt. Marion wusste, dass er nicht nur über Hitlers Kriegspolitik unglücklich war, sondern über vieles andere mehr, das sich in diesem Land ereignete. Es sei ein beschämendes Schauspiel, wie das Deutsche Reich mit den Juden umginge, hatte er kürzlich geäußert.
»Ich musste es machen, während er im Zimmer war«, sagte Marion. »Mag ja sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, obwohl ich es nicht glaube.« Sie öffnete die Handtasche und reichte ihm das Fläschchen. »Wer weiß, was da überhaupt drin ist.«
»Ich werde dem auf den Grund gehen«, erklärte Rolf, nachdem er das Fläschchen weggesteckt hatte. »Hast du das richtige Dokument? Konntest du es lesen?«
Sie nickte. »Es trägt das Datum, das du mir genannt hast, und ist das Protokoll einer Besprechung des Führers mit Göring und einigen ranghohen Offizieren der Wehrmacht.«
»Was wurde besprochen?«
»Der Führer will den Krieg, und zwar ganz egal, ob die Polen auf Deutschlands Forderungen eingehen oder nicht.«
»Das ist es«, sagte Rolf. »Dieses Protokoll habe ich gebraucht.«
»Du wusstest über den Inhalt Bescheid?«
Rolf nickte. »Wir brauchen die Fotos als Beweis.«
»Was willst du damit machen?«
Er reagierte nicht, und natürlich hatte sie kein Recht auf eine Antwort. Wofür die Informationen gebraucht wurden, die sie beschaffen musste, ging sie nichts an. Trotzdem spürte sie einen Anflug von Ärger. Sie hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass man sie benutzte, dass sie nicht mehr Herr über ihre Entschlüsse war, weil sie die Dinge, die sie tat, in ihrer Bedeutung nicht vollständig verstand. Sie hatte sich auf die Sache mit Böhme eingelassen, weil sie Rolf vertraut hatte, aber nun sagte sie sich, dass ihr vorbehaltloses Vertrauen ein Fehler gewesen war. Sie brauchte nicht alles zu wissen, doch sie hätte die Fragen stellen müssen, die ihr auf der Seele lagen, und den Auftrag ablehnen sollen, solange sie keine zufriedenstellenden Antworten erhielt. Die Einsicht kam zu spät, aber was sie erlebt hatte, würde ihr eine Lehre sein.
»Die Ausführungen des Führers wären für die Deutschen ein Schock«, sagte sie, »nicht nur für die Deutschen, auch für Deutschlands Gegner. Es wäre für die Regierung des Reiches mehr als misslich, sollten das Protokoll und damit die wahren Gründe des Kriegs an die Öffentlichkeit gelangen.«
Rolf Michalik nickte. »Es wäre sicher ein Politikum von äußerster Brisanz.«
»Aus diesem Grunde wäre es schon interessant zu erfahren, in wessen Hände ein solches Dokument am Ende gelangen soll«, sagte Marion.
»Vergiss nicht, dass die Schwarzen und wir Hand in Hand arbeiten. Ich kann oft selbst nicht sagen, wer am Ende der Kette dahintersteckt, wenn ein solcher Auftrag an mich ergeht. Bewahre striktes Stillschweigen, Marion. Auch ich muss sehr, sehr vorsichtig sein.«
Mit den Schwarzen waren der Sicherheitsdienst der SS und die Gestapo gemeint. Was Rolf sagte, bestätigte nur ihre düsteren Ahnungen, dass etwas faul an der Sache war und dem Auftraggeber ihres Führungsoffiziers nicht unbedingt zu trauen war. Ausländische Diplomaten oder andere ausländische Geheimnisträger im Dienste der Abwehr auszuhorchen, bereitete ihr keine Gewissensqualen. Doch dass sie, ohne es zu wissen, für die Gestapo oder den SD arbeitete und trotz Rolfs anderslautender Beteuerungen nicht ausschließen konnte, jemanden in Schwierigkeiten zu bringen, bereitete ihr Unbehagen. Sie konnte nur hoffen, dass Rolf, wenn er sich schon aufs Schweigen verlegte, sie wenigstens nicht belog und ihr anderweitig Sand in die Augen streute.
»Warum setzt mich die Abwehr auf jemanden von der Wehrmacht an?«, fragte sie. »Was verschweigst du mir?«
»Die Entwicklung der letzten Tage hat uns alle überrascht«, erwiderte Rolf. »Noch Mitte des Monats hat niemand an Krieg gedacht. Plötzlich zeigt sich, dass Deutschland seine Ziele ohne einen Krieg nicht wird erlangen können, und mit einem Male spielen alle verrückt und wollen schleunigst noch ihre Angelegenheiten in trockene Tücher bringen.«
»Du hast mich nicht erst vor ein paar Tagen auf Henning Böhme angesetzt«, entgegnete sie.
Es verstand sich von selbst, dass sie zumeist leise miteinander sprachen. Aber gerade weil es so ungestüm und ungezwungen bei Mutter Maenz zuging, bestand kaum Gefahr, dass jemand sie hörte. Auch wenn man die Ohren spitzte, bekam man im Lokal nicht viel von dem mit, worüber die Menschen an den anderen Tischen plauderten.
»Wovon ich dir zugegebenermaßen nichts berichtet habe, als wir Anfang der Woche darüber sprachen, war die Anweisung, die Sache Böhme zu forcieren und zu einem Abschluss zu bringen, um kurzfristig Ergebnisse zu erzielen.«
»Du hast versprochen, dass ich niemanden ans Messer liefern muss.«
»Du kannst beruhigt sein«, erwiderte Rolf. »Es geht nicht um Böhme, so viel steht fest. Gegen den Mann liegt nichts vor.«
»Gib mir nie wieder einen solchen Auftrag!«, zischte sie noch eine Spur leiser, aber nicht ohne Schärfe im Ton. »Die Sache hat mir von Anfang an nicht behagt. Ich weiß, dass meine Arbeit nicht ungefährlich ist. Es ist sogar ein Grund, weshalb ich mich darauf eingelassen habe. Aber ich möchte nicht verheizt werden, sondern muss die Risiken, die ich eingehe, abschätzen können. Hereingelegt werden, will ich auf keinen Fall. Von niemandem! Schon gar nicht von dir! Gott sei Dank, dass es vorüber ist. Es ist gerade noch einmal gut gegangen.«
»Ich bin dir sehr dankbar für alles«, erwiderte Rolf. »Die Fotos?«
Marion hatte die kleine Kamera in die Hand genommen und hielt sie eine Weile in der geschlossenen Faust, bevor sie diese in Rolfs Hand legte. Der ließ die Minox sofort in der Tasche seiner Jacke verschwinden.
»Sie ist fantastisch, wie angefertigt für mich«, sagte sie. »Ich denke, dass die Fotos gut gelungen sind. Gibst du mir das Geld?«
Er griff in seine Jacke, nahm einen Umschlag heraus und schob ihn ihr hin. Sie steckte den Umschlag in die Innentasche ihres Mantels.
»Es wird Krieg geben, das steht offenbar bereits fest«, bemerkte sie.
»Was soll man sonst aus Ribbentrops Moskaureise schließen?«, erwiderte Rolf. »Wenn Stalin mit dem Führer einen Nichtangriffspakt abschließt, steht der Weg nach Polen für die deutsche Wehrmacht offen. Es ist genauso gekommen, wie man erwarten konnte, als man von dem Pakt erfuhr, nur ging es noch schneller, als ich es mir habe vorstellen können. Seit ein paar Tagen verdichten sich die Nachrichten um einen bewaffneten Konflikt um Danzig. Plötzlich berichteten die Zeitungen darüber, dass die Ernte in diesem Jahr besonders früh eingebracht wurde, dass der Ausbau des Westwalls gut vorankommt und vor der Vollendung steht, und so weiter. Beunruhigende Hinweise, die wohl sagen sollen, dass das deutsche Heer gerüstet ist, um ungehindert nach Osten zu marschieren.«
»Wie man sich doch täuschen kann«, sagte Marion. »Früher hätte ich es begrüßt und als ein gutes Zeichen gewertet, wenn sich die Deutschen wieder mit den Russen vertragen hätten, doch in Wahrheit deutet diese Annäherung auf Unheilvolles hin. Habe ich deshalb das Dokument fotografiert?« Ihre Stimme wurde leiser. »Oder habe ich es gemacht, weil noch die Chance besteht, einen Krieg zu verhindern? Willst du die Fotos nicht auch jemandem zeigen, der etwas bewirken kann?«
Einen Augenblick schaute Rolf sie überrascht an. Eine solche Frage zu stellen, grenzte an Verweigerung der Subordination, wenn nicht Schlimmeres. Aber Rolf war niemand, der ihr aus irgendeiner unpassenden Bemerkung einen Strick gedreht hätte; denn trotz allem blieben sie doch Kollegen. Er nickte bloß, dann murmelte er leise: »Ich stelle jedenfalls mehr als bloß einen einzigen Abzug her. Einer ist für mich. Du arbeitest für die deutsche Abwehr und ihr schuldest du Gehorsam. Es ist nicht ausgeschlossen, und ich hoffe es sogar, dass die Beweise, die du herangeschafft hast, an geeigneter Stelle Eindruck machen und etwas Gutes bewirken. Weniger wohl die Verhinderung des Kriegsausbruches selbst, vielleicht aber können sie Einfluss auf den weiteren Verlauf nehmen.«
Sie fragte lieber nicht, an was für Stellen er dachte. Mit seiner Bemerkung war er schon weiter auf sie zugegangen, als sie erwartet hatte, und damit war sie vorerst zufrieden. Er hatte seine Versäumnisse bei der Erteilung des Auftrags ihr gegenüber gewissermaßen wiedergutgemacht.
»Was passiert mit den Negativen?«, fragte sie.
»Die werde ich nicht behalten dürfen«, sagte er. »Das ist sicher. Dafür werde ich eine vollständige Abschrift des Protokolls anfertigen. Ich hoffe, dass man alles gut lesen kann.«
»Dann steht ja alles bestens«, sagte Marion, doch ihre Stimme hatte nicht so geklungen, als ob sie wirklich überzeugt davon war.
»Will Major Böhme dich wiedersehen?«, fragte Rolf.
»Ich hoffe nicht. Die Zahl meiner Verehrer ist groß genug. Beim Abschied hat er nichts darüber verlauten lassen.«
»Er weiß nicht, wo du arbeitest?«
»Ich hab ihm gegenüber mit keinem Wort erwähnt, dass ich im Coco tanze. Wir hatten uns vor dem Ciro verabredet, wo er mich im Wagen abgeholt hat. Er hält mich für eine Hure der Oberklasse. Ich habe ihm die übliche Geschichte erzählt.«
Rolf nickte. »Die unbekannte Schöne, die plötzlich auftauchte und wieder verschwand.«
»Er wird im Ciro nach mir suchen, falls er mich wiedersehen will, aber da bin ich nur selten. Na gut, wenn er es drauf anlegt, wird er mich natürlich finden. Ich wohne nicht weit davon weg und das Coco liegt um die Ecke. Aber er ist Offizier und zieht sicher bald in den Krieg.«
»Er gehört bestimmt nicht zu den Ersten, die an die Front müssen.«
»Soll er mich doch finden, ich kann mich wehren.«
»Das kannst du tatsächlich«, seufzte er, »dabei bist du noch so jung.«
»Ich hatte es in meinem Leben nie leicht.«
Er nickte. »Du hast mir schon einmal davon erzählt.«
Sie hatte sich des Öfteren gefragt, weshalb sie sich auf Rolf Michaliks Angebot, für ihn zu arbeiten, eingelassen hatte, und auch in diesem Moment musste sie wieder daran denken. Zuerst hatte sie gedacht, dass es wegen des Geldes und aus einer gewissen Abenteuerlust heraus geschehen war, doch inzwischen glaubte sie, es besser zu wissen, wenigstens so ungefähr. Es hatte mit ihrem Vater zu tun, mit seiner Hinrichtung durch die Truppen der Gegenrevolution im Frühjahr 1919. Ein tapferer junger Mann mit den besten Anlagen, der mit kaum zweiundzwanzig Jahren hatte sterben müssen, ungefähr in demselben Alter, in dem sie selbst heute war. Sie hatte sich stets für Politik interessiert, und wenn es noch andere Parteien als die Nazipartei geben würde, hätte sie sich vermutlich in einer von ihnen engagiert. Vielleicht bei den Kommunisten. Obwohl sie eigentlich keine Kommunistin war. Auch ihr Vater war kein Kommunist gewesen, wusste sie von der Mutter, sondern ein Sozialdemokrat, doch die eigenen Leute hatten ihn verraten. Ebert und Noske. Nicht ihn persönlich, wohl aber die deutsche Revolution.
»Du bist das, was sie heute eine moderne Frau nennen, nicht wahr?«, riss Rolf sie aus ihren Gedanken.
»Man darf sich nicht zu sehr auf die Männer einlassen«, entgegnete Marion, »sonst versuchen sie, einen zu fangen.«
»Gibt es niemanden, von dem du dich gern fangen lassen würdest?«
Es klang etwas Bedauerndes in seinem Tonfall mit.
»Für ein Abenteuer gern, wenn der Mann mir gefällt«, erwiderte sie. »Der Mann, den ich heiraten möchte, ist mir noch nicht begegnet.«
Es stimmte nicht ganz, dachte sie. Mit Felix Neuburger könnte sie sich schon eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Doch das alles war weit weg. Wenn sich die allgemeinen Befürchtungen bewahrheiteten, kam zuvorderst leider ein Krieg. Immerhin hatte ihr Geliebter keinen Stellungsbefehl bekommen und würde vermutlich auch so bald keinen erhalten, was wiederum mit einem anderen Problem zusammenhing: Felix war zum Teil Jude.
»Schade«, murmelte Rolf und Marion hatte das Gefühl, dass er selbst gerne dieser Mann gewesen wäre. »Du bist ein tapferes Mädchen, Marion, das muss ich dir einmal sagen. Ich hoffe, noch lange etwas an dir zu haben, nicht nur als Agentin, sondern auch privat.«
»Ich mag dich, Rolf«, sagte sie, »deshalb habe ich mich damals auf ein Verhältnis mit dir eingelassen. Das mit dem Verhältnis ist vorbei, aber ist denn etwa Freundschaft nichts wert?«
»Ist schon gut«, sagte Rolf und winkte Mutter Maenz, der weißhaarigen Wirtin, die gerade mit einem Tablett mit Tassen und Gläsern des Weges kam. »Es hat schon alles seine Richtigkeit. Für mich wird es nun aber Zeit zum Aufbruch.«
Mutter Maenz, die kurz darauf an ihrem Tisch erschien, war eine korpulente Frau mit hochgetürmter Frisur, eine Frau mit Herz, die für ihre Gäste lebte. Von anderen Gästen hatte Marion gehört, dass es die Kneipe schon seit Jahrzehnten gab, ohne dass sich an ihrem Charakter irgendetwas verändert hätte. So wie heute war es hier schon vor zwanzig oder dreißig Jahren zugegangen. Während draußen die Welt immer schillernder wurde, blieb bei Mutter Maenz alles beim Alten, und gerade weil das Lokal wie ein Gegenentwurf zum schicken Kurfürstendamm um die Ecke wirkte, zog es auch illustre Gäste an. Ob es in drei oder vier Jahren noch so sein würde wie heute und in den vergangenen zwanzig Jahren, stand freilich auf einem ganz anderen Blatt.
»Der Herr möchte zahlen?« Mutter Maenz warf einen kurzen Blick auf Marion. »Ja, ist recht. Wenn die Dame galant ist, zahlt der Herr.« Sie rechnete auf ihrem Zettel den Verzehr zusammen. »Zwei Mark achtzig.«
Während Rolf die Zeche bezahlte und ein Trinkgeld gab, fiel Marions Blick auf einen Tisch in der Nähe, an dem zwei Männer in Trenchcoats saßen. Sie sprachen miteinander, schienen von niemandem sonst im Lokal Notiz zu nehmen, doch Marion beschlich bei ihrem Anblick ein unbehagliches Gefühl. Auch zu Mutter Maenz verirrten sich zuweilen Gestalten, die nicht in das Lokal passten, und diese beiden rochen eindeutig nach Gestapo.
»Wenn ich dich brauche, gebe ich dir Nachricht«, sagte Michalik und erhob sich von seinem Platz. Auch Marion stand für einen Augenblick auf, um sich mit einer Umarmung von ihrem Führungsoffizier zu verabschieden. »Pass auf, ob dir jemand folgt«, flüsterte sie ihm zu. »Sieh nicht hin, aber dahinten sitzen zwei so komische Kerle.«
Rolf nickte bloß, dann verließ er das Lokal. Marion setzte sich wieder auf ihren Platz und trank den Rest des Kaffees, der noch in ihrer Tasse war. Eine Weile saß sie so da, hatte sich in Gedanken versunken auf der Bank zurückgelehnt, dann sah sie noch einmal hinüber zu den beiden Männern, die zu ihrer Erleichterung auf ihren Stühlen sitzen geblieben waren. Sie sah einige Momente länger hin als beim ersten Mal und dachte, dass es nicht nur die Mäntel waren, die sie verdächtig machten, sondern es war auch dieses Geschäftsmäßige, Unbeteiligte, das von ihnen ausströmte, was sie störte. Wirkte es nicht gespielt? Natürlich mussten die Männer, auch wenn es Gestapoleute waren, nicht Rolfs oder ihretwegen in das Lokal gekommen sein. Ihre Anwesenheit konnte auch andere Gründe haben. Mutter Maenz war zum Glück ein Lokal, in dem jeder nach seiner Fasson selig werden konnte, und sie ließ die beiden aus den Augen. Ein, zwei Minuten später erhob sie sich und trat durch die Eingangstür ins Freie.
3. Kapitel
Das Wetter draußen war strahlend schön. Der Sommer war erst in der zweiten Augusthälfte über die Stadt gekommen, nachdem der Juli ungewöhnlich kühl gewesen war. Aber nun gab die warme, sonnige Witterung sich den Anschein, so bald nicht wieder weichen zu wollen.
Marion entschied sich, noch etwas bummeln zu gehen, schlenderte auf der Augsburger Straße in die südöstliche Richtung und bog bald darauf in die Passauer Straße ein, um zum Tauentzien zu gelangen, einer Straße, geschäftig wie der Kurfürstendamm. Eigentlich war es wie immer. Die Menschen, denen sie begegnete, wirkten unbekümmert, nichts deutete darauf hin, dass die Angst vor einem Krieg umging. Doch Marion wusste, dass der äußere Anschein täuschte.
Es war erst wenige Tage her, dass die Nachricht von der Reise des deutschen Außenministers nach Moskau wie eine Bombe eingeschlagen hatte. Praktisch niemand hatte damit gerechnet, denn die russischen Kommunisten unter Stalin galten als der Feind. Doch seit man von der Übereinkunft wusste, war klar, dass das Schicksal Polens damit besiegelt war. In der Stadt und im ganzen Land hatten sich Spannung, Ungewissheit und Angst breitgemacht. Gleichzeitig hatte eine fieberhafte Untergangs- und Feierstimmung um sich gegriffen. Es gab niemanden, der nicht das Bedürfnis hatte, Gesellschaft zu suchen.
Über Marions Kopf verfingen sich die Sonnenstrahlen in den Blättern von Kastanienbäumen, tanzten wie Lichtstreifen über den Asphalt, was für eine gewisse Unruhe sorgte, und plötzlich beschlich sie die deutliche Ahnung, dass sie jemand verfolgte. Sie beschleunigte ihre Schritte, doch das Gefühl ließ nicht nach.
Ohne sich umzudrehen, machte sie eine leichte Kopfbewegung zur Seite, und diese reichte aus, um einen Blick auf lange Mäntel und Velourhüte zu erhaschen, deren Träger dafür verantwortlich waren, dass sie ihre Schritte beschleunigt hatte. Also doch! Gestapo. Wer am hellen Nachmittag eine Frau verfolgte, musste sich seiner Sache sicher sein, weil er es in dem Bewusstsein tat, die Staatsmacht hinter sich zu haben.
Sie wurde langsamer, als auf der rechten Seite die Auslage eines Bekleidungsgeschäfts auftauchte, und blieb schließlich vor dem Schaufenster stehen, als wollte sie die Ware betrachten. Das Schaufenster lag ein gutes Stück hinter Straße und Bürgersteig. Ihre Verfolger schlossen zu ihr auf, gingen aber nicht weiter. Zum Glück trug sie weder die Kamera noch sonstige Beweisstücke mehr bei sich, die es zu verbergen galt. Ob die Männer die Übergabe zwischen Rolf und ihr beobachtet hatten?
»Fräulein Bendt«, hörte sie einen der Verfolger hinter sich sagen.
Sie drehte sich um. Kein Zweifel, es waren die Männer aus dem Lokal. Sie waren mittleren Alters, der eine hochgewachsen und hager, der andere stämmig und kaum mittelgroß.
»Ja, bitte?«
»Gestapo, wir haben eine Frage an Sie«, sagte der hagere Mann.
Marion versuchte, Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Weshalb waren die Männer im Lokal von Mutter Maenz gewesen? Hatten sie von ihrem Treffen mit Rolf Michalik gewusst? Oder verhielt es sich so, dass sie schon seit Längerem von der Gestapo beobachtet wurde und die Männer ihr gar von ihrer Wohnung aus zu Mutter Maenz gefolgt waren?
»Was möchten Sie wissen?«, fragte sie und musterte äußerlich gleichmütig ihre Verfolger, während sie doch nicht verhindern konnte, dass ihr Herz heftig schlug.
Der hagere Mann erwiderte ihren Blick. Er hatte kalte blaue Augen, und für einen Sekundenbruchteil fragte sie sich, ob diese Augen jemals Wärme ausstrahlen könnten.
»Sie sind mit Herrn Felix Neuburger befreundet?«
Kaum dass der Name gefallen war, kam ihr ein übler Verdacht.
»Wir kennen uns gut«, erwiderte sie. »Er ist mein Kollege, mein Tanzpartner in dem Lokal, in dem ich arbeite.«
»Und weiter?«, fragte der hagere Mann.
»Das ist alles.«
Er fixierte sie mit einem durchdringenden Blick. »Um eines gleich klarzustellen«, sagte er. »Entweder Sie beantworten meine Fragen auf der Stelle wahrheitsgemäß und vollständig, oder Sie kommen mit uns mit. Haben wir uns verstanden?«
Marion spürte, wie sie blass wurde. »Ja, natürlich, entschuldigen Sie.«
»Gut, dann bleiben Sie dabei«, sagte der Hagere. »Ist Ihnen das Gesetz zum Schutz deutschen Blutes bekannt?«
Es war genau das, was sie befürchtet hatte. Doch sie zögerte nur kurz, bevor sie antwortete: »Ich habe davon gehört.«
Die Männer traten noch ein Stück näher, bauten sich fast bedrohlich vor ihr auf.
»Das Gesetz untersagt intime Kontakte zwischen Deutschen und Juden. Ist Ihnen das bekannt?«
Marion nickte. »Nicht die Einzelheiten, aber – ja, die Verbote sind mir bekannt.«
»Warum verstoßen Sie gegen das Gesetz, wenn Sie es kennen?«, fragte der andere Mann, der wohl einige Jahre jünger als sein Begleiter war.
Plötzlich wurde Marion argwöhnisch. Wer waren diese Leute überhaupt? Sie machte einen Schritt zur Seite, um die Distanz zu ihnen ein wenig zu vergrößern. »Bitte nennen Sie mir Ihre Namen! Ich möchte gern Ihre Ausweise sehen.«
Der Ältere der beiden nickte. Er schien das Kommando zu haben. »Mein Name ist Krausnick«, stellte er sich vor und ließ Marion dann einen Blick in das Dokument werfen, das er aus der Innentasche seines Mantels zog. »Mein Kollege heißt Göde.«
Die Ausweise, die die Männer ihr vorhielten, schienen echt zu sein.
»Sie irren sich! Ich verstoße gegen keine Gesetze«, stellte Marion fest. Inzwischen hatte sie sich wieder gefasst.
»Sie wissen, dass Herr Neuburger mosaischen Glaubens ist?«, fragte Krausnick und schob das Dokument wieder in seine Manteltasche zurück.
»Nein, davon weiß ich nichts.«
»Herr Neuburger ist Jude«, sagte Göde.
Marion warf ihm nur einen schnellen Blick zu. Er überragte sie kaum. Aber mit ihren langen Beinen machte sie eindeutig die bessere Figur. »Sie wissen beide mehr als ich. Was ist denn mit Herrn Neuburger?«
»Es geht nicht um Herrn Neuburger, sondern um Sie«, reagierte Krausnick. »Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor, wonach Sie mit Herrn Neuburger eine Beziehung unterhalten, die als Rassenschande gelten muss.«
Marion schaute zur Seite. Immer wieder eilten Passanten vorüber, aber niemand warf auch nur einen Blick in ihre Richtung. Die Menschen hatten einen Instinkt dafür entwickelt, einen Bogen um Szenen dieser Art zu machen.
»Ich begehe keine Rassenschande«, sagte sie nach einer Weile leise. »Wer behauptet so etwas? Wer hat mich angezeigt?«
»Bleiben Sie bei der Wahrheit!«, reagierte Göde forsch und trat etwas näher an sie heran. »Eindeutige Tatsachen zu leugnen, wird Ihnen nichts nützen, Fräulein Bendt. Wir wissen, dass Sie geschlechtlich mit Herrn Neuburger verkehrt haben, das lässt sich beweisen. Machen Sie reinen Tisch! Nur, wenn Sie ein Geständnis ablegen, können Sie auf Milde hoffen.«
Was sie fühlte, war mehr Ärger als Angst. Weshalb wurde sie überhaupt auf der Straße angesprochen? Schickte die Gestapo nicht normalerweise eine Vorladung? Sie hatte mehrfach von diesen Vorladungen gehört, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzten, weil sie oft nicht einmal wussten, was man ihnen vorwerfen würde. Ihr war klar, dass wegen Rassenschande nur ein Mann bestraft werden konnte, aber sie wusste auch sehr gut, dass dies nur die halbe Wahrheit war. Die Frau war deshalb nicht außer Gefahr. Im Gegenteil: Eine Frau mit lockerem Lebenswandel, oder eine, die man dafür hielt, galt bei den Behörden von vorneherein als verdächtig. Wenn sie sich mit einem Juden einließ, musste sie damit rechnen, zu Besserungszwecken in ein Konzentrationslager eingeliefert zu werden. In der Regel war die Frau infolgedessen genauso schlecht dran wie der Mann, vielleicht sogar schlechter. Trotzdem sagte Marion sich, dass sie keinen Grund hatte, in eine Schockstarre zu verfallen. Sie war nicht schutzlos, sondern besaß Verbindungen zur Partei. Ein Umstand, der sie andererseits nicht dazu verleiten sollte, unvorsichtig zu sein.
»Ich habe nicht gesagt, dass es kein Verhältnis zwischen uns gibt, sondern nur, dass es kein verbotenes Verhältnis ist.«
»Sie geben also zu, dass Sie mit Herrn Neuburger intimen Verkehr hatten?«, fragte Göde.
Der Kerl war genauso plump, wie sie befürchtet hatte. Doch würde es ihr etwas nützen, den Vorwurf des geschlechtlichen Umgangs zu bestreiten? Letztlich war diese Tatsache nicht zu verbergen. Weit schwieriger würde es für die Gestapo sein, ihr zu beweisen, dass sie gewusst hatte, dass Felix ein Jude war.
»Wenn Herr Neuburger Jude wäre, wüsste ich es«, sagte sie.
»Aha«, lachte Göde. »Hat er Ihnen seinen Arierausweis vorgelegt?«
Sie schaffte es, sich von der Frage nicht verunsichern zu lassen. »Er gab keinen Grund, weshalb ich ihn mir hätte vorlegen lassen sollen.«
»Und warum nicht?«, fragte Göde.
»Herr Neuburger ist nicht beschnitten.«
Göde erwiderte nichts, als hätte ihre Antwort ihn für den Moment sprachlos gemacht. Stattdessen betrachtete er ihren langen Hals, das nackte Dekolleté zwischen den Kragenaufschlägen ihres Sommermantels, und ihr kam es vor, als wäre er gerade dabei, sie in Gedanken auszuziehen.
»Woher wissen Sie das?«, fragte er schließlich.
Weil wir beim Vögeln nicht das Licht ausmachen, hätte sie am liebsten geantwortet, aber nicht immer trug Frechheit den Sieg davon. Sie wollte den Mann nicht noch zusätzlich provozieren, denn sie musste damit rechnen, dass dieser es bereits als anmaßend empfand, dass sie als unverheiratete Frau ein geschlechtliches Verhältnis zu einem Mann unterhielt.
»Sie können es sich wohl denken«, sagte sie. »Darf ich jetzt weitergehen? Ich habe Ihre Fragen beantwortet.«
»So ein Früchtchen wie Sie ist mir überhaupt noch nicht untergekommen, Fräulein Bendt«, sagte Göde, den anscheinend selbst ihre ausweichende Antwort empörte.
So konnte sie nicht mit sich umspringen lassen, dachte Marion. Auf keinen Fall durfte sie nachgeben und sich schuldig bekennen.
»Erkundigen Sie sich bitte bei Ihren Vorgesetzten nach mir, Herr Göde«, entgegnete sie, »dort werden Sie erfahren, dass ich kein Früchtchen bin und dass Sie falsche Vorwürfe gegen mich erheben.«
Natürlich würde der Vorgesetzte der Herren sie nicht rechtfertigen können. Aber sie war eine Mitarbeiterin der Abwehr und niemand, mit dem diese Beamten tun und lassen konnten, was sie wollten. Es war ein Versuch, sich selbst gegenüber der Staatsmacht zu behaupten.
»Ich sehe schon, Sie möchten uns gern begleiten«, sagte Göde und ein unverschämtes Grinsen trat auf sein Gesicht. »Gut, wenn Sie es so wollen. Ich habe nichts gegen Ihre aparte Gesellschaft einzuwenden, Fräulein Bendt.«
Marion schaute an den Männern vorbei in Richtung Tauentzien. Nicht weit entfernt toste der städtische Verkehr. Busse und Straßenbahnen donnerten vorüber und über allem glänzte der herrliche Sommertag. Doch sie fühlte sich auf merkwürdige Weise davon getrennt, ebenso wie von den Menschen, die vorübergingen; als hätten das Sonnenlicht und der städtische Alltag nichts mehr mit ihr zu tun.
»Ich kann Sie nicht begleiten«, erwiderte sie. »Falls es noch weitere Fragen gibt, müssen Sie mir eine Vorladung schicken. Damit kann ich mich dann an die vorgesetzten Dienststellen wenden.« Äußerlich gleichmütig musterte sie ihre Verfolger.
»Mitkommen!«, sagte Göde. »Gehen wir zum Wagen.« Er machte Anstalten, nach Marions Arm zu greifen, doch Marion entzog sich ihm durch einen neuerlichen Schritt zur Seite.
Krausnick warf einen Blick die Straße hinunter. »Nicht so schnell, Herr Kollege«, bemerkte er, »wir wollen nichts überstürzen. Wie Sie sehen, ist das schöne Fräulein nicht auf den Mund gefallen. Und wo die Dame recht hat, da hat sie erst einmal recht.« Sein Blick schweifte ein weiteres Mal ab, als ob sein Verstand eine gedankliche Pause brauchte, dann sah er Marion wieder an. »Natürlich wollen wir Ihnen nicht schaden, Fräulein Bendt, diese Ansprache durch uns ist allein zu Ihrem Besten gemeint. Ich denke, Sie haben verstanden. Betrachten Sie unsere Fragen als Warnung. Sie können sicher sein, dass wir Sie im Auge behalten werden.«
Er war nicht dumm, erkannte Marion; er brauste nicht auf, war sich nicht zu schade, den Rückzug anzutreten, wenn es sich als zweckmäßig erwies. Der Gestapobeamte war ein Mann, der seine Gegner in Sicherheit wog, bevor er zum vernichtenden Schlag gegen sie ausholte. Sie wusste, was das bedeutete. Krausnick war weit gefährlicher als sein Kollege Göde, der alles in allem recht vorhersehbar reagierte.
»Jeder von uns tut seine Pflicht«, sagte sie. »Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen und so wird es auch in Zukunft sein.«
Krausnick führte die Hand zum Kopf und lüftete seinen Hut. »Kommen Sie, Göde. Einen angenehmen Tag noch, Fräulein Bendt.«
Göde fügte sich nach kurzem Zögern der Anordnung seines Kollegen, und indem er Marion zum Abschied noch einmal angrinste, folgte er seinem Herrn und Meister.
Eine Weile stand sie noch da, schaute zu den Kastanien, die die Straße mit den hochgeschossigen Gebäuden säumte. Vögel zwitscherten. Ein Stück weiter die Straße hinunter spielten Kinder auf dem breiten Trottoir. Die Sonne neigte sich zum Horizont und würde bald golden im Westen erglühen.
Es war wie in den Zeiten der Hexenverfolgung, dachte sie. Damals wurden Frauen von Männern beschuldigt, mit Satan verkehrt zu haben, und über ihr Intimleben mit inquisitorischen Fragen verfolgt. Heute war es nicht anders. Wenn sie nicht gestand, musste sie damit rechnen, inhaftiert und gequält zu werden.
Schließlich ging sie weiter. Rassenschande, was für ein Blödsinn. Felix Neuburger war Halbjude, das hatte er ihr kürzlich erzählt, und ihr somit eine Erklärung geliefert, wieso er keinen Stellungsbefehl erhalten hatte. Doch konnte ein Halbjude überhaupt Rassenschande begehen? Halbe Rassenschande sozusagen? Aber so wie die Dinge in Deutschland standen, war diese wahrscheinlich auch verboten.
Sie war doch ein wenig beunruhigt. Wer hatte sie angezeigt? Es musste jemand sein, der hinter der Bühne verkehrte, denn nur dort konnte sie jemand mit ihrem Geliebten beobachtet haben.
Verdammte Denunzianten, dachte sie. Diese Menschen waren eine regelrechte Pest. Was sie taten, gehörte zu den schlimmsten Dingen, die in diesem Land in den letzten Jahren Verbreitung gefunden hatten. Sogar der Führer hatte vor den Denunzianten gewarnt, er mochte sie nicht, auch wenn ihre Anzeigen seiner Partei nützten.
Sie überlegte, eine Telefonzelle aufzusuchen, um mit Rolf Michalik zu sprechen. Doch war das notwendig? Sie würde ihm von Felix erzählen müssen, und sie war sich nicht sicher, wie er auf ihr Geständnis von dieser Beziehung reagieren würde.
War das Ganze womöglich ein Racheakt aus enttäuschter Liebe? Vielleicht eine der Tänzerinnen, die ein Auge auf Felix geworfen hatten? Oder steckte noch etwas anderes dahinter?
Sie blickte auf die Uhr an ihrem Handgelenk. Auf jeden Fall musste sie Felix warnen, so viel stand fest. Er besaß kein Telefon, aber in ein paar Stunden würde sie ihn ohnehin treffen. Bis dahin hatte die Sache sicherlich Zeit. Was sollte die Gestapo schon machen? Etwa nachsehen, ob Felix Neuburger beschnitten war?
Sie setzte ihren Weg in Richtung Tauentzien fort. Es wurmte sie, dass man ihr den Spaß verderben wollte. Sie würde nicht nachgeben, dachte sie bei sich, und so konnte ihre Antwort nur lauten: jetzt erst recht.
4. Kapitel
Das Coco, in dem Marion als Tänzerin und Barkellnerin arbeitete, war ein Nachtlokal, eine kleine Tanzbar. Über den Abend verteilt fanden Varieté-Einlagen statt, die von gut gewachsenen Tänzerinnen bestritten wurden. Von der Bar im vorderen Teil des Lokals gelangte man über einen breiten Durchgang auf ein spiegelndes Tanzparkett, an das auf der rückwärtigen Seite eine kleine Bühne angrenzte; eine aus wenigen Musikern bestehende Swingkapelle hatte auf dem Podest ihren Platz. Die Band, mit dem Akkordeon als melodieführendes Instrument, spielte die neuesten Songs aus amerikanischen Musikfilmen. Zwischen amerikanischem Jazz, deutschem Swing und Tanzmusik aller Art wurden auch rheinische und Wiener Lieder gespielt, wenn die Stimmung danach war, oder Gäste anwesend waren, von denen anderenfalls Beschwerden zu befürchten waren.
Marion traf Mustafa, den Besitzer des Coco, auf dem Weg zur Garderobe. Der Ägypter trug auf Hochglanz polierte schwarze Schuhe, einen modischen Anzug und pechschwarze, nach hinten gekämmte Haare. Er war in den späten Dreißigern und hatte ein freundliches Gesicht, auf dem immer ein zuvorkommendes Lächeln lag. Da er außerdem ein guter Tänzer war, hätte man ihn leicht für einen Gigolo halten können.
»Oh, Marion, mein bestes Pferdchen im Stall«, sagte er, »wenn ich dich nicht hätte, ginge es mir schlecht. Die Konkurrenz schläft nicht, aber gegen Felix und dich kommt so leicht niemand an.«
»Übertreib nicht, Mustafa, als Felix noch nicht da war, lief das Lokal fast genauso gut.«
»Was früher war, reicht heute nicht mehr. Noch läuft es ausgezeichnet, aber jeden Tag kann es damit vorüber sein«, lamentierte der Barbesitzer. »Es sind keine normalen Zeiten, seit einer Woche spielt die ganze Stadt verrückt. Alle reden vom drohenden Krieg, und diejenigen, die nicht davon reden, denken daran. Was soll ich bloß machen, wenn es wirklich ernst wird? Etwa fortgehen aus Berlin?«
»Du musst dir etwas einfallen lassen, um den Laden am Laufen zu halten, du bist doch nicht erst seit gestern in diesem Geschäft.«
Marion hatte ihren Chef einmal gefragt, wie er aus seiner Geburtsstadt Kairo nach Berlin gekommen war, doch nach der Geschichte, die er ihr erzählt hatte, war sie nicht viel schlauer gewesen als zuvor. Er verstand sich darauf, mit vielen Worten nichts zu sagen, die Damenwelt, deren Herz er erobert hatte, störte es nicht. Sein Weg aus der Heimat hatte ihn vor zwölf Jahren zunächst nach Paris und im Jahre 1932 dann weiter nach Berlin geführt. Viel mehr war ihr aus seinen gelegentlichen Berichten nicht in Erinnerung geblieben. Es spielte auch keine Rolle. Bedeutsam war etwas anderes: Mustafa hatte in ihr die Liebe zum Tango geweckt.
»Immer etwas Neues, noch besser, noch frivoler«, sagte er, »nur dann bleibt man auf der Höhe der Zeit. Je nackter, umso besser, heißt es in diesem Jahr. Noch im vergangenen Jahr hätte ich Bedenken gehabt, euren gemeinsamen Auftritt ins Programm zu nehmen, doch in diesem Sommer ist in Berlin alles erlaubt. Man fragt sich, wie das Ganze noch überboten werden soll.«
»Den Eindruck haben alle«, sagte Marion.
»Oh, es geht natürlich immer noch ein bisschen mehr«, sagte Mustafa mit einem Schmunzeln. »Was unterscheidet Berlin von Städten wie London und Paris?«
»Sag es mir, Mustafa!«
»In Berlin geht es nicht lasterhafter als in den anderen Städten zu, nur weniger verschämt und nicht so heuchlerisch.«