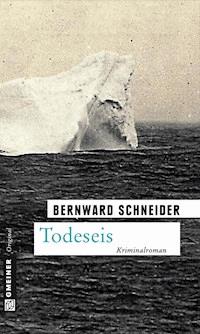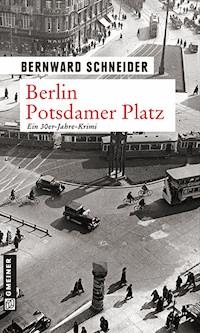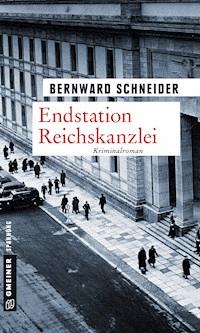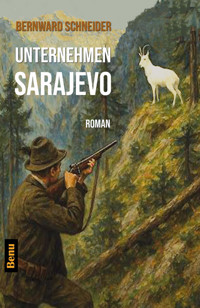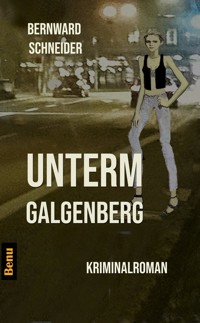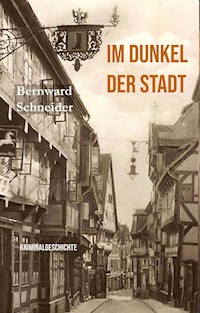
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Im Dunkel der Stadt« ist eine spannende Kriminalgeschichte von Krimi-Autor Bernward Schneider, die aus bisher drei Episoden besteht und am Ende der 1890er Jahre in Hildesheim spielt. Hildesheim war eine alte deutsche Stadt mit einem gewachsenen mittelalterlichen Stadtbild und galt bis zu seiner Zerstörung am 22. März 1945 als das »Rotenburg des Nordens«. Die drei hier veröffentlichten Teile sind durch einen roten Faden miteinander verknüpft. Im Laufe der Zeit sollen weitere Episoden hinzukommen. -- 2. erweiterte Auflage 2023.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bernward Schneider
Im Dunkel der Stadt
Kriminalgeschichte
Inhaltsverzeichnis
3. Kapitel
Impressum
Bernward Schneider
Im Dunkel der Stadt
Eine Hildesheimliche Kriminalgeschichte
Benu Krimi Edition
Eine »Hildesheimliche Kriminalgeschichte« in Form eines Episodenromans. Die ersten drei Teile sind hier veröffentlicht. Ich hoffe, dass im Laufe der Zeit weitere Episoden hinzukommen werden. Die Episoden sind durch einen roten Faden miteinander verknüpft, von dem ich nicht weiß, wohin er führen wird.
Teil I Im Dunkel der Stadt
1. Kapitel
An einem Sommerabend des Jahres 1895 klopfte es an der Tür meines Hauses am Alten Markt. Draußen stand ein älterer Mann, der sich mir als Bediensteter des Kaufmanns Beuken vorstellte. Er war außer Atem und hatte ein gerötetes Gesicht, als ob er gelaufen sei.
»Kommen Sie schnell, Herr Advokat Fasterling«, rief er mir zu, »dem Herrn geht es schlecht! Es ist wegen seines Testaments!«
Ich griff mir Jacke, Papier und Stift und folgte Beukens Diener hinaus in den hellen Abend.
Sein Herr habe sich nach dem Abendessen unwohl gefühlt, berichtete mir der Mann, während wir die Dammstraße hinuntereilten; der herbeigerufene Arzt habe ein bedenkliches Gesicht gemacht und eine Medizin verordnet, mit der sich Herr Beuken zur Ruhe begeben habe; aber eine halbe Stunde später habe sein Herr nach ihm gerufen und erklärt, er befürchte, sein Ende stünde bevor, doch solle nicht der Arzt, sondern der Advokat gerufen werden.
Wir bogen in die Alfelder Straße, wo sich Beukens Haus befand. Es war ein Gebäude im englischen Tudorstil; mit seinen Ecktürmchen, Zinnen und Sandsteinquadern unterschied es sich auffallend von den Fachwerkhäusern mit ihren spitzen roten Dächern, wie sie im inneren Bereich der Stadt üblich waren.
Die Halle, in die wir traten, war mit fremdländischen Exponaten geschmückt; Statuen und Masken, die von den Reisen stammten, von denen ich wusste, dass Beuken sie in ferne Länder unternommen hatte.
Nachdem wir eine Treppe hinaufgestiegen waren, öffnete der Diener eine Tür.
»Oh, der Herr hat sich erhoben«, hörte ich ihn sagen, kaum dass er die Kammer betreten hatte, »es scheint …«
Jäh verstummte die Stimme des Mannes, und ich sah, wie er eine unwillkürliche Bewegung des Erschreckens machte.
Schnell trat ich vor. Kaufmann Beuken saß reglos in einem Sessel neben dem Bett. Seine Augen waren geschlossen. Der linke Arm lag schlaff auf einer Stuhllehne.
»Herr Beuken«, rief ich ihn an, »Was ist Ihr Wunsch wegen des Testaments?«
Der Kaufmann reagierte nicht, und so beugte ich mich zu ihm hinunter und tastete nach dem Puls an seinem Arm. Ich konnte jedoch nichts finden.
»Er ist tot«, murmelte ich, nachdem ich ein paar Mal an der Schulter des reglos Dasitzenden gerüttelt hatte. »Niemand kann ihm mehr helfen. Kein Advokat, aber auch kein Arzt.«
»Ach, wäre er doch liegen geblieben!«, äußerte der Diener bestürzt. »Sicher hat er sich aus dem Bett erhoben, um Ihnen zu beweisen, dass er noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sei.«
»Das lässt sich vermuten«, erwiderte ich. »Hat Herr Beuken seinen letzten Willen Ihnen gegenüber geäußert?«
Der Diener schüttelte den Kopf. »Er sprach von einer Stiftung für Bedürftige. Mehr ließ er nicht verlauten.«
»Warum hat er nicht früher ein Testament errichtet?«, sagte ich mit einem Kopfschütteln. »Fühlt man bereits das Ende nahen, ist es häufig zu spät.«
Der Diener sah mich merkwürdig an. »Herr Beuken hatte am späten Nachmittag Besuch von einem mir unbekannten Herrn. Aber ich kann nicht sagen, ob der Entschluss meines Herrn mit dem Besuch zusammenhing.«
»Wer war dieser Besucher?«
»Ein junger Herr, der seinen Namen nicht nannte. Er schien mir kein Hiesiger zu sein.«
Ich überlegte einen Moment, ob mit dem Hinweis etwas anzufangen war, konnte aber nichts daran finden.
»War der Arzt zugegen, als Beuken von seinem letzten Wunsche sprach?«
»Nein, der Arzt war bereits gegangen.«
Ich seufzte. »Dann gibt es für mich nichts mehr zu tun. Um ein Nottestament zu errichten, hätte es dreier Zeugen bedurft. So muss alles seinen Lauf nehmen, wie es eben ist. Wer sind die nächsten Angehörigen?«
»Sie werden wissen, dass Herr Beuken unbeweibt und kinderlos war«, erwiderte der Diener. »Es gab eine jüngere Schwester, die in Göttingen heimisch war, aber schon vor einiger Zeit verstarb, wohl unter Hinterlassung einer Tochter. Genaueres ist mir nicht bekannt.«
Beuken war schon in mittleren Jahren durch einen Importhandel mit orientalischen Ländern zu Geld und Ansehen gekommen, wie ich wusste. Er war ein alter Hagestolz gewesen und hatte als Weiberfeind gegolten. Wie der berühmte Bankier Pelizaeus, mit dem er befreundet war, galt er außerdem als weitgereister Mann, wobei sein hauptsächliches Interesse angeblich den okkulten Wissenschaften des Orients gegolten hatte. Wer auch immer von seinen entfernteren Verwandten in den Genuss der reichhaltigen Erbschaft kommen würde – er konnte sich freuen.
»Holen Sie den Arzt, damit er den Totenschein ausstellt, guter Mann«, sagte ich zu dem Bediensteten. »Ich werde derweil im Hause zuwarten.«
»Auch den Senator Wiechens werde ich benachrichtigen«, erwiderte der Diener, »und mich nach seinen Weisungen richten, was zu veranlassen ist. Herr Wiechens war der beste Freund meines Herrn.«
Er eilte davon und kehrte schon nach ein paar Minuten mit dem Arzte zurück. Dieser konstatierte nach kurzer Untersuchung, dass der Kaufmann einem Herzschlag erlegen sei.
Noch während der Arzt mit dem Totenschein beschäftigt war, traf Senator Wiechens ein. Er war ein grauer Herr nahe den Sechzigern und einer der bedeutendsten Männer der Stadt.
Der Senator zeigte sich erschüttert. »Mein Freund war noch bei guter Gesundheit, als ich ihn am vergangenen Sonntag zuletzt sah!«
Der Arzt zuckte mit den Achseln. »In das Herz eines Menschen kann niemand blicken«, sagte er und unterschrieb den Schein. »Solche Schläge geschehen ganz plötzlich. Er hat offenbar nicht gelitten, sondern einen Tod gehabt, wie man ihn sich wünscht.«
Mit diesen Worten verabschiedete er sich.
Ich fragte den Senator, ob Herr Beuken je von seinem Testament zu ihm gesprochen habe. Wiechens verneinte. Er werde sich jedoch gleich am nächsten Tag beim Nachlassgericht erkundigen, ob dort ein älteres Testament hinterlegt sei, fügte er hinzu; falls nicht, sei wohl eine Nichte die gesetzliche Erbin, Tochter einer vorverstorbenen Schwester. Er würde alles veranlassen, was zu unternehmen sei, und das so, wie es sich geziemte.
Es gab nichts mehr für mich zu tun, und so wünschte ich dem Senator und dem Bediensteten eine gute Nacht und verließ das Haus.
Draußen hatte die Dämmerung eingesetzt. Das Licht einer Gaslaterne verbreitete einen milden orangefarbenen Schimmer. Ein Stück außerhalb des Scheins fiel mein Blick auf eine männliche Gestalt, die sich im selben Moment, da sie meiner ansichtig wurde, abwendete und mit zügigen Schritten in Richtung Stadt entfernte.
Das Gesicht des Mannes hatte ich nicht erkennen können. Doch es musste ein noch junger Mann sein, denn sein Gang war auffallend leichtfüßig und beschwingt, federnd und behände, wodurch seine Erscheinung gefällig wirkte.
Ich musste an den nachmittäglichen Besucher denken, von dem Beukens Bediensteter gesprochen hatte, und fragte mich, ob jener wohl mit dem Davonschreitenden identisch war. Einen Augenblick spürte ich den Impuls, dem Manne hinterher zu eilen, um ihn gewissermaßen zur Rede zu stellen, doch ich ließ schließlich davon ab, da es keinen rechten Grund dafür gab.
Kurz darauf war der Mann hinter der Ecke zur Dammstraße verschwunden.
2. Kapitel
Einige Tage darauf begrub man Kaufmann Beuken auf dem Marienfriedhof vor den Toren der Stadt. Beuken war ein vielseits geachteter und angesehener Kaufmann gewesen, und wer in der Stadt Rang und Namen hatte, war zu der Beerdigung erschienen. Unter den Trauergästen erblickte ich eine schwarz verschleierte Dame, die ich nicht zuordnen konnte und der ich kurz kondolierte. Sie schien recht jung zu sein und vermittelte mir trotz ihrer Umhüllungen den Eindruck einer anmutigen Gestalt.
Beim Verlassen des Friedhofs sah ich die Dame im Gespräch mit Senator Wiechens. Gleich darauf bestieg sie eine Kutsche, die vor dem Friedhof gewartet hatte. Vorn auf dem Bock saß der mir bekannte Diener des Kaufmanns Beuken in livrierter Kutscheruniform.
Ich wollte mich gerade entfernen, als ich den Ratsherrn Wiechens auf mich zukommen sah.
»Fräulein Liane Amiens wünscht, dass Sie an der kleinen Begräbnisfeierlichkeit teilnehmen, die in zwei Stunden im Hause des Verstorbenen stattfindet«, erklärte er, und fügte hinzu, jene Dame sei die Nichte und Erbin des Verstorbenen und hätte die bedeutenderen Teilnehmer des Begräbnisses zu dem Empfange eingeladen.
Ich war nicht sonderlich erpicht darauf, an diesem Leichenschmaus teilzunehmen, auch wenn er der Vorstellung der Erbin diente, aber da ich mein Erscheinen als eine Pflicht empfand, sagte ich zu.
Vom Friedhof kehrte ich zurück zum Alten Markt. Das Haus, das ich dort zusammen mit meiner betagten Mutter bewohnte, war eines der besseren Häuser der Straße, und auch meine Kanzlei befand sich darin. Ich brachte in einer Mandantenangelegenheit, die eilig war, einen Brief zu Papier und machte mich dann auf den Weg zum Postkasten.
Von dort setzte ich, ohne noch einmal umzukehren, meinen Weg zu der Feier des Andenkens des Verstorbenen fort.
Es war ein schöner Sommertag, und es machte mir Freude, den Besuch bei der Trauergesellschaft mit einem Spaziergang durch die sommerlichen Wiesen der Innersteaue zu verbinden, um den frühen und noch ganz hellen sommerlichen Abend eine kleine Weile genießen zu können.
Alles in allem war ich guter Dinge, während ich durch die Sonne spazierte; dann jedoch musste ich an den Verstorbenen denken, und mit diesem Gedanken wölbte sich vor meinem Geiste die Frage, ob mir ein ähnliches Schicksal wie dem alten Hagestolz drohte und ich eines nicht fernen Tages wohl in den Ruf eines Weiberfeindes käme. Einmal mehr empfand ich, wie widrig es doch war, eine Gesellschaft wie die, zu der man mich geladen hatte, allein und ohne treue Begleiterin aufsuchen zu müssen. Die meisten Freunde in meinem Alter hatten Frau und Kinder; nur ich war immer noch allein. Bald nach Überschreiten des dreißigsten Jahres, nachdem mein beruflicher Stand mir einigermaßen gefestigt schien, hatte ich damit begonnen, mich nach einer Frau umzusehen. Einige Herren, die unverheiratete Töchter besaßen, waren mit mehr oder weniger eindeutigen Hinweisen an mich herangetreten, und es gab mehrere Familien mit jungen Damen, die ich besucht hatte. Doch die Richtige hatte ich nicht gefunden, und Jahr um Jahr war verstrichen, ohne dass sich eine Verbindung ergeben hätte, der ich nicht das alleinige Zusammenleben mit der Mutter vorgezogen hätte.
Als ich die Tudorvilla des verstorbenen Herrn Beuken erreichte, stellte ich beim Blick auf meine Taschenuhr fest, dass es noch einiges vor der geladenen Stunde war. Offenbar war ich von allen Gästen der erste. Am besten, ich wartete, bis jemand mir Bekanntes erschiene, dachte ich bei mir, sah dann aber, dass das Gartentor weit geöffnet stand.
Einem inneren Impulse folgend, ging ich weiter und schlenderte unter der im Westen sinkenden Sonne durch das Tor hindurch.
Ein grasüberwachsener Weg führte zwischen Gesträuch seitlich an dem Gebäude entlang und öffnete sich dahinter auf einen Rasen, der von Farnkraut, Schlingpflanzen und wilden Blumen eingefasst war. An seinem Ende hing eine Weide herab über ein Gartenhäuschen und beschattete eine steinerne Bank, die inmitten der stillen Pracht zum Verweilen einlud.
Es war etwas Märchenhaftes um den einsamen Ort; doch war es weniger die Ansicht des sommerlichen Gartens, als vielmehr der Anblick der jungen Dame, die ganz allein auf dem steinernen Bänkchen vor dem Gartenhause saß, der meine Schritte bannte und mich verblüfft und fasziniert innehalten ließ.
Die Erscheinung der jungen Frau war so lieblich, ihr Gesicht so elfenhaft schön, dass mir für einen Moment war, als würde ich träumen. Welch ein bezauberndes Geschöpf, dachte ich, während ich zugleich gewahrte, dass das herrliche Wesen dem Mädchenalter längst entwachsen und zu einer zarten Jungfrau herangeblüht war. Das Grün des Baumes umgab sie wie eine leuchtende Aureole, die mit dem in der späten Sonne glitzernden Grün des Rasens auf das Herrlichste verschmolz. Kein Maler wäre imstande gewesen, ein ansprechenderes Bild auf eine Leinwand zu werfen, als das, was ich so unerwartet vor meinem Auge sah.
Endlich erkannte ich sie: Es war niemand anderes als Liane Amiens, die Nichte des Verstorbenen. Die junge Frau hatte sich der schwarzen Jacke, die sie am Grabe des Onkels getragen, entledigt und auf die Bank gelegt. Sie trug eine weiße Bluse mit kurzen Ärmeln, ihre schlanken runden Arme waren von schönster Gestalt. Ihr übriger Leib war es nicht minder, wie ich gewahr wurde, denn keine Bekleidung vermochte die Anmut ihres Gliederbaus zu verbergen.
In diesem Moment bemerkte sie mich. Ich deutete eine Geste der Entschuldigung ob meines unbefugten Eindringens an, doch der Blick, mit dem sie mich streifte, war offen und gelöst. Mein Erscheinen hatte sie offenbar in keiner Weise erschreckt; vielmehr war es fast, als hätte sie mit mir gerechnet. Dann begann sie zart zu lächeln.
»Treten Sie doch näher«, sagte sie, da ich stehen geblieben war. »Sie sind der Advokat Fasterling, nicht wahr? Ich kann mir Gesichter gut merken. Senator Wiechens wies mich bereits am Friedhof auf Sie hin und bezeichnete Sie mir als einen Vertrauten des Oheims. Sie sind eine angenehme Erscheinung.«
Ich war verblüfft über ein Kompliment, wie ich es noch nie aus dem Munde einer jungen Frau vernommen hatte, und obendrein von einer, die ich nicht kannte. Aber ich tat wie geheißen, trat näher und ergriff die warme Hand, die sich mir entgegenstreckte. Sie hielt die meine einen Moment fest, länger als üblich, und mir war, als hätte sich noch nie eine menschliche Hand so gut in die meine gefügt.
»Sie vermuten recht, mein Fräulein. Mein Name ist Fasterling. Fräulein Liane Amiens, nehme ich an?«
Sie nickte. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Fasterling.«
Ich fühlte mich wie betäubt und wusste nicht, was ich sagen sollte. Mein Herz war wie geschwollen, und ich fühlte mich unerwartet beseelt. Schließlich wandte ich den Blick von ihr und richtete ihn zu dem Gartenhäuschen und den Blumen.
»Welch zauberhafter Garten.«
»Ja, nicht wahr?«, stimmte das holde Geschöpf mir zu. »Es ist ein englischer Garten. Der Oheim besaß in solchen Dingen ausgezeichneten Geschmack.«
»In der Tat. Ich war noch niemals hier und bin überrascht.«
Sie nickte sinnend. »Der Oheim wohnte ganz allein inmitten dieser Pracht. Wie schade, dass er sein Glück mit niemandem teilte.«
Sie warf mir einen verstohlenen Blick zu, und es durchrieselte mich so köstlich, wie ich es noch nie in meinem Leben empfunden hatte.
»Dies herrliche Anwesen wird nun bald das Ihrige sein, denke ich.«
Sie wandte den Kopf zurück und sah zart zu mir auf. »Ist das wirklich so?«
»Gewiss! Sobald die Formalitäten erledigt sind. Wie ich hörte, sind Sie die einzige Erbin Ihres verstorbenen Onkels.«
»Ach, ich weiß nicht … Mir kam zu Ohren, der Onkel habe ein Testament errichten wollen, um eine kirchliche Stiftung zu bedenken.«
Normalerweise hätte ich an dieser Stelle eine ausweichende Bemerkung gemacht, um nicht ein Thema zu vertiefen, das mich nichts anging und über das zu sprechen mir meine berufliche Verschwiegenheit verbot. Allein, gegenüber diesem schönen Mädchen fühlte ich mein Innerstes wie geöffnet, als dürfte ich keine Geheimnisse vor diesem holden Wesen bewahren. Eine Instanz, höher als alle berufliche Pflicht, schien sich mit all ihren Rechten meiner Seele bemächtigt zu haben.
»Es lag wohl so etwas in der Schwebe«, antwortete ich, »aber aufgrund des plötzlichen Todes Ihres Herrn Onkels kam es nicht dazu.«
Ihr Gesicht wurde ernst, und einen Moment sah sie mich mit merkwürdigem Ausdruck an, als ob sie leichtes Bedauern darüber empfinde, dass ihr Besitz und Vermögen des alten Herrn zugefallen waren.
»Natürlich werde ich mich dem Willen des Oheims fügen und die Kirche mit einer großzügigen Zuwendung bedenken«, sagte sie leise.
Was für ein edler und reiner Charakter, dachte ich bei mir und fühlte mein Herz sich ausdehnen, als wollte es schier zerspringen. Was für ein Glück, dass es dem Kaufmann Beuken nicht mehr vergönnt gewesen war, jenes Testament zu errichten, ging es mir durch den Sinn. Welch Glück für mich! Denn anderenfalls hätte es mir das Schicksal wohl verwehrt, mit diesem holden Wesen Bekanntschaft zu schließen.
Aus der Ferne her erklangen jetzt Stimmen. Sie brachen den Zauber, der mich gefesselt hatte, und Fräulein Liane schien es ähnlich zu gehen. Sie griff nach ihrer Jacke und zog sie über.
»Wir sehen uns gleich darinnen«, raunte sie mir fast verschwörerisch zu, während sie sich erhob. Dann nickte sie kurz mit ihrem Köpfchen und strebte dem Hintereingang zu.
Ich kehrte auf den Weg zurück, auf dem ich gekommen war und erreichte wieder die Straße. Mehrere mir bekannte Senatoren standen vor dem Haus. Sie hatten ihre Gattinnen mitgebracht, die gewiss erpicht darauf waren, die neue Besitzerin des prächtigen Anwesens in Augenschein zu nehmen.
Mit den anderen Gästen zusammen trat ich in die Halle, wo das schöne Fräulein Amiens die Erschienenen begrüßte. Mir selbst schenkte sie ein ganz besonderes Lächeln, während sie so tat, als begrüßten wir einander zum ersten Mal.
Der ältere Diener des Verstorbenen und ein weiterer livrierter Diener empfingen die Gäste mit einem Glas Wein. Dazu wurden kleine Erfrischungen gereicht.
Senator Wiechens führte Fräulein Amiens in die Gesellschaft ein. Es war zu spüren, dass die meisten der anwesenden Herren an der neuen Bewohnerin des Anwesens großen Gefallen fanden, während manche der Damen sich eher reserviert zeigten, einige gar die Nasen hoben und spitze Bemerkungen hören ließen, was wohl dem Neid auf die Schönheit der neuen Hausherrin entsprang.
Einige Damen begannen der schönen Besitzerin Fragen zu stellen, die darauf abzuzielen schienen, sie in Verlegenheit zu bringen, doch das junge Fräulein begegnete diesen Äußerungen auf so überlegene Art, wie man es einer jungen Frau, die kaum mehr als zwanzig Jahre zählen mochte, nicht zugetraut hätte. In ihrem Auftreten lag eine Selbstsicherheit, wie sie sich bei jungen Frauen dieses Alters gewöhnlich nicht findet und die sich vielleicht auch nicht recht geziemte; mich selbst jedoch störte ihr Auftreten nicht. Vielmehr steigerte es noch das Gefühl der Bewunderung, das ich gegenüber der jungen Dame empfand.
Bald kam ich mit verschiedenen der anwesenden Herren und auch mit einigen Damen ins Gespräch, und auch mit einigen der Auswärtigen, die unter den Gästen waren.
Einer von ihnen erregte mein besonderes Interesse, denn es war etwas in seinem Äußeren und in der Art seines Auftretens, das wohl keinen unbeeindruckt gelassen hätte. Die Gestalt des jungen Mannes war an sich nicht imposant, er war allenfalls von mittlerer Größe, doch der Körperbau war auffallend harmonisch, und in allen seinen Bewegungen, auch den geringsten, tat sich eine selbstverständliche Gelassenheit und Anmut kund, eine katzenhafte Geschmeidigkeit, was ihm große Anziehungskraft verlieh. Seine Gesichtszüge waren von angenehmer Regelmäßigkeit, und die glänzenden Augen strahlten vor Lebendigkeit. Ein Günstling der Natur, so wollte es scheinen; einer, der jenen Goldenen Schnitten entsprungen war, zu denen sie sich gelegentlich verstand.
Es ergab sich, dass der junge Mann mit Senator Wiechens im Gespräch beieinander stand, und als ich meine Schritte in ihre Nähe lenkte, geschah das, was ich beabsichtigt hatte – nämlich, dass der Senator mir seine Aufmerksamkeit schenkte und mich herbeiwinkte.
»Ich möchte Ihnen Herrn Robert Merlin vorstellen, einer angesehenen rheinländischen Familie entstammend und ein junger Freund von Herrn Beuken. Er begleitete ihn auf einigen seiner zahlreichen Reisen«, erklärte Wiechens und wandte sich zu dem jungen Mann herum. »Herr Fasterling, einer unserer aufstrebenden jungen Advokaten. Er gehört dem Stiftungsrat des Roemer-Museums an, über dessen Ausstattung Sie sich gestern bei unserer Besichtigung so entzückt zeigten.«
Der junge Mann schaute mich freundlich an, und wir schüttelten einander die Hand.
»Es handelt sich bei Ihrem Museum in der Tat um eine ganz ausgezeichnete Einrichtung«, sagte Herr Merlin. »Die wenigsten der größeren Städte verfügen über Säle mit so großartigen fremdländischen Exponaten, wie sie hier in Hildesheim dem gemeinen Volke präsentiert werden.«
»Aufgrund Ihrer Reisen sind Sie gewiss so etwas wie ein Fachmann in diesen Dingen«, vermutete ich. »Wohin haben die Reisen, die Sie gemeinsam mit Kaufmann Beuken unternahmen, Sie geführt?«
»Nun, nicht ohne Grund beeindruckte mich der Ägyptensaal Ihres Hauses ganz besonders«, erwiderte der fast beklemmend schöne Mann. »Dieses Land ist mir besonders ans Herz gewachsen.«
»Ich hörte bereits, dass auch Herr Beuken Ägypten außerordentlich liebte«, erwiderte ich. »Was ist es, was dieses Land so faszinierend macht? Wonach suchte Herr Beuken dort?«
Merlin sah mich merkwürdig an.
»Er suchte das Geheimnis der Unsterblichkeit zu ergründen«, sagte er leise. Dann lächelte er. »Man braucht viele Reisen und einen langen Atem dazu. Und wohl auch mehr als ein Leben.«
Wiechens räusperte sich. »Herr Merlin ist auch mit Herrn Pelizaeus gut bekannt«, gab er zum Besten, »dem bedeutendsten Sohn unserer Stadt.«
Dass Wiechens den Kaufmann und Bankier Pelizaeus erwähnte, kam nicht von ungefähr; war dieser doch der bedeutendste Förderer des von dem verstorbenen Senator Roemer begründeten Museums. Aus Hildesheim gebürtig, besaß Pelizaeus weit über die Grenzen der Stadt hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Das Ägyptische Zimmer, von dem Merlin gesprochen hatte, war wesentlich aus jenen Schenkungen hervorgegangen, mit denen Pelizaeus das Haus bei seinen gelegentlichen Besuchen in seiner Heimatstadt bedachte.
»Oh ja, Pelizaeus ist ein ausgezeichneter Mann«, bestätigte Merlin. »Ein Eingeweihter, in vielerlei Hinsicht. Mehrfach hatte ich Gelegenheit, ihn an seinen Wirkungsstätten in Ägypten aufsuchen zu dürfen. Durch ihn lernten Herr Beuken und ich uns kennen.«
Eine Erinnerung griff plötzlich nach mir. Wo war ich Merlin schon einmal begegnet? War er es nicht gewesen, den ich am Abend des Todes von Beuken draußen auf der Straße erblickt hatte? Jener junge Mann von geschmeidiger Gestalt, der mit so federnden Schritten davongegangen war? War Merlin auch der Fremde gewesen, der den Kaufmann am Nachmittage davor besucht hatte? Beukens Diener sollte es wissen, fiel mir ein. Bei ihm konnte ich mich nach dem Manne erkundigen.
Wiechens stellte inzwischen weitere Fragen zu Ägypten, und Merlin erzählte von einer Reise, die ihn auf dem Nil bis zu den südlichsten Königsgräbern geführt hatte. Was er zu berichten hatte, interessierte mich durchaus, aber da sich meine Gedanken zugleich an anderem festgemacht hatten und ich in Merlins Nähe eine gewisse Unruhe spürte, hörte ich nur mit halbem Ohre hin.
»Was wären wir ohne Herrn Pelizaeus«, kam Wiechens noch einmal auf den verehrten Förderer zu sprechen.