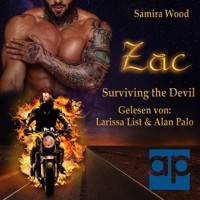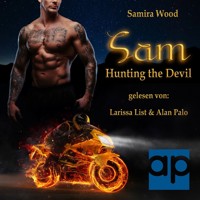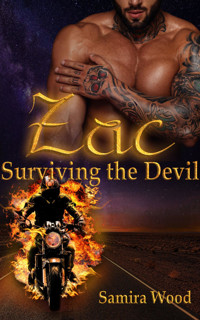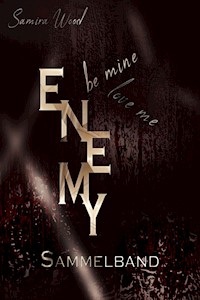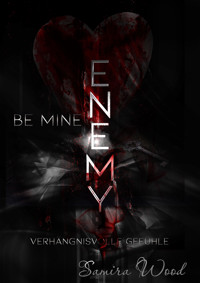3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emma ist traumatisiert und nur die Suche nach ihrer Tochter hilft ihr, sich nicht selbst aufzugeben. Enzo ist ein eiskalter Mafiosi, doch er war nicht immer so. Die Dämonen der Vergangenheit haben ihn dazu gemacht. Kann ausgerechnet er ihr helfen, wieder ins Leben zu finden? Und wird er sie wieder gehen lassen? Jeder Teil der Enemy Reihe ist abgeschlossen. Reihenfolge: Enemy, be mine - Verhängnisvolle Gefühle Enemy, love me - Verbotene Gefühle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Samira Wood
Enemy, love me Verbotene Gefühle
Impressum
© 2020, Samira Wood
https://www.facebook.com/SamiraWoodAutorin/
Alina Jipp
Am Georg-Stollen 30
37539 Bad Grund
Cover
Art for your book Sabrina Dahlenburg
Lektorat, Korrektorat & Buchlayout
Lektorat Buchstabenpuzzle B. Karwatt
www.buchstabenpuzzle.de
Bildmaterial Buchlayout
www.pixabay.com
Die geschilderten Personen und Ereignisse sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
1. Auflage
Auch als Taschenbuch erhältlich!
ISBN-13: 979-8-6111-8735-7
Kapitel 1
Emma
»Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, geliebte Emilia Hope. Happy Birthday to you.« Nachdem ich mein mehr gekrächztes als gesungenes Lied beendet hatte, zündete ich eine Geburtstagskerze an und stellte sie neben das einzige Foto, das ich von meiner Tochter besaß, auf den Tisch. Die Tränen liefen mir dabei ohne Unterlass über die Wangen. Der Schmerz fraß mich regelrecht auf. Das Bild zeigte Emilia im Alter von drei Tagen. Mein Baby fehlte mir so sehr und langsam schwand meine Hoffnung, sie jemals wiedersehen zu dürfen. Raûl war tot und hatte das Geheimnis ihres Aufenthaltsortes mit ins Grab genommen.
An manchen Tagen kam ich kaum noch aus dem Bett. Wozu auch, es gab nichts, wofür das Aufstehen lohnte. Manchmal wünschte ich mir fast, die Gewissheit zu erhalten, dass sie nicht mehr lebte. Dann könnte ich meine sinnlose Existenz auch endlich beenden.
»Emma, Essen ist fertig. Kommst du?« Die Stimme meiner Schwester Keyla riss mich aus diesen trüben Gedanken. Ich bemerkte nicht einmal, dass sie das Zimmer betreten hatte. Ihr Gesicht wurde wehmütig, als sie das Bild und die Kerze ansah. Ahnte sie, woran ich gerade dachte?
»Wir werden sie finden, Emma.« Doch daran zu glauben, fiel mir immer schwerer. Zu oft hatten sie mir das versprochen und zu oft wurde ich hinterher nur enttäuscht.
»Ich habe keinen Hunger.« Den hatte ich schon lange nicht mehr.
»Bitte, Emma. Du musst etwas essen. An dir ist doch schon jetzt nichts mehr dran.« Ihre Fröhlichkeit war inzwischen vollständig aus ihrem Gesicht verschwunden. Stattdessen sah ich dort Sorge und Mitleid. Ich hasste diesen Ausdruck in ihren Zügen. Sie war erst ein paar Monate verheiratet und das mit ihrem Traummann. Nicht wie ich mit einem Monster. Sie sollte glücklich sein, fast noch im Honeymoon, stattdessen kümmerte sie sich ständig um mich und meine Probleme.
»Zum Mittagessen komme ich«, versprach ich ihr halbherzig, nur um sie loszuwerden und weiter in Ruhe trauern zu können.
»Komm wenigstens mit und trink einen Tee. Mario ist auch da, der freut sich immer, dich zu sehen.« Nun lächelte sie wieder leicht. Aber das reichte schon aus, um ihre Augen zum Funkeln zu bringen. »Ich glaube, er hat sich in dich verliebt. Magst du ihn denn auch ein bisschen?« Wahrscheinlich bot ich einen verdammt seltsamen Anblick, als ich sie statt mit einer Antwort nur mit weit geöffnetem Mund anstarrte, denn Keyla grinste nun wieder mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen. Endlich fand ich meine Sprache wieder.
»Wie kommst du darauf?« Mario war nett, aber ich hatte mit ihm nie mehr als ein oder zwei Sätze gewechselt.
»Ich hatte irgendwie gehofft, du könntest seine Gefühle erwidern und damit etwas zurück ins Leben finden. Er ist ein echt guter Kerl – besonders für jemanden, der für die Mafia arbeitet. Außerdem bedeutest du ihm wirklich etwas. Täglich macht er freiwillig mehr, als er muss, um nach Emilia zu suchen.« Davon hatte ich bisher nichts gewusst, aber änderte es irgendetwas? Ich fühlte mich schuldig, aber mehr auch nicht. Und das tat ich sowieso immer. Schließlich war ich schuld daran, dass Raûl mir die Kleine überhaupt weggenommen hatte. Ich hätte nur besser gehorchen müssen und wenn ich seinen Tod verhindert hätte, könnte ich meine Kleine zumindest einmal pro Woche sehen, so wie am Anfang. Aber alles ›hätte‹ und ›könnte‹ half nichts. Meine Fehler würde ich nie wieder ausbügeln können, egal was ich tat. Mir blieb nur zu hoffen, dass man mein Baby, das nun schon ein Kleinkind war, irgendwann fand. Entweder tot oder lebendig. Damit mein Leiden endlich ein Ende finden könnte.
»Also komm wenigstens mit und leiste uns Gesellschaft. Mario würde sich freuen und zum Mittag kommst du sowieso wieder nicht, denn da wird Enzo anwesend sein und dem gehst du ja immer aus dem Weg. Dabei würde er dir nie etwas tun, vor allem nicht hier im Haus.«
»Okay, ich komme mit«, beeilte ich mich, zu antworten. Nicht wegen Mario, aber Enzo ging ich wirklich aus dem Weg. Er war Keylas Schwiegervater und der Boss der italienischen Mafia hier in der Stadt, während Antonio – Keylas Mann – seit der Ermordung unseres Erzeugers den eigentlich mexikanischen Clan leitete. Enzo war ein seltsamer Mann. Jeder wusste, dass er grausam, kalt und ohne Gefühl war. Doch dann hatte er alle überrascht und unsere Mutter zurückgebracht und angeblich sogar nach Emilia gesucht. Ich wusste nicht, was ich von ihm halten sollte. Manchmal warf er mir sehr seltsame Blicke zu, daher ging ich ihm lieber aus dem Weg und jeder hier im Haus akzeptierte das. Wahrscheinlich fühlte ich mich nicht als einzige in seiner Gegenwart unbehaglich.
In der Küche erwarteten uns nicht nur die Männer, die immer hier im Haus waren – Antonio, Mario und Marco, die beiden Hacker, Derek und Ian, Antonios engste Vertraute – sondern auch noch unsere Mamita, die lächelnd am Herd stand. Sie liebte es, alle zu verwöhnen und seit dem Tod unseres Vaters war sie so richtig aufgeblüht. Zum ersten Mal seit Jahren konnte sie nun tun und lassen, was sie wollte. Ich gönnte es ihr, auch wenn ich mich dadurch oft wie eine Außenseiterin fühlte. Immerhin war ich die einzige, die hier im Haus miese Stimmung versprühte wie einen schlechten Duft. Ich hätte besser doch auf meinem Zimmer bleiben sollen.
»Emma, mein Schatz. Das Rührei ist fertig, oder möchtest du lieber etwas anderes? Du bist so dünn geworden, du musst unbedingt mehr essen, mein Schatz.« Nun fing sie auch noch an. Die Männer begrüßten mich alle mit einem freundlichen Nicken, nur Mario sprang sofort auf, rückte mir einen Stuhl zurecht und fragte, was ich trinken wolle.
»O–Saft, bitte.« Schnell goss er mir das Gewünschte ein.
»Kann ich dir sonst noch etwas Gutes tun?«, fragte er eifrig wie so ein Labrador, der um Lob bettelte. Oh Mann. Am liebsten wäre ich schreiend davon gelaufen. Dabei meinten es ja alle nur gut mit mir. Nun stellte Mom mir auch noch einen Teller vor die Nase, auf dem sich eine Portion für drei erwachsene Männer befand. Das würde ich nie essen können. Aber jeder Protest verhallte hier sowieso ungehört. Also hielt ich einfach gleich meinen Mund und führte lieber die erste Gabel dorthin. Doch kaum hatte ich den Mund voll, öffnete sich die Küchentür erneut und sofort jagte es mir einen Riesenschreck ein. Denn niemand Geringeres als Enzo Esposito stand dort und sein Blick bohrte sich regelrecht in meinen. Sollte der nicht erst zum Mittagessen kommen?
Enzo
Normalerweise besuchte ich das Haus, in dem mein Sohn sein Hauptquartier hatte, nicht ohne Ankündigung. Auch wenn seine Leute mich alle kannten und ohne Probleme hineinließen. Doch die misstrauischen Blicke blieben, und würden wahrscheinlich auch nie mehr verschwinden. Fast dreißig Jahre lang hatten die Italiener und die Mexikaner sich bekriegt. Es hatte viele Gräueltaten auf beiden Seiten gegeben, da fiel es den meisten immer noch schwer, nun an den Frieden zu glauben. Wie schwer es ihnen erst fiel, meinen Sohn und eine Frau als Anführer zu akzeptieren, wollte ich gar nicht wissen. Frauen hatten unter Juan Rodriguez nie etwas zu sagen gehabt. Im Gegenteil, er hatte seine Ehefrau zur Sexsklavin ausbilden lassen, seine älteste Tochter mit einem perversen Arschloch verheiratet und seine jüngere auch zu einer Hochzeit zwingen wollen. Doch Keyla war geflohen und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Heute lebten alle drei Rodriguez-Frauen frei in diesem Haus und Keyla führte zusammen mit Antonio – einem der früher verhassten Feinde – das Kartell. Und es funktionierte überraschend gut. Trotzdem blieb das Misstrauen.
Mir selbst fiel es auch noch immer schwer, den Frieden zu wahren. Und das nicht nur zu den Mexikanern, sondern auch den zu meinem Sohn. Jahrelang hatte ich ihn nicht als das annehmen können, was er war. Hatte ihn teilweise sogar gehasst. Um dann genau in dem Moment, in dem er sich in den Händen meiner Feinde befand, zu erfahren, dass ich einer Lüge aufgesessen war. Über zwei Jahrzehnte hatte ich fest daran geglaubt, dass Antonio ein Bastard war, den meine Frau mir unterschieben wollte. Immerhin hatte ich den Vaterschaftstest schwarz auf weiß vor mir gehabt. Konnte ich doch nicht ahnen, dass das Ganze ein abgekartertes Spiel war. Antonio würde mir mein früheres Verhalten zu recht wohl niemals verzeihen. Wie auch, wenn ich es selbst nicht konnte? Also spielte ich weiter den Herzlosen und versuchte dennoch, gleichzeitig Wiedergutmachung zu leisten, indem ich nach dem Baby suchte. Es war Antonio wichtig, also suchte ich danach und nun gab es endlich eine heiße Spur.
»Ich habe Neuigkeiten«, erklärte ich meinen plötzlichen Besuch und sofort verstummten alle Gespräche im gut besuchten Raum. Ich hielt ja nichts davon, zusammen mit meinen Untergebenen zu speisen, aber mein Sohn sah vieles anders als ich. Also sagte ich nichts dazu. Zumal mir das heute die Arbeit sehr erleichterte.
»Hallo, Vater.« Antonio stand auf und kam auf mich zu, um mich zu begrüßen. Obwohl er mich die meiste Zeit meines Lebens hasste, zollte er mir doch den gebotenen Respekt. »Wir haben erst zum Mittag mit dir gerechnet. Möchtest du dich trotzdem zu uns setzen und mit uns frühstücken, oder wollen wir runter in mein Büro gehen und deine Neuigkeiten in Ruhe besprechen?«
»Ich erzähle es am besten hier, denn die Neuigkeiten werden alle interessieren.« Mein Blick wanderte zu Emma, die inzwischen den Kopf gesenkt hatte und sich fast hinter dem riesigen Essensberg auf ihrem Teller versteckte. Keylas Schwester war lange nicht so taff wie ihre kleine Schwester. Das Arschloch Raûl hatte sie gebrochen, als er ihr das gemeinsame Kind nahm. Ich konnte nur erahnen, was in ihr vorging. Hatte ich doch selbst einen ähnlichen Verlust erlitten, als meine Frau Fiona bei der Geburt unseres Sohnes gestorben war. Es veränderte einen, wenn man einen geliebten Menschen verlor. Wahrscheinlich ließ mich diese Frau – dieses Mädchen musste ich ja fast noch sagen – deshalb nicht los. Noch nie hatte ich Monate Arbeit, viel Geld und unzählige Verhöre dafür verschwendet, ein Baby zu finden. Doch jetzt hatte ich es getan und vor zwanzig Minuten endlich einen entscheidenden Schritt nach vorn geschafft.
»Es gibt eine neue Spur von Emmas Tochter«, ließ ich mit wenigen Worten die Bombe platzen. Sofort riss Emma den Kopf hoch, während alle anderen mich nur neugierig anstarrten.
»Lebt … lebt sie noch?« Es schien Emma unheimlich schwerzufallen, mir diese Frage persönlich zu stellen. Doch sie schaffte es schließlich, ihren Satz zu beenden.
»Ja, wenn es keinen schrecklichen Unfall gab, lebt sie noch. Ich habe endlich herausgefunden, wo die Kleine hingebracht wurde, nachdem man sie von deiner Mutter getrennt hat.«
»Sag schon, wo ist sie? Ich möchte meine Nichte endlich kennenlernen«, mischte sich nun Keyla ein, die ihr Temperament nicht zügeln konnte. »Sie hat doch heute Geburtstag.«
»Genau weiß ich es noch nicht, aber bis vor vier Wochen befand sie sich in einer Pflegefamilie an der Grenze zu Mexiko. Nur muss irgendjemand bemerkt haben, wie nah ich der Kleinen inzwischen gekommen bin, denn als ich endlich die genaue Adresse hatte, war die Kleine nicht mehr dort. Aber ich kann zu hundert Prozent sagen, dass sie vor kurzem noch dort war. Wir haben DNA von ihr an mehreren Schnullern und Fläschchen gefunden.« Niemals wäre ich mit dieser Nachricht hierher gekommen, wenn ich nicht die Bestätigung erhalten hätte, dass es sich bei der angeblichen Maria Paltina wirklich um die gesuchte Emilia Hope Rodriguez handelte. Schnell zog ich zwei Fotos aus der Tasche, die ich von der verängstigten Pflegemutter bekommen hatte. Sie hatte eigentlich alle Beweise vernichten sollen, dass die Kleine jemals bei ihr war. Doch das Baby war ihr so ans Herz gewachsen, dass sie es nicht fertiggebracht hatte. Mein Glück in diesem Fall. Das eine Bild war angeblich erst zwei Tage, bevor die Kleine abgeholt wurde, entstanden.
»Hier, Emma. So sieht deine Tochter jetzt aus.« Ich ging mit wenigen Schritten zu der jungen Frau und drückte ihr die Fotos in die zitternde Hand. Natürlich hatte ich die Bilder auch an alle meine Männer weitergeleitet. Irgendwo mussten wir das Baby doch finden können.
Emma
Meine Hände zitterten so stark, dass mir die Bilder fast aus den Händen fielen. Emilia lebte. Mein Baby war zu einem süßen Kleinkind geworden. Auf dem einen Foto schlief sie halb im Sitzen auf einem Sofa und auf dem anderen grinste sie in die Kamera. Ich sog jede Kleinigkeit in mich auf. Ihre schwarzen Löckchen, die beiden Schneidezähne, die man auf der zweiten Aufnahme so gut erkennen konnte. Sie sah glücklich und gesund aus. Irgendwo gab es ein Babybild von Keyla, auf dem sie fast genauso aussah. Es brach mir das Herz, dass sie so nah gewesen war und nun doch nicht zu mir zurückgebracht wurde.
»Wo könnte sie jetzt sein?«, fragte ich und meine Stimme zitterte dabei kaum weniger als meine Hände. Warum hatten sie Emilia weggebracht? Und wohin? Vielleicht hatten sie meiner Kleinen auch etwas angetan. Allein der Gedanke reichte aus, um die Tränen laufen zu lassen.
»Noch weiß ich das nicht, aber ich werde es herausfinden und wenn ich jeden Stein auf diesem Planeten dafür umdrehen muss.« Enzos Stimme klang so entschlossen, dass er mir automatisch wieder Mut gab. Auch wenn ich nicht verstehen konnte, warum ausgerechnet er sich so sehr in die Geschichte hineinziehen ließ. Es passte so gar nicht zu diesem harten und oft angsteinflößenden Kerl. Ohne darüber groß nachzudenken sprang ich von meinem Stuhl auf und stand plötzlich direkt vor ihm. Was sollte ich jetzt tun? Ihn umarmen? Irgendwie wollte ich das, aber gleichzeitig traute ich mich nicht.
»Danke«, sagte ich also nur leise und legte meine Hand auf seinen Oberarm, um ihn dort kurz zu drücken. Albern irgendwie, aber trotzdem trat ich gleich wieder zurück.
»Darf ich die Bilder behalten?« Sein Mund verzog sich zu einem Lächeln.
»Natürlich, ich habe die Bilder bereits digitalisiert und sende sie allen zu. Dir natürlich auch noch. Aber ich dachte, du hättest gern diese Originale aus dem Haus der Pflegemutter. Sie hat auch eine digitale Kopie von mir bekommen. Zuerst wollte ich sie töten, aber dann habe ich herausgefunden, dass sie nicht wusste, woher Emilia kam.«
Unser Vater und seine Leute hätten sie getötet, ohne Rücksicht darauf, ob sie etwas gewusst hatte oder nicht. Ich rechnete es Enzo hoch an, dass er sie leben ließ. Schließlich schien sie gut für Emilia gesorgt zu haben. Meine kleine Emilia Hope. Vielleicht sollte ich ihren Zweitnamen als Omen sehen und die Hoffnung niemals aufgeben.
Vielleicht war Enzo doch ein besserer Mann als unser Vater. Keyla zum Beispiel sprach immer wieder über die Amish Familie, die ihretwegen sterben musste. Dabei hatten die Leute nicht einmal gewusst, wer sie war, und wollten nur helfen. Sie litt deswegen unter großen Schuldgefühlen.
Über alles sprechen, es sich von der Seele reden, das sollte helfen. Auch Mom versuchte so, mit ihrem Schicksal fertig zu werden. Wenn auch nicht uns gegenüber, sondern bei einem teuren Psychologen, der ihr wirklich zu helfen schien. Nur ich schaffte es nicht, über meine Erlebnisse als Raûls Ehefrau zu sprechen. Es war einfach zu grausam, daher drängte ich sie in die hinterste Ecke meines Gehirns und verschloss sie dort, so gut es ging. Die meiste Zeit erfüllten mich sowieso nur die Gedanken an Emilia, aber gerade jetzt, als ich noch immer vor Enzo stand, kamen unliebsame Gedanken zurück. Er sah mich so durchdringend an, als könne er meine Gedanken lesen und genau auf diese Kiste in meinem Kopf zusteuern, um sie zu öffnen. Doch das durfte ich nicht zulassen. Deshalb drehte ich mich auf dem Absatz um und floh aus der Küche, auch wenn er mich jetzt wahrscheinlich für völlig verrückt hielt. Irgendjemand folgte mir, denn ich konnte Schritte hören. Aber ich drehte mich nicht um, sondern lief auf direktem Weg in mein Zimmer, wo ich die Tür hinter mir zweimal abschloss. Erst als ich mich aufs Bett fallen ließ und die Bilder in meiner Hand sah, hörte mein Herz auf, wie wild in meiner Brust zu galoppieren, und schlug langsam wieder in einem normalen Rhythmus. Emilia lebte und auch wenn sie ihren ersten Geburtstag nicht mit uns feiern konnte, so klammerte ich mich doch an den Gedanken, dass es ihr bisher anscheinend ziemlich gut ergangen war. Vielleicht gab es ja doch noch eine Hoffnung, dass ich meine Prinzessin irgendwann wieder in den Armen halten durfte.
Kapitel 2
Enzo
Die Tage vergingen und ich wurde immer frustrierter. Es war, als ahnten die Entführer der kleinen Rodriguez – der Schwächling Raûl hatte tatsächlich zugestimmt, dass seine Frau ihren Namen behielt und auch die Kleine so hieß – was wir taten und wo wir als Nächstes suchen würden. Langsam wuchs in mir die Gewissheit, dass wir einen Maulwurf unter uns haben mussten. Allerdings wusste ich bisher nicht, wer es sein könnte und ob er zu meinen oder Antonios Leuten gehörte. Was das Ganze nicht gerade leichter machte. Wie sollten wir den Informanten ausmachen, wenn wir nicht einmal wussten, in welchen Reihen er zu finden war?
Natürlich drängte sich mir sofort der Gedanke auf, dass der Spion nur bei Antonio sitzen konnte. Er hatte den Clan nicht gerade friedlich übernommen. Warum sollten seine Leute also loyal sein? Bestimmt nicht, weil er seiner Frau so viel Macht zugestand und auch, dass er den Handel mit unfreiwilligen Sexsklavinnen verboten hatte, brachte ihm nicht nur Freunde ein. Allerdings war er ja auch nicht so blöd, alle Informationen mit Hinz und Kunz zu teilen. Die bekam nur sein innerer Kreis und diese Leute standen voll und ganz hinter ihm. Seine komischen Nerds zum Beispiel gehörten dazu, doch für die würde selbst ich meine Hand ins Feuer legen. Unter Rodriguez und seinen Konsorten waren sie wie Dreck behandelt und erpresst worden, während Antonio sie ganz anders behandelte. Welchen Grund sollten sie also haben, gegen ihn zu arbeiten? Seine Bodyguards hatte er aus meinen Reihen rekrutiert und die Kerle waren schon vorher Freunde von ihm gewesen, als er noch der ungeliebte Sohn ihres Bosses war. Sie hatten also ebenfalls keinen Grund, gegen ihn zu arbeiten. Aber bei mir sah es ja auch nicht anders aus im engeren Kreis. Ohne Vertrauen konnte man so einen Clan einfach nicht leiten.
Es klopfte kurz an der Tür und Swetlana kam herein. Sie war meine momentane Gespielin, denn seit dem Tod meiner Frau hatte ich niemals mehr als das gehabt. Nie wieder wollte ich jemanden so sehr an mich heranlassen, dass mein Herz gebrochen werden konnte. Und schon gar keine Frau.
»Es ist schon fast Mitternacht.« Ihre Stimme klang fast wie das Schnurren einer Katze und sollte wahrscheinlich verführerisch klingen. »Komm doch zu mir ins Bett. Es ist da so einsam ohne dich.« Sie drehte sich etwas, so dass sich das hauchdünne Negligé, das sie trug, etwas aufbauschte und noch durchscheinender wurde, als es sowieso schon war. Doch heute schaffte sie es nicht, mich dadurch zu reizen. Normalerweise hätte ich ihr Verhalten zum Anlass genommen, sie zu bestrafen. Immerhin war sie so durchs Haus gelaufen und wer wusste schon, wer sie alles so sehen konnte. Doch heute verspürte ich keinerlei Lust, sie dafür zu züchtigen. Im Gegenteil, es war mir sogar irgendwie egal.
»Ich muss noch arbeiten. Geh schon mal in dein Zimmer und leg dich schlafen. Ich benötige dich heute nicht mehr«, wies ich sie daher an. Den beleidigten Blick, den sie mir dafür zuwarf, ignorierte ich ebenso wie das Türenknallen, das gleich darauf folgte. Wenn sie dachte, mich so herumzubekommen, dann hatte sie sich getäuscht. Mir machte es eher bewusst, dass es Zeit wurde, sie wegzuschicken und mir ein neues Spielzeug zu suchen. Bis ich die Richtige dafür fand, konnte ich ja auf einen meiner BDSM-Clubs ausweichen. Dort gab es immer willige Subs, die sich nur zu gern dem Boss unterwarfen. Einige kamen sogar nur in der Hoffnung, dort auf mich zu treffen und vielleicht auch von mir ausgewählt zu werden, meine nächste Dauergespielin zu werden. Und das, obwohl diese nach der Liaison mit mir, nie wieder zurück in ihr altes Leben konnten. Niemanden, der einmal in meinem Hauptquartier war, konnte ich so einfach wieder gehen lassen. Früher hatte ich die Frauen beseitigt oder als Sexsklavinnen verkauft, doch inzwischen tat ich das Antonio zuliebe nicht mehr. Die Letzte hatte ich also im gegenseitigen Einvernehmen mit einem meiner Leute verheiratet. Außerdem hatte ich für Swetlana sowieso andere Pläne. Ich wollte sie zur Agentin für meine Organisation ausbilden lassen. So wäre sie immerhin noch zu etwas nützlich und durfte weiter in der Gegend leben.
Emma
Wie so oft in den letzten Tagen saß ich in meinem Zimmer und sah mir stundenlang das Bild meiner kleinen Tochter an. Wo konnte sie nur sein? Und wer war für ihr Verschwinden verantwortlich? Irgendjemand von Dads oder Raûls Leuten musste dahinter stecken, nur wer? Die meisten hatten sich Antonio inzwischen angeschlossen und der Rest war in alle Winde zerstreut.
Mario war einer von denen, die sich immer hier im Haus befanden, so wie früher in Raûls. Aber trotz dieser gemeinsamen Vergangenheit und der Tatsache, dass er meiner Folter zugesehen hatte, mochte ich den Nerd irgendwie, wenn auch nicht so, wie er mich offenbar. Eigentlich war selbst das krank, oder? Diese Frage stellte ich mir immer wieder, kam aber zu keiner befriedigenden Antwort. Zumal Keyla mich ständig ermunterte, Zeit mit ihm zu verbringen. Doch wollte ich das? Von Männern hatte ich eigentlich die Nase gestrichen voll und meine Tochter war das Einzige, was mich noch interessierte.
Es klopfte an meiner Tür und ohne eine Antwort abzuwarten, kam meine Schwester herein.
»Hey, Große. Wir wollen heute einen Filmabend machen. Nur Mamita, Rosa, du und ich. Antonio muss noch mit einigen Männern weg und ich dachte, wir nutzen die Zeit für einen Frauenabend.« Frauenabend? So etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Von klein auf war mein Vater sehr streng zu mir gewesen und Freundinnen durfte ich außerhalb der Schule eigentlich nie treffen. Nach der kurzen heimlichen Affäre, die ich mit Jaxon, einem der Stallburschen, gehabt hatte, war ich bei ihm sowieso unten durch und er übergab mich seiner rechten Hand als Frau. Immerhin bezahlte ich, im Gegensatz zu Jaxon, nicht mit meinem Leben dafür. Trotzdem bestrafte er mich, denn mein Vater wusste sicher, was Raûl für ein Typ war und ahnte zumindest, was dieser mir in der folgenden Zeit alles antat.
»Komm schon, Mamita freut sich so darauf.« Dieser Seitenhieb traf mich, denn Mamita hatte versucht, mich zu beschützen und dafür ebenfalls sehr leiden müssen. Wie sollte ich ihr also diesen Wunsch abschlagen?
»Okay, gib mir zwanzig Minuten, um mich frisch zu machen, dann komme ich runter«, versprach ich also wenig begeistert.
»Quatsch, wir machen einen Gammelabend. Jogginghose und Shirt reichen völlig, also Haare kämmen ist erlaubt, und dann kommst du. Ich gebe dir fünf Minuten, sonst drückst du dich doch nur wieder und schläfst ein.« Früher hätte ich ihr für so einen frechen Spruch irgendwas an den Kopf geworfen. Doch diese Zeiten waren vorbei. Mir fehlte einfach die Energie, um mich zu streiten. Auch wenn ich seit Emilias Geburtstag etwas Mut gefasst hatte, so blieb da doch immer noch diese Leere in mir und der Knoten in meinem Magen, der mich am essen hinderte. Wahrscheinlich würde ein Arzt mir Tabletten aufschreiben oder mich in die Psychiatrie einweisen oder so, denn ich zeigte alle Anzeichen einer Depression.
»Ich komme ja schon«, gab ich also nur von mir und stand dann brav auf. Obwohl ich mich langsam bewegte, verspürte ich ein Schwindelgefühl. So unauffällig wie möglich hielt ich mich an der Bettkante fest. Doch Keyla war zu aufmerksam und bemerkte natürlich sofort, dass etwas mit mir nicht stimmte.
»Was ist los? Ist dir schwindelig? Brauchst du einen Arzt?« Musste sie denn immer alles mitbekommen? »Hast du wieder nicht gegessen, Emma? Du hast mir versprochen, mehr auf dich zu achten. Was soll denn mit Emilia passieren, wenn wir sie endlich finden und dir etwas zustößt. Sie braucht ihre Mom doch noch.«
»Sie kennt ihre Mutter überhaupt nicht. Was passiert, wenn sie gefunden wird und dann ihre Pflegemutter vermisst und mich hasst?«, brach es aus mir heraus. Dabei wollte ich diese Gedanken doch eigentlich mit niemanden teilen. Aber sie fraßen mich auf. Erst habe ich sie einfach nur vermisst und befürchtet, ihr wäre etwas zugestoßen. Doch seit Enzo mir die Fotos gebracht hatte, fürchtete ich einerseits, sie trotzdem nie wiedersehen zu dürfen oder falls doch, dass sie sich schreiend abwenden würde, weil ich eine Fremde für sie war. Diese Gedanken ließen mich kaum schlafen und erst recht nicht essen, auch wenn ich selbst bemerkte, wie ich meinen Körper damit zu Grunde richtete.
»Sie wird lernen, dich zu lieben. Denn du wirst ihr die beste Mutter sein, die sie je haben könnte. Aber dafür musst du auf dich aufpassen.« Keyla hatte gut reden. Es war gar nicht so einfach, nicht den Mut zu verlieren.
»Okay, ich versuche es«, versprach ich ihr halbherzig. Ich wollte ja leben, aber jeder Bissen fiel mir schwer. »Könntest du mir ein Glas Coke holen? Der Zucker bringt mich bestimmt wieder auf die Beine.« Keyla lief sofort los, um mir das Gewünschte zu holen, und wirklich ging es mir gleich besser, nachdem ich das Glas geleert hatte.
»Bereit?«, fragte meine Schwester und grinste mich an.
›Nicht wirklich‹, hätte ich am liebsten geantwortet, nickte aber brav. Vielleicht sollte ich es einfach versuchen und dem Abend eine Chance geben, gut zu werden.
Er wurde wider Erwarten auch noch ganz schön und nur im Beisein der Frauen brachte ich sogar etwas zu Essen hinunter, wenn auch nicht viel. Mein Magen war inzwischen wahrscheinlich geschrumpft. Wir tranken Wein, sahen einen albernen Film und ich lachte sogar einige Male. Vielleicht waren es ja auch bloß die Männer hier im Haus, die mir sonst den Appetit und die Laune verdarben. Auch wenn es nicht die Männer waren, die sich unter der Führung unseres Vaters hier versammelt hatten, so waren es doch immer noch Mafiosi. Männer, die Gesetze brachen, Menschen quälten und ermordeten. Manchmal konnte ich das verdrängen, doch oft auch nicht.
Zum ersten Mal seit Tagen ging ich sehr viel später entspannt ins Bett und hoffte, endlich einmal wieder durchschlafen zu können. Doch schon während ich noch am Eindösen war, spielten die Gedanken in meinem Kopf schon wieder verrückt.
Ich sah mein Baby in völliger Dunkelheit liegen und niemand reagierte auf das verzweifelte Weinen der Kleinen. Ich wollte zu ihr eilen, doch ich konnte nicht, denn ich war in einem Raum eingesperrt, aus dem ich der Kleinen zwar per Monitor zuschauen konnte, aber aus dem ich nicht eingreifen konnte. Ich schrie. Tobte. Warf sogar Sachen durch die Gegend, doch es half alles nichts. Selbst als ich auf dem Monitor sah, wie Raûl sich ihr näherte und sie schlug, konnte ich nichts weiter tun, als hilflos zuzusehen. Ich sah zu, wie er so lange mit einem Gürtel auf sie einschlug, bis ihr Schreien aufhörte und sie sich nicht mehr bewegte. Dann drehte er sich zur Kamera um und grinste mich durch den Monitor an.
»Sie wird sterben, weil du mich nicht gerettet hast. Du bist schuld an ihrem Leid. Nur du!« Mit einem lauten Schrei und am ganzen Körper zitternd wachte ich auf. Die Bilder des Traums noch immer überdeutlich vor Augen. Ja, ich war schuld. Wie konnte ich es da nur wagen, mir einen schönen Abend zu machen? So etwas hatte ich doch wirklich nicht verdient. Alles Leid, das meiner Kleinen widerfuhr, hatte ich zu verantworten. Ich ganz allein.
Kapitel 3
Enzo
Gerade als ich das Gebäude betrat, in dem mein neuer Club entstand, klingelte mein Telefon. Eigentlich wollte ich jetzt absolut nicht gestört werden, um jedes Detail eigenhändig genau zu überprüfen, doch dann sah ich, wer der Anrufer war. Antonio. Mein Sohn würde sich niemals grundlos bei mir melden. Dazu saß das Misstrauen immer noch viel zu tief. Daher nahm ich das Gespräch an.
»Was gibts?« Ich hielt mich nie mit langen Begrüßungsfloskeln auf. Zeit war Geld und seit ich auf einige Geschäftszweige verzichtete, musste ich neue erschließen. Okay, musste wohl nicht, schließlich besaß ich schon jetzt mehr Geld, als ich jemals ausgeben könnte, doch der Aufbau befriedigte mich. Die Aufregung, die Spannung, das alles fühlte ich nur bei neuen Projekten oder Frauen und einige neue legale Standbeine konnten wirklich nicht schaden.
»Ich brauche deine Hilfe, Dad.« Mir blieb für einen Moment die Luft weg. Dass er mich Dad nannte, kam so gut wie nie vor. Fast so selten, wie er mich um Hilfe bat, aber beides in einem Satz? Da musste wirklich Not am Mann sein.
»Wo brennt es?«
»Es geht um Emma. Sie braucht Hilfe.« Worauf zum Teufel wollte er hinaus? Ich tat doch schon alles, um ihr Kind zu finden.
»Inwiefern?«
»Du hattest mal eine Sklavin, die gebrochen war, nachdem du sie freigeben wolltest. Sie kam nicht damit zurecht und wollte sich aufgeben. Doch du hast es geschafft, dass sie wieder in ein einigermaßen normales Leben gefunden hat und heute als Geschäftsführerin für dich arbeitet.« Wie kam er jetzt darauf? Natürlich wusste ich, von wem er sprach. Tara, doch die konnte man nicht mit Emma vergleichen. Tara hatte sich aufgegeben, Drogen genommen, war zur Schmerzsklavin ausgebildet worden und hatte ihre Persönlichkeit völlig verloren. Am Ende wollte sie nur noch sterben, doch das ließ ich nicht zu, denn sie war früher eine Freundin von Fiona gewesen und sie aufzugeben hätte fast dasselbe bedeutet, wie meine Frau endgültig aufzugeben. Ich hatte dafür gesorgt, dass sie kämpfte und eine Aufgabe fand, die ihr Leben bereicherte. Warum ich das tat, konnte ich später selbst nicht sagen. Wirklich für Fiona? Viele andere in ihrer Lage ließ ich, ohne mit der Wimper zu zucken, sterben, doch bei ihr konnte ich es einfach nicht.
»Worauf willst du hinaus?« Irgendwie ahnte ich es schon. Aber das konnte doch nicht Antonios Ernst sein.
»Du sollst Emma helfen, bevor sie uns hier noch verhungert. Keyla glaubt zwar, ihr Zustand hat nur mit der Kleinen zu tun, aber das glaube ich nicht, das geht tiefer. Raûl hat etwas in ihr zerbrochen.« So, wie ich Raûl kennengelernt hatte, konnte das möglich sein.
»Und da glaubst du, dass ausgerechnet ich es reparieren kann? Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie ist eine Rodriguez und ist mit dem Hass gegen mich aufgewachsen.« Wie kam er nur auf diese völlig hirnrissige Idee. Ich war nun wirklich der Letzte, dem man eine verletzte Person anvertrauen sollte. Machte ich doch immer alles kaputt und diejenigen, die mir näher kamen.
»Ja, das glaube ich. Denn du könntest sie aus diesem Haus holen, das voller schlechter Erinnerungen steckt. Hier hat ihr Vater ihre erste Liebe – einen Stallburschen – vor ihren Augen getötet. Und hier hat er sie gegen ihren Willen mit Raûl verheiratet. Meinst du wirklich, hier könnte sie gesund werden?« Obwohl ich weiterhin nach Gründen suchte, die dagegen sprachen, hörte ich mich plötzlich sagen: »Okay, ich versuche es, aber nur, wenn sie es selbst will. Ich werde sie nicht gegen ihren Willen zu mir holen.« Was ritt mich nur dabei?
Emma
Wie schon in den letzten Tagen lag ich auch jetzt in meinem Bett und rührte mich nicht. In meinen Händen hielt ich die beiden Fotos, die ich von Enzo bekommen hatte. Doch selbst der Gedanke an Emilia half mir nicht. Sie würde mich sowieso nicht mehr erkennen. Vermutlich weinen, wenn sie mich sehen würde. Ich hatte sie verloren. Endgültig, ihr Lächeln galt einer anderen Frau.
Mein Mund fühlte sich schon ganz trocken an, aber ich ignorierte es genauso wie meinen schmerzenden Magen. Essen oder Trinken war das Letzte, wonach mir im Moment der Sinn stand. Eigentlich wollte ich mich am liebsten in Luft auflösen, aber das ging natürlich nicht. Der Traum, der mich seit Tagen jedes Mal heimsuchte, wenn ich meine Augen schloss, beraubte mich allen Mutes. Jeder Hoffnung. Mamita und Keyla verzweifelten schon langsam mit mir, aber ich konnte einfach nichts dagegen machen. In mir war etwas gestorben und vielleicht konnte ich bald wirklich für immer die Augen schließen. Kein Schmerz mehr, keine Schuld und keine Erinnerungen. Warum hatte ich überhaupt so lange gekämpft? Es ergab doch sowieso keinen Sinn. Mein Baby war weg. Für immer verloren und ich war schuld.
Die Zimmertür öffnete sich, doch ich ignorierte die Personen, die wortlos hereinkamen. Sollten sie mich anstarren, mir war es wirklich egal. Zu weit entfernt fühlte sich mein Leben an. Der Tod war mir viel näher. Eine Person begann im Zimmer hin und her zu laufen, sagte aber keinen Ton. An den Schritten hörte ich schon, dass es weder Keyla, noch unsere Mutter sein konnte. Es war irgendein Mann, doch das änderte nichts an der Situation, und weckte mich nicht aus meiner Lethargie. Wenn ich mich nicht rührte, würde er bestimmt bald wieder verschwinden. Oder mich bestrafen. So wie Raûl es immer getan hatte. Doch sogar das wäre mir jetzt egal. Der Schmerz in meinem Inneren war so stark, den würde selbst eine Auspeitschung nicht vertreiben können. Plötzlich blieb die Person direkt neben mir stehen, doch ich reagierte nicht.
»Emma, du musst aufstehen und etwas essen«, flehte Keyla von der Tür her. Doch ich ignorierte sie weiterhin. Ich konnte nichts essen. Vielleicht nie wieder.
»Emma, steh auf!«, die Stimme des Mannes, der neben mir stand, klang so streng, dass ich automatisch handelte, ohne es bewusst zu steuern. Mein Körper reagierte einfach auf den Tonfall, wahrscheinlich um mich trotz allem vor einer Bestrafung zu schützen. Ich stellte mich so hin, wie Raûl es mir antrainiert hatte, den Rücken durchgedrückt, aber den Blick auf die Fußspitzen gesenkt. So hatte ich oft stehen müssen, über Stunden und jede kleinste Regung war bestraft worden. Doch heute würde ich keine Stunden so ausharren können. Der Mann sagte nichts und so verharrte ich erst einmal. Allerdings fingen nach wenigen Sekunden meine Beine an zu zittern, mir wurde übel und dann wurde mir schwarz vor Augen.
Enzo
»Scheiße!«, schrie ich und sprang auf Emma zu, die einfach neben mir zusammenbrach. Gerade noch konnte ich verhindern, dass sie mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Schnell zog ich sie auf meinen Schoß. Eigentlich hatte ich den Plan, Antonio zu zeigen, wie falsch er mit seiner Idee lag. Doch nun musste ich wohl zugeben, dass er recht hatte. Wenn wir nicht handelten, würde Emma nicht mehr lange leben. Sie schien völlig dehydriert zu sein und von ihrem Gewicht wollte ich lieber gar nicht reden. Sie konnte höchstens noch vierzig Kilo wiegen. Warum hatten sie nicht eher gehandelt und sie in eine Klinik gebracht?
»Emma!«, rief Keyla und eilte um das Bett herum und zu uns.
»Das meine ich, Vater. Sie reagiert automatisch auf dich.« Antonio schien nicht glücklich darüber zu sein, dass er recht hatte. Mit liebevoller Zuwendung konnte man Emma jetzt wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Als Keyla sie ansprach, reagierte sie gar nicht, auf meinen Befehl allerdings schon.
»Okay, ich mache es.« Keyla sah mich zweifelnd an, Antonio dafür umso hoffnungsvoller.
»Ich bin immer noch der Meinung, dass die Idee falsch ist. Vielleicht sollten wir Emma lieber in eine Klinik bringen.« Doch da hatte sie die Rechnung ohne ihre Schwester gemacht, die sich in meinen Armen zu bewegen begann.
»Nein, keine Klinik«, sagte sie mit überraschend fester Stimme. Dann versuchte sie, sich aus meinen Armen zu befreien, doch sie besaß kaum Kraft und hatte keine Chance gegen mich. Zwar ließ ich zu, dass sie sich aufsetzte, aber dabei hielt ich sie weiterhin fest.
»Du hast die Wahl, Emma. Du kannst entweder in eine Klinik gehen oder du kommst mit in meine Wohnung, wo ich mich persönlich um dich kümmere.« Es gelang mir nicht, ganz so streng zu klingen wie vorhin, doch wollte ich nicht, dass sie nur auf meinen Befehl zu mir kam, sondern aus freien Stücken. Außerdem sollte Keyla nicht denken, ich täte ihrer Schwester etwas an.
»Kann ich nicht einfach hierbleiben? Ich verspreche auch, dass ich besser auf mich achte.« Emma sah von einem zum anderen. Doch ihr Blick war so leer und traurig, dass ich ihr kein Wort glaubte. Der Kampfgeist und Wille fehlte ihr im Moment völlig. Vermutlich hatte sie sich selbst schon aufgegeben. Was sie brauchte, war ein Grund zum Weitermachen. Eine Aufgabe. Okay, am meisten würde ihr wahrscheinlich ihre Tochter helfen, doch bisher hatte ich die Kleine einfach nicht aufspüren können. Es gab keine Spur, weder von ihr noch von dem vermuteten Maulwurf in unseren Reihen. Es war zum Verrücktwerden.
»Du bist zusammengebrochen, Emma. Du bist völlig abgemagert und dehydriert. Wann hast du zuletzt etwas gegessen oder getrunken?« Ich versuchte, ihr klarzumachen, in was für einem Zustand sie sich befand. Doch sie zuckte nur mit den Schultern und senkte den Blick. »Wir werden nicht zulassen, dass dir jemand schadet. Auch du selbst nicht. Daher kannst du jetzt wählen, ob du zu mir kommst oder in die Klinik gehst. Hier lieben dich alle zu sehr, um dich zu etwas zu zwingen, auch wenn es zu deinem Besten ist.« Ich erwartete Widerstand, einen Wutanfall oder Ähnliches, doch sie saß einfach mit gesenktem Kopf da und sagte nichts. Vielleicht dachte sie, ich würde es nicht ernst meinen, aber da kannte sie mich schlecht.
»Keyla, packst du bitte schon einmal eine Tasche? Egal wofür Emma sich entscheidet, sie wird eine Zeitlang weg sein und braucht Sachen.« Endlich kam etwas Leben in sie.
»Das könnt ihr vergessen. Ich gehe nirgendwo hin, solange ich nicht weiß, wo Emilia ist. Sonst bekomme ich ja gar nichts mehr mit.